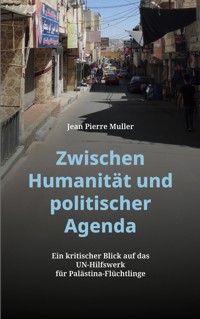
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
UNRWA und der 7. Oktober - Zwischen Hilfe, Hass und Heuchelei. Nach den Massakern vom 7. Oktober 2023, die auch von einigen Mitarbeitern des UN-Hilfswerks für Palästina-Flüchtlinge (UNRWA) bejubelt wurden, ist Israel gegen die UNRWA vorgegangen. Seitdem steht die Organisation inmitten einer Zerreißprobe zwischen Israel und den Vereinten Nationen. Im Gazastreifen soll die humanitäre Hilfe an die notleidende Zivilbevölkerung von der Gaza Humanitarian Foundation (GHF) übernommen werden, eine gemeinsame Initiative Israel's und den USA. Für die großen Geldgeber im Westen war die Versorgung von Millionen UNRWA-Flüchtlingen durch die UN-Organisation immer ein Garant für Stabilität im Nahen Osten. Für andere in der Region ist sie eines der größten Hindernisse auf dem Weg zu einem dauerhaften Frieden im Nahostkonflikt. Immer mehr UNRWA-Betreute mit dem umstrittenen Rückkehrrecht - etwa hunderttausend pro Jahr - stellen eine ständige Bedrohung für den jüdischen Staat und dessen Nachbarn dar. Ohne tiefgreifende Korrekturen wird es unweigerlich zu existenziellen Verwerfungen kommen, die zur Gefahr für die ganze Region werden. In diesem Spannungsfeld stellt der Autor unbequeme Fragen: Was ist die Exit-Strategie des ewigen Hilfswerks? Kann Hilfe zur Ideologie werden? Und wie sehr blenden westliche Medien die strukturelle Nähe zwischen UNRWA und der Hamas aus? Ein eigenes Kapitel widmet sich der deutschen Medienlandschaft - mit besonderem Fokus auf das Nachrichtenmagazin DER SPIEGEL. In einer systematischen Analyse zeigt der Autor auf, wie erstaunlich kritikfrei dort über die Verflechtungen im Gazastreifen berichtet wird - selbst nach dem 7. Oktober. Ein aufrüttelndes Sachbuch über ein Hilfswerk, das längst zum geopolitischen Akteur geworden ist - mit weitreichenden Folgen für die Region und den Frieden im Nahen Osten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Den geschundenen Völkern des Nahen Ostens.
Vorwort
Für die großen Geldgeber im Westen ist die Versorgung von Millionen Flüchtlingen durch das UN-Hilfswerk für Palästina (UNRWA) ein Garant für Stabilität im Nahen Osten. Für andere ist es eines der größten Hindernisse auf dem Weg zu einem dauerhaften Frieden in der Region. Immer mehr UNRWA-Betreute mit dem umstrittenen „Rückkehrrecht“ stellen eine ständige Bedrohung für den jüdischen Staat dar. Ohne tiefgreifende Korrekturen wird es unweigerlich zu existenziellen Verwerfungen kommen, die zur Gefahr für die ganze Region werden. Nach den Massakern des 7. Oktober 2023, die auch von Mitarbeitern des Hilfswerks bejubelt wurden, ist Israel gegen die UNRWA vorgegangen. Seitdem steht die Organisation inmitten einer Zerreißprobe zwischen Israel und den Vereinten Nationen. In diesem Spannungsfeld stellt der Autor unbequeme Fragen: was ist die Exit-Strategie des ewigen Hilfswerkes? Am Beispiel des SPIEGEL fragt er welches Bild die hiesigen Medien von der Flüchtlingsagentur ohne Flüchtlinge zeichnen. Dabei zeigt sich eine unheilige Allianz, die das Existenzrecht Israels immer unverhohlener in Frage stellt. Aber es gibt Auswege, Hoffnung und Perspektiven, ohne dass es Verlierer geben muss.
Der Autor
Seit Jahrzehnten ist der Autor mit der Region verbunden, in der sich das Drama des UN-Flüchtlingshilfswerks für Palästina (UNRWA) abspielt. Er hat in der Region und darüber hinaus als Hochschullehrer gewirkt und internationale Organisationen in Fragen der öffentlichen Gesundheit beraten. Beruflich wie privat hat er viel Zeit mit Menschen der verschiedenen Seiten des Nahostkonflikts zugebracht und den Wandel vor Ort oft hautnah miterlebt. Dabei hatte er stets im Blick, wie die hiesigen Medien über die Krisenherde im Nahen Osten - insbesondere über Israel und seine Nachbarn – berichten. In Vorträgen und Berichten schildert er seine persönlichen Eindrücke, um zu einem breiteren und kritischeren öffentlichen Diskurs anzuregen.
Wussten Sie
dass gerade die vehementesten Verfechter der Zweistaatenlösung, Deutschland und Europa, die UNRWA seit Jahrzehnten mit den größten freiwilligen Millionenbeträgen am Leben erhalten?
dass 2,6 Millionen UNRWA-Flüchtlinge die jordanische Staatsbürgerschaft besitzen und dennoch Flüchtlinge bleiben?
dass die Hamas aus Sicht der UNRWA keine Terrororganisation ist: „Wir sind vereint [mit der Hamas]“?
dass die Hamas mit der Behauptung 80% der Bevölkerung Gazas seien Flüchtlinge, die Verantwortung für deren Versorgung auf die UNRWA abwälzt und damit seit Jahren Unsummen für Raketen und Terror spart?
dass UNRWA-Palästinenser im ehemaligen Palästina-Mandatsgebiet nach 75 Jahren von den eigenen Behörden immer noch in sogenannten Lagern gehalten werden - als Flüchtlinge im eigenen Land?
dass der Personalschlüssel der UNRWA 25 Mal mehr Betreuer je Nachkommen der Palästina-Flüchtlinge von 1948 vorsieht, als das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR für aktuell vertriebene Flüchtlinge weltweit?
dass die UNRWA 2018, als die USA ihre Zahlungen einstellten „nur“ 26.000 neue „Flüchtlinge“ aufnahm? Als Deutschland die fehlenden Gelder ausglich, kamen im Jahr danach mehr als 250.000 Neuaufnahmen dazu.
dass Israel die UNRWA aus all diesen Gründen auf seinem Staatsgebiet verboten hat, was eine Zerreißprobe mit den Vereinten Nationen um die Zukunft der Agentur ausgelöst hat?
dass es dennoch Auswege und Perspektiven gibt, bei denen es eigentlich nur Gewinner gibt?
INHALTSVERZEICHNIS
Prolog
Die UNRWA: Flüchtlingsagentur ohne Flüchtlinge
1.1 Die Flüchtlingsströme des 20. Jahrhunderts
1.2. Die jüdische Nakba
1.3. Die arabische Nakba
1.4 Die deutsche Nakba
1.5 Wer ist UNRWA-Flüchtling?
1.6 Immer mehr Leistungsempfänger
1.7 Die Wohltaten der UNRWA
1.8 Die sogenannten Flüchtlingslager
1.9 Milliarden gegen den Frieden
1.10 Fass ohne Boden
1.11 UNRWAs privilegierte „Flüchtlinge“
1.12 UNRWA und UNHCR im Vergleich
1.13 Vertriebene Brüder
1.14 Das Recht auf Rückkehr
1.15 Die UNRWA-Fields
1.16 UNRWA ohne Exitstrategie
UNRWA, ein Hort des Hasses
2.1 Bildungssystem und Mandat
2.2 Vorwürfe und Reaktionen
2.3 Hass in den Schulbüchern
2.4 Hass als Anleitung für Lehrer
2.5 Was sagen UNRWA-Schüler?
2.6 Hass nicht nur in Schulbüchern
2.7 Die UNRWA-Lehrer-Posts vor dem UN-Menschenrechtsrat
2.8 Die Reaktionen der UNRWA
2.9 Der verlängerte Arm der Hamas
2.10 UNRWA zu Hamas: „Wir sind vereint und niemand kann uns trennen!“
2.11 Hamas in den UNRWA-Schulen
2.12 Bescheidenes Umdenken in der arabischen Welt
Die UNRWA nach dem 7. Oktober
3.1 Der 7. Oktober 2023 und die UN
3.2 Die Saat ist aufgegangen: UNRWA-Angestellte sind dabei
3.3 Millionen auf Eis
3.4 Der Colonna-Bericht: Gefällig, oberflächlich, missbraucht
3.5 Reaktionen auf Colonna: Neues Geld und Immunität
3.6 Missbrauch von UNRWA-Einrichtungen
3.7 Serververbindungen zwischen Hamas und UNRWA
3.8 UN, Medien, NGOs und Hamas, eine unheilige Allianz
3.9 UNRWA und die Hilfslieferungen.
3.10 Straffreiheit durch Immunität
3.11 Israel geht gegen die UNRWA vor
3.12 UNRWA und Hamas: Eine Hand wäscht die andere
3.13 Eine Welt ohne UNRWA.
UNRWA im Spiegel
4.1 Humanität oder politische Agenda?
4.2 UNRWA im Spiegel-Online
4.3 UNRWA im Print-Spiegel
4.4 Unheilige Allianzen
4.5 Journalistische Tricks
Exitstrategie ohne UNRWA
5.1 Zwischen humanitärer und politischer Agenda
5.2 Abkehr von der Rückkehr
5.3. Alternativen zur UNRWA
5.4 Alte Reflexe
EPILOG
1. Perspektiven, aber ohne Rückkehrer
2. Der Kreis schließt sich
Danksagung
Abkürzungen
Quellenverzeichnis
PROLOG
Israel hat kurz vor Erscheinen dieses Buches sämtliche Aktivitäten des UN-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge (UNRWA) im Land untersagt und damit eine beispiellose Zerreißprobe in den Beziehungen zu den Vereinten Nationen ausgelöst. Im Kern geht es darum, ob die UNRWA tatsächlich eine humanitäre Organisation ist oder vielmehr Instrument einer gefährlichen, politischen Agenda. Die Meinungen dazu könnten gegensätzlicher kaum sein. Dennoch haben die meisten Menschen nur eine vage Vorstellung davon, was es mit dieser Sonderorganisation der Vereinten Nationen auf sich hat.
Die UNRWA wurde ins Leben gerufen, um Geflohene und Vertriebene kurzzeitig zu unterstützen, die im Zuge der Staatsgründung Israels im Jahr 1948 Haus und Hof verloren haben. Ihr Mandat, ursprünglich als temporäre Maßnahme gedacht, wird nun seit 75 Jahren fortwährend verlängert. Kaum bekannt ist, dass der Kreis der UNRWA-Leistungsempfänger über die Jahrzehnte stetig gewachsen ist. Ein entscheidender Faktor ist dabei der einzigartige Flüchtlingsstatus, der über Generationen hinweg vererbt wird. Auch wurde das Mandat auf immer neue Personenkreise ausgeweitet. Während die ursprüngliche Zahl der Palästina-Flüchtlinge 1948 etwa 700.000 betrug, ist sie mittlerweile auf das Zehnfache angewachsen.
Viele dieser Menschen leben längst in Gebieten, die zu einem künftigen palästinensischen Staat werden würden und unter der Verwaltung palästinensischer De-facto-Regierungen in Gaza und Ramallah. Oder sie besitzen die Staatsangehörigkeit Jordaniens, mit den entsprechenden Bürgerrechten. Dennoch behalten sie lebenslang den Status eines Palästina-Flüchtlings – auch dann, wenn sie niemals selbst aus dem ehemaligen britischen Mandatsgebiet geflohen sind. Sie bleiben unter dem Schutz der UNRWA, erhalten umfassende Leistungen und verfügen über ein von den Vereinten Nationen verbrieftes Rückkehrrecht.
Was ist mit dem Rückkehrrecht gemeint? Historische Vergleiche hinken. Dennoch machen sie manchmal verständlich, was tausend Erklärungen nicht vermitteln können. Gerade wenn man sie sich, wie im Folgenden, als fiktives Szenario vorstellt:
Nach einem verlorenen Angriffskrieg wurden 10 Millionen Deutschstämmige 1945 aus den Ostgebieten des damaligen Deutschen Reichs und weiteren Regionen vertrieben. Ein überfordertes Nachkriegsdeutschland siedelte sie an der Ostgrenze in provisorischen Lagern an.1 Die UN-Vollversammlung schuf daraufhin eine Hilfsagentur für Nachkriegsdeutschland (UNHAD), um die Flüchtlinge zu registrieren und zu versorgen. Zunächst auf zwei Jahre angelegt, wurde ihr Mandat immer wieder verlängert. Die Jahre vergingen, der Traum von der alten Heimat blieb. In den Lagern gediehen Revanchismus und Extremismus. Man übertrug dem neugeschaffenen Hilfswerk die Verantwortung für die Schulbildung von ganzen Heerscharen von Kindern. Hunderte von Schulen und Gesundheitsstationen wurden nach und nach in ihren Lagern errichtet. Die Hoffnung auf eine Rückkehr in die verlorenen Ostgebiete wurde von der Hilfsagentur in ihren Schulen und Einrichtungen nach Kräften befördert. Deutschland weigerte sich dabei standhaft, die Flüchtlinge aufzunehmen. Das Recht auf Rückkehr in die Ostgebiete wurde zu ihrer nationalen Identität. Die Hilfsagentur ließ sich ihr Mandat durch die UN-Vollversammlung auf immer weitere Personenkreise im kriegszerstörten Europa ausweiten. Sämtliche Nachkommen der kinderreichen Ostvertriebenen wurden vom Hilfswerk aufgenommen. Ihre Zahl wuchs jedes Jahr um 1 bis 2 %. Die 10 Millionen registrierten Ostflüchtlinge samt Kindeskindern in vierter Generation sind inzwischen auf das Achtfache angewachsen. Sie sind zu einem eigenen Staat im Staat geworden. Sie alle haben ein UN-verbrieftes Rückkehrrecht in ihre alte Heimat und fordern dies oft auch durch Gewalt und Terror ein. Ein Drittel hat mittlerweile die deutsche oder eine andere Staatsangehörigkeit, dennoch bleiben sie Flüchtlinge und werden von ihrer Flüchtlingsorganisation, der UNHAD, versorgt – so lange, bis eine „gerechte“ Lösung für sie gefunden wird. So sichert sich die Agentur dauerhaft ihren Fortbestand. Keine andere Bevölkerungsgruppe, deren Vorfahren vor 75 Jahren geflohen sind, alimentieren die Vereinten Nationen jährlich mit ein bis zwei Milliarden Euro, um deren Traum an die alte Heimat wachzuhalten. Mit diesen Milliarden werden sie bei der Stange gehalten, um irgendwann ihr Rückkehrrecht in die früheren Ostgebiete wahrzumachen, womöglich nicht ohne Gewalt.
Um diesen fiktiven Vergleich mit der UNRWA zu Ende zu führen:
Die Milliarden kämen nicht etwa aus Europa, sondern wie im Fall der UNRWA sind es Out-of-area-Staaten, die die Ostflüchtlinge samt deren Revanchismus finanzieren: Reiche Golfstaaten ließen es sich gerne etwas kosten, die Nachkriegsfriedensarchitektur in Mitteleuropa mit Milliarden von US-Dollar für Millionen von sogenannten Flüchtlingen nachhaltig zu stören. Jede Nachkriegsfriedensregelung in Europa müsste das Rückkehrrecht von zig Millionen Nachkommen der Ostflüchtlinge berücksichtigen. Es wäre ein unüberwindbares Hindernis auf dem Weg zu einer Friedensordnung in Mittel- und Osteuropa gewesen.
Millionen von Vertriebenen und Verfolgten weltweit finden Schutz und eine neue Heimat unter der Obhut des UN-Hochkommissariats für Flüchtlinge (UNHCR). Nur für eine Gruppe, den Nachkommen jener Flüchtlinge, die vor einem Menschenleben aus dem ehemaligen britischen Mandatsgebiet Palästina flohen, existiert ein eigenes Hilfswerk, die UNRWA eben.
Im Gegensatz zu anderen UN-Organisationen agiert die UNRWA weder international noch als neutraler Akteur im Nahostkonflikt. Sie beschäftigt Zehntausende Palästinenser, die wiederum Millionen ihrer Landsleute mit staatlichen und kommunalen Dienstleistungen in fünf Einsatzgebieten dauerhaft versorgen, ohne den Auftrag ihnen eine neue Bleibe zu finden. Es ist ein Konstrukt, das einem transnationalen Staat im Staat gleich kommt.
Finanziert wird dieses System großzügig durch externe Geldgeber, insbesondere aus dem Westen, allen voran Deutschland. Solange die UNRWA sich als humanitäre Organisation präsentiert und als solche wahrgenommen wird, fließen die Gelder weiter, an eine rasch zunehmende Zahl von Begünstigten. Doch hinter der Fassade reiner Nothilfe stehen weitreichende politische Ziele. Die UNRWA selbst bringt es auf den Punkt: Es geht nicht um Geld, sondern um das angeblich legitime Recht auf Rückkehr.
Während das von der UNRWA propagierte Rückkehrrecht von Millionen Registrierten eine Zweistaatenlösung faktisch unmöglich macht, sind es paradoxerweise gerade deren lauteste Verfechter im Westen, die das Hilfswerk mit Milliardenspenden am Leben erhalten. Sie sehen in ihm einen Stabilitätsfaktor für die Region. Andere hingegen betrachten das Beharren auf der Rückkehr als größtes Hindernis für einen dauerhaften Frieden. Tatsächlich wären weder Israel noch ein zukünftiger palästinensischer Staat bereit oder in der Lage, die ständig wachsende Zahl von UNRWA-Palästinenser aufzunehmen.
Ohne ein grundlegendes Umdenken und tiefgreifende Korrekturen steuert die Region unweigerlich auf noch schwerere Verwerfungen und existentielle Krisen zu. Mit dem Verbot der UNRWA auf seinem Staatsgebiet hat Israel am 1. Februar 2025 einen ersten Schritt getan. Doch die Welt war nicht bereit für ein Umdenken: Der Vorstoß stieß auf scharfe Kritik und zu einem eskalierenden Streit mit den Vereinten Nationen. Plötzlich rückte die Flüchtlingsagentur ins Zentrum der globalen Aufmerksamkeit.
In diesem Spannungsfeld wirft der Autor unbequeme Fragen auf: Wie konnte es soweit kommen, und vor allem: Wie soll es weitergehen? Wann sehen die UNRWA und ihre Geldgeber ihre Mission als erfüllt an? Was ist deren Exit-Strategie für dieses ewige Hilfswerk? Diesen Fragen, auf die es keine einfachen Antworten gibt, soll hier nachgegangen werden.
Lange ist es der UNRWA gelungen ihre politische Agenda zu verschleiern, und die Geberländer waren allzu bereit diese auszublenden. In diesem riskanten politischen Vabanquespiel kommt den Medien eine entscheidende Rolle zu. Sie haben es in der Hand, das Bild der UNRWA in der Öffentlichkeit entweder als neutrale humanitäre Organisation zu zeichnen oder vor ihrer politischen Instrumentalisierung zu warnen. Gewissermaßen stellvertretend wird auf diesen Seiten der Versuch unternommen, ausgehend von einem meinungsprägenden Leitmedium, dem Spiegel, Tendenzen in der deutschen Berichterstattung auszumachen. Dabei offenbart sich eine gefährliche Toleranz für die Verflechtung der UNRWA mit radikal-islamistischen Gruppen, für die der Spiegel zahlreiche Beispiele liefert.
Diese verhängnisvolle Nähe von Medien, UNRWA und extremistischen Bewegungen ist geeignet ein Meinungsumfeld zu schaffen, das nicht nur Israels Existenz untergräbt, sondern auch Palästinenser immer tiefer ins Verderben reitet. Doch jenseits ideologischer Verhärtung gibt es Auswege und Hoffnung auf realistische Lösungen, die niemanden als Verlierer zurücklassen muss.
Dies ist ein Plädoyer für eine Welt, in der Palästinenser sich aus Abhängigkeit befreien, und für sich und ihre Kindern ein selbstbestimmtes und würdevolles Leben aufbauen, statt ohne Zukunftschancen in einer Endlosschleife des Wartens instrumentalisiert zu werden für eine illusorische Rückkehr.
1 In der Realität, das weiß der Leser, wurden sie natürlich in Deutschland aufgenommen und zügig integriert.
KAPITEL 1
DIE UNRWA: FLÜCHTLINGSAGENTUR OHNE FLÜCHTLINGE
1.1 Die Flüchtlingsströme des 20. Jahrhunderts
Millionen auf der Flucht. Weltkriege und zahlreiche Bürgerkriege machten Millionen von Menschen im 20. Jahrhundert zu Flüchtlingen. Im Zuge des Ersten Weltkriegs (1914–1918) wurden 7 bis 15 Millionen Menschen aus ihren Heimatländern vertrieben – allein in Europa. Während der Russischen Revolution und des darauffolgenden Bürgerkriegs (1917–1922) verließen mehrere Millionen fluchtartig ihr Land. Zwischen 1933 und 1941 flohen 280.000 Juden und politisch oder ethnisch Verfolgte vor den Nationalsozialisten aus dem Deutschen Reich und 117.000 aus dem 1938 besetzten Österreich.1 Im Zweiten Weltkrieg (1939–1945) flüchteten 60 Millionen Menschen vor Krieg, Zerstörung und Verfolgung. In den Wirren danach waren weitere 30 Millionen auf der Flucht. Die Teilung von Britisch-Indien (1947) setzte gigantische Flüchtlingsströme in Bewegung: 10 bis 20 Millionen Menschen suchten in Indien oder Pakistan eine neue Heimat, ein wahrer Bevölkerungsaustausch. Zu einem anderen Austausch mit 2 Millionen Flüchtlingen kam es in den Nachwehen des Griechisch-Türkischen Krieges (1919–1922)2,. Unabhängigkeits- und Bürgerkriege zwangen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts weitere Millionen zur Flucht: Der Algerienkrieg (1954–1962) hatte eine Million enteigneter europäischstämmiger Zivilisten zur Folge, der Unabhängigkeitskrieg von Bangladesch (1971) hatte 9 Millionen Flüchtlinge zur Folge, der Koreakrieg (1950–1953) 5 Millionen, der Vietnamkrieg (1955–1975) 6 Millionen, der Bürgerkrieg in Mosambik (1977–1992) 1,7 Millionen, der Jahrzehnte währende Bürgerkrieg in Somalia 1 Million, der Genozid in Ruanda (1994) 2,1 Millionen, die Kriege in Ex-Jugoslawien (1991–1999) 2,4 Millionen. Der sowjetische Einmarsch in Afghanistan (1979–1989) vertrieb 3 Millionen Menschen in die Nachbarländer, und der Afghanische Bürgerkrieg (1989–2001) nach dem Abzug der sowjetischen Besatzungstruppen weitere 7 Millionen. Ungezählte Millionen Menschen sind während der Unabhängigkeits- und Bürgerkriege in Afrika geflohen, meist ohne große öffentliche Aufmerksamkeit im Westen. Das sind nur einige der großen Flüchtlingsströme, die im 20. Jahrhundert jeweils mehr als eine Million Menschen in Bewegung setzten.
Dutzende weitere politische und kriegerische Krisen vertrieben jeweils weniger als eine Million Menschen. Die seit 1950 anhaltende Besetzung Tibets durch China trieb 150.000 Tibeter nach Indien. Die Besetzung der Tschechoslowakei durch die Sowjetunion (1968) trieb bis zu 200.000 Flüchtlinge in die Nachbarländer, 600.000 flohen aus Bergkarabach und Umgebung nach Aserbaidschan, Zigtausende flohen aus Venezuela in die Nachbarländer, es kam zu großen Flüchtlingsbewegungen auch aus Jemen in die Nachbarstaaten sowie aus Myanmar nach Thailand, Bangladesch und Indien. Hunderttausende flohen während des Jahrzehnte anhaltenden Bürgerkriegs im Sudan und aktuell – während des Gaza Kriegs - sind wieder 12.5 Millionen auf der Flucht, davon 4 Millionen im Südsudan. Die Liste ließe sich beliebig verlängern. Die meisten dieser Flüchtlingskrisen sind von der Tagesordnung verschwunden. Niemand spricht mehr von ihnen, aber das 20. Jahrhundert ist eine einzige Geschichte von Flucht und Vertreibungen.
Naher und Mittlerer Osten. Nach Auflösung des Britischen Mandats und während des ersten arabisch-israelischen Kriegs 1948 sind etwa 711.000 Araber geflüchtet. Im Zuge der Machtübernahme durch Chomeini 1979 haben Zigtausende Iraner ihr Land verlassen. Die Massenflucht setzte sich während des Krieges zwischen dem Iran und dem Irak (1980–1988) fort und hält bis heute an. Allein 2020 lag die Zahl der Asylsuchenden und Flüchtlinge aus dem Iran bei 210.000. Der Iran selbst nahm bis Ende 2020 bis zu 780.000 registrierte afghanische Flüchtlinge auf sowie geschätzte 2 Millionen nichtdokumentierte Afghanen. Die Niederschlagung von kurdischen Autonomie- und Unabhängigkeitsbestrebungen seit 1919 hat immer wieder größere Flüchtlingsströme ausgelöst. Zigtausende Kurden wurden im ersten und im zweiten irakisch-kurdischen Krieg in den 1960er und 70er Jahren vertrieben oder sind geflüchtet. Der erste Golfkrieg in den 90ern und die Aufstände haben wieder Millionen – vor allem kurdische – Flüchtlinge ins Ausland getrieben. Allein 1,4 Millionen Kurden haben Zuflucht während des Zweiten Golfkriegs (1990–1991) im Iran gefunden. Heute besteht ein Großteil der kurdischen Bevölkerung aus Flüchtlingen und deren Nachkommen. Während des Bürgerkriegs im Libanon (1975–1990) flohen 800.000 Libanesen ins Ausland. Der Bürgerkrieg in Syrien hat seit 2011 zu einer der größten Fluchtbewegungen im Nahen und Mittleren Osten geführt: mit 6,8 Millionen Flüchtlingen in die Nachbarländer Türkei, Jordanien, Libanon und in Richtung Europa.
Globale Zahlen.3 Zu den Millionen Menschen, die bei ihrer Flucht eine Landesgrenze übertreten haben und deshalb nach internationalem Recht als Flüchtlinge gelten, kommt meist noch ein Vielfaches an Binnenflüchtlingen hinzu. Allein im Jahr 2022 schätzte die UN-Flüchtlingsorganisation UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) die Zahl der Flüchtlinge auf 32,5 Millionen und fast doppelt so viele Binnenflüchtlinge (53,2 Millionen). 72 % der Flüchtlinge kommen aus fünf Ländern: Syrien (6,8 Millionen), Venezuela (5,6 Millionen), Ukraine (5,4 Millionen), Afghanistan (2,8 Millionen), Südsudan (2,4 Millionen). 36 % der Geflohenen wurden von fünf Ländern (Türkei, Kolumbien, Deutschland, Pakistan und Uganda) aufgenommen. Seit dem Zweiten Weltkrieg haben mehr als 170 Kriege und Bürgerkriege stattgefunden, die meisten davon in den Regionen des Globalen Südens. Alle waren von Massenfluchtbewegungen und Vertreibungen begleitet.
Geringe Aussicht auf Rückkehr. In den meisten dieser Konflikte konnten oder wollten die Geflüchteten und Vertriebenen nicht mehr in ihre angestammte Heimat zurückkehren. Sie wurden in den Erstaufnahmeländern heimisch oder zogen weiter in ein Land ihrer Wahl, das ihnen dauerhaft Zuflucht gewährte. Spätestens nach ein paar Jahren waren sie in ihrer neuen Heimat angekommen. In den Gastländern werden die Flüchtlinge in der Anfangsphase oft von staatlichen Programmen, von der Zivilgesellschaft oder Nichtregierungsorganisationen unterstützt. Je nach Bedarf bzw. Notwendigkeit betreuen internationale Organisationen wie das UNHCR oder das UN World Food Programme (WFP) die Neuankömmlinge und unterstützen sie manchmal mit eigenen Programmen. Nach Wochen, Monaten oder wenigen Jahren haben sie in der Regel ihren Flüchtlingsstatus verloren und sind zu „normalen“ Einwanderern geworden.
1.2. Die jüdische Nakba
Auch eine Nakba.4 Fast eine Million Juden5 wurden im 20. Jahrhundert aus arabischen und muslimischen Ländern im Nahen Osten und Nordafrika vertrieben, etwa 700.000 bis 800.000 allein zwischen 1948 und 1951. Auslöser der Flucht dieser Mizrachim-Juden waren politische Instabilität, soziale Unruhe und eine Zunahme von Antisemitismus und Gewalt, insbesondere nach dem ersten arabisch-israelischen Krieg von 1948. Zurück blieben in Marokko von 250.000 gerade mal 2000 jüdische Bürger, in Tunesien 1500 (von 100.000), in Ägypten blieben von 75.000, im Irak von 150.000 und in Syrien von 30.000 jeweils weniger als 50. In Algerien und Libyen leben heute keine Juden mehr – von vormals 140.000 bzw. 38.000. Bekannte Pogrome fanden überall in der arabischen Welt statt. Die Weltorganisation von Juden in arabischen Ländern schätzt, dass die Geflüchteten dabei bis zu $ 300 Milliarden und 100.000 km2 Land, was der fünffachen Fläche von Israel entspricht, zurücklassen mussten.6 Ein Drittel der jüdischen Flüchtlinge aus arabischen Ländern ist nach Europa geflohen: algerische Juden besonders nach Frankreich und ägyptische, syrische und libanesische Juden vor allem in die Vereinigten Staaten. 600.000 aus Marokko, Tunesien, Algerien, Libyen, Ägypten, Jemen und dem Irak wurden in Israel aufgenommen.7 Sie lebten zunächst in Zeltlagern, sogenannten Einwandererlagern, die von der Jewish Agency betrieben wurden. In den 1950er Jahren entstanden daraus Übergangslager aus Wellblechhütten. Die Lebensbedingungen verbesserten sich, aber die Bewohner mussten sich fortan selbst versorgen. Das letzte Übergangslager wurde 1963 aufgelöst. Aus den Lagern wurden dauerhafte Siedlungen, sogenannte Entwicklungsstädte, die langsam zu richtigen Städten heranwuchsen. Die Bewohner erhielten feste Wohnungen. Heute besteht ein Großteil der Bevölkerung Israels aus Flüchtlingen und ihren Nachkommen. Sie sind sowohl in Israel als auch im Westen voll integriert. Von den jüdischen Flüchtlingen aus den arabischen Ländern spricht heute niemand mehr. Niemand käme auf die Idee, sie noch als Flüchtlinge zu bezeichnen oder sie als Empfänger von UN-Leistungen zu registrieren.
Die arabischen Palästina-Flüchtlinge hingegen, die aus Israel geflohen sind – oft kaum mehr als hundert Kilometer –, gelten nach mehr als 75 Jahren immer noch als „Flüchtlinge“ und geben diesen vererbbaren Status an ihre Nachkommen – mittlerweile in der vierten und fünften Generation – weiter. Die Zahl der aus arabischen Ländern vertriebenen Juden ist also vergleichbar oder sogar höher als die der 700.000 bis 750.000 arabischen Flüchtlinge, die etwa zeitgleich aus dem ehemaligen Britischen Mandatsgebiet geflohen sind. Angesichts der hohen Werte, die jüdische Flüchtlinge in ihren Heimatländer zurückließen, war es materiell eigentlich ein Bevölkerungsaustausch „zugunsten“ der Fluchtländer. Auch lohnt es sich, die Zahlen der arabischen Palästina-Flüchtlinge mit denen der o. g. Flüchtlingsbewegungen des 20. Jahrhunderts zu vergleichen.
Doppelmaß. Am Weltflüchtlingstags der Vereinten Nationen gedenkt man in Israel der vergessenen Juden, die aus den arabischen Ländern vertrieben wurden.8 Warum, so muss gefragt werden, wurden die 850.000 jüdischen Flüchtlinge aus der arabischen Welt nach 1948 erfolgreich im winzigen Israel und anderen Ländern angesiedelt. Sie gelten heute nirgendwo mehr als Flüchtlinge, während die Zahl der Flüchtlinge der UNRWA (United Nations Relief and Work Agency for Palestine Refugees in the Neareast) von 711.000 auf mittlerweile 6,8 Millionen (2023) angestiegen ist? Dieser Frage soll hier nachgegangen werden.
1.3. Die arabische Nakba
Der erste arabisch-israelische Krieg 1947/48. Am 29. November 1947 wurde der Plan zur Teilung des damaligen Britischen Mandatsgebiet Palästina von der UN-Vollversammlung angenommen. Am 14. Mai 1948 zogen sich die letzten britischen Truppen aus dem Mandat zurück und Israel erklärte seine Unabhängigkeit. Am nächsten Tag griffen fünf arabische Armeen das Territorium, das die UN für den neuen Staat vorgesehen hatte, von allen Seiten an. Ägypten, das damalige Transjordanien, Syrien, der Libanon und der Irak beteiligten sich am Krieg gegen den jungen Staat. Auch Jemen und Saudi-Arabien schickten Expeditionsarmeen. Ihr Ziel war es, den jüdischen Staat durch Vernichtung zu verhindern. Der Krieg dauerte 15 Monate und ging am 10. März 1949 zu Israels Gunsten mit einigen Gebietsgewinnen innerhalb der Waffenstillstandslinien aus. Er endete mit separaten Waffenstillstandsabkommen, die Israel 1949 am 24. Februar mit Ägypten, am 23. März mit Libanon, am 3. April mit Transjordanien und am 20. Juli mit Syrien unterzeichnete.
Arabische Palästina-Flüchtlinge. Infolge der bürgerkriegsähnlichen Zustände im britischen Mandatsgebiet Palästina 1947/48 und des ersten arabisch-israelischen Krieges 1948 sind 700.000 bis 750.000 von 1,2 Millionen Palästina-Arabern aus ihren Häusern und Dörfern geflohen oder wurden von dort vertrieben. Die UN Conciliation Commission for Palestine (CCP) gab die offizielle Zahl mit 711.000 an.9 Hinzu kamen Binnenflüchtlinge innerhalb des israelischen Staatsgebietes. Angeblich wurden damals 400 arabische Dörfer und 10 jüdische Dörfer entvölkert, die meisten davon 1948 während der Kämpfe. Nach früheren Volkszählungen belief sich die Bevölkerung 1947 auf etwa 1,8 Millionen, davon 60 % Muslime und 31 % Juden. Offizielle UN-Zahlen von 1947 gehen von 1.076.780 Muslime und 608.230 Juden aus, bei einer Gesamtbevölkerung von 1.845.560.10 Laut den israelischen Volkszählungen von 1947, vor dem Krieg also, und 1949, also nach dem Waffenstillstand, lebten von insgesamt 807.000 Arabern noch 160.000 im Land. Demnach hätten etwa 650.000 Araber Israel verlassen. Die im Land verbliebenen Araber wurden israelische Staatsbürger, im Gegensatz zu den Geflohenen, die bis heute einen oft prekären Flüchtlingsstatus haben.11 Die israelische Unabhängigkeitserklärung hatte sie ausdrücklich aufgefordert im Land zu bleiben und sich mit gleichen Rechten am Aufbau des Landes zu beteiligen. In der UN-Resolution 194(III) heißt es: „Flüchtlinge, die in ihre Heimat zurückkehren und in Frieden mit ihren Nachbarn leben wollen, soll dies […] gestattet werden.“ Die anderen sollten für ihre Verluste entschädigt werden.12 Die Araber lehnten die Resolution vom Dezember 1948 jedoch ab, da der Krieg damals noch nicht zu Ende war und sie immer noch auf die Vernichtung Israels hofften. Erst nach dem verlorenen Krieg interpretierten sie die Resolution als Recht auf Rückkehr. Die UN erkannte damals, dass nicht alle geflohenen Araber zurückkehren konnten, ohne die Sicherheit Israels zu gefährden. Israel bot an 200.000 zurückzunehmen.13 Die Araber lehnten nicht nur ab, sondern verweigerten ihnen im Libanon, Syrien und Ägypten (Gaza) die Staatsangehörigkeit – bis heute. Sie machten keinen Hehl daraus, dass sie die Flüchtlinge als Waffe in ihrem Krieg gegen Israel betrachten. 5.60 der 6.77 Millionen Palästina-Flüchtlingen, also die überwältigende Mehrheit, leben auf dem Gebiet des historischen Mandats Palästina: in Jordanien, Westjordanland und Gaza.
Der genaue Hergang des Palästina-Exodus von 1948 ist unter Historikern umstritten. Es gibt unterschiedliche Narrative:
Aufforderungen zu Flucht. Aus israelischer Sicht verließen die Palästina-Araber ihre Häuser oft freiwillig oder aus Angst bzw. auf Anweisung der anrückenden arabischen Armeen, damit diese freie Bahn hätten. Es wurde ihnen vorgegaukelt, dass sie in wenigen Wochen – nach der Vernichtung Israels – wieder in ihre Dörfer zurückkehren könnten. So erklärte der irakische Premierminister Nuri Said: „Wir werden das Land mit unseren Waffen zerschlagen und jeden Ort, an dem die Juden Schutz suchen, auslöschen. Die Araber sollten ihre Frauen und Kinder in sichere Gebiete bringen, bis die Kämpfe abgeklungen sind.“14 Zahlreiche arabische Führer inner- und außerhalb Israels sowie nationale arabische Führungsgremien (The Arab National Committee in Jerusalem, The Arab Higher Committee) ermutigten die arabische Bevölkerung, ihre Dörfer zu verlassen. Einer der einflussreichsten Anführer war der Großmufti von Jerusalem, Haj Amin al-Husseini. Die Angst bestand weniger darin, dass die Menschen in Gefahr waren, sondern dass sie dem jüdischen Staat Legitimität verleihen würden, wenn sie Israel nicht verließen.15 Oft war es eine Mischung aus Angst, Drohungen und Befehlen, die den Anstoß zur Flucht gegeben hat. Sich diesen Befehlen zu widersetzen, galt als Behinderung der Kämpfe und des Heiligen Krieges.16 Der Historiker Efraim Karsh, Leiter der Abteilung Mittlerer Osten am King’s College London, schrieb in seinem Buch „Palestine Betrayed“, dass er aufgrund seiner Recherchen in britischen, israelischen und arabischen Archiven zur Erkenntnis gekommen ist, dass die Araber bleiben konnten, sofern sie die Waffen niederlegten, aber dass die Befehle des Großmuftis dies nicht zuließen.17 Die arabischen Nachbarstaaten ließen sie einwandern, hielten sie aber rechtlos unter kümmerlichen Bedingungen, und das hat sich bis heute für die meisten Nachkommen der Palästina-Flüchtlinge nicht geändert.
Gezielte Säuberungen. Aus palästinensischer Sicht wurden die ursprünglichen Einwohner durch gezielte Säuberungen von den Israelis vertrieben. Laut dem Palestinian Central Bureau of Statistics18 wurden 1948 mehr als 800.000 von 1,4 Millionen in 1300 Städten und Dörfern lebenden Arabern aus ihrer Heimat in das Westjordanland, den Gazastreifen, in die benachbarten arabischen Länder und in die Welt vertrieben. Laut wenig zuverlässigen Quellen wie PalestineRemembered. com kontrollierten die Israelis während der Nakba 774 Städte und Dörfer. Die israelischen Streitkräfte zerstörten dieser palästinensischen Quelle zufolge 531 palästinensische Städte und Dörfer und begingen mehr als 70 Massaker an der lokalen Bevölkerung, bei denen insgesamt 15.000 Araber getötet worden seien.19 Deir Yasin ist das bekannteste davon: Mehr als 110 Männer, Frauen und Kinder wurden dort von Irgun- und Stern-Kämpfern getötet. Mehr als 6000 israelische Juden, ein Drittel Zivilisten und mehr als 10.000 arabische Soldaten und Zivilisten seien im israelischen Unabhängigkeitskrieg ums Leben gekommen.20 Andere Quellen gehen von 7000 toten Arabern aus, die Hälfte davon Palästinenser.21
Die Aufnahmeländer. Etwa ein Drittel der geflohenen Araber ging ins Westjordanland, das damals unter jordanischer Kontrolle stand, ein Viertel siedelte in den Gazastreifen um, der damals von Ägypten kontrolliert wurde.22 Das heißt, dass fast 60 % der Palästina-Araber die arabisch-palästinensischen Gebiete nie verlassen haben. Die übrigen zogen nach Jordanien, nach Syrien und in den Libanon. Die arabischen Staaten weigerten sich, die aus dem Britischen Mandat Palästina vertriebenen Araber (von der UN offiziell als „Palästina-Flüchtlinge“ bezeichnet) aufzunehmen, und hielten sie stattdessen in Flüchtlingslagern fest. Die Arabische Liga wies ihre Mitgliedstaaten an, den Palästina-Flüchtlingen die Staatsbürgerschaft zu verweigern, „um den Verlust ihrer Identität zu vermeiden und ihr Recht auf Rückkehr in ihre Heimat zu schützen“. Israel hatte 1949 der Rückkehr von 100.000 Palästina-Flüchtlingen zugestimmt, doch die arabischen Staaten lehnten ab.23 Für sie hatte der Kampf gegen den neuen Staat gerade erst begonnen, und entwurzelte, gefrustete Flüchtlinge sollten da eine willkommene Waffe sein.
Gründung der UNRWA. In dieser Situation waren die Neuankömmlinge in den arabischen Aufnahmeländern auf humanitäre Hilfe angewiesen. Am 8. Dezember 1949 wurde die UNRWA durch den Beschluss 302(IV)24 der Vollversammlung der Vereinten Nationen gegründet, um den Flüchtlingen aus Palästina in Gaza, dem Westjordanland, Jordanien, Libanon und Syrien humanitäre Hilfe zu leisten und für ihre grundlegenden Bedürfnisse zu sorgen. Ein damals einmaliger Vorgang für Geflüchtete. Die UNHCR gab es noch nicht. Die UNRWA wurde als temporäre Organisation angelegt, zunächst mit einem Mandat von einem Jahr. In einem Ergänzungsantrag der arabischen Staaten wurde die Möglichkeit einer Verlängerung des Mandats festgehalten. Seitdem wird das Mandat bis heute regelmäßig verlängert, zuletzt Ende 2022 bis Mitte 2026, mit der überwältigenden Mehrheit von 157 Stimmen, einer Gegenstimme (Israel) und 10 Enthaltungen. Gleichzeitig wurde ein knappes Dutzend anderer Resolutionen gegen Israel verabschiedet.25 Die Verlängerung ist jedes Mal eine reine Routineangelegenheit, über die ohne Kontroversen abgestimmt wird, obwohl von den ursprünglich Geflohenen kaum noch welche leben.
Wenig bekannt ist, dass die UNRWA den Flüchtlingen beider Seiten helfen sollte. Die Definition umfasste auch 17.000 Juden und 50.000 Araber, die innerhalb der Waffenstillstandslinie geflohen sind.26
1.4 Die deutsche Nakba
Die Ostvertriebenen. Zwischen 1944 und 1948 – also etwa zeitgleich mit den Ereignissen im Nahen Osten – wurden 12 Millionen Deutsche aus ihrer Heimat vertrieben: 3.250.000 aus Schlesien, 2.900.000 aus der Tschechoslowakei, jeweils knapp 2 Millionen aus Ostpreußen und Pommern, weitere knapp 2 Millionen aus Westpreußen und Posen, Rumänien Jugoslawien und Ungarn. Sie alle wurden im zerstörten Deutschland aufgenommen: jeweils knapp 2 Millionen in Bayern und Niedersachsen, die meisten anderen Länder nahmen zwischen 680.000 und 860.000 Flüchtlinge auf, das völlig zerstörte Berlin über 200.000. Die Vertriebenen flohen in Trecks, wurden ausgewiesen, evakuiert oder deportiert. Für die Bundeszentrale für politische Bildung war die „Vertreibung […] ein mehrschichtiger, regional unterschiedlicher, mehrere Phasen umfassender Prozess […], zu dem u. a. im vorherrschenden Verständnis gehören: die Evakuierungen seit Herbst 1944, die allgemeine Flucht im Frühjahr 1945 mit Trecks oder über die See, die teilweise Rückkehr in die Wohngebiete, die Deportationen in die Sowjetunion, die Einrichtung von Internierungslagern und die Ausweisung. Die Maßnahmen gegen diesen Teil der [lokalen] Bevölkerung resultierten teils aus ,wilden‘ oder gezielten Aktionen anderer nationaler Gruppen, die unter dem Nationalsozialismus gelitten hatten, teils aus massiven Ausschreitungen der vorrückenden russischen Truppen gegen die Zivilbevölkerung, teils aus alliierten Beschlüssen, die nicht selten bereits geschaffene Tatsachen legalisierten oder zu weiteren Vertreibungsmaßnahmen führten.“27 Motive der Vertreibung waren Vergeltung für im Krieg erlittenes Leid, Entschädigung für materielle Verluste oder Rache an Kollaborateuren. Sie wurden zu Opfern ohne aber Täter gewesen zu sein. Schätzungsweise zwei Millionen Menschen sind auf der Flucht oder durch Vertreibungsverbrechen umgekommen. Es war die Folge eines brutalen Angriffskriegs, den Deutschland gegen seine Nachbarn geführt hatte. Sie kamen mittellos in Deutschland an und mussten in einem zerstörten und verarmten Land bei Null anfangen.
Die Nakba der Ostvertriebenen. Ist man verleitet, in Analogie zur Nakba in Palästina auch von einer deutschen Nakba zu sprechen, so ist es wichtig, hinzuzufügen, dass 15-mal mehr Menschen aus den Ostgebieten vertrieben wurden als aus Palästina, dass die Ostvertriebenen oft tausend Kilometer durch zerstörte und feindselige Gebiete irrten, während Palästina-Flüchtlinge oft nach kaum hundert Kilometer ankamen, dass auf dem Weg nach Deutschland zwei Millionen Menschen durch Gewalt und Entbehrungen umkamen, dass ihre Aufnahme in einem zerstörten und zerrissenen Deutschland unsicher war, dass sie vor allem auf die Solidarität der ausgebombten einheimischen Bevölkerung angewiesen waren, da keine UN-Organisation bereitstand, um sie aufzunehmen. Sie leben nach 70 Jahren nicht noch in UN-finanzierten sogenannten Flüchtlingslagern, aus denen sie die Ostgebiete mit ihrer Rückkehr bedrohen. Stattdessen wurden sie in Deutschland aufgenommen, versorgt und integriert. Sie wurden nicht zum Spielball von Politik und nationalistischen Interessen, sondern zu mündigen Bürgern, die rasch Teil der Gesellschaft wurden. Ein weiterer Unterschied ist aber auch, dass sie nicht von feindlich gesinnten Geldgebern mit Milliardenbeträgen als Flüchtlinge alimentiert wurden, um irgendwann ihre Rückkehr wahrzumachen. Im Fall der UNRWA sitzen die Hauptgeldgeber auf anderen Kontinenten, in Europa und Amerika. Es ist, als würden mittelöstliche Staaten Milliarden an eine stetig wachsende Zahl – eine Verzehnfachung seit den 50er Jahren – von Vertriebenen spenden, um deren Rückkehrrevanchismus am Leben zu erhalten. Sie alle waren das Ergebnis verlorener Angriffs- und Vernichtungskriege der Deutschen gegen ihre Nachbarländer bzw. der vereinten arabischen Armeen gegen den jungen Staat Israel.
1.5 Wer ist UNRWA-Flüchtling?
UNRWA-Flüchtlinge.28 Die UNRWA definiert Palästina-Flüchtlinge als
„Persons whose normal place of residence was Palestine during the period 1 June 1946 to 15 May 1948, and who lost both home and means of livelihood as a result of the 1948 conflict. UNRWA services are available to all those […] who are registered with the Agency and who need assistance. The descendants of Palestine refugee males, including adopted children, are also eligible for registration. [They] live in 58 recognized Palestine refugee camps in Jordan, Lebanon, the Syrian Arab Republic, the Gaza Strip and the West Bank, including East Jerusalem. […] While most of UNRWA’s installations such as schools and health centres are located in the Palestine refugee camps, a number are outside; all of the Agency’s services are available to all registered Palestine refugees, including those who do not live in the camps.“
In Anlehnung an diesen Text spricht die UNRWA korrekterweise immer von Palästina-Flüchtlingen.
Die Agentur ist also mandatiert, Dienstleistungen zu erbringen. Damit ist die UNRWA die einzige UN-Organisation, die selbst Dienstleistungen für Endverbraucher erbringt. Das UN-Kinderhilfswerk betreibt keine einzige Schule, die Weltgesundheitsorganisation kein einziges Krankenhaus.
UNRWA-Flüchtlinge müssen also mehrere Bedingungen erfüllen:
Sie müssen Bewohner sein des Territoriums des Teils des Britischen Mandats, das dem Staatsgebiet Israels zugesprochen wurde.
Sie müssen zwischen dem 1. Juni 1946 und dem 15. Mai 1948 – dem Tag nach Ende des Britischen Mandats bzw. dem Tag des arabischen Angriff s – im Britischen Mandatsgebiet Palästina gewohnt haben und durch den Krieg von 1948 Haus und Hof verloren haben. Bis zum 1. Mai 1948 waren 175.000 Araber geflohen.
29
Im September 1949 schätzte die UN Conciliation Commission for Palestine die Zahl der Flüchtlinge außerhalb Israels auf 711.000.
30
Somit scheint es, dass die überwiegende Mehrzahl der 711.000 Araber erst nach dem Stichtag im Mai 1948 gefl ohen sein könnte.
Sämtliche Nachkommen männlicher UNRWA-Leistungsempfänger, einschließlich adoptierter Kinder, erben automatisch den UNRWA-Flüchtlingsstatus.
Sämtliche Dienstleistungen der UNRWA stehen allen registrierten Palästina-Flüchtlingen zur Verfügung, einschließlich jenen, die nicht in einem Camp leben.
Wenn das eigentliche Mandat schon von Anfang an nicht eingehalten wurde, so wurde es im Laufe der Jahre ständig um weitere Personenkreise erweitert: 31
Die UNRWA übernahm bereits bei der Gründung von anderen Hilfsorganisation listenweise Personen, die die o.g. Kriterien für Palästinaflüchtlinge nicht erfüllten.
Dann kamen die „Jerusalem poor“ und die „Gaza poor“ hinzu, die nicht den Kriterien der UNRWA entsprachen, aber kooptiert wurden.
Während des Sechstagekrieges 1967 – diesmal ein angekündigter Angriffskrieg seiner Nachbarn, dem Israel durch einen Präventivschlag zuvorgekommen ist – setzten sich erneut 250.000 bis 300.000 Palästina-Flüchtlinge (einschließlich 120.000 registrierter Flüchtlinge) aus dem Westjordanland und dem Gazastreifen in Bewegung. Das Mandat wurde auf diese „1967 displaced“ erweitert. 10 neue Camps seien für die neue Welle von Vertriebenen, für Flüchtlinge wie Nichtflüchtlinge, errichtet worden, schreibt die UNRWA.
1982 wurde das Mandat nach Israels Einmarsch im Libanon erneut erweitert auf alle Personen, die als „displaced by subsequent hostilities“ galten.1993 wurde Bedürftigkeit als Anspruchsberechtigung gestrichen. Fortan konnten auch Nichtbedürftige aufgenommen werden, was den Kreis der Berechtigten nochmals erweiterte. Laut JP sind z.B. der jordanisch-amerikanische Immobilienmogul Mohamed Hadid und seine fünf millionenschweren Kinder, darunter die Supermodels Bella und Gigi Hadid und die milliardenschwere Tochter Zahwa Arafat des ehemaligen Palästinenserführers Jassir Arafat als Palästinena Flüchtlinge eingestuften.
32
2006 wurde das Mandat auch auf Nachkommen von weiblichen UNRWA-Registrierten ausgeweitet, auch wenn der Vater kein registrierter UNRWA-Flüchtling ist.
Im selben Jahr wurde das Mandat wieder erweitert, und zwar um jene Personen, die im Libanon oder im Gazastreifen (nach dem Rückzug Israels im Jahr 2000 bzw. 2005) „aufgrund von Feindseligkeiten“ als „displaced“ galten. Viele waren Libanesen und keine Nachkommen von Palästina-Flüchtlingen.
Darüber hinaus wurde das Mandat zwischen 1993 bis 2002 mehrfach auf immer neue Personenkreise erweitert, „in enger Zusammenarbeit mit dem UN-Sonderkoordinator für den Nahost-Friedensprozess (UNSCO) und spezialisierten UN-Organisationen“, wie es hieß, um dem Ganzen einen Anstrich von Legitimität zu verleihen. Aufgenommen wurden sie aus wirtschaftlichen Gründen, wurden aber dem Heer von „Palästina-Flüchtlingen“ mit „Rückkehrrecht“ hinzugeschlagen. 2002 wurde die spezifische Referenz auf Palästina-Flüchtlinge ersetzt durch eine neue UN-Schwurbelformulierung mit dem Ergebnis, dass auch „andere“ Personen registriert werden konnten. Das Mandat war nicht länger nur auf Palästina-Flüchtlinge oder „Displaced Persons“ beschränkt.
2009 – also fast sechzig Jahre nach der Nakba - wurde zu den Kriterien für die Registrierung als Palästina-Flüchtling folgender Satz hinzugefügt: „The Agency accepts new applications from persons who wish to be registered as Palestine Refugees.“
Waren Personen einmal als Berechtigte registriert, so vererbten sie ihren Status automatisch auf sämtliche Nachkommen. Einmal UNRWA-Flüchtling, immer UNRWA-Flüchtling? Es gab einige Versuche zwischen Personen zu unterschieden die UNRWA-Dienstleistungen in Anspruch nahmen und „offiziellen“ Palästina-Flüchtlingen. Welche der verschiedenen Kategorien den einen und den anderen zugerechnet werden, und was dies zahlenmäßig bedeutet, wäre eine eigene Untersuchung wert.
Hinzu kommen noch andere „Andere“. Damit sind solche gemeint, „die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Registrierung nicht alle Kriterien der UNRWA als Palästina-Flüchtlinge erfüllten, bei denen jedoch festgestellt wurde, dass sie aus Gründen, die mit dem Konflikt in Palästina von 1948 zusammenhängen, erhebliche Verluste und/oder Härten erlitten hatten. Zu den „Anderen“ gehören auch Familienangehörige anderer registrierter Personen.“
33
So wurden alleine zwischen 2020 und 2023, also innerhalb von zwei Jahren, mehr als 110.000 „Andere“ neu aufgenommen.
Die UNRWA sollte Flüchtlinge beider Seiten des Konflikts aufnehmen. Laut Don Peretz,34 einem amerikanischen Politologie-Professor, Nahostexperten und Autor zahlreicher Bücher, umfasste die ursprüngliche Definition eines UNRWA-Flüchtlings auch etwa 17.000 Juden, die in Gebieten Palästinas gelebt hatten, die während des Krieges von 1948 von arabischen Streitkräften übernommen wurden, sowie 50.000 Araber, die innerhalb der israelischen Waffenstillstandsgrenzen lebten. Israel übernahm die Verantwortung für diese Personen, Araber und Juden. Sie wurden israelische Bürger und 1950 von den UNRWA-Listen gestrichen. Unter den UNRWA-Berechtigten befindet sich vermutlich heute kein einziger jüdischer Flüchtling. So kam es, dass nur Palästina-Araber (und ein paar Hundert nichtarabische christliche Palästinenser) außerhalb Israels in der Obhut der UNRWA blieben und deren Nachkommen nach 75 Jahren immer noch in den arabischen Gastländern als Flüchtlinge gelten, meist mit prekärem Status.
„Großzügige“ Praxis. Jenseits von ihrem befristeten Mandat hat sich die UNRWA immer weiter von ihrer ursprünglichen Bestimmung entfernt: Definition und Mandat uferten immer weiter aus. Gleichzeitig wurde auch die Praxis immer permissiver.
Bis 1967 war das Westjordanland unter jordanischer Herrschaft. Im Sechstagekrieg verlor das Königreich die Kontrolle darüber an Israel. Zwanzig Jahre später, im Juli 1988, gab es seinen Anspruch auf diese Gebiete westlich des Jordans auf, über die seitdem niemand mehr die Souveränität ausübt.35 Palästina-Flüchtlinge aus dem Westjordanland, die von Jordanien aufgenommen wurden, besitzen einen jordanischen Pass. Sie machen rund 93 % der 2,3 Millionen UNRWA-Registrierten in Jordanien aus. Sie sind seit Jahren jordanische Staatsbürger mit Zugang zu Sozialleistungen, Bürgerrechten und dem jordanischen und nahöstlichen Arbeitsmarkt. Dennoch bleiben sie und ihre Nachkommen UNRWA-„Flüchtlinge“.
Allein die 158.000 Nachkommen der Flüchtlinge aus dem ehemals ägyptischen Gaza haben nur provisorische Papiere und eingeschränkte Rechte in Jordanien.36 Offenbar lebt es sich als UNRWA-„Flüchtling“ und Bürger zweiter Klasse unter haschemitischer Fremdherrschaft immer noch besser als unter einer palästinensischen Regierung im Gazastreifen.
In Jordanien können auch Rückkehrer nach langjährigem Arbeitsaufenthalt in den Golfstaaten ihre Berechtigungskarte, die beliebte „ration card“ der UNRWA zurückbekommen. Auch ihre im Ausland angeheirateten Frauen und ihre Kinder werden dann ebenfalls zu UNRWA-Palästina-Flüchtlingen. Bei der UN-Flüchtlingsorganisation UNHCR wäre dies nicht möglich.
Als der Irak Kuwait überfiel, flohen Hunderttausende Palästinenser aus dem Land. Die meisten besaßen jordanische Pässe. Sie wurden nach Jordanien abgeschoben. Diejenigen, denen wegen ihrer Sympathien für Saddam Hussein ihre eben erst gewonnene kuwaitische Staatsbürgerschaft wieder entzogen wurde, wurden nicht vom UNHCR aufgenommen, sondern wurden wieder UNRWA-Berechtigte Palästina-Flüchtlinge in Jordanien oder in Camps im Westjordanland oder in Gaza.
2005 rief Palästinenser-Führer Mahmud Abbas sämtliche Gastländer auf, palästinensischen Flüchtlingen die Staatsbürgerschaft zu verleihen.37 „Dies bedeutet keine Ansiedlung [von Flüchtlingen]. Ein Palästinenser würde in sein Heimatland zurückkehren, sobald es ihm erlaubt wird, unabhängig davon, ob er eine arabische oder nichtarabische Staatsbürgerschaft besitzt“, sagte er. „Ein Palästinenser der fünften Generation, der in Chile lebt, möchte ebenfalls zurückkehren, wenn es ihm erlaubt wird.“ Das sei eine emotionale Angelegenheit, die nichts mit der Staatsbürgerschaft zu tun habe, fügte er hinzu. Rückkehrrecht trotz Staatsbürgerschaft!
1.6 Immer mehr Leistungsempfänger
Rekrutierung immer neuer Berechtigter. Durch die zahlreichen Mandatserweiterungen und die automatische Weitergabe (Vererbung) des UNRWA-Status an alle Nachkommen ist deren Zahl von ursprünglich 711.000 (CCP 1950) auf mittlerweile knapp 6,8 Millionen angewachsen, davon mehr als 10% „Andere“ (2023, s. Tabelle). Allein zwischen 2020 und 2023 kamen über Hunderttausend Andere dazu. Zu den Anderen gehörten auch Verstorbene, die nicht abgemeldet worden waren, fiktive Namen, Beduinen ohne festen Wohnsitz, für die die Agentur nie etwas getan hat. Laut internen Berichten von 1951 und 1960 sollten die Flüchtlingskriterien „sehr flexibel“ gehalten werden, um auch solche, die lediglich in Israel arbeiteten, zuzulassen.38
Kamen im ersten Jahrzehnt etwa 200.000 Personen dazu, waren es im zweiten, dritten und vierten Jahrzehnt bereits jeweils 300.000 (1960–70), 400.000 (1970–80) und 600.000 (1980–90) zusätzliche Anspruchsberechtigte (s. Tabelle). Ab 1990 beschleunigte sich der Zuwachs massiv und immer rasanter: In den nächsten Jahrzehnten kamen 1,3 Millionen (1990–2000), dann 1,23 Millionen (2000–2010) und 1,4 Millionen (2010–2020) hinzu. Auffällig ist, dass im Jahr 2018, als die USA ihre Zahlungen einstellten, „nur“ noch 26.000 Berechtigte hinzukamen. Als Deutschland und Europa den finanziellen Verlust ausglichen, gab es 2019 wieder zehnmal mehr, nämlich 250.000 Neuzugänge in einem einzigen Jahr. Demzufolge kamen in zehn Jahren jeweils über eine Million Leistungsempfänger hinzu, also mehr als 100.000 pro Jahr oder 2000 pro Woche. In den sieben Jahrzehnten ihres Bestehens hat sich die Zahl der UNRWA-Registrierten fast verzehnfacht. Es ist fraglich, ob die UNRWA selbst über zuverlässige und glaubwürdige Zahlen verfügt. Sie alle genießen den UNRWA-Flüchtlingsstatus mit verbrieftem Rückkehrrecht nach Israel.
Laut einer Studie der Obama-Administration sahen die Zahlen jedoch ganz anders aus: 2012 waren von den Millionen UNRWA-Registrierten weniger als 200.000 Flüchtlinge nach UN-Kriterien, nur ein Bruchteil dessen was die UNRWA angibt.39, 40 Palästinenser, die in palästinensisch kontrollierten Gebieten (Gazastreifen und Westjordanland) lebten oder aber Staatsangehörige anderer Länder (z.B. Jordanien) waren, wurden nicht mitgezählt. Die Studie von 2012 wurde nie veröffentlicht, auch nicht von der Biden-Administration, die den Vorwürfen immer wieder nachgehen wollte.41 Heute, mehr als zehn Jahre später, dürfte nur noch ein Bruchteil der 2012 erfassten Flüchtlinge von 1950 am Leben sein. Der US-Senat ging 2012 sogar von nur 30.000 im Jahr 1950 geflüchteten Personen aus.42 Mehr als 10 Jahre später dürfte auch davon nur noch ein Bruchteil am Leben sein.
Tabelle: Registrierte UNRWA-Flüchtlinge.43 1950 ohne 45.800 Personen, die bereits 1952 von Israel übernommen wurden. Zahlen für 2020 bis 2023 sind den UNRWA Operational Reports entnommen. Zahlen in Klammern sind „Andere“. Die Gesamtzahlen stimmen nicht immer mit denen der Einsatzgebiete überein.
Jahr
Jordanien
Libanon
Syrien
Westjordanland
Gazastreifen
Gesamt
2023
2.582.144 (189.009)
568.206 (75.005)
682.571 (95.729)
1.139.284 (226.405)
1.796.006 (209.041)
6.768.208 (795.189)
2022
2.542.999 (176.949)
557.342 (69.680)
647.455 93.473)
1.123.485 (222.450)
1.754.309 (200.441)
6.652.590 (762.957)
2020
2.463.130 (156.119)
543.824 (64.287)
655.729 (86.999)
1.082.653 (211.116)
1.643.551 (166.845)
6.388.887 (685.366)
2020
2.307.011
479.537
568.730
871.537
1.476.706
5.703.546
2019
2.206.736
476.033
552.000
828.328
1.386.455
5.449.552
2018
2.242.579
475.075
438.000
846.465
1.421.282
5.423.401
2015
2.097.338
449.957
526.744
762.288
1.258.559
5.094.886
2013
2.034.641
441.543
499.189
741.409
1.203.135
4.919.917
2010
44
2.000.000
427.057
477.700
788.108
1.100.000
4.792.865
2010
1.999.466
455.373
495.970
848.494
1.167.361
4.966.664
2003
1.718.767
391.679
409.662
654.971
907.221
4.082.300
2000
1.570.192
376.472
383.199
583.009
824.622
3.737.494
1995
1.288.197
346.164
337.308
517.412
683.560
3.172.641
1990
929.097
302.049
280.731
414.298
496.339
2.422.514
1985
799.724
263.599
244.626
357.704
427.892
2.093.545
1980
716.372
226.554
209.362
324.035
367.995
1.844.318
1975
625.857
196.855
184.042
292.922
333.031
1.632.707
1970
506.038
175.958
158.717
272.692
311.814
1.425.219
1965
688.089
159.810
135.971
-
296.953
1.280.823
1960
613.743
136.561
115.043
-
255.542
1.120.889
1955
502.135
100.820
88.330
-
214.701
905.986
1950
506.200
127.600
82.194
-
198.227
914.221
Interessant ist, wie diese Zahlen zustande kommen. Im Bericht an den UNRWA-Generalkommissar von 1997/98 heißt es wörtlich:45 „Die Zahlen der UNRWA-Registrierung beruhen auf freiwilligen Angaben der Flüchtlinge, die in erster Linie dazu dienen, Zugang zu den Dienstleistungen der Agentur zu erhalten, und können daher nicht als statistisch gültige demografische Daten angesehen werden. Die Zahl der registrierten Flüchtlinge im Einsatzgebiet der Agentur ist mit ziemlicher Sicherheit geringer als die erfasste Bevölkerung.“ Welchen Grund gäbe es da, einen Verstorbenen abzumelden - oder anzumelden?
Flüchtlingsexplosion im Gazastreifen. Am schnellsten wuchs die Zahl der UNRWA-Berechtigen im Küstenstreifen. Sie machen 81% der über 2.2 Millionen Einwohner aus. Bei einer Fertilität von 7,9 Geburten pro Frau (1970) nahm die Zahl der UNRWA-Registrierten in 70 Jahren um das Achtfache zu. Laut Weltbank hatte der Gazastreifen auch noch 2015 mit über 3 % eine der höchsten Geburten- und Bevölkerungswachstumsraten weltweit.46 Insgesamt wuchs die Bevölkerung im Gazastreifen nach 1950 bis 1967 von 250.000 auf 350.000.47 Eine israelische Volkszählung von 1967 kam auf 394.000 Einwohner.48 Aufgrund der extrem hohen Geburtenrate wurde um die Jahrtausendwende die erste Million überschritten, zwanzig Jahre später die zweite Million. Kinder unter fünf Jahren machen 13 % der Bevölkerung aus; 28 % sind jünger als 10 Jahre und mehr als die Hälfte sind noch keine 20 Jahre alt.49
Viele Kinder, viele schwangere Frauen, Millionen „Flüchtlinge“ im engen, schmalen Küstenstreifen. Daraus lassen sich vortrefflich Argumente für eine alternativlose humanitäre Rolle des UNRWA-Hilfswerks konstruieren. Dabei wird der Mythos bemüht, Gaza habe die höchste Bevölkerungsdichte der Welt. Tatsache ist jedoch, dass Gaza-Stadt mit 13.100 Einwohnern pro Quadratkilometer, die am dichtesten besiedelte Region des Gazastreifens ist und im weltweiten Dichte-Ranking nur auf Platz 92 liegt.50 Zahlreiche andere Metropolen, wie Manila oder Gizeh bei Kairo, sind bis zu viermal dichter besiedelt. Allein sieben israelische Städte weisen eine höhere Bevölkerungsdichte auf. Im Gazastreifen leben auf 360 Quadratkilometer 2,23 Millionen Menschen, was einer Dichte von 6200 Einwohnern pro Quadratkilometer entspricht. Damit liegt der Gazastreifen im globalen Ländervergleich an fünfter Stelle – zwischen Hongkong und Gibraltar.51
Bezahlter „Flüchtlingsstatus“. Die Politik der UNRWA, die Kinder, Enkel, Urenkel und Ururenkel der 1948 und 1967 Geflohenen sowie immer neue Quereinsteiger als „Flüchtlinge“ mit Anspruch auf die attraktive „ration card“ aufzunehmen, ist weltweit einzigartig und wird bei keiner Flüchtlingsgruppe anderer Krisenherde praktiziert. Während das UNHCR sich darum bemüht, dass seine Flüchtlinge im Aufnahmeland möglichst schnell auf eigenen Beinen stehen und wirtschaftlich unabhängig werden, setzt die UNRWA alles daran, immer mehr Berechtigte zu registrieren und abhängig zu machen. Die Zahl der sogenannten Palästina-Flüchtlinge wird ungebremst und ohne zeitliche Limitierung weiter steigen. Dafür sorgt die UNRWA im eigenen Interesse – eine besondere Art der Hilfe zur Selbsthilfe.





























