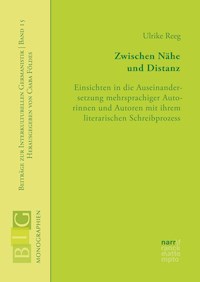
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Beiträge zur Interkulturellen Germanistik
- Sprache: Deutsch
Der Band beschäftigt sich mit den Selbstäußerungen mehrsprachiger Autorinnen und Autoren unterschiedlicher kultureller Herkunft, die seit der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum schreiben und publizieren. Im Zentrum stehen autobiographische Essays, Poetikvorlesungen sowie Gesprächsaufzeichnungen, in denen sie ihr Verhältnis zu den jeweiligen Herkunftssprachen reflektieren, sich intensiv mit dem Deutschen als fremder Literatursprache auseinandersetzen und ihr Selbstverständnis als Autorinnen und Autoren schildern. Die durch zahlreiche Zitate belegten Selbstreflexionen bieten zudem weitreichende Einsichten in die ambivalente Auseinandersetzung mit ihrer Sprachidentität. Die Studie liefert einen Beitrag zur Erhellung von individueller Mehrsprachigkeit in Bezug auf die Entwicklung kreativer Schreibprozesse.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 327
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Beiträge zur Interkulturellen Germanistik
Herausgegeben vonCsaba Földes
Band 15
Ulrike Reeg
Zwischen Nähe und Distanz
Einsichten in die Auseinandersetzungmehrsprachiger Autorinnen und Autorenmit ihrem literarischen Schreibprozess
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
DOI: https://doi.org/10.24053/9783823395447
© 2022 · Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG
Dischingerweg 5 · D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.de
eMail: [email protected]
Satz: PD Dr. Markus Hartmann
ISSN 2190-3425
ISBN 978-3-8233-8544-8 (Print)
ISBN 978-3-8233-9544-7 (ePDF)
Für Luciano
Inhalt
Vorwort des Herausgebers
Danksagung
1Zur Einleitung
1.1Materialgrundlage
1.2Zum Begriffsfeld Sprache
1.3Sichtweisen
2Innovative Synthesen: ein Prolog
3Erinnerungen
3.1Zwei Mütter
3.2Das Archiv
3.3Nebeneinander
3.4Zusammenführungen
4Das Gedächtnis der Sprachen
4.1Mehrsprachigkeit
4.2Schreibengehen
5Zweifel und Widerstände
5.1„On Learning a New Language“
5.2Im Labyrinth von zwei Sprachen verirrt
5.3Die Unbeherrschbarkeit der Sprache
5.4Sprachfremde
5.5Sprachfluss
6Festschreibungen
7Freischreibungen
7.1Enttabuisierung
7.2Affektive Verarbeitung
8Identität
9Emotionen
10Ressourcen
11Zum Schluss: Rückblick und Perspektiven
11.1Sprache erschreiben
11.2Dialoge
11.3Sprachwelten
12Literatur
Vorwort des Herausgebers
Es freut mich als Herausgeber, dass nach der Monographie von Bianka Burka „Manifestationen der Mehrsprachigkeit und Ausdrucksformen des ‚Fremden‘ in deutschsprachigen literarischen Texten: exemplifiziert am Beispiel von Terézia Moras Werken“ als Band 6 der „Beiträge zur Interkulturellen Germanistik“ (Tübingen: Narr 2016) in unserer Reihe nun wieder einmal ein Buch zur literarischen Mehrsprachigkeit und Interkulturalität erscheint.
Die Verfasserin, Frau Ulrike Marie Reeg, ist Germanistikprofessorin an der Università degli Studi di Bari Aldo Moro in Italien und beschäftigt sich in Forschung und Lehre seit Längerem produktiv mit interkulturellen Fragen sowohl in weiten Bereichen der Sprachwissenschaft als auch auf dem Gebiet der Didaktik und der Literaturwissenschaft. Die vorliegende Untersuchung ist ebenfalls in hohem Maße komplexer inter- bzw. transdisziplinärer Natur und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der Frage, wie mehrsprachige Autorinnen und Autoren, deren Leben von den Migrationsprozessen der letzten Jahrzehnte geprägt ist, ihr literarisches Schreiben reflektieren, welchen Stellenwert das Deutsche als später erlernte Sprache für sie hat, von welchen Emotionen ihr Schreibprozess begleitet wird, welche Perspektiven sich während ihres Schaffensprozesses eröffnen, aber auch welche Widerstände sich ihrem jeweiligen Ausdruckswunsch entgegenstellen können.
Von einem übergeordneten Blickwinkel aus handelt es sich darum, unterschiedliche Aspekte des Zusammenhangs von individuellen Migrations- und Spracherfahrungen und dem Schreiben literarischer Texte zu erhellen und vor allem diesbezügliche Reflexionen der Autorinnen und der Autoren als zentrale Belege heranzuziehen. Insofern bietet diese Studie grundsätzlich auch wertvolle Einblicke in das Zusammenspiel von individueller Mehrsprachigkeit und den damit verbundenen möglichen kreativen Schreibprozessen.
Für die Untersuchung werden Texte herangezogen, die bisher eher weniger im Zentrum des Interesses jener Forschung stehen, welche sich in den letzten Jahren vor allem vermehrt mit Manifestationen von Mehrsprachigkeit in der Literatur des deutschsprachigen Raums beschäftigt und/oder im Bereich linguistischer Forschungen sprachbiographische Fragestellungen in den Fokus rückt: Bei den hier zitierten Texten handelt es sich um Poetikvorlesungen, Gesprächsaufzeichnungen und sprachbiographische, teilweise verdichtete Texte. In ihnen reflektieren die Autorinnen und Autoren ihre durchaus ambivalenten Sprach- und Schreiberfahrungen sowie Aspekte ihrer kulturellen Verortung und Standortbestimmung als mehrsprachige Autorinnen und Autoren im deutschsprachigen Literaturraum.
Im Einklang mit aktuellen Positionen der Mehrsprachigkeitsforschung, die insbesondere für den Einbezug des subjektiven Erfahrungshorizonts mehrsprachiger Personen plädiert, wird dabei diesen Texten konsequenterweise die Möglichkeit zuerkannt, aussagekräftige Erkenntnisse in Bezug auf diese besondere Form gelebter Mehrsprachigkeit zu liefern.
In dieser mehrperspektivischen Studie wird schließlich der Versuch unternommen, insbesondere psychoanalytische und sozialpsychologische Einsichten sowie Resultate der aktuellen Mehrsprachigkeitsforschung zu skizzieren und als Deutungsangebote zu diskutieren, mit dem Ziel, die spezifischen Erfahrungen von Mehrsprachigkeit der hier vorgestellten Autorinnen und Autoren, insbesondere aber auch ihre damit im Zusammenhang stehenden Schreibdispositionen besser nachvollziehen zu können.
Aufgrund seines anregenden Inhalts wird der Band die interkulturelle Germanistik zweifellos fruchtbar bereichern. Ich wünsche ihm eine gute Aufnahme!
Erfurt, im Mai 2022
Csaba Földes
Danksagung
Ich möchte mich zunächst sehr herzlich bei Herrn Prof. Dr. Dr. Csaba Földes für seine großzügige Unterstützung meines Projekts sowie die Aufnahme der vorliegenden Untersuchung in die Reihe Beiträge zur Interkulturellen Germanistik bedanken. Dank gebührt auch Herrn PD Dr. Markus Hartmann für seine überaus geduldige und kompetente Hilfe bei der Textrevision und -formatierung.
Ein großes Dankeschön geht zudem an meine Kollegin und Freundin Ulrike Simon, die mit ihrer verlässlichen und aufwendigen Korrekturarbeit nicht unerheblich zur Entstehung des Textes beigetragen hat.
Gabriele Patermann und Dagmar Vogelgesang sei gedankt für ihre ersten Leseeindrücke des noch unfertigen Manuskripts.
Schließlich möchte ich mich an dieser Stelle für die zahlreichen Anregungen bedanken, die ich in vielen Gesprächen vor allem von Franco Biondi, Gino Chiellino und José F.A. Oliver im Laufe vieler Jahre und bei ganz unterschiedlichen Gelegenheiten erhalten habe. Mit ihrem Zuspruch, aber auch mit ihrer Kritik haben sie entscheidend dazu beigetragen, dass mein Interesse an der Erkundung des literarischen Schreibens mit mehreren Sprachen nie nachgelassen hat.
Conversano/Frankfurt am Main, im Mai 2022
Ulrike Reeg
1Zur Einleitung
Diese Sprachen, Johanna, machen uns zu Fremden – selbst wenn die Frau vom ungarischen Kulturinstitut Polnisch und Ungarisch sprach, die Dame vom polnischen Kulturinstitut Deutsch und Polnisch, der Lyriker Englisch und Polnisch, ich mitten unter einander jagenden Sprachfetzen und Satzmelodien, ungefähr wie früher, wenn meine versprengte Flüchtlingsweltverwandtschaft aus Kanada, den USA, Schweden und Deutschland einmal im Jahr am Balaton aufeinanderstieß und ihr babylonisches Sprachwirrwarr über seine grünblauen Ufer goss (Zsuzsa Bánk 2017: 388).
Schreiben als Mehrsprachige, das Entstehen einer ‚deutschsprachigen‘ Literatur, in die sich andere Sprachen wie von selbst einschreiben oder von den Autor/innen bewusst miteinbezogen, in ihre Texte oft gut versteckt und kaum erkennbar eingewoben werden, ist bis in konkrete topographische und sprachliche Verweise oft einl e b e n s g e s c h i c h t l i c h e sSchreiben. Diese vorwiegend in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, im Zuge von Migrationen in den deutschsprachigen Raum entstandene Literatur, auf die ich mich bei meinen folgenden Überlegungen beziehe, erlaubt es, „Aufbrüche neuer transkultureller, translingualer und transarealer Bewegungsmuster“ (Ette 2005: 15) zu erkennen. Sie lässt „Orte des Umdenkens“ (Adelson 2006: 40) entstehen und wird vor allem von der Literaturwissenschaft, vor dem Hintergrund unterschiedlicher Paradigmen, die sich im wechselvollen Diskurs um Fremde und Fremdheitserfahrungen herauskristallisiert haben, untersucht (vgl. u.a. Reeg 1988; Amodeo 1996; Chiellino 2000; Blioumi 2002; Arnold 2006; Lengl 2012; Laudenberg 2016).
Eine neue Entwicklung zeichnet sich allerdings in den letzten Jahren ab: Sowohl im öffentlichen Raum mit Blick auf (bildungs-)politische Erfordernisse, als auch in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen, zu denen vor allem auch die Sprachwissenschaft samt ihren Teildisziplinen zählt, ist ein erheblich gesteigertes Interesse an dem Themenfeld derM e h r s p r a c h i g k e i tzu bemerken (vgl. u.a. Auer/Li Wei 2007; Reeg/Simon 2019; Földes/Roelcke 2022). Interdisziplinär angelegte Überblicksdarstellungen (vgl. Bürger-Koftis/Schweiger/Vlasta 2010 aber auch vermehrt literatur- und kulturwissenschaftliche Untersuchungen widmen nunmehr Aspekten derl i t e r a r i s c h e nM e h r s p r a c h i g k e i tumfangreiche Darstellungen, in denen grundlegende Fragestellungen, wie beispielsweise „sprachliche Rahmenbedingungen“ und „Basisverfahren“ vermessen werden (Dembeck/Parr 2017: 5f.; vgl. dazu auch; ZiG 2015; Dembeck/Uhrmacher 2016). Zudem entstehen vertiefende Analysen zu Manifestationen von Mehrsprachigkeit einzelner Autor/innen in ihren literarischen Texten (vgl. Burka 2016).
Der Einbezug der Vita der Autor/innen durch den Zugriff auf biographische Daten und Informationen zu ihrem Erwerb des Deutschen als Fremdsprache, ihrer späteren Literatursprache, wurde und wird von einigen Autor/innen als wenig zielführend oder sogar als ausgrenzend angesehen.1 In den betreffenden Auseinandersetzungen darüber wurde die Forderung ins Spiel gebracht, der hier zur Diskussion stehenden literarischen Textproduktion, die im Kontext der nach dem Zweiten Weltkrieg einsetzenden Migrationsbewegungen in deutschsprachige Regionen entstand, keinerlei vermeintlich die literarische Qualität der Texte nivellierenden Sonderstatus einzuräumen. Bei der späteren Abschaffung des Adelbert-von-Chamisso-Preises (vgl. Esselborn 2004; Vertlib 2007b: 159–161; Bodrožić 2008: 72–74; Weinrich 2008) der dazu gedacht war, die Literatur von Autor/innen nicht deutschsprachiger Provenienz in besonderer Weise zu fördern und sie im deutschsprachigen literarischen Feld besser zu verorten, wird mit der Aussage, dass „[v]iele dieser Autoren heute nur für ihre literarischen Leistungen gewürdigt werden [wollen], und nicht wegen ihres biografischen Hintergrunds“ (Robert-Bosch-Stiftung, Pressemeldung [04.10.2021]) an diese Argumentation nolens volens angeknüpft. 2018 kommt es dennoch mit dem Chamisso-Preis/Hellerau zu einer Fortsetzung dieser Auszeichnung, wobei wiederum der Lebenskontext der Autor/innen in besonderer Weise von Interesse ist, denn es werden deutsch schreibende Autor/innen ausgezeichnet, „deren literarische Arbeit von einer Migrationsgeschichte geprägt ist“ (Schmitz 2019a: 10 und 2019b: 17–31).
Es ist hier nicht der Ort, diese Auseinandersetzung weiter zu vertiefen. Es bleibt hingegen festzuhalten, dass sich eine Reihe von Publikationen dezidiert mit der Frage des Zusammenhangs von individuellen Migrations- und Spracherfahrungen und dem literarischen Schaffen kritisch auseinandersetzen und dabei viele der Autor/innen selbst zu Wort kommen lassen (vgl. exemplarisch Amodeo/Hörner 2010; Siller/Vlasta 2020). Darüber hinaus ist in den letzten Jahren auch aus sprachwissenschaftlicher Perspektive die Sprachlichkeit und die Bedingungen des Spracherwerbs mehrsprachiger Autor/innen im Kontext von Migrationen sowie ihre damit im Zusammenhang stehende literarische Mehrsprachigkeit ins Blickfeld gerückt ist.2
Dies ist sicherlich auch im Kontext des besonders in den letzten Jahrzehnten erstarkten Interesses an interkulturellen Lebensläufen sowie generell an Sprachbiographien mehrsprachiger Sprecher/innen im Kontext von Migration und Exil zu sehen (vgl. u.a. Thum/Keller 1998; Franceschini 2001; Franceschini/Miecznikowski 2004; Hein-Khatib 2007; Busch/Busch 2008; Thüne/Betten 2011). Eine viele Untersuchungen kennzeichnende, genuin literatur- und kulturwissenschaftliche Fragekonstellation wurde somit um interdisziplinäre, insbesondere (sprach-)biographisch zu verortende Problemstellungen erweitert (vgl. dazu u.a. Acker/Fleig/Lüthjohann 2019; Reeg 2019; www.polyphonie.at: Interviewdatenbank, Stand: 24.01.2021).
Die vorliegende Studie knüpft mit der zentralen Frage nach den individuellen Sprach- und Schreiberfahrungen mehrsprachiger Autor/innen an diesen Untersuchungshorizont an – sie tut dies jedoch auf der Basis von Texten, die bisher eher marginal beachtet wurden. Es handelt sich dabei um (teilweise verdichtete) Darstellungen, in denen Autor/innen über ihre Sprachen und ihren kreativen Schreibprozess in der Literatursprache Deutsch nachdenken und damit sehr spezifische und m.E. bisher eher selten beachtete Einblicke in ihre vielfach ambivalenten Spracherfahrungen ermöglichen. Unter einem übergeordneten Gesichtspunkt beabsichtigt diese Studie einen Beitrag zur Erhellung des Verhältnisses von individueller Mehrsprachigkeit und der damit im Zusammenhang stehenden Entwicklung kreativer Schreibprozesse zu leisten.
1.1Materialgrundlage
Im Zentrum dieser Untersuchung stehen Texte von Autorinnen und Autoren, deren Herkunftssprache nicht (nur) das Deutsche ist und die sich in den letzten Jahrzehnten im deutschsprachigen literarischen Feld etablieren konnten. Generell handelt es sich dabei um Selbstaussagen, in denen sie aus einem räumlichen und zeitlichen Abstand heraus das Verhältnis zu ihrer/n Herkunftssprache/n reflektieren. Zentrale Themen sind dabei der Prozess der Annäherung an das Deutsche, die ambivalenten Erfahrungen in ihrem literarischen Schreibprozess sowie ihr Selbstverständnis als Autor/innen nicht-deutschsprachiger kultureller Provenienz auch im Sinne einer damit einhergehenden kulturellen Verortung.3
Die in der Folge zitierten Autor/innen, Zsuzsa Bánk, María Cecilia Barbetta, Artur Becker, Franco Biondi, Marica Bodrožić, Irena Brežná, Gino Chiellino, Ota Filip, Jiří Gruša, Radek Knapp, Francesco Micieli, Ilma Rakusa, Terézia Mora, Yüksel Pazarkaya, Rafik Schami, Saša Stanišić, Yoko Tawada, Ilija Trojanow, José F.A. Oliver, SAID, und Vladimir Vertlib haben das Deutsche erst zu einem späteren Zeitpunkt, im Verlauf ihres Lebens in deutschsprachigen Ländern erlernt und/oder perfektioniert und zur Literatursprache erhoben. José F.A. Oliver bildet hierzu eine Ausnahme (vgl. Kap. 3.1 und 11.3): Bei dem im Schwarzwald aufgewachsenen Sohn spanischer Arbeitsimmigranten muss von einem simultanen bilingualen Spracherwerb (vgl. Rothweiler 2007: 106) unter Einbezug sprachlicher Varietäten ausgegangen werden.
Grundsätzlich gilt, dass für alle Autor/innen das Deutsche zum Zeitpunkt ihres Schreibprozesses die dominante Sprache des sozialen und literarischen Umfeldes ist, in dem sie agieren, und es ist vor allem eine zentrale Sprache ihrer literarischen Kreativität.4 In narrativen, lyrischen und dramatischen Texten gestalten sie neue literarische Räume, wobei sie in und mit dem Deutschen neue (Sprach-)Identitäten (vgl. exemplarisch De Florio-Hansen/Hu, Adelheid 2007; Reeg 2014b) entwerfen.
Diese, im engeren Sinne literarische Produktion wird in dieser Untersuchung zwar ‚mitgedacht‘, ist jedoch kein Bezugspunkt für die folgenden Analysen. Hierzu werden vielmehr, wie bereits erwähnt, solche reflexiven Selbstdarstellungen herangezogen, wie sie in zahlreichen (autobiographischen) Essays, Poetikvorlesungen und Gesprächsaufzeichnungen verschriftlicht wurden.5 Dabei ist die Unterscheidung von literarischen und nicht-literarischen Texten nicht immer trennscharf. Vor allem die Essays von José F.A. Oliver aber auch die autobiographisch angelegten Prosatexte von Marica Bodrožić, um nur zwei Beipiele zu nennen, zeichnen sich durch Prozesse der Verdichtung und Metaphorisierung aus, die wenig Ähnlichkeit mit jenen zweckgerichteten, auf Informativität bedachten Texten haben, wie wir sie etwa aus Sprachbiographien kennen, die im Kontext wissenschaftlicher Erforschung und/oder genuin sprachwissenschaftlicher Dokumentation erfragt und rekonstruiert werden (vgl. Tophinke 2002: 8). Sie können auch nicht mit jenen fragmentarischen autobiographischen Äußerungen in Gesprächsaufzeichnungen verglichen werden, die an verschiedenen Stellen in diese Studie miteinbezogen werden (vgl. Amodeo/Hörner 2010).
Von Belang ist jedoch die Tatsache, dass sie alle m.E. unzweifelhaft als Texte von Wert sind, mit deren Hilfe wir aussagekräftige Erkenntnisse zu dieser besonderen Form der gelebten Mehrsprachigkeit gewinnen können.6 Diese Textausschnitte, die das Datenmaterial für die vorliegende Untersuchung sind, müssen als äußerst heterogeneF a c e t t e nbiographischen Erzählens, als Kommentare und Reflexionen von Sprachlichkeit vor dem Hintergrund spezifischer Migrationserfahrungen gesehen werden. Bei den zitierten Texten bzw. -ausschnitten, die unter verschiedenen Aspekten untersucht werden, sind nämlich auch die unterschiedlichen kommunikativen Rahmenbedingungen ihrer Entstehung mit in Betracht zu ziehen: Thematische Fokussierungen, inhaltliche Ausgestaltung sowie die formale Beschaffenheit, die sich in verschiedenen Textsorten (Ausarbeitungen von Poetikvorlesungen, Verschriftlichungen von Gesprächen etc.) konkretisieren, stehen in engem Zusammenhang mit dem spezifischen Schreib- bzw. dem ihm vorausgehenden Redeanlass, der damit verbundenen Mitteilungsabsicht und dem potentiellen Lesepublikum und/oder einem tatsächlichen Auditorium.
Den zitierten Textpassagen ist gemeinsam, dass sie auf der Folie von Erinnerungen der mehrsprachigen Autor/innen an Lebensabschnitte in nicht-deutschsprachigen und/oder mehrkulturellen Kulturräumen entstanden sind, was für ihre Identitätskonstruktion und Standortbestimmung konstitutiv ist. Alle Texte können dabei als (teilweise ästhetisch äußerst anspruchsvoll) gestaltete Selbstentwürfe der Autor/innen angesehen werden, wobei die jeweiligen biographischen Rückbezüge durchaus beabsichtigt sind. Sie können folglich als Entwürfe von Erzählräumen gelten, in denen das erzählende Ich, aufs Engste mit dem Erfahrungshorizont des Autors/der Autorin verwoben ist, womit das hohe Erkenntnispotential in Bezug auf seine/ihre Erfahrungen der eigenen Mehrsprachigkeit umrissen ist.7 Diese Grundannahme wird auch nicht durch die Tatsache eingeschränkt, dass der erkennbare literarische Gestaltungswille eine Distanzierung von der eigenen Biographie bedeuten kann. Dass dieses vielmehr als ein literarischesS u r p l u szu bewerten ist, welches die Einblicke in die Erfahrung von Mehrsprachigkeit und den damit in Zusammenhang stehenden literarischen Schreibprozessen nicht verstellt, verdeutlichen beispielsweise die Überlegungen von Teufel in ihrem Vorwort zu Vladimir Vertlibs Publikation „Ich und die Eingeborenen. Essays und Aufsätze“ (2012f). Darin führt sie aus, dass die Essays einerseits das „autobiographische Fundament seiner Autorschaft“ aufdecken, womit u.a. migrationsbedingte Grenz- und Fremdheitserfahrungen gemeint sind, andererseits jedoch ein „paradigmatisches Zeugnis“ ablegen wollen. Infolgedessen sei die zentrale Frage von Vladimir Vertlibs Poetologie die, „wie aus der individuellen Erfahrung des Einzelnen – wie aus dem Leben, dem Erlittenen, Erlesenen und Erzählten – Literatur werden kann“ (Teufel 2012: 12).
1.2Zum Begriffsfeld Sprache
Wenn im Folgenden von‚S p r a c h e‘,genauer gesagt von‚H e r k u n f t s s p r a c h e‘8 (anstatt‚M u t t e r s p r a c h e‘,vgl. unten) und‚F r e m d s p r a c h e‘die Rede ist, dann sind diese Begriffe immer pluralisch zu verstehen, da mit ihnen ein Ensemble von Sprachen und Varietäten gemeint ist, dessen Gesamtheit dasS p r a c h r e p e r t o i r evon Sprecher/innen darstellt, wobei die prominente Auffassung von Grosjean, „that the bilingual is NOT the sum of two complete or incomplete monolinguals“ (Grosjean 1989: 3; vgl. dazu auch das mit ihm 2002 durchgeführte Interview, [02/08/2021]) nach wie vor mit zu bedenken ist. Hinzu kommt, dass die grundlegenden konzeptuellen Veränderungen im Zuge poststrukturalistischen Denkens für den Untersuchungshorizont dieser Arbeit und das begriffliche Inventar beachtet werden. Damit ist gemeint, dass Sprachen u.a. nicht mehr als abgeschlossene Systeme vorstellbar sind, die unabhängig von Sprecher/innen und deren individuellen Erfahrungen untersucht werden könnten. Meine Untersuchung sprachreflexiver Äußerungen mehrsprachiger Autor/innen erfolgt somit vor dem Hintergrund der Favorisierung subjektorientierter Sprachkonzepte, die das Spracherleben bzw. die Sprachlichkeit von Menschen (vgl. Hein-Khatib 2007: 40–46) in den Fokus rücken und die Mehrsprachigkeit als ein „integratives Repertoire, mit dessen Hilfe sprachlich gehandelt wird“ begreifen. Wichtig ist dabei, wie Subjekte diese „Bedeutung und Bedeutungssysteme konstruieren, inszenieren oder erzählen“ können (Hu 2019: 17f.).
Daran anknüpfend liegt das Hauptinteresse der vorliegenden Arbeit im Aufspüren und der Analyse individueller, signifikanter Momente des Spracherlebens der jeweiligen Autor/innen, die im Zusammenhang mit einer Neuinterpretation von Situationen zu begreifen sind, die für sie lebensgeschichtlich relevant sind. So gesehen sind die in den Textausschnitten dargestellten Spracherfahrungen immer als aussagekräftige biographische Erfahrungen einzustufen (vgl. Hein-Khatib 2007: 47). Aus ihren sprachreflexiven Texten wird herausgelesen, in welcher Form und in welchem Ausmaß, sie dabei jeweils auf ihrS p r a c h r e p e r t o i r ezugreifen können und/oder mit welchen Schwierigkeiten dies auch verbunden sein kann (vgl. dazu exemplarisch Kramsch 2012; Pavlenko 2014; Busch 2021). Dieses allumfassende Sprachrepertoire ist zudem als eine Ressource für die Persönlichkeitsentwicklung vor allem auch im Sinne möglicher Identitätskonstruktionen aufzufassen. Es steht Sprecher/innen auch zur Verfügung, um den kreativen Umgang mit ihren Sprachen und Varietäten zu erproben und damit das eigene Ausdrucksspektrum zu erweitern. Die kreativen Schreibprozesse der hier zur Diskussion stehenden, mehrsprachigen Autor/innen bezeichnen solche Zugriffswege.
Gerade die von mir verfolgte Subjektperspektive, die die ambivalenten Spracherfahrungen der mehrsprachigen Autor/innen fokussiert, macht es erforderlich, die mögliche Verwendung emotional besonders markierter Begriffe wie ‚Muttersprache‘ und ‚Fremdsprache‘ im Vorfeld zu problematisieren: Eine dynamische Sichtweise auf denM e h r s p r a c h i g k e i t s e r w e r bund dieM e h r s p r a c h i g k e i t,wie sie in den letzten Jahren modelliert wird (vgl. Herdina/Jessner 2002; Jessner 2007; Allgäuer-Hackl/Jessner 2015) bedingt, dass sprachliche Zuordnungen nur mit Bedacht vorgenommen werden sollten, da man grundsätzlich „sehr viele Kombinationsmöglichkeiten und Varianten“ annehmen kann „zwischen der Mehrsprachigkeit von Kindern, die ihre Sprachen ungefähr gleich gut von Geburt an erwerben, und der institutionell erlernten Mehrsprachigkeit“ (Allgäuer-Hackl/Jessner 2015: 210). Hinzu kommt, dass die emotionale Einstellung von Sprecher/innen zu Sprachen und Sprachkompetenzen sich möglicherweise ändert, dass generell die Zusammenhänge sehr komplex sind und dass durch Bezeichnungen fälschlicherweise Identitäten festgelegt werden können (vgl. dazu auch Brizić 2007).9
‚Muttersprache‘ ist durchgängig der zentrale Begriff sowohl im allgemeinen Sprachgebrauch, als auch in den Textauszügen der in dieser Studie zitierten Autor/innen, aber auch in vielen wissenschaftlichen Untersuchungen. Bei ‚Muttersprache‘ ebenso wie bei „‘Madre lingua’, ‘mother tongue’, ‘alma mater’“ handelt es sich um Sprachbilder mit einer gewissen Suggestivkraft, die die Vorstellung vermitteln, „che la funzione del linguaggio venga ‘presa’ e appresa attaccati al seno materno, insieme al latte“ (Amati Mehler et al. 2003: 82).10
Dabei soll eine mögliche Schlüsselrolle der Mutter beim frühkindlichen Spracherwerb nicht in Abrede gestellt werden – zumal bereits drei Monate vor der Geburt das Hörvermögen des Embryos insoweit ausgebildet ist, dass er „die einzigartige Klangschrift der mütterlichen Stimme“ und ihre Sprache identifizieren kann (Butzkamm/Butzkamm 2008: 5). Die Annahme – hier sei stellvertretend die Psychoanalyse genannt – dass die primäre körperliche und sprachliche Beziehung zur Mutter die Entwicklung des kindlichen Erstspracherwerbs entscheidend prägt, ist somit keineswegs obsolet, muss aber aus verschiedenen Gründen modifiziert werden und einer erweiterten Perspektive weichen. Zunächst ist in Betracht zu ziehen, dass in der Vergangenheit umfangreiche klinische Untersuchungen zu dem Ergebnis geführt haben, dass die Muttersprache nicht ausschließlich einer Mutter-Kind-Symbiose zuzuordnen ist, ohne die Funktion weiterer Bezugspersonen miteinzubeziehen:
Sia perché il rapporto primario si può declinare fin dalle origini in più linguaggi (anzi – se teniamo conto dei dialetti, dei gerghi, dei lessici familiari, oltre che delle lingua ufficialmente codificate – in una certa misura ogni bambino viene allevato in più lingue); sia perché, a livelli precoci dell’esistenza, la caratteristica precipua del rapporto materno è quella di essere indifferenziato e di comprendere quindi anche altri rapporti – il padre, le nonne … – che si embricano con quello materno11 (Amati Mehler et al. 2003: 99).
Ein weiteres, gewichtiges Argument, das gegen die Entscheidung, den Begriff ‚Muttersprache‘ zu benutzen, spricht, ist zudem die Bedeutung biographischer Konstellationen – vor allem unter den Bedingungen von Migration. Nicht selten spielen auch hier mehr als nur eine Sprache und/oder Varietät und damit mehr als nur eine Bezugsperson bei der sprachlichen Entwicklung des Kindes eine große Rolle.12
Aus diesen Gründen bevorzuge ich im Folgenden den Begriff ‚Herkunftssprache‘, der mehrere und durchaus auch sehr verschiedene Sprachen bezeichnet, dessen semantischer Gehalt sowohl soziokulturelle als auch biographische Komponenten umfasst und der damit entschieden weiter greift, als der traditionelle Begriff ‚Muttersprache‘.
Der generelle Verzicht auf die in der Sprachwissenschaft üblichen, funktionalen Kurzbezeichnungen L1, L2, L3 etc., der aus dem bisher Dargelegten hervorgeht, setzt sich auch mit der Wahl des Begriffes ‚Fremdsprache‘ fort – obwohl die Auffassung darüber, welche Sprache im Einzelfall als Fremdsprache empfunden wird, von den mehrsprachigen Autor/innen oft nicht eindeutig beantwortet werden kann und damit an das mit dem Begriff ‚Muttersprache‘ skizzierte Dilemma erinnert. Für die Verwendung dieses Begriffs spricht aus meiner Sicht jedoch die Tatsache, dass das Adjektiv fremd und damit auch das Kompositum Fremdsprache in einem traditionsreichen und für diese Studie mitzudenkenden Diskurszusammenhang steht (vgl. dazu Ehlich 2010), in dem u.a. die Dichotomien (und ihre Dekonstruktion) von Nähe und Distanz und/oder Eigenem und Fremdem und/oder Zentrum und Peripherie sowie die Thematisierung von Inklusion und Exklusion aus unterschiedlichen disziplinären Perspektiven grundsätzlich mitschwingen. ‚Fremdsprache‘ ist aus diesem Grund eine adäquatere und aussagekräftigere Bezeichnung als der mit ‚Herkunftssprache‘ eher korrespondierende Begriff ‚Zielsprache‘ oder ‚Landessprache‘ (vgl. Chiellino 2016: 133).
1.3Sichtweisen
Das im Titel dieser Untersuchung verwendete Wort Einsichten meint konkret die Möglichkeit, die Reflexionen der Autor/innen in den zitierten Texten exemplarisch rezipieren zu können. Es ist aber auch als Synonym für ‚Erkenntnisse‘ in Bezug auf ihreD i s p o s i t i o n13 als mehrsprachige Individuen und im engeren Sinn, die damit in Zusammenhang stehendenS c h r e i b d i s p o s i t i o n e nintendiert. Im Folgenden werden hierzu mehrperspektivisch Denkanstöße aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Untersuchungsfeldern mit den Selbstäußerungen der Autor/innen in Zusammenhang gebracht und als Deutungsangebote diskutiert.
Dabei wird zunächst dasS i c h - E r i n n e r nals Voraussetzung und Ausgangsbasis für das Schreiben der autobiographisch-narrativen und deskriptivreflexiven Texte untersucht (vgl. Kap. 3). Die Aktivierung des Gedächtnisses wird dabei nicht nur als notwendiger Motor des Schreibprozesses angenommen, sondern auch als Möglichkeit, Erfahrungen eine Form zu geben,14 die Identitätskonstruktionen und kulturelle Neupositionierungen überhaupt erst ermöglichen (vgl. Welzer 2011) und im Kontext von Migration eine besonders wichtige Rolle spielen. Emotionen haben dabei die essenzielle Funktion, Aufmerksamkeit zu verstärken und Erinnerungen zu stabilisieren (vgl. Assmann: www.bpb.de, Stand: 02.10.2021).
Die hier untersuchten Äußerungen lassen sich dabei verschiedenen Dimensionen zuordnen, die von den Autor/innen in besonderer Weise fokussiert werden. Die erste umfasst die Erinnerungen an die Kindheit und Adoleszenz, an die Spracherfahrungen in mehrsprachiger Umgebung und die damit einhergehenden Prozesse sprachlicher Identifizierung. Eine zweite Dimension betrifft die Erinnerung an kulturelle Ausdrucksformen der Herkunftsgesellschaft, die auf den gegenwärtigen Schreibprozess bezogen werden. Eine dritte Dimension bezieht sich auf die Auswirkungen eines „kollektiven Gedächtnisses“ (Erll 2017: 5) und des damit verbundenen, für den Schreibprozess relevanten, Erinnerungspotentials bestimmter Orte. Schließlich wird in einer vierten Dimension die Reaktivierung von Lebenserfahrungen in der Herkunftskultur und die Vergegenwärtigung mehrsprachiger Identität im Zusammenhang mit der Entstehung eines interkulturellen Gedächtnisses reflektiert. Besondere Beachtung im Hinblick auf das Erinnerungsvermögen verdient schließlich der Aspekt der Koexistenz mehrerer Sprachen (vgl. Hassoun 2003; Brizić 2007), genauer gesagt, wie die Sprachen eines Subjekts interagieren, in welchem Umfang erworbene Sprachen auch in anderskulturellen Umgebungen fortbestehen und welche Auswirkungen das auf die kreativen Schreibprozesse mehrsprachiger Autor/innen haben kann (vgl. Kap. 4).
Eine eher negative Schreibdisposition geht insbesondere aus den Reflexionen exilierter Autor/innen hervor, die über einen langen Zeitraum nicht an eine Rückkehr in ihre Herkunftsländer denken konnten. Ihr Schreibprozess in der (fremden) Literatursprache verläuft nicht reibungslos, und eine Reihe innerer Konflikte bei der Auseinandersetzung um das Problem der sprachlichen Identität sind zu erkennen. Dabei wird auch bezweifelt, ob die Qualität ästhetischer Gestaltung ausreicht, um den intendierten Mitteilungs- und Wirkungsabsichten zu genügen (vgl. Kap. 5). Die bereits in den frühen Grundlagentexten der psychoanalytischen Mehrsprachigkeitsforschung genannten Dynamiken des Unbewussten, die dort als Bedingungsfaktoren für den Fremdsprachenerwerb und generell das Spracherleben mehrsprachiger Individuen gelten, werden bis heute breit rezipiert (vgl. Kilchmann 2019) und bieten auch für die vorliegende Untersuchung einige zielführende Denkanstöße, insofern sie in Zusammenhang mit einer inneren Disposition des Zweifelns und des Empfindens von Widerständen gebracht werden können. Darüber hinaus thematisieren Autor/innen sowohl in sprachtheoretischen Texten als auch in Reflexionen zu ihren Schreiberfahrungen die Eigenständigkeit von Sprache, die Bedeutungserschließungen und das Festlegen von Bedeutung grundsätzlich verhindert (vgl. Lacan 2017). Die dadurch verbleibende ‚Restfremde‘ entzieht sich dem individuellen Zugriff und kann bestenfalls als Chance für immer wieder neue Selbstentwürfe aufgefasst werden.
Eine weitere Erschwernis, mit denen mehrsprachige Autor/innen sich auseinandersetzen müssen, die ihre Fremdsprache Deutsch als Literatursprache gewählt haben, ist die oft von Vorurteilen behaftete negative Einschätzung ihres Ausdrucksvermögens. Diese äußert sich beispielsweise in Sprachkorrekturen ‚professioneller‘ Leser/innen während der redaktionellen Arbeit an ihren Texten und werden, die von den Autor/innen oft als unrechtmäßig und limitierend empfunden werden (vgl. Kap. 6).
Im Unterschied zu diesem eher negativen Erfahrungshorizont heben viele Autor/innen jedoch eine grundsätzlich konstruktive Haltung hervor. Diese Disposition desS i c h - F r e i s c h r e i b e n s(vgl. Kap. 7) führt dazu, dass das ‚Terrain‘ der Fremdsprache als ein Raum empfunden wird, der ‚Schreibbewegungen‘ aus einer als befreiend empfundenen Distanz zur Herkunftssprache ermöglicht. Aufschlussreiche Erklärungsansätze dazu bietet – auch aus historischer Perspektive – die psychoanalytische Mehrsprachigkeitsforschung (vgl. Amati Mehler et al. 2003), die auf die Möglichkeiten enttabuisierter Sprachverwendung im Hinblick auf das Ausdruckspotential in einer Fremdsprache hinweisen. Die Möglichkeiten und Grenzen eines ‚befreiten‘ Umgangs mit der Fremdsprache und der Entfaltung eines literarischen Profils in ihr hängen auch ganz wesentlich mit der emotionalen Bindung an Herkunfts- und Fremdsprache zusammen. Unter Einbezug grundlegender Forschungsarbeiten zum multilingual writing (vgl. Pavlenko 2014) kann einigen Selbstäußerungen mehrsprachiger Autor/innen ergänzend dazu entnommen werden, dass ihnen eine positive emotionale Annäherung an das Deutsche gelingt, und sie sich damit einen neuen kreativen Freiraum schaffen können.
Relevante und für diese Studie äußerst zielführende Erkenntnisse können aus unterschiedlichen Konzeptionen und Forschungsergebnissen im Zusammenhang mit dem vielschichtigen Problem der Identität gewonnen werden (vgl. Keupp u.a. 2008; Straub 2019a). Die Auffassung, dass es sich bei der Konstruktion von Identität um einen offenen, lebenslangen Prozess handelt und diese selbst pluralisch zu verstehen ist, da SubjekteT e i l i d e n t i t ä t e nbilden, die verschiedenen Rollen und Funktionen entsprechen und dass in diesem Prozess die narrative Rekonfiguration biographischer Daten wesentlich ist, wird zu den verschiedenen Formen von Selbstäußerungen der Autor/innen in Bezug gesetzt. Die Reflexionen, in denen sie sich mit ihrer Sprachlichkeit im Zusammenhang mit der Identitätskonstruktion befassen und sich selbst mit und in ihren Sprachen positionieren, sind äußerst aussagekräftig und werfen ein Licht auf das Bewusstsein, das sie insbesondere im Hinblick auf ihre Sprachidentität entwickeln (vgl. Kap. 8).
Eng damit verbunden ist die Frage nach der Funktion, die Emotionen im Prozess der Identitätskonstruktion spielen, anders ausgedrückt, wie Subjekte ihre Sprachen erleben, zu welcher Sprache sie sich emotional stärker hingezogen fühlen, in welcher Sprache sie ihre Emotionalität am ehesten ausdrücken können und dergleichen mehr (vgl. Pavlenko 2005 und 2014). Besonders Textpassagen, in denen Autor/innen im autobiographischen Rückbezug ihre Mehrsprachigkeitserfahrungen narrativ entfalten, bieten interessante Einblicke in den emotionalen Bezug, den sie zu Herkunfts- und Fremdsprache entwickeln (vgl. Kap. 9).
Des Weiteren geht aus vielen Texten erstens hervor, dass die Autor/innen ein besonderes metasprachliches Bewusstsein in Bezug auf ihr Sprachrepertoire (Busch 2021) entwickeln, d.h. darüber, welche Sprachen und Varietäten ihnen in welchem Umfang zur Verfügung stehen. Zweitens wird deutlich, dass sie dieses als eine Ressource für die narrative und/oder reflexive Rekonstruktion ihrer Teilidentitäten im Prozess des Schreibens auffassen, was sie u.a. darin unterstützt, signifikante, lebensgeschichtliche Diskontinuitäten zu überbrücken (vgl. Kap. 10).
Am Schluss dieser Studie steht die Auseinandersetzung mit der literarischen Kreativität im Zentrum. Es wird der Frage nachgegangen, in welcher Form mehrsprachige Autor/innen sich in ihrer Literatursprache Deutsch verorten, genauer gesagt, wie sie die Gestaltung diesesS p r a c h r a u m srückblickend bewerten und/oder in Zukunft vornehmen möchten, welche Wirkungsabsichten sie mit ihrer Literatur verfolgen und in welcher Weise sie dabei Bezugnahmen auf außersprachliche, soziokulturelle Kontexte reflektieren (vgl. Kap. 11).
1Vergleiche dazu die kritische Erörterung von Rothenbühler (2010: 53f.). Im Rahmen des Projekts „Generationen im Wandel“ werden 16 in der Schweiz lebende Autor/innen anderskultureller Provenienz zu ihren Migrationserfahrungen und ihrem literarischen Schaffen befragt: „Was sie in literarischer Hinsicht vereinigt, sind nicht mögliche Merkmale einer ‚Migrationsliteratur‘, sondern die einhellige Ablehnung dieses Konzepts. […] ‚Ich gebe gerne Auskunft über mein Leben, wenn das jemand aus irgendwelchen Gründen interessiert‘, sagt zum Beispiel Christina Viragh, fügt jedoch gleich einschränkend an ‚Ich hab’s nicht gern, wenn man mich als Schriftstellerin in eine bestimmte Ecke stellt, nicht, so: Ich bin die Emigrantin.‘ Und Rafik Ben Salah versichert, er habe sich nie als Migranten oder Immigranten gesehen: ‚Ich dachte mich als Schriftsteller. Punkt. […].“ Vgl. dazu auch Spoerri (2010: 37): „Neben der Literaturproduktion findet, eng mit ihr verflochten, der gesellschaftliche Diskurs über Literatur statt, der Autorinnen und Autoren mit Migrationshintergrund immer wieder vereinnahmt beziehungsweise ausgegrenzt hat – doch an diesen Diskussionen haben sich die Betroffenen oft auch stark selbst beteiligt, mit unterschiedlichen Haltungen: um entweder ihre Sonderposition zu bestärken oder um sich gegen eine ihnen unangenehme Sonderbehandlung zur Wehr zu setzen.“
2Auch in den zehn Autorenporträts, die von den beiden Literaturwissenschaftlern Chiellino und Lengl im Jahrbuch für Internationale Germanistik (2016) herausgegeben werden, spielt die Biographie der Autor/innen, als Verschränkung von Leben und literarischem Schreiben, eine große Rolle. In seinem kurzen Überblick zur Entwicklung der interkulturellen Literatur führt Chiellino zudem die Sprache bzw. den Sprachwechsel als mögliches Signum einer neuen Autor/innengeneration ins Feld, bei der im Vergleich zu früher, „die Breite und Intensität vom Auftreten des Sprachwechsels“ auffällig sei (Chiellino/Lengl 2016: 21).
3Im Verlauf dieser Studie werde ich dabei häufig längere Passagen zitieren, einmal, um eine etwas bessere Kontextualisierung zu ermöglichen, zum anderen aber auch, um das individuelle Schreibprofil der Autor/innen in zwar kurzen, aber dennoch aussagekräftigen Ausschnitten illustrieren zu können.
4Dass einige der Autor/innen, wie u.a. Yüksel Pazarkaya und Yoko Tawada auch in ihrer Herkunftssprache publizieren, ist für die vorliegende Studie von untergeordneter Bedeutung.
5Sprachwissenschaftlich ggf. relevante Vergleichsdaten wie etwa Informationen zur sprachlichen Erstsozialisation in der jeweiligen Herkunftsgesellschaft der Autor/innen, können in die vorliegende Untersuchung nicht miteinbezogen werden, da zu den sozialen, affektiven und spracherzieherischen Faktoren ihres Sozialisationsprozesses in der Erstsprache keine ausreichenden Informationen vorhanden sind. Auch wenn darüber hinaus die Selbstaussagen der Autor/innen zu ihren Erfahrungen von Mehrsprachigkeit nicht in enger Verzahnung mit weiterem biographischem Quellenmaterial interpretiert werden können, wie dies etwa Pavlenko (2014: Kap. 7) bei der Beschreibung von Marc Chagalls literarischen Schreibversuchen unternimmt, wird diese Engführung der Perspektive billigend in Kauf genommen und in Bezug auf die Erkenntnisinteressen dieser Studie nicht als Defizit gewertet.
6Vergleiche dazu die Bestandsaufnahme von Tophinke (2002) zu den Anlässen und Formen sprachbiographischer Rekonstruktion, in denen sie ausführt, dass diese sowohl mündlich als auch schriftlich realisiert werden könne und an „keine spezifische textuelle Form“ gebunden sei. Dazu zählten etwa „längere narrative Texte […], deren zentrales Thema die eigene Sprachbiografie oder die einer anderen Person ist. […] Hinzuzurechnen seien auch „kürzere Textsequenzen […], die das Verhältnis und die Einstellungen zur Sprache, den Sprach- und Schrifterwerb, Sprachkompetenzen usw. zum Thema machen. […] Auch in literarischen und semiliterarischen Arbeiten, in denen Lebensbeschreibungen erfolgen, spielen Bindungen an Sprachen nicht selten eine Rolle und wird damit Sprachbiografie – indirekt – behandelt“ (Tophinke 2002: 8). Dies kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass sog. „interkulturelle Autobiographien“ von der etablierten Spracherwerbsforschung in vielen Fällen nicht akzeptiert werden, „weil qualitative Ansätze als nicht objektiv verpönt sind“ (Jessner 2007: 28). Demgegenüber steht jedoch in sprachwissenschaftlichen Untersuchungen der letzten Jahre gerade die Subjektivität mehrsprachiger Individuen, d.h. wie die Mehrsprachigkeit von den Betreffenden selbst dargestellt wird, im Zentrum des Interesses. Dies besonders im Hinblick auf Prozesse des Zweitspracherwerbs (vgl. exemplarisch Kramsch 2012) sowie der sprachlichen Identitätskonstruktion (vgl. exemplarisch Busch 2021).
7Vergleiche dazu auch die Ausführungen von Straub (2019d: 143f.), der autobiographischen Rückblicken, die narrativ vermittelt werden, aus Sicht der narrativen Psychologie und der Migrationsforschung, einen „unschätzbare[n] wissenschaftliche[n] Wert“ zuspricht. Dies gilt besonders für die narrative Vermittlung kontaktkultureller Erfahrungsdimensionen im Verlauf „migratorische[r] Existenz, da diese „von massiven Verlusterfahrungen, Anpassungsdruck und Entwicklungsherausforderungen, kurz: von oktroyierten Identitätsformationen“ geprägt ist. Am Beispiel des auch in vielen anderen Untersuchungen immer wieder gerne zitierten autobiographischen Textes „Lost in Translation. A Life in a New Language“ (1989) von Eva Hoffman, zeigt er auf, in welcher Weise hier signifikante „psychosoziale Phänomene“ narrativ vermittelt werden.
8Vergleiche dazu die Definition von Chiellino, der davon ausgeht, dass „interkulturelle Autoren“ häufig einen „dreisprachigen Lebenslauf “ haben können, so dass man unter dem Begriff der Herkunftssprache ein „differenzierendes Synonym von Geburts- und Muttersprache“ verstehen müsse (Chiellino 2016: 93).
9Vergleiche dazu auch die Ausführungen von Kremnitz (2015: 28ff.), der die Bedeutung vonB i l d u n g s s p r a c h e n,„in denen Sprecher ihr vor allem schriftliches kulturelles Wissen erwerben“ und die besondere „psychologische oder symbolische Bedeutung“ hervorhebt, für mehrsprachige Autor/innen wie Ilma Rakusa und Moses Rosenkranz haben kann.
10„dass die Sprache zusammen mit der Muttermilch an der Mutterbrust ‚aufgenommen‘ und erlernt wird“ (Übersetzung von Klaus Laermann 2010: 136, im Folgenden KL).
11„weil sich die erste Beziehung schon von Anfang an in mehreren Sprachen entwickeln kann. Wenn wir Dialekte, Slang und familiäre Redeweisen ebenso wie offiziell kodifizierte Sprachen in Rechnung stellen, dann wächst in der Tat jedes Kind mit mehreren Sprachen auf. Doch in der frühesten Entwicklung ist die Beziehung zur Mutter undifferenziert und umfasst mithin auch andere Beziehungen, die sie überlappen, beispielsweise die zum Vater und zu den Großeltern (Amati Mehler et al. 2010: 153, KL: 153).
12Vergleiche dazu etwa die Äußerungen von José F.A. Oliver in Kap. 3.1.
13Unter Disposition verstehe ich generell „die Fähigkeit und Bereitschaft einer Person, best. Gedanken und Gefühle zu erleben, best. Leistungen zu erbringen und best. Verhaltensweisen zu äußern“ (Wirtz online, Stand: 13.02.2021).
14Konkretisierungen von Gedächtnisspuren in den literarischen Texten werden teilweise als Einschreibungen der jeweiligen Herkunftssprache begriffen, die auf das sog. Interkulturelle Gedächtnis mehrsprachiger Autor/innen hinweisen könnten (vgl. Chiellino 2001d und 2002).
2Innovative Synthesen:15 ein Prolog
Der vorliegenden Studie, die sich mit den vielschichtigen und ambivalenten Erfahrungen mehrsprachiger Autor/innen, die das Deutsche als ihre Literatursprache gewählt haben, befasst, möchte ich einige Gedanken aus dem von Kristeva 1988 erstmals publizierten Text „Etrangers à nous-mêmes“ voranstellen, da sie besonders eindrücklich und wegweisend Kernprobleme dieser besonderen Erfahrungsdimension der Mehrsprachigkeit zum Ausdruck bringen.
Kristeva betont, dass die Entscheidung, Sprache zu formen, zu gestalten, sie zum Instrument des individuellen Schreibprozesses zu machen, sich in und mit ihr auszudrücken besonders dann ein mutiger Schritt ist, wenn es sich dabei um eine Fremdsprache handelt. Die Bindungen an die Herkunft und die Herkunftssprache rücken zunächst in den Hintergrund. Als durchaus auch schmerzhafte Selbstentfremdung verschafft die neue Sprache, dennoch jene „distance exquise, où s’amorce aussi bien le plaisir pervers que ma possibilité d’imaginer et de penser, l’impulsion de ma culture“ (1988: 25).16 Als Akt der Selbstbefreiung von den Zwängen der Muttersprache (Kristeva 1988: 48), sich keiner Kultur mehr zugehörig fühlend, erlebt derF r e m d eeine besondere Dimension vonS p r a c h b e f r e i u n g. Als Mensch, der in seiner Herkunftssprache den Zwängen gesellschaftlicher Normierung und familiärer Tabuisierung erlegen war, betritt er in der Fremdsprache neues Terrain:
Telle personne qui osait à peine parler en public et tenait des propos embarrassée dans sa langue maternelle se retrouve dans l’autre langue un interlocuteur intrépide. L’apprentissage de nouveaux domaines abstraits se révèle d’une légèreté inouïe, les mots érotiques sur lesquels pesait l’interdit familial ne font plus peur17 (Kristeva 1988: 49).
Kristeva bezeichnet die neu erlernte Sprache jedoch als eine künstliche, eine Art Algebra oder musikalische Übung, die sich nicht in gleicher Weise wie die Herkunftssprache in den Körper und das Gedächtnis eingeschrieben hat. Nur ein Genie oder ein Künstler ist in der Lage, etwas anderes als künstliche Redundanzen zu erzeugen und Innovatives in ihr zu entwickeln. Nur allzu oft kreisen die neuerlernten sprachlichen Konstruktionen desF r e m d e num sich selbst, ins Leere, „dissociées de son corps et de ses passions, laissées en otages à la langue maternelle“18 (Kristeva 1988: 49). Er weiß in dieser Hinsicht nicht, was er sagt und seine Rede ruft in ihm keinerlei Irritationen oder Widerwillen hervor, „tant son inconscient se protège de l’autre côté de la frottiere“.19 In ihrem Essay „Le silence des polyglottes“ (Kristeva 1988: 26–29) beschreibt sie bildhaft das Agieren in einer fremden Sprache als einen Zustand, in dem man radikal von der Kindheit abgeschnitten ist. Man trägt die Herkunftssprache in sich wie „un caveau secret ou comme un enfant handicapé – chéri et inutile – ce langage d’autrefois qui se fane sans jamais vous quitter“20 (Kristeva 1988: 27). Um diese Spaltung zu überwinden, muss eine innere Sammlung und Konzentration stattfinden können, wofür beispielsweise Künstler bzw. Schriftsteller, wie ich hinzufügen möchte, prädestiniert sind. Das Selbst muss intensiv erforscht und dem Gedächtnis sowie dem Körper nachgespürt werden, um Ursprüngliches und neu Erworbenes zu einer jenen „synthèses mobiles et novatrices“21 (Kristeva 1988: 49f.) zu verschweißen.
Im Anschluss an die hier skizzierten Überlegungen möchte ich folgende Leitfragen formulieren: In welcher Weise reflektieren die hier untersuchten mehrsprachigen Autor/inneni n n o v a t i v eS y n t h e s e nin Bezug auf ihr literarisches Schaffen und welche Strategien entwickeln sie, um Vergangenes und Gegenwärtiges miteinander zu verschmelzen, die Spaltung von ihrer Erstsprache zu überwinden und damit gleichsam sich ihre sprachlichen Wurzeln im Prozess des Schreibens zu vergegenwärtigen?
15Vergleiche Anm. 21.
16„erlesene Distanz, aus der sowohl die perverse Lust als auch meine Möglichkeit zu imaginieren und zu denken erwachsen, der Impuls meiner Kultur“ (Übersetzung von Xenia Rajewsky, 1990; im Folgenden XR).
17„Diese Person, die in der Öffentlichkeit kaum zu sprechen wagte und sich in ihrer Muttersprache nur verlegen und wirr äußerte, entpuppt sich in der neu angeeigneten Sprache als unerschrockener Gesprächspartner. Neue abstrakte Bereiche werden mit unerhörter Leichtigkeit erlernt, erotische Wörter und Wendungen, auf denen früher das familiale Verbot lastete, machen keine Angst mehr“ (XR: 41).
18„getrennt von seinem Körper und seinen Leidenschaften, die Geiseln der Muttersprache geblieben sind“ (XR: 41).
19„denn sein Unbewusstes verbirgt sich auf der anderen Seite der Grenze“ (XR: 41).
20





























