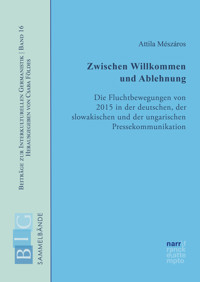
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Beiträge zur Interkulturellen Germanistik
- Sprache: Deutsch
Die Fluchtbewegungen von 2015 haben EU-weit einen neuen öffentlichen Diskurs über die Migration ausgelöst. Dabei geht es um ein breites Spektrum von verschiedenen Standpunkten der einzelnen Länder, die einen breiten Bogen zwischen Akzeptanz und Ablehnung darstellen, was sich u.a. durch den häufigen Gebrauch von sehr unterschiedlichen Schlagwörtern und Argumentationsmustern zeigt. Das Novum dieses Bandes besteht darin, dass ein politisch brisantes Thema einer vergleichenden linguistischen Analyse des sog. Migrationsdiskurses am Beispiel der deutschen, der slowakischen und der ungarischen Pressekommunikation präsentiert wird. Vor dem Hintergrund eines Mehrebenen-Analysemodells wird ein Blick in diskursspezifische Phänomene von der Mikroebene (Wort- und Toposanalyse) bis zur Makroebene (Akteure, Topoi) geboten. Das Werk liefert somit einen wertvollen Beitrag zum sich etablierenden Fachbereich der kontrastiven Diskursanalyse.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 480
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Attila Mészáros
Zwischen Willkommen und Ablehnung
Die Fluchtbewegungen von 2015 in der deutschen, der slowakischen und der ungarischen Pressekommunikation
DOI: https://doi.org/10.24053/9783381120826
© 2024 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
ISSN 2190-3425
ISBN 978-3-381-12081-9 (Print)
ISBN 978-3-381-12083-3 (ePub)
Inhalt
Vorwort
Vorliegendes Buch stellt eine überarbeitete Version meiner ursprünglichen Habilitationsarbeit dar. Die Entstehung dieser Publikation ist in großem Maße dem Zusammenspiel mehrerer günstiger Faktoren zu verdanken, die mein berufliches und privates Leben in den letzten Jahren bestimmt haben. Die Idee selbst, die Flüchtlingskrise von 2015 zum Gegenstand einer diskurslinguistisch orientierten Untersuchung in einem sprachkontrastiven Kontext zu machen, wurde durch einen Vortrag von Herrn Prof. Thomas Niehr an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg motiviert, den ich während meines von der Hermann-Niermann-Stiftung geförderten Forschungsaufenthalts (Studienbörse Germanistik) 2015-2016 absolviert habe. Während die Recherche der einschlägigen Fachliteratur und das Sammeln des sprachlichen Materials für die Erstellung der Korpora in Würzburg erfolgte, fand die Erarbeitung der theoretischen Grundlagen der Arbeit sowie die empirische Analyse des deutschsprachigen Materials im Rahmen eines weiteren Forschungsaufenthaltes (gefördert durch den KAAD, 2017-2018) an der Universität Erfurt statt. Das Habilitationsprojekt wurde schließlich Ende 2021 abgeschlossen, nachdem auch die slowakischen und die ungarischen Teilkorpora bearbeitet und die entsprechenden empirischen Analysen durchgeführt worden sind. Die Anfang 2020 ausgebrochene Coronavirus-Pandemie hat die Arbeit zwar verlangsamt, aber die inzwischen vergangene Zeit bot auch die Möglichkeit, neue Tools kennenzulernen, mit deren Hilfe sich aus den Untersuchungskorpora noch mehr Daten extrahieren und auf innovative Weise veranschaulichen lassen.
Es gibt zahlreiche Personen, Institutionen und Unternehmen, denen ich zu Dank verpflichtet bin. Ich möchte mich an dieser Stelle beim Herrn Univ.-Prof. Dr. Dr. Csaba Földes, dem Leiter des Lehrstuhls für Germanistische Sprachwissenschaft der Universität Erfurt, für seine Betreuung und umfassende Unterstützung im Laufe meiner bisherigen professionellen Laufbahn und insbesondere während meines Habilitationsprojektes bedanken. Ganz herzlich danke ich ihm zugleich für die Aufnahme meiner wissenschaftlichen Arbeit in die BIG-Buchreihe beim Narr Francke Attempto Verlag. Mein Dank gilt auch Frau Prof. Dr. Elisabeth Knipf-Komlósi und Frau Prof. Dr. Erzsébet Drahota-Szabó für ihre Anregungen und kritischen Anmerkungen in den einzelnen Entstehungsphasen der Arbeit sowie Frau Dr. Monika Riedel, die mich durch ihre wertvollen Vorschläge und Anweisungen bei der Korrektur unterstützt hat. Meinen ehemaligen Hochschullehrern, Herrn PhDr. Roman Trošok, CSc. und Frau doc. PaedDr. Oľga Wrede, PhD., zwei bedeutenden Vertretern der Nitraer Germanistik, bin ich besonders dankbar, dass sie mich sowohl während meines Studiums als auch im Laufe meiner weiteren akademischen Laufbahn ermutigt und mir vertraut haben.
Den Gutachtern der Habilitationsschrift, Prof. Dr. Torsten Roelcke und Prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD., danke ich für die verschiedenen Anregungen und Hinweise.
Meine verschiedenen Ansprechpartner bei der Süddeutschen Zeitung und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung haben einen enormen Beitrag zu meiner Arbeit geleistet, indem sie durch den freien Zugang zu ihren Online-Archiven die Erstellung der deutschen Textkorpora in erheblichem Maße vereinfacht haben.
Dankbar bin ich der Leitung der J.-Selye-Universität in Komárno in der Slowakei bzw. deren Pädagogischen Fakultät für die Möglichkeit, meine ausländischen Forschungsaufenthalte unter optimalen Bedingungen zu absolvieren, sowie meinen jetzigen und früheren Kollegen und Kolleginnen bzw. meinen Studierenden, die mich stets motiviert und inspiriert haben. Herr Prof. Waldemar Czachur und Herr Prof. Philipp Dreesen haben meine Untersuchungen durch ihre bahnbrechende Arbeit auf dem Gebiet der kontrastiven Diskurslinguistik und durch meine Einbindung in ihre laufenden Projekte ausschlaggebend beeinflusst und in die korrekte Richtung gelenkt. Frau Dr. Renáta Péter-Szabó, Frau Judith Freier, M. A. und Herr PD Dr. Markus Hartmann haben mich während meines Aufenthalts an der Universität Erfurt tatkräftig unterstützt.
Nicht zuletzt möchte ich mich an dieser Stelle herzlich bei meinen Eltern und allen Freunden und Bekannten bedanken, die mich in dieser wichtigen Phase meines Lebens auf vielfältige Weise unterstützt haben. Der größte Dank geht jedoch an meine Frau und meine Kinder für ihre unendliche Geduld und ihr Verständnis. Ohne diese wäre die Idee meiner Habilitation nie zur Realität geworden.
September 2024 Attila Mészáros
1Einleitung
Als der Begriff Flüchtlinge Ende 2015 zum Wort des Jahres gekürt wurde, wählte die Gesellschaft für deutsche Sprache nicht einfach ein Substantiv, das das politisch-gesellschaftliche Geschehen und zugleich auch den öffentlichen Diskurs das ganze Jahr über weltweit dominierte. Die Entscheidung der Jury generierte rasch eine weitere Debatte zu möglichen Alternativbezeichnungen. Denn das Wort ist auch „sprachlich interessant“, kann aber „für sprachsensible Ohren […] abschätzig“ klingen (GFDS 2015). Trotz kritischer Stimmen stellte diese Diskussion nur die Spitze des Eisbergs dar, die reale Lösungen für das eigentliche Problem kaum liefern konnte. Die Folgen dieses als Flüchtlingskrise bezeichneten Phänomens wurden hingegen für die Mehrheit der europäischen Länder und deren Bevölkerung in kürzester Zeit auch unmittelbar, z. B. durch die erneut eingeführten Kontrollen an EU-Binnengrenzen oder durch die tumultartigen Ereignisse etwa in Aufnahmeeinrichtungen und Bahnhöfen, sichtbar geworden. Obgleich nur ein Bruchteil der heimischen Bevölkerung(en) einen direkten Kontakt zu Flüchtlingen hatte, schien das Thema dank der medialen Berichterstattung rasch zu einem brisanten ‚Problem‘ in Europa geworden zu sein.
Die sog. Flüchtlingskrise bietet somit ein ausgezeichnetes Material, die durch den Bürgerkrieg in Syrien ausgelöste und in der Öffentlichkeit sehr kontrovers bewertete Ereigniskette, in einem Gewebe von Höhe- und Tiefpunkten adressatengerecht, in Form von maßgeschneiderten Inhalten zu präsentieren und dadurch nicht nur einen öffentlichen Diskurs um Migration und Einwanderung, sondern eventuell auch politische Entscheidungen zu provozieren. Ein Beispiel dafür liefert das Foto des ertrunkenen Alan Kurdi vom 2. September 2015. In diesem einzigen Bild erscheint komprimiert das Elend der Flüchtlinge, insbesondere der am meisten betroffenen Gruppe der Kinder. Dementsprechend löste die Veröffentlichung des Fotos eine Diskussion aus, inwieweit die Medien Bilder des Krieges veröffentlichen und dadurch den Diskurs beeinflussen dürften.
Es sind natürlich nicht nur Bild- und Videoaufnahmen oder statistische Angaben, die Informationen über den Krieg in Syrien und dessen Folgen vermittelten. Das primäre Instrument der Erkenntnis ist weiterhin die Sprache (vgl. FELDER 2013: 19), die als wissensstiftendes Medium grundlegend bestimmt, wie man die Welt wahrnimmt und darüber Fakten herstellt. Auf dieser Basis ließe sich zugleich fragen, ob das Phänomen Migration und Flucht über die deutsche und die ungarische Sprache ähnlich vermittelt wird. Liest man einen Artikel über den ungarisch-serbischen Grenzzaun, werden dann bei der deutschen wie bei der ungarischen Leserschaft die gleichen Wissensbestände aktiviert? Wird der Begriff Multikulturalismus in Ungarn gleich konzeptualisiert, wie in Deutschland oder der Slowakei? Was weiß man überhaupt über Migration und Flucht in den drei Ländern? Was macht eigentlich dieses Phänomen aus? Diese Fragen weisen auf die gesellschaftspolitischen Implikationen hin, deren Reichweite jedoch weit über die Rahmen einer diskurslinguistisch orientierten Abhandlung hinausgeht.
Dass das Thema Flucht für sprachwissenschaftliche Untersuchungen einen interessanten und vielseitigen Forschungsgegenstand darstellt, wird auch durch die stets wachsende Anzahl von Arbeiten, die den Asyldiskurs unter den unterschiedlichsten Aspekten thematisieren, bestätigt (vgl. Kap. 2.7). Es steht außer Zweifel, dass das Phänomen Migration und Flucht und dessen Erforschung nach einer stark interdisziplinär orientierten Perspektive verlangt. Hierzu zählen neben den soziologischen, historischen, ökonomischen und politischen Aspekten auch die Möglichkeiten und Herausforderungen, die die Migration z. B. für die Sprachwissenschaft sowie für weitere interdisziplinär und -kulturell ausgerichtete Disziplinen bedeutet. Darüber hinaus muss auch berücksichtigt werden, dass es sich um ein Phänomen handelt, das Europa als Ganzes betrifft und so zugleich einen transnationalen Diskurs generiert. Obwohl einige Aspekte nur auf lokaler Ebene relevant sind,1 verläuft der Hauptstrang des Diskurses europaweit, in erster Linie auf der Ebene der EU-Länder und -Institutionen. Besonders interessant zeigt sich hier, wie die Kernproblematik in unterschiedlichen Regionen Europas durch die Lupe einzelner Sprachen wahrgenommen und verarbeitet wird. Die oben angesprochene interdisziplinäre und mehrsprachige Beobachtung gilt daher als Voraussetzung jener Multiperspektivität, die es erst überhaupt ermöglicht, dieses vielseitige Phänomen in ihrer Komplexität zu beschreiben und zu verstehen.
Die vorliegende Arbeit fragt grundsätzlich danach, wie die Fluchtbewegungen von 2015 in drei unterschiedlichen Sprach- und Kulturgemeinschaften diskursiv verarbeitet werden. Ihr Ziel ist es, durch die Kontrastierung des sog. Flüchtlingsdiskurses in Deutschland, Ungarn und in der Slowakei Ähnlichkeiten und Unterschiede im öffentlichen Sprachgebrauch in den einzelnen Ländern aufzuzeigen. Mein Forschungsinteresse gilt in erster Linie der Frage, wie über dieses Phänomen diskursive Weltbilder in der jeweiligen Sprach- und Kulturgemeinschaft konstruiert, ausgehandelt und distribuiert werden. WARNKE (vgl. 2009: 115) betrachtet diese als Stationen der Wissenskonstituierung, die bei der Teilnahme spezifischer diskursiver Strategien die Herstellung von diskursiven Weltbildern erzielt.
CZACHUR (vgl. 2013a: 186ff.) bezeichnet diesen Prozess als Profilierung, d. h. als jenes Verfahren, in dem vorhandene Wissensbestände aktualisiert, miteinander verknüpft und ergänzt werden, neues Wissen generiert und dieses in größere und kollektiv verfügbare Netze integriert wird.2
Das Buch gliedert sich in zehn Kapitel. Nach einer Einführung in die Problematik werden im Kapitel 2 die grundlegenden Begriffe bestimmt und es wird auf die Beziehung von Sprache und Wissen eingegangen. Vor diesem Hintergrund werden die Forschungsfragen formuliert und die Hypothesen gebildet.
Eine Diskursanalyse versteht sich als ein Prozess, in dem Diskurse als Phänomene untersucht werden, die im öffentlichen Sprachgebrauch bei einem komplexen Zusammenspiel von manchen diskurskonstituierenden Größen zustande kommen. Sie erfordert daher die Erarbeitung eines umfassenden diskurslinguistisch ausgerichteten theoretischen Rahmens mit besonderem Blick auf den Kommunikationsbereich Politik, was im Kapitel 3 erfolgt.
Erweitert wird diese theoretische Basis um die kontrastive Perspektive, deren Grundzüge im Kapitel 4 erarbeitet werden. Ebenso wird hier auf die methodischen Fragen einer kontrastiven Diskursanalyse eingegangen.
Kapitel 5 und 6 sind dem Forschungsdesign und den methodischen Fragen der empirischen Analyse gewidmet. Im Kapitel 5 wird das Modell der sog. Diskurslinguistischen Mehr-Ebenen-Analyse (DIMEAN) dargestellt, das sich in der germanistischen Diskurslinguistik bereits als gut anwendbares Forschungsinstrument etablierte. Davon ausgehend werden hier die einzelnen Ebenen beschrieben, die bei der Analyse im Fokus stehen. Im Kapitel 6 werden hingegen die Schritte des Korpusbaus sowie die einzelnen Verfahren beschrieben, die im Falle der einzelnen Teilkorpora in jeder untersuchten Sprache wiederholt durchgeführt wurden.
Die Kapitel 7 bis 9 enthalten die empirischen Analysen des deutschen, des slowakischen und des ungarischen Diskurses. In den einzelnen Kapiteln wird vorerst jeweils eine Akteursanalyse durchgeführt, die die Grundlage für die anschließende Diskursnetzwerkanalyse und die Argumentationsanalyse bildet. Hierbei werden die zentralen Topoi ermittelt, die den jeweiligen Diskurs dominieren und somit den Charakter der einzelnen Nationaldiskurse bestimmen. Bei den wortorientierten Analysen wird jeweils auf die lexikalische Ebene eingegangen. Im Fokus stehen dabei die Schlüsselwörter wie Flüchtling und Asyl bzw. deren slowakischen und ungarischen Entsprechungen, die jeweils in Bezug auf deren Wortbildungspotenzial, Partnerwörter u.ä. näher beschrieben werden.
Im Sinne des gewählten vergleichenden Verfahrens erfolgt die Kontrastierung der drei Diskurse im Kapitel 10. Die in den vorangehenden Kapiteln jeweils sprachspezifisch ermittelten Ergebnisse werden hier gegenübergestellt und die Ähnlichkeiten und Unterschiede werden aufgezeigt bzw. interpretiert. Neben der Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse werden im Fazit weitere Möglichkeiten skizziert, die das hier bearbeitete Thema für weiterführende Untersuchungen bieten kann.
2Sprache und Wissen
2.1Begriffsbestimmungen
Im Sinne einer Annäherung an den hier thematisierten Diskurs werden zunächst die Begriffe erörtert, die für die Untersuchung zentral sind. Eine solche Begriffspräzisierung erscheint schon angesichts des öffentlichen Sprachgebrauchs, in dem die konkurrierenden Ausdrücke Flüchtling, Asylant, Migrant oder auch Geflüchteter sowohl bei den Journalisten als auch beim Publikum für große Verwirrung sorgen, wichtig.
Migration
Der Begriff Migration stammt aus dem lateinischen Wort migrare bzw. migratio, was im Deutschen wandern, wegziehen bedeutet. Im Migrationsbericht 2011 des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge wird es wie folgt definiert:
Von Migration spricht man, wenn eine Person ihren Lebensmittelpunkt räumlich verlegt. Von internationaler Migration spricht man dann, wenn dies über Staatsgrenzen hinweg geschieht. (INNERN 2013: 12)
Vereinfacht sind also unter Migration „geografisch-räumliche Bewegungen von Personen bzw. Personengruppen“ zu verstehen, „die mit einem dauerhaften Wohnortwechsel verbunden sind“ (HAN 2016: 5). Vor diesem Hintergrund scheint daher der eher neutrale Begriff Migrant als korrekte Bezeichnung für jene Leute zu sein, die aus unterschiedlichen Gründen (Krieg, Verfolgung, wirtschaftliche Lage) ihre Heimat verlassen und vorübergehend in einem anderen Land niederlassen (vgl. EDWARDS 2015).
Flüchtling
Im Sinne des Artikels 1 der Genfer Flüchtlingskonvention wird als Flüchtling jene Person definiert,
die sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt oder in dem sie ihren ständigen Wohnsitz hat, und die wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung eine wohlbegründete Furcht vor Verfolgung hat und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Furcht vor Verfolgung nicht dorthin zurückkehren kann. (FAQ Flüchtlinge)
Mit dieser Definition wird zugleich ein rechtlicher Rahmen geschaffen, der nach einer vorläufigen Prüfung, ob für den Betroffenen eine „begründete Furcht vor Verfolgung wegen seiner Ethnie, Religion, Nationalität, politischen Überzeugung oder seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe“ (AsylG. §3 (1)) besteht, als Grundlage dient, ihm den Flüchtlingsstatus zuzusprechen. In der sprachlichen Praxis wird jedoch der Ausdruck Flüchtling immer öfter durch den Begriff Geflüchtete/r ersetzt. Wie bereits vor der Entscheidung der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) der Sprachwissenschaftler Anatol STEFANOWITSCH festgestellt hat, evozieren die Begriffe Flüchtling, Asylbewerber oder Asylant automatisch eine gewisse Haltung, sodass deren Vorkommen im Sprachgebrauch nie neutral erfolgen kann (STEFANOWITSCH 2015a). Diese Begriffe eröffnen eine semantische Dimension, die im Kontext von historischen Ereignissen, insbesondere der NS-Diktatur bis heute negative Konnotationen hervorruft. In sprachlicher Hinsicht wird Flüchtling auch bei EISENBERG (2015) als problematisch bezeichnet, da das Suffix -ling kein Gendern zulässt. Der politischen Korrektheit wegen und auch den Regeln des deutschen Sprachsystems gerecht zu werden, schlägt er die Verwendung von Alternativen wie Geflüchtete/r oder auch Geflohene/r vor. Obwohl diese für den alltäglichen Sprachbenutzer vielleicht die gleiche Bedeutung aufweisen, bestehen zwischen ihnen semantische Unterschiede, weswegen bei deren Gebrauch ebenfalls Vorsicht erforderlich sei (vgl. hierzu KAŁASZNIK 2018).
Im vorliegenden Buch werden die oben genannten Ausdrücke synonym verwendet. Eine Unterscheidung zwischen Flüchtling und Asylbewerber erfolgt nur an jenen Stellen, wo das aus forschungspraktischen Gründen ausdrücklich notwendig ist.
Flüchtlingsdiskurs
Als Flüchtlingsdiskurs wird hier im Weiteren die Gesamtheit von Aussagen bezeichnet, die im Kontext der Fluchtbewegungen von 2015 von Akteuren in der Vertretung unterschiedlicher Länder schriftlich realisiert und durch Offline- bzw. Online-Medien übermittelt wurden. Vor diesem Hintergrund versteht sich dieser Diskurs als eine unendliche Menge von Kommunikaten, die durch das gemeinsame Thema Flucht in einen diskursiven Zusammenhang eingebettet sind und in Form von konkreten Untersuchungskorpora für linguistische Analysen zugänglich gemacht werden können.
2.2Abgrenzung des Themas
Die Motivation, den durch die Fluchtbewegungen von 2015 ausgelösten Diskurs in einem sprachkontrastiv ausgerichteten Rahmen linguistisch zu verarbeiten, ergibt sich aus der Relevanz der Thematik. Die hier fokussierten Fluchtbewegungen fanden vor unseren Augen statt und entwickelten sich rasch zum festen Bestandteil des europäischen Alltags. Auffallend war jedoch, dass auch in Tschechien, Polen und in der Slowakei ein Diskurs über die Flüchtlingsfrage entflammte, obwohl in erster Linie in Ungarn, Österreich und Deutschland Asylanträge gestellt wurden.
Die Art und Weise der Diskussion in den Medien generierte für meine Forschung zwei grundsätzliche Fragen:
Beschränkt sich die Rolle der Medien in diesem Diskurs auf die der Informationsvermittler oder treten sie als Akteure auf, die durch präzise formulierten Aussagen die öffentliche Meinung in eine gewisse Richtung lenken?
Ist es überhaupt möglich, Diskurse ohne Berücksichtigung von Medien linguistisch zu untersuchen?
Ausgehend von der Prämisse, dass die Medien durch ihre meinungssteuernde Rolle die Konstituierung des jeweiligen Diskurses maßgeblich beeinflussen (vgl. MAURER et al. 2021) und als solche eventuell auch als (politisches) Machtinstrument eingesetzt werden können, wurde die Entscheidung getroffen, dieses Phänomen zum Gegenstand diskurslinguistischer Untersuchungen zu erheben. Die unterschiedliche Rezeption der Flüchtlingsproblematik in der Presse war ein wichtiger Anstoß dazu, eine kontrastive Perspektive einzunehmen. Einen wesentlichen Beitrag dazu leisteten auch die Diskussionen im Rahmen der durch das Netzwerk Diskurs – interdisziplinär,1 im November 2016 veranstalteten Tagung Diskurs – kontrastiv, wo Aspekte und Potentiale etwa in Hinsicht auf das Diskursvokabular und die Argumentationsstruktur aufgezeigt wurden.
Seit der öffentliche Sprachgebrauch zum Gegenstand von systematischen sprachwissenschaftlichen Untersuchungen erhoben wurde, haben auch die Themen Migration und Einwanderung Eingang in die linguistische Forschung gefunden (vgl. NIEHR 1993; STÖTZEL et al. 1995; BÖKE et al. 1996; NIEHR/BÖKE 2000). Das Thema Migration wird wegen seiner andauernden Aktualität insbesondere in der politischen Kommunikation (vgl. ROTH et al. 2013; HENKELMANN 2012; WENDEKAMM 2014) aufgegriffen. Die durch den syrischen Bürgerkrieg ausgelösten Fluchtbewegungen gaben erneut Anstoß zu Untersuchungen auch auf dem Gebiet der Sprachwissenschaft, unterschiedliche Aspekte dieses Phänomens wie etwa die Änderungen im Wortschatz oder die Metaphorik unter die Lupe zu nehmen (vgl. BECKER 2015). Zu betonen sind hierbei jene Arbeiten, die die Themen Religion (Islam) und Sicherheit (Terrorismus) behandeln, die von manchen Beobachtern als direkte Folgen der sog. Flüchtlingskrise angesehen werden (vgl. KALWA 2013; HALM 2008).
Das Thema Flucht liefert gerade in einem vergleichenden Kontext interessantes Material für diskurslinguistische Analysen (vgl. GÜR-ŞEKER 2012; ATA 2011; LOHJA 2014). Das wachsende Interesse in Bezug auf die sog. Flüchtlingskrise von 2015 bestätigt inzwischen auch die zunehmende Anzahl von sprachkontrastiv ausgerichteten Arbeiten (vgl. AHO 2016; RADA 2019; CZACHUR/SMYKAŁA 2020; FLINZ et al. 2020). Während auf EU-Ebene angesichts der aktuellen Migrations- und Fluchtbewegungen nach einem gemeinsamen europäischen Vorgehen gesucht wird, erscheint diese Frage auf nationaler Ebene in je eigenem Gewand, was sinngemäß auch im zugehörigen Diskurs einen Niederschlag findet.
Es schien daher zweckmäßig, solche Sprachen und solche Länder in die Untersuchung einzubeziehen, die von der Flüchtlingsproblematik unterschiedlich betroffen sind und deren Haltung in diesem Kontext große Abweichungen aufweist. Die Bundesrepublik galt 2015 als das primäre Zielland und es war von Anfang an in die Lösung der Flüchtlingsproblematik auf EU-Ebene involviert. Das zweite Land ist Ungarn, ein Staat des ehemaligen Ostblocks, der insbesondere seit 2010, dem Amtsantritt der konservativ-nationalistischen Regierung Viktor Orbáns, für einige kontroversen Schritte u. a. im Bereich der Wirtschaft, der Finanzen und der sozialen Leistungen von führenden westlichen Politikern der EU mehrfach kritisiert wurde. Wegen seiner ablehnenden Haltung bezüglich der Flüchtlingsfrage wurde Ungarn wieder einer starken Kritik ausgesetzt, wodurch sich hier ein gut abgrenzbarer Gegenpol zum damaligen Pro-Diskurs2 in Deutschland konstituierte.
Das dritte, neben Deutschland und Ungarn in die Untersuchung einbezogene Land, die Slowakei, war im Unterschied zu den beiden ersten Ländern weder Ziel- noch Transitland. Obwohl eine direkte Betroffenheit in diesem Sinne nicht vorlag, entstand spätestens seit 2015 auch hier eine öffentliche Debatte. Einen kontroversen Standpunkt vertrat in erster Linie die slowakische Regierung, die das Thema versuchte, im Wahlkampf vor den am 05. März 2016 stattgefundenen Parlamentswahlen zu instrumentalisieren. Als die Slowakei im Juli 2016 die EU-Ratspräsidentschaft übernahm, musste sie sich die Frage stellen, wie die xenophobe Haltung ihrer Regierung und die Äußerungen von führenden slowakischen Politikern mit den Werten und Positionen der EU in Einklang gebracht werden können.
Aus den obigen Überlegungen ist ersichtlich, dass in den hier genannten Ländern der Fluchtdiskurs parallel auf mehreren Ebenen verlief. Einerseits entstand eine Debatte auf nationaler Ebene, in welcher in erster Linie die nationalen Interessen des jeweiligen Landes ausgehandelt worden sind. Parallel dazu verlief jedoch ein Diskurs auf transnationaler Ebene, wo ähnliche Aspekte in Bezug auf die gemeinsame EU-Politik diskutiert wurden. Die beiden Ebenen sind fest miteinander verbunden, sodass eine Trennung zwischen ihnen kaum möglich ist. Aus diesem Grund möchte die vorliegende Arbeit auch darauf fokussieren, wie zentrale Themen der EU, z. B. die geplanten Flüchtlingsquoten, in den nationalen Diskursen erscheinen und umgekehrt, ob und wie die ursprünglich auf nationaler Ebene thematisierten Ereignisse zum gemeinsamen Thema auf EU-Ebene erhoben werden.
2.3Problemaufriss
Die hier thematisierten Fluchtbewegungen gelten als ein komplexes Phänomen, die einerseits im Nahen Osten ein ernstes geopolitisches Problem darstellen, andererseits spätestens seit 2015 in ganz Europa, insbesondere für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, ein permanentes Konfliktfeld bedeuten. Die Vielseitigkeit Europas, die traditionell als die Stärke und Attraktivität des alten Kontinents betrachtet wird, stellt die größte Herausforderung beim Lösen dieses Problems dar. Die unterschiedlichen historischen Traditionen und Einstellungen der einzelnen Mitgliedsstaaten führen zu abweichenden Positionen, die den Sinn der europäischen Zusammenarbeit und selbst die Zukunft der EU wiederholt in Frage stellen. Deshalb lässt sich die hier thematisierte sog. Flüchtlingskrise – nach der Finanz- und Wirtschaftskrise vor einigen Jahren – als weiterer Versuch betrachten, die Zusammenarbeit und Solidarität Europas einer Prüfung zu unterziehen.
Anhand der Lektüre der täglichen Berichterstattung lässt sich leicht feststellen, dass sich unter den 28 EU-Ländern1 einige Gruppen bilden, um die eigenen Interessen innerhalb der EU stärker zu vertreten. Diese manifestieren sich in erster Linie in sprachlichen Äußerungen des Fluchtdiskurses. Die grundlegende Frage besteht hier darin, worauf die unterschiedlichen Positionen der einzelnen Länder zurückzuführen sind bzw. in welchem Maße die länderspezifischen Besonderheiten in den Diskursen auf nationaler Ebene oder auch in einem gemeinsamen Europa-Diskurs erscheinen. Besonders interessant ist eine solche Fragestellung z. B. im Falle der Ländergruppierung der V4-Länder Ungarn, Tschechien, Polen und der Slowakei. Diese sind nämlich durch historische und/oder regionale Gemeinsamkeiten bzw. Gegebenheiten miteinander eng verbunden und versuchen sich innerhalb der EU als ein Block zu positionieren, um die Interessen der mittelosteuropäischen Region zu vertreten. Es können hier folgende Fragen gestellt werden:
Wird die sog. Flüchtlingskrise von der Bevölkerung dieser Länder auf die gleiche Weise konzeptualisiert?
Wie beeinflussen die historischen und gesellschaftlichen Erfahrungen diese Konzeptualisierung?
Wie werden die nationalen Interessen der betroffenen Länder hinsichtlich der Migration durch höhere Interessen (etwa wirtschaftliche Beziehungen der Region mit Deutschland sowie die EU-Mitgliedschaft) beeinflusst?
Die Aufmerksamkeit gilt auf der anderen Seite Deutschland, das gerade in diesem Kontext in mehreren Rollen auftreten muss: einerseits als führende wirtschaftliche und politische Kraft der EU, andererseits als das primäre Zielland der Flüchtlinge. Diese beiden Positionen sind nicht leicht zu harmonisieren.
In diesem Buch werden themenbedingt zwar einige politikwissenschaftliche Aspekte angesprochen, jedoch richtet sich das Hauptaugenmerk auf die Frage, wie mittels Sprache kodiertes und gespeichertes Wissen eines Kollektivs bzw. einer Gesellschaft in Diskursen manifestiert. Es wird mit dem Begriff von „diskursiven Weltbildern“ (CZACHUR 2013a: 187) gearbeitet, die als Wissensrepräsentationen gedeutet werden, die als kognitive Konzepte die Weltwahrnehmung eines Individuums oder einer Gemeinschaft steuern. Durch die Annahme, dass sich diese Wissensformationen in Diskursen konstituieren, sich verändern und neues Wissen generieren, kann behauptet werden, dass diskursive Weltbilder grundsätzlich einen dynamischen Charakter haben. Unter (diskursiver) Dynamik ist keine tiefgreifende Veränderung dieser Wissensformationen zu verstehen, sondern eine wiederholte Aktualisierung und Erweiterung vorhandener Wissensbestände. Generell zeichnen sich diese Weltbilder durch Stabilität und Dauerhaftigkeit aus (vgl. CZACHUR 2011b: 99). Ausgehend von dieser Denkweise kann behauptet werden, dass diskursive Weltbilder prinzipiell sprach- und kulturgebunden sind und durch den Vergleich von Diskursen Erkenntnisse über die Denksysteme der zugrunde liegenden Gemeinschaften erschließen lassen. Die vorliegende Arbeit möchte daher auch zur kontrastiven Diskurslinguistik einen Beitrag leisten, indem drei sprachliche und kulturelle Perspektiven analysiert werden.
Die Grundprämisse lautet, dass die Sprache unsere Weltwahrnehmnung bestimmt (vgl. HENNIGFELD 1976). Sprache wird daher als grundlegendes Mittel verstanden, mit dem die Sprachbenutzer Wissen über die außersprachliche Realität herstellen und vermitteln. Unser Weltbild, unser Wissen über die Welt wird maßgeblich von medialen Berichterstattungen geprägt, deren Mittel die Sprache ist. Daraus folgt, dass die Sprache als wissensstiftendes Medium grundlegend bestimmt, wie wir die Welt wahrnehmen und wie wir darüber Fakten herstellen.
Die mit der Wissensrekonstruktion verbundenen Operationen finden im Sprachgebrauch statt, der wiederum als sprachlich-soziales Handeln betrachtet wird, dessen Spuren an der sprachlichen Oberfläche von Linguisten gelesen und gedeutet werden können (vgl. BUBENHOFER et al. 2013: 420). Diese Spuren als zeichenhafte Manifestierungen von Weltwissen können als Basis für diskurslinguistisch ausgerichtete Untersuchungen herangezogen werden, wobei nicht singuläre Texte, sondern Anhäufungen von Texten – in Textkorpora zugänglich gemachte Diskurse – als Ausgangspunkt der Analyse dienen sollen.
In der Annahme, dass Wissen in Diskurszusammenhängen entsteht, werden Diskurse als Rahmen betrachtet, die den Sprachbenutzern zur Orientierung dienen, während sie sprachlich handeln. Es ist dabei zu berücksichtigen, dass Wissensbestände über die Wirklichkeit nicht nur von den verschiedenen Akteuren unterschiedlich hergestellt, sondern auch von den Rezipierenden unterschiedlich rekonstruiert bzw. interpretiert werden. Dadurch entsteht eine Multiperspektivität, die zusammen mit der Heterogenität an (Sub-)Themen die Voraussetzung dazu ist, den verlangten objektiven Erkenntnissen der Realität näher zu kommen.
Die Sprache als Vehikel vermittelt bereits vorhandene Wissensbestände über das jeweilige Thema und sie bietet als natürliches Instrument die Möglichkeit, neues Wissen darüber zu schaffen. Der dadurch als „Menge von zur selben diskursiven Formation gehörenden Aussagen“ (FOUCAULT 1981: 170) entstandene Diskurs versteht sich jedoch nicht nur als bloße Ansammlung von – in Texten verfügbaren – sprachlichen Äußerungen. Der Diskurs bedeutet auch „die Praxis der symbolischen Herstellung von Gegenständen, deren Materialisierung sowie deren Reproduktion durch Konstruktion von Bedeutung und Sinn in einer komplexen gesellschaftlichen Praxis“ (BUBLITZ 1998: 9). Sprachgebrauch als diskursive Praxis setzt daher nicht nur die Existenz von Sprache als Mittel zum Kodieren und Dekodieren von Botschaften voraus, sondern auch die aktive Teilnahme der Sprachbenutzer, die mittels diskursiver Praktika versuchen, in der Öffentlichkeit eine vornehmliche Position einzunehmen, d. h. an die Macht zu gelangen.
Der Diskursbegriff erfuhr im Laufe der Zeit manche Neuinterpretationen, die zum Verständnis des hier thematisierten Diskurses in großem Ausmaß beitragen können (vgl. GARDT 2007). Es wird hier die Ansicht vertreten, dass relevante Aufschlüsse über den sog. Flüchtlingsdiskurs vom Linguisten erst dann gemacht werden können, wenn nicht nur die sprachliche Oberfläche, d. h. isolierte Phänomene wie etwa das Lexeminventar, sondern auch die Dimension der Akteure, der Sprachbenutzer als Gegenstand der Untersuchung miteinbezogen wird. Erst durch diese erweiterte Perspektive lassen sich über die sprachlichen Regularitäten hinaus auch Erkenntnisse über die Denkweisen, Motivationen und Einstellungen gewinnen, die die jeweilige Epoche prägen.
2.4Sprache im Kontext von Wissen und Kultur
Die linguistische Analyse von Diskursen bedeutet keine exklusive Beschäftigung mit dem Sprachgebrauch der jeweiligen Sprachgemeinschaft(en). Bei diskurslinguistisch orientierten Untersuchungen steht weniger die Sprache als deren Verwendung durch die Sprachbenutzer im Vordergrund. Hier wird nämlich ein Komplex von außersprachlichen Faktoren in Bewegung gesetzt, die für die effektive Kommunikation ebenso fundamental sind wie für eine linguistische Analyse. Unter diesem Komplex wird hier ein Orientierungssystem im Sinne von Kultur (vgl. FÖLDES 2003: 9) verstanden. Es umfasst jene Praktiken und Typisierungen, die für die Sprachbenutzer als Mitglied einer Sprach- und Kulturgemeinschaft die Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme an der öffentlichen Kommunikation bedeuten. Die Diskursanalyse ist daher auch als kulturbezogenes Arbeiten zu verstehen, wobei Phänomene auf der sprachlichen Oberfläche als Repräsentationen von Kultur zu betrachten sind.
Spätestens seit Ende der 1990er Jahre lassen sich Tendenzen in der Sprachwissenschaft beobachten, die die sog. kulturanalytische Linguistik als eigenständige Disziplin abzugrenzen versuchen (vgl. TIENKEN 2015: 465), die das Verhältnis zwischen Sprache und Kultur zum Ausgangspunkt von (diskurs-)linguistischer Untersuchungen macht. Der Kulturbegriff zählt zu jenen Termini, über die die einschlägige Literatur bis heute nicht einig ist. Die vorliegende Arbeit möchte in diesem Kontext auch auf die Frage eingehen, inwiefern Kultur als Deutungsrahmen für einen Diskurs betrachtet werden kann.
Versucht man den Begriff Kultur zu definieren, stehen unterschiedliche Konzepte zur Verfügung. Die sog. kulturelle Wende in den 1960er Jahren bedeutete eine Abkehr vom herkömmlichen elitistischen Kulturverständnis, das durch einen erweiterten Kulturbegriff im Sinne eines Symbolsystems bzw. einer symbolischen Ordnung ersetzt wurde. Diese Ordnung kann als Grundlage für soziale Praktiken sowie individuelle Einstellungen verstanden werden, an die zugleich unser sprachliches Handeln gebunden ist, d. h. die Diskurse konstituieren. Doris BACHMANN-MEDICK (2004) bezeichnet mit Kultur im Kontext der Kulturanthropologie eine „Praxis der Signifikation“ (ebd.: 16). Sprachliche Zeichen stellen nicht nur einen Bezug zur Wirklichkeit her, sondern geben eine Bedeutung den Dingen. Diese sinngebende Funktion von Sprache ist in der Kultur bzw. Sozialität verankert (vgl. FEILKE 1998: 173). Als Manifestierung des Verhältnisses zwischen Sprache und Kultur betont Angelika LINKE (vgl. 2011: 27) die Präferenz von bestimmten sprachlichen Mustern, die kontextabhängig eine Aktualisierung und u. U. auch einen diachronen Wandel erfahren können. Susanne TIENKEN (vgl. 2015: 470) bezeichnet die Kontrastivität und die Serialität als jene Merkmale, die bei der Diskursanalyse sprachliche Muster als Marker der kulturellen Gebundenheit von Sprachgebrauch aufspürbar machen können. In der vorliegenden kontrastiven Arbeit können insbesondere Gegenüberstellungen eingesetzt werden. Das Merkmal der Serialität lässt sich hingegen bei quantitativ ausgerichteten Untersuchungen effektiv anwenden.
Die Untersuchung dieser symbolischen Wissensordnungen betrachtet die moderne Kulturwissenschaft als eine ihrer grundlegenden Aufgaben. Das Primat liegt hierbei in der Erforschung der Rolle von Massenmedien. Im Sinne der kulturwissenschaftlichen Auffassung besteht die Funktion von Massenmedien nämlich darin, solche Ordnungen zu produzieren und zu distribuieren (vgl. KARIS 2013: 64). Diese Ordnungen dienen als gemeinsame kulturelle Orientierungs- bzw. Deutungsrahmen, die sowohl bei der Produktion als auch bei der Rezeption von Informationen als Grundlage dienen. Im Falle von medialen Angeboten – Nachrichten u.ä. – orientieren sich also sowohl Journalisten als auch ihre Adressaten an den gleichen Symbolen und Bedeutungsstrukturen. Dieser Gedanke wurde von Stuart HALL (2003) in seinem Encoding-Decoding-Modell zu einem Konzept der massenmedialen Kommunikation erarbeitet, das zu den prominentesten kulturwissenschaftlich orientierten Kommunikationsmodellen gehört. Es kommt hierbei zwei Prämissen eine fundamentale Bedeutung zu. Erstens ist eine objektive Wirklichkeitsdarstellung durch die Medien nicht möglich; der Journalist ist während seiner Arbeit immer an einen bestimmten Deutungsrahmen gebunden, der hier als Kultur bezeichnet wird. Zweitens besteht zwischen Input und Output, d. h. zwischen der von Journalisten kodierten und von der Leserschaft dekodierten Botschaft keine Äquivalenz. Auch wenn die Kultur als gemeinsamer Deutungsrahmen die Interpretationsmöglichkeiten von Wirklichkeit in gewissem Maße einschränkt, produziert man in der Regel polyseme Botschaften, die vom Publikum auf unterschiedliche Weise gedeutet werden können. Wie jedoch HALL (vgl. ebd.: 118) selbst darauf hinweist, wird die Mehrdeutigkeit von Medienaussagen von einer Reihe von Faktoren begrenzt, die schließlich in der öffentlichen Debatte, also im Diskurs aufgehen. Hierzu zählt man u. a. Ideologie, Dominanz und Konsens, d. h. all jene Phänomene, die die Entstehung und das Aufrechterhalten von Diskursen motivieren und beeinflussen. Versucht man in diesem Kontext die Rolle von Medien zu bestimmen, kann deren Aufgabe darin bestehen, eine „dominante kulturelle Ordnung“ (vgl. ebd.: 115) zu etablieren und dadurch die möglichen Bedeutungen von Medienaussagen auf einige wenige bevorzugte zu beschränken. Diese Praxis dient letztendlich der Erlangung von Diskurshoheit, um bestimmte Absichten von Akteuren durchzusetzen.
Nach BACHMANN-MEDICK (vgl. 2004: 16) wird im Prozess des Diskurses Wissen konstituiert und zugleich erfolgt auch die Signifikation, die Herstellung von sprachlicher Referenz auf die Entitäten der Wirklichkeit. Diesen Prozess der Wissensproduktion bezeichnet Hall als Signifikationspolitik (vgl. HALL 1982: 64, ferner auch MARCHART 2003; MARCHART 2004). Den Medien kommt die Rolle des Signifikationsapparates zu. Das bedeutet, dass diese im Kampf um Bedeutung als „dominante Mittel sozialer Signifikation“ (HALL 1982: 83) auftreten. Sie kämpfen dabei um die Macht, um bestimmte Ereignisse mit (bevorzugten) Bedeutungen auszustatten.
Aus den obigen Überlegungen wird deutlich, dass die Medien vor dem Hintergrund der jeweiligen Kultur eine Wirklichkeit konstruieren, die das Publikum im Kontext verschiedener kulturspezifischer Praktiken, Ideologien u.ä. zu deuten versucht. Sie erfüllen dabei jedoch auch eine inventarisierende und klassifizierende Funktion, indem sie es ermöglichen, „die soziale Realität zu kartografieren, zu regeln, sie in eine bestimmte Ordnung und imaginierte Kohärenz zu bringen und sich selbst darin zurecht zu finden“ (MARCHART 2008: 166).
2.5Sprache und Wissen
Das Verhältnis von Sprache und Wissen dient für die vorliegende Arbeit zur Beleuchtung des theoretischen Hintergrundes des eigentlichen Forschungsgegenstandes. Die Vagheit und Mehrdeutigkeit des Wissensbegriffes motivieren jedoch den Verfasser dazu, einige Termini in diesem Kontext zu präzisieren.
Der Terminus Wissen gehört zu jenen Ausdrücken, die in der letzten Zeit im Kontext einer sog. Wissensgesellschaft inflationär gebraucht werden. Die postmoderne Gebrauchsweise bevorzugt einen wirtschaftswissenschaftlich ausgerichteten Wissensbegriff, nach dem Wissen als
die Gesamtheit der Kenntnisse und Fähigkeiten [verstanden wird], die Individuen zur Lösung von Problemen einsetzen. Wissen basiert auf Daten und Informationen, ist im Gegensatz zu diesen aber immer an eine Person gebunden. (GABLER 2018)
In diesem Kontext bedeutet also Wissen ein ökonomisches Gut, das als besonders wertvolles Kapital angesehen wird. Betrachtet man es aus biologischer Sicht, dann sind damit neuronale (Netzwerk-)Theorien gemeint, die Wissen als biologisches Phänomen interpretieren, das eine neurophysiologische und kognitiv-psychologische Gebundenheit an Individuen aufweist (vgl. BRENDEL 2013). Auf dem Gebiet der Geisteswissenschaften, u. a. der kognitiven Linguistik und der Psycholinguistik kommt hingegen eine primär an die individuelle Erkenntnis und die soziale Interaktion gebundene, kulturell und gesellschaftlich bedingte Auffassung zum Tragen:
Wissen bezeichnet […] die von einer Person gespeicherten und reproduzierbaren Kenntnisse, Erkenntnisse, Einsichten, Daten und Fakten über die Beschaffenheit bestimmter Wirklichkeitsbereiche, wobei mit Beschaffenheit Merkmale, Funktionen, Beziehungen, Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge, Ordnungen, Kategorien, Sinnzusammenhänge, Aufbau, System gemeint sind. Wissen stellt eine Auswahl aus jenen Informationen dar, die Menschen zur Kenntnis nehmen, verstehen, in ihre kognitiven Schemata integrieren und die eine Bedeutung für sie haben. Wissen ist somit die aktive Leistung eines Subjekts und bildet eine Brücke zwischen einem individuellen kognitiven System und der Umwelt dieses Subjekts. (STANGL 2018)
Wissen heißt also prinzipiell das Kennen von Tatsachen, Praktiken und Orientierungsmustern, die dem Individuum helfen sollen, sich im Netz von alltäglichen Lebenszusammenhängen zu orientieren. Man greift dabei auf unterschiedliche Arten von Wissen zurück, grundsätzlich sind es das prozedurale und das deklarative Wissen (vgl. KONERDING 2009: 83–86). Die typisierten Kontexte mit den zugehörenden Skripten bilden sog. Wissensrahmen (Frames), die es überhaupt ermöglichen, Gegenstände der außersprachlichen Welt zu erfahren. Diese lassen sich als Steuerungselemente der Wahrnehmung betrachten, indem sie mittels repräsentativer Zeichenketten dem Sprachbenutzer jenen Kontext herstellen, in dem er durch den Bezug auf sein Wissen die jeweilige Situation deuten und erfahren kann. Die auf kollektivem Wissen beruhenden und durch Sprache vermittelten Wahrnehmungsmuster können daher als „sprachlich konstituierte Kulturprodukte angesehen werden“ (FELDER 2009: 28).
Die Determiniertheit der kognitiven Perspektivität formulierte bereits HUMBOLDT in seiner grundlegenden These:
Der Mensch lebt hauptsächlich mit den Gegenständen, so wie sie ihm die Sprache zuführt, und da Empfinden und handeln in ihm von seinen Vorstellungen abhängt, sogar ausschließlich so. (HUMBOLDT 1963: 225, zitiert nach KÖLLER 2004: 24)
Wie jedoch Ingo WARNKE (2009: 116) darauf hinweist, beschränken neuere linguistische Forschungen die Rolle von Sprache nicht bloß auf die des Mittels der Erkenntnis, sondern weisen ihr eine fundamentale Bedeutung sowohl bei der Konstruktion als auch bei der Wahrnehmung von Wirklichkeit zu. Gerade auf diese sprachliche Wirklichkeitskonstruktion richtet sich das diskurslinguistische Forschungsinteresse. Wichtig ist dabei, dass Diskurse nicht als eine Schnittstelle zwischen dem Sprachsystem und dem Denken betrachtet werden sollen (vgl. BUSSE 1987: 226). Sie stellen „Regelsysteme“ dar, in denen die sprachliche Konstruktion von Wirklichkeit und die Konstituierung von Wissen überhaupt möglich ist. WARNKE (vgl. 2009: 118–121) unterscheidet hier zwischen drei Klassen von Wissenskonstituierung:
Konstruktion – Herstellung von Faktizität;
Argumentation – Rechtfertigung von Faktizität;
Distribution – Streuung von Geltungsansprüchen auf Wahrheit.
Den Ausgangspunkt dazu bildet die Annahme, dass Diskurse als Regelsysteme und die Konstituierung von Wissen als sozialer Prozess zu betrachten sind. Unter Wissenskonstruktion ist daher eine Faktizitätsherstellung „in regelgeleiteten sozialen Prozessen“ (WARNKE 2009: 118) zu verstehen. Das heißt zugleich, dass jede Erkenntnis durch die Äußerungen anderer Diskursteilnehmer bedingt ist, „weil nur das, was sprachlich objektiviert ist, auch als […] Wissen erfahrbar ist“ (ebd.: 119). In einer weiteren Phase erfolgt die Rechtfertigung der Faktizität vom konstruierten Wissen; dies geschieht durch die zustimmende oder ablehnende Argumentation der Diskursakteure. Wissen zeichnet sich demnach als soziales und dynamisches Konstrukt aus, das sich „auf kollektive Meinungen bezieht, die als unstrittig geteilt werden und über die ein relativer Konsens besteht“ (KONERDING 2009: 81). Diese argumentative Aushandlung von Wirklichkeit versteht sich als Interessenausgleich, d. h. als Anpassung und Optimierung von Ansprüchen auf (diskursive) Hoheit bzw. die Macht. Dieser Prozess resultiert in materialisierten Wissenskonstrukten, etwa in verschiedenen Lexemen. Die Durchsetzung der einzelnen Benennungen, z. B. im Bereich der politischen Kommunikation, ist daher als Resultat dieser Aushandlungsprozesse, der Argumentation der Diskursakteure zu betrachten. Das Wissen über Migration und Flucht sowie die Kategorien, die man diesen Entitäten zuordnet (z. B. Flüchtlinge – illegale Einwanderer) entstehen als Ergebnis von kommunikativen Leistungen unterschiedlicher Akteure (Politikern, Institutionen, NGO-Aktivisten). Es handelt sich dabei um einen semantischen Kampf, wo die Durchsetzung von eigenen Positionen nicht einfach wegen der Dominanz im Diskurs notwendig ist, sondern wegen der Tatsache, dass die Distribution von Wissen von einer dominanten Position aus wesentlich leichter und effektiver ist, als von der eines Akteurs, dessen Stimme kaum Resonanz erfährt.
In dieser Phase der Wissenskonstituierung kommt die größte Bedeutung den Medien zu. Diese nehmen an der Wissensdistribution teil. Ihre Rolle beschränkt sich in der Regel nicht auf die der passiven Replikatoren von Informationen. Grundsätzlich fungieren sie als Filter, indem sie die Aussagen einzelner Akteure in optimierter Form dem breiten Publikum verfügbar machen. Somit agieren sie jedoch in gewissem Sinne aktiv im Diskurs, denn sie können dabei Aussagen von anderen Diskursteilnehmern so artikulieren, dass ihre eigenen Interessen (d. h. die der Medien) etwa zur besseren Positionierung auf dem Markt auch zum Ausdruck kommen.
2.5.1Exkurs: Das Frame-Konzept im Kontext der Diskurslinguistik
In Anlehnung an MINSKY (1979) und FILLMORE (1985) lassen sich Frames als kulturspezifisch verankerte, aber zugleich variable Wissensstrukturen betrachten, die unterschiedliche Abstraktionsstufen darstellen. Sie bestehen einerseits aus sog. Slots (Leerstellen), die als feste Wissensdomänen gelten, andererseits aus variablen Elementen, den sog. Fillers, die hingegen stark kontext- und performanzabhängig sind. Die Slots werden in der Regel durch Standardwerte (sog. Default Values) besetzt, diese sind konventionelle Prädikationsstrukturen, die aus dem Gedächtnis abgerufen werden können. Von der Prämisse ausgehend, dass kollektives Wissen in Form von miteinander verknüpften Wissensbeständen gespeichert und für die Mitglieder der jeweiligen Sprachgemeinschaft zur Verfügung gestellt wird, kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass analog dazu auch die Frames als Bestandteile eines Netzwerkes organisiert werden. Diese Annahme steht in Einklang mit dem Ansatz MINSKYs, der die Frames als Elemente von Frame-Netzwerken betrachtet (vgl. MINSKY 1979). Diese sog. Frame-Semantik hat in jüngster Zeit durch KONERDING (1993), FRAAS (1996) und KLEIN (1999) bzw. ZIEM (2008) und BUSSE (2008) auch in die germanistischen Diskurslinguistik Einzug gehalten. Auf der Basis des Foucaultschen Gedanken, dass in Diskursen kollektives Wissen der jeweiligen Kultur- und Sprachgemeinschaft konstruiert wird, werden unter Frame Repräsentationsformate für die verschiedenen Wissensformen verstanden, in denen sie als übergeordnete Wissensrahmen gelten, die „Sinnesdaten in einen kognitiv konstruierten Kontext“ (ZIEM 2005: 1) einbetten. BUSSE (vgl. 2008: 70) beschreibt diese als Wissensrahmen zur Speicherung von unterschiedlichen Typen verstehensrelevanten Wissens, d. h. sowohl vom stereotypen als auch vom prozeduralen Wissen. Diese Wissensbestände seien kollektiv verfügbar und in konkreten Situationen kognitiv abrufbar. Die hier beschriebenen Ausführungen über den Zusammenhang zwischen Frames und kollektivem Wissen evozieren weitere Überlegungen, um auf dieser Basis das Frame-Konzept mit diskursanalytischen Untersuchungen zu kombinieren. Eine solche Perspektive scheint umso mehr fruchtbar zu sein, wenn man annimt, dass „verstehensrelevantes Wissen nur mittels Sprache als Wissen konstituiert“ (ebd.: 84) werden kann. Werden Frames als Repräsentationsformat eines Wissens angesehen, dass in einem Diskurs zustande kommt, dann sollen sie zugleich geeignet sein, die gängigen diskurslinguistischen Kategorien (vgl. DIMEAN, Kap. 5.3) „gleichermaßen abzudecken und miteinander zu kombinieren“ (VARGA 2019: 3). Hierzu gehören sowohl wortorientierte Analysen der lexikalischen Ebene als auch Argumentations- und Toposanalysen. Wenn also Topoi als „Bestandteile von Wissensrahmen [angesehen werden], die bei Emittenten und Rezipienten von sprachlichen Äußerungen ab- und aufgerufen werden“ (SZULC-BRZOZOWSKA 2018: 140), dann bietet sich die günstige Konstellation, Frame- und Toposanalyse miteinander zu kombinieren.
2.5.2Texte als sprachliche Realisierungen von Wissen
Vor dem Hintergrund der im Kapitel 2.4 angesprochenen theoretischen Prämissen wird danach gefragt, (a) wie Wissen durch Sprache erzeugt, (b) wie Wissen im Kontext des Diskurses interpretiert und (c) wie dieses Wissen im Diskurs verwendet wird. Als Grundlage dieser Überlegungen dient das wissensbasierte Textverständnis bei ANTOS (1997). Sein Konzept über das Primat der Texte basiert auf der Annahme, dass
Texte kommuniziertes, kulturell überliefertes und kognitiv generiertes Wissen archivieren;
Texte als erstes Leitmedium von Kommunikation fungieren, die in räumlicher und zeitlicher Distanz erfolgt;
Texte als autonome und prototypische Kommunikationsmittel fungieren, die sich durch maximale Kontextunabhängigkeit sowie durch sprachliche Konstruktivität auszeichnen (vgl. ANTOS 2007: 34).
Ausgehend von diesen Annahmen betrachtet er Texte als „komplexe sprachliche Modelle der Erzeugung von individuellem und kollektivem Wissen“, die als dessen „historisch wie systematisch als kulturspezifische sprachliche Konstitutionsformen“ (ANTOS 2010: 43) aufgefasst werden müssen. Dieses Konzept harmoniert nicht nur mit der weit verbreiteten textbasierten Auffassung von Diskursen (vgl. OLSZEWSKA/KĄTNY 2013), sondern kann in einen integrativ orientierten Forschungsrahmen adäquat eingebettet werden. Das Verständnis von Texten als Mittel der Wissensrepräsentation, der Wissensarchivierung und der individuellen und sozialen Wissenskonstitution (vgl. ANTOS 1997) ermöglicht es, diese als Träger von diskursstiftenden Elementen auf einer höheren Ebene zu betrachten und als solche zum Ausgangspunkt von Diskursanalysen zu machen. Texte spielen daher eine grundlegende Rolle in der Wissensvermittlung, da diese „bestimmte Formen von Kognitionen, individuell wie kollektiv wahrnehmbar machen“ (ANTOS 2010: 49).
Wenn Wissen durch die Kognition von Mitgliedern einer Gemeinschaft entsteht und sich in kollektiv verfügbaren Formen – in Texten – konstituiert, vermittelt und archiviert wird, dann gilt auch, dass
jede Wahrnehmung ein bereits vorhandenes Wissen voraussetzt,
jede individuelle Erkenntnis (durch die Mitglieder der Gemeinschaft) im Kontext der kulturellen, historischen und sozialen Traditionen und Praktiken des jeweiligen Kollektivs erfolgt,
sich das Individuum vom „kollektiven Auge“ nicht lösen kann.
Das heißt zugleich, dass die Aushandlung von Wissen im öffentlichen Sprachgebrauch, d. h. in Diskursen, ebenfalls vor den Augen eines Kollektivs verläuft (vgl. FLECK 1983: 154). Die Teilnahme am Diskurs ist erst durch den Zugang zu einem kollektiven Gedächtnis möglich. Erst der Zugriff auf diesen höheren, kollektiv verankerten Erinnerungs- und Deutungsrahmen ermöglicht es dem Individuum, durch das Abrufen bereits geschehenen Wissensvorräte aktuelle Ereignisse u.ä. zu interpretieren, zu verstehen und die so gewonnenen Erkenntnisse wiederum in größere Wissensformationen zu organisieren. Das heißt zugleich, dass durch die wiederholten Zugriffe und Erweiterungen dieser Wissensbestände durch die Mitglieder des Kollektivs dieses Wissen immer wieder aktualisiert wird. Das bedeutet zugleich, das Wissen keine statische Größe ist, sondern ein „dynamisch verhandeltes Gut der Vergesellschaftung“ (WARNKE 2009: 114). Darunter wird die Gesamtheit jener Prozesse verstanden, die auf den Interessenausgleich und die -Verbindung der Akteure gerichtet sind. Im Diskurs erfolgt das mittels Sprache. Solange durch themenidentische Aussagen die Kohärenz im Diskurs aufrechterhalten wird, wird die diskursive Serialität gewährleistet. Kommt es hingegen zur Konfrontation von thematisch unterschiedlichen Aussagen, entsteht serielle Diskontinuität, die auf den einzelnen Ebenen der Diskursanalyse durch sprachliche Umbrüche indiziert wird (vgl. KÄMPER 2011: 35).
Diese Dynamik des Diskurses ist die Folge von kognitiven bzw. diskursiven Aktivitäten der Akteure. Die Zugehörigkeit zu einem Kollektiv bedeutet jedoch nicht die bedingungslose Akzeptanz von historisch tradierten Ansichten und Meinungen. Die Individuen bewegen sich in „sozial- und kulturgeschichtlich bedingte[n] Denksystemen oder -strukturen, die für jedes Mitglied einer sozialkulturellen Gemeinschaft verbindlich sind“ (WENGELER 2005: 273). Diese werden bei FLECK (vgl. 1980: 106) als Denkstil bezeichnet. Die Wahrnehmung von Wirklichkeit erfolgt immer innerhalb bestimmter Ideensysteme. Denkstile liefern für die Diskursteilnehmer jene Orientierungspunkte, die es bei der Aushandlung von Wissenselementen mitbestimmen, was zu sagen möglich ist. Dadurch entsteht ein bestimmter Denkzwang (vgl. FLECK 1983: 273), der aber für individuelle Intentionen und Interessen nur die Rahmenbedingungen herstellt, ohne quasi vorzuschreiben, was man über konkrete Ereignisse und Entitäten denken sollte.
Die Unterscheidung zwischen Individuum und Kollektiv auf der Ebene von Wissen greift auf die Differenzierung zwischen einem impliziten und einem expliziten Wissen zurück, die u. a. im Bereich des Wissensmanagements eine grundlegende Rolle spielt. Demnach stellt implizites Wissen „das persönliche Wissen eines Individuums dar, welches auf Idealen, Werten und Gefühlen der einzelnen Person beruht“ (NORTH 2005: 43). NORTH (ebd.) unterscheidet dabei zwischen einer technischen und einer kognitiven Komponente. Letztere umfasst Werte, Ideale, Einstellungen und Überzeugungen und beeinflusst die Art und Weise, wie Menschen die Welt wahrnehmen, beurteilen und erleben. Explizites Wissen ist hingegen artikulierbar, formalisierbar und daher relativ leicht transferierbar. Beim Wissenstransfer und generell beim Wissensmanagement geht es deshalb prinzipiell darum, wie das implizite Wissen des Individuums in ein explizites Wissen transformiert werden kann, das für das ganze Kollektiv verfügbar ist. Dieser Transformationsprozess wird im sog. SECI-Modell (Sozialisation, Externalisation, Kombination, Internalisierung) von TAKEUCHI und NONAKA (vgl. 2012: 71) erklärt.
In der politischen Kommunikation geht es nicht um die bloße Vermittlung von Wissensbeständen, sondern um die Argumentation. Die Wissensakteure versuchen „Faktizität durch Begründung oder Widerlegung von konstruiertem Wissen“ (WARNKE 2009: 119) rechtzufertigen. Argumente sind erforderlich, um Geltungsansprüche durchzusetzen. Als Wissensakteure werden hier diejenigen Beteiligten verstanden, die durch ihre Qualifikation (vgl. Kap. 5.5.1) nicht nur Zugang zum kollektiven Wissen haben, sondern dieses auch maßgeblich beeinflussen und formulieren. In diesem Kontext handelt es sich u. a. um Politiker, die als diskurssteuernde Teilnehmer in der Öffentlichkeit auftreten. Im Rahmen der Wissenstransformation im öffentlichen Diskurs liegt die Betonung auf der Akzeptanz und der Internalisierung der Gedanken des Wissensakteurs beim breiten Publikum. Die Wissenskommunikation im Diskurs dient dazu, in der Öffentlichkeit Akzeptanz für die eigenen Positionen zu erreichen und durch diskursive Aktivitäten die Wahrnehmung der Welt beim Kollektiv möglichst in größerem Maße zu beeinflussen.
2.5.3Medien als wissenskonstituierende Entitäten
Der Begriff Medium gehört trotz seiner alltäglichen Verwendung zu jenen Ausdrücken, die stark kontextabhängig und deren Gebrauchsweise somit besonders variabel ist. Als vermittelndes Element wird der Begriff im Duden wie folgt präzisiert (vgl. auch JARREN/DONGES 2011: 79–85):
(bildungssprachlich) Einrichtung, organisatorischer und technischer Apparat für die Vermittlung von Meinungen, Informationen, Kulturgütern; eines der Massenmedien Film, Funk, Fernsehen, Presse;
Hilfsmittel, das der Vermittlung von Information und Bildung dient (z. B. Buch, Tonband);
(Werbesprache) für die Werbung benutztes Kommunikationsmittel; Werbeträger.
Medien eröffnen Handlungsräume, wo (politische) Akteure durch wiederholte Bezüge auf kollektives Wissen ihre Absichten und Interessen artikulieren und somit vorhandenes Wissen aktualisieren und neue Wissensbestände generieren können. Die „Mediensysteme einer Gemeinschaft bilden einen Mediendiskurs“ (CZACHUR 2011a: 63). Diese schaffen die Wirklichkeit, „in der die Menschen ihre Existenz gestalten“ (ebd.). Mediendiskurse sind demnach als Erzeuger und Speicher vom kollektiven Wissen zu betrachten.
Im Sinne des von WARNKE (2009) vorgeschlagenen Konzeptes der Wissenskonstituierung umfasst die Konstituierung von Wissen neben Konstruktion und Argumentation die Distribution, d. h. die „Streuung von Geltungsansprüchen auf Wahrheit“ (ebd.: 121, vgl. auch SPITZMÜLLER/WARNKE 2011). Das bedeutet, dass Diskurse auf die Medien angewiesen sind, indem sich diese als jene Orte verstehen, wo Diskurse überhaupt ausgetragen werden: „Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir durch die Medien“ (LUHMANN 1996: 9).
Im Kontext der politischen Kommunikation bieten Medien die Arenen zum politischen Handeln, in denen unterschiedliche Perspektiven mit dem Ziel konfrontiert werden, den (theoretisch) bestmöglichen Standpunkt auszuwählen (vgl. Kap. 3.8.2). Öffentliche Diskurse dürfen jedoch nicht mit Mediendiskursen gleichgesetzt werden, denn im ersten Falle handelt es sich um eine „eher soziologische Kategorie“, die auf „Partizipationsmöglichkeiten der unterschiedlichen Akteure und gesellschaftspolitische Themen“ (CZACHUR 2011a: 65) fokussiert. Als Mediendiskurse sind hingegen nur diejenigen Teile von öffentlichen Diskursen zu betrachten, die über die Medien vermittelt werden.
In Bezug auf das Verhältnis zwischen Diskurs und Medien werden hier zwei Perspektiven dargestellt, die in erster Linie in die germanistische Forschung Einzug gehalten haben (vgl. KUMIEGA 2012: 32). Die Vertreter der Duisburger Schule der Kritischen Diskursanalyse (vgl. JÄGER/JÄGER 2007) betrachten Medien als jene Orte, wo „thematisch definierte Diskurse ausgetragen werden“ (KUMIEGA 2012: 32). Bei dieser Perspektive liegt der Aspekt von Macht im Vordergrund, doch wird auch die Frage angesprochen, inwieweit Medien über die Replikator-Funktion hinaus auch die eines Regulators zukommt (vgl. JÄGER/JÄGER 2007: 73).
Den Überlegungen in der vorliegenden Arbeit steht vielmehr der Chemnitzer Ansatz von Fraas (vgl. FRAAS 2005; FRAAS et al. 2014b; SOMMER et al. 2014) nahe. Dieser operiert mit dem Begriff Mediendiskurs, der, wie bereits im oben ausgehandelten Wissensbegriff, als „Baustein gesellschaftlicher Wissenskonstitution“ (FRAAS 2005: 1) definiert wird. Dieser Ansatz berücksichtigt auch die technischen Gegebenheiten des jeweiligen Mediums, um zu erfassen, „wie medienspezifische Bedingungen auf die jeweilige Kommunikation Einfluss haben“ (FRAAS et al. 2014a: 84). Im Falle von Online-Inhalten, die im Internet verfügbar sind, zählt man hierzu etwa Verlinkungen, die als Verweise auf fremde Texte direkte Verbindungen zwischen mehreren diskursiven Einheiten herstellen und als „diskurskonstituierende Elemente“ (FRAAS/MEIER 2004: 89) fungieren. Dieses erweiterte Verständnis von Mediendiskursen ist daher für die Analyse von jenen Diskursen fruchtbar, die sich etwa in neuen (Online-)Medien konstituieren, wo z. B. die jeweilige Online-Plattform die Wissenskonstitution und somit auch die Entstehung des Diskurses wesentlich beeinflusst. Eine solche Perspektive ermöglicht die medienspezifischen Kontexte tiefer in die Untersuchung einzubeziehen und somit die Aspekte wie Multimodalität bzw. Multikodierung bei der Diskursanalyse zu berücksichtigen.
Trotz dieser erweiterten Perspektive ist die Mehrheit der Diskursanalysen bis heute noch textbasiert, weshalb diese mehr oder weniger als Kombinationen von textanalytischen Verfahren betrachtet werden können (vgl. MAAS 1984: 17; GARDT 2013). Als Basis dienen Korpora von Texten aus Printmedien, was bei der theoretischen Fundierung der diskursanalytischen Bearbeitung vom medial vermittelten Sprachmaterial erforderlich macht, auf einige Fragen von Diskurs und Medien einzugehen. Ein solches Verfahren ist umso wichtiger, wenn ein theoretisches und methodisches Konzept auf dem Foucaultschen Diskursverständnis aufgebaut werden soll. Es ist nämlich gerade der Aspekt bzw. die Rolle der Medien, die bei FOUCAULT (vgl. ERNST 2004: 243) kaum Aufmerksamkeit finden. Den Überlegungen liegt hier die Prämisse zugrunde, dass Medien bzw. Medialität nicht als eine Option, sondern als Grundbedingung zur Entstehung von Diskursen zu betrachten sind. Diskurse und Medien dürfen folglich nicht von einander getrennt als zwei selbstständige Entitäten angesehen und behandelt werden, sondern als zwei Phänomene, die in einem unauflösbaren Verhältnis zueinander stehen (vgl. SARASIN 2001: 64). PARR und THIELE (2007: 104ff.) führen einige, in der Medienwissenschaft verbreitete Modellierungen auf, die das Verhältnis von Diskurs und Medien zu begreifen versuchen. Den einen Pol stellt hier die Vorstellung dar, die den Diskurs durch die Medien ersetzt bzw. die beiden als gleichbedeutend behandelt. Den anderen Pol bilden hierarchische Modelle, in denen Medien entweder als äußere Kräfte erscheinen, die Diskurse beeinflussen oder umgekehrt, in denen Medien lediglich als Arenen fungieren, wo Diskurse stattfinden und sichtbar werden (vgl. HABERMAS 1990: 35). Diskurse sind jedoch grundsätzlich an die Medien angewiesen und somit treten auch die Medien notwendigerweise in die Konstituierung von Diskursen ein, d. h. ein hierarchisches Verhältnis zwischen den beiden ist ausgeschlossen (vgl. KARIS 2012: 50ff.).
2.6Forschungsfragen und Hypothesenbildung
Die konkrete Fragestellung der Arbeit bezieht sich auf die folgenden Ebenen:
Wie wird mittels Sprache spezifisches Wissen über Flüchtlinge in den hier beobachteten drei Sprachen hergestellt?
Welche vordiskursiven Konzepte bestimmen in der jeweiligen Sprach- und Kulturgemeinschaft das Bild über Flüchtlinge?
Welche Akteurkonstellationen ergeben sich im untersuchten Diskurs und wie verhalten sich diese?
Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede lassen sich auf den einzelnen Diskursebenen in einem transnationalen bzw. interlingualen Vergleich feststellen?
In Bezug auf die in der Einführung geschilderten Situation der sog. Flüchtlingskrise in den drei untersuchten Ländern können folgende Hypothesen formuliert werden:
H1 Mit Rücksicht auf den globalen Charakter der hier thematisierten Flüchtlingskrise entsteht grundsätzlich ein transnationaler Diskurs, in den die eventuellen Diskursstränge auf nationaler Ebene eingebettet sind.
H2 Die Fluchtproblematik wird in der Öffentlichkeit sehr kontrovers aufgegriffen, wodurch diese Wirkung in allen drei Ländern in einem stark polarisierten Diskurs resultiert.
H3 Aufgrund der mangelnden Erfahrungen mit dem Fremden und der historischen Traditionen liegen der Argumentation im ungarischen und im slowakischen Diskurs größtenteils andere Topoi zugrunde als jener im deutschen Diskurs.
Die Beantwortung der Forschungsfragen und der Arbeitshypothesen erfordert eine synthetisierende Betrachtung der ermittelten Ergebnisse, d. h. die Erkenntnisse der Wortschatzebene und die der Akteurs- und Argumentationsebene ergänzen sich gegenseitig. Die Arbeit soll daher auf einer kontrastiv ausgerichteten theoretischen und methodologischen Grundlage basieren, die um die Triade von Handlung, Wissen und Akteur aufgebaut wird. Diese sind nämlich nicht nur diejenigen Dimensionen, anhand deren Diskurse interpretiert werden können, sondern auch jene, die die Entstehung von Diskursen grundsätzlich voraussetzen.
Ein Anspruch auf eine vollständige Diskursanalyse etwa im Sinne des DIMEAN-Modells (vgl. Kap. 5.3) wird nicht erhoben. Wenn auch Bereiche der Lexik und Metaphorik teilweise angesprochen werden, das Forschungsinteresse liegt primär auf der transtextuellen Ebene sowie auf der Ebene der Akteure. Die vorliegende Arbeit möchte nämlich in erster Linie die Argumentationsstruktur im Kontext der handelnden Akteure ermitteln, die im Hintergrund des Flüchtlingsdiskurses aktiviert wird. Auf der Argumentationsebene werden die sog. agonalen Zentren erschlossen, die „im Sinne diskursiver Wettkämpfe um Geltungsansprüche“ (FELDER et al. 2012: 20) das Handeln der Diskursakteure (un-)bewusst beeinflussen. Voraussetzung dafür ist das Entschlüsseln entsprechender Diskursmarker auf der Textoberfläche, die als deren unmittelbare sprachliche Manifestationen gelten. Damit wird die Basis für das Aufzeigen von Sprachgebrauchsmustern geschaffen. Diese fungieren als sprachliche Manifestationen von Topoi im Sinne von kollektiv verankerten und individuell abrufbaren vordiskursiven Größen, die zugleich die Argumentation im Diskurs sowie Akteurpositionen und Diskursentwicklungen maßgebend bestimmen.
Andererseits liegt der Forschungsschwerpunkt auf der Komponente der Diskursakteure, wodurch auch eine sozialwissenschaftliche Perspektive in die Analyse einbezogen wird. Die an dem jeweiligen Diskurs teilnehmenden und real existierenden Personen konstruieren und formulieren durch ihre Aussagen und Positionsbestimmungen praktisch den Diskurs. Die Sprache tritt in einer doppelten Funktion auf: einerseits als Instrument des (politischen) Handelns, das eine semantische Dimension eröffnet, indem Begriffe im Diskurs gezielt und in Konkurrenz zueinander eingesetzt werden, andererseits als Voraussetzung für die Existenz des öffentlichen Handelns, so auch der Politik. Sie gilt als ein natürliches Codesystem, um Ideen, Meinungen, Haltungen auszudrücken und zugleich die Wirklichkeitswahrnehmung von anderen Personen zu beeinflussen bzw. Reaktionen hervorzurufen. In Anlehnung an das Saussuresche Zeichenmodell lässt sich die Beziehung zwischen Zeichen und Bedeutung sowie Sprache und Sprachbenutzer als dynamisch betrachten. So, wie die Bedeutung eines sprachlichen Zeichens im jeweiligen Kontext immer wieder aktualisiert werden kann (z. B. Migrant als 1. eine Person, die sich von einem zu einem anderen Ort bewegt und 2. im Sinne von Flüchtling, Fremder, unerwünschte Person), verfügen die im Diskurs handelnden Akteure – hier: politisch relevante Entitäten – über keine vorprogrammierten Denkweisen und Haltungen. Diese formieren sich unter dem Einfluss von anderen Akteuren und das Instrument Sprache wird dementsprechend immer wieder der jeweils aktuellen Absicht angepasst (vgl. NONHOFF 2017: 492–494). Die dadurch entstandene Diskursdynamik wird insbesondere auf der lexikalischen Ebene deutlich, insofern die konkurrierenden Begriffe sog. semantische Kämpfe generieren.
Vor diesem Hintergrund kommt hier der lexikalischen Ebene eine sekundäre Rolle zu. Wortschatzelemente drücken als Sprachthematisierungen Einstellungen und Positionen der Diskursakteure aus. Hier wird die Ansicht vertreten, dass die Ermittlung und Interpretation des Diskursvokabulars lediglich im Kontext der als Basis dienenden Argumentationsstruktur möglich ist. Schlüsselwörter, Fahnenwörter sowie die Metaphorik gelten daher als Manifestierungen der argumentativen Tiefenstrukturen auf der sprachlichen Oberfläche, wobei zwischen den drei Ebenen ein direkter Zusammenhang besteht (vgl. NIEHR 2004: 106). Es ist anzunehmen, dass Änderungen in der Argumentation auch einen Wandel in der Lexik sowie der Metaphorik auslösen. Um solche Änderungen im Diskurs zu beobachten, ist jedoch eine diachrone Perspektive erforderlich, die über den Rahmen der vorliegenden Arbeit hinausgeht.





























