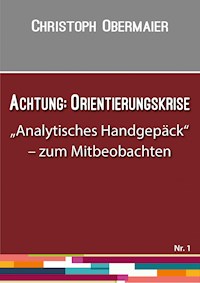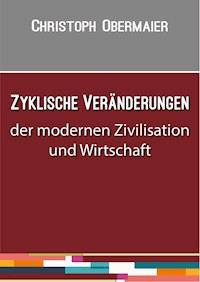
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Ab 2015 (1915, 1815...) erlebt die moderne Zivilisation jeweils eine Orientierungskrise: eine Zeit höchster geistiger und kultureller Produktivität, aber menschlich, gesellschaftlich und politisch belastend, mit einem stereotypen, strukturierten Verlauf von begrenzter Dauer. Diese Phase ist Teil eines zyklischen Wandels der modernen Zivilisation, in den auch die Wirtschaft eingebunden ist. Damit finden die großen Wirtschaftszyklen (Kondratieff-Zyklen) erstmals eine schlüssige Erklärung. Der Essay enthält umfassende prognostische Aussagen und Zeittafeln zu den bevorstehenden dramatischen Wendungen unseres Zeitalters.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 152
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christoph Obermaier
Zyklische Veränderungen
der modernen Zivilisation und Wirtschaft
Imprint
Christoph Obermaier Zyklische Veränderungen der modernen Zivilisation und Wirtschaft
published by: epubli GmbH, Berlinwww.epubli.de
Copyright: © Dr. Christoph Obermaier ISBN 978-3-7418-2823-2
Lektorat: Dr. Stefanie Obermaier Konvertierung: sabine abels | www.e-book-erstellung.de
www.zeitanalyse.de
Einleitung
0.1. Zur Beobachtung großer Zyklen in der Wirtschaft
Dass es im Prozess der Wirtschaft zyklische Veränderungen gibt – und zwar im großen Maßstab, mit Perioden von mehreren Jahrzehnten –, dieser Gedanke wurde erstmals 1926 von Nikolai Kondratieff auf Deutsch publiziert [1], also vor nun 90 Jahren, aber zeitnah auch auf Englisch, Russisch und Französisch [2]. Und bis heute hat er als Diskussionsgegenstand hohe Aktualität, ohne dass jedoch die – zumal prognostische – Belastbarkeit dieser Auffassungen geklärt wäre [3].
Enorme Ausdehnung
Und dabei geht es um zyklische Vorgänge, die offenbar 30 bis 60 Jahre überwölben – also nicht etwa nur um vorübergehende konjunkturelle Schwankungen von wenigen Jahren oder um bloße Störungen des ökonomischen Gleichgewichts durch Zufälle oder identifizierbare und korrigierbare Fehlentwicklungen.
Fast möchte man, in Anlehnung an einen geschichtsphilosophischen Begriff, sagen, es handele sich um eine Theorie des ökonomischen Schicksals. Beispielsweise fänden junge Menschen zu unterschiedlichen Zeitaltern höchst verschiedene wirtschaftliche Bedingungen vor; nicht anders Menschen in ihren mittleren Jahren ebenso wie Ältere: immer je nach der gesamtwirtschaftlichen Situation, in die die Lebensphase der einzelnen fällt. – Und das läge nicht an äußeren Ereignissen oder am Unvermögen von Wirtschaftspolitikern, sondern entspräche der Natur der Wirtschaft selbst. Nicht zu jeder Zeit ließen sich in gleicher Weise Wachstum und Prosperität generieren.
Potentielle prognostische Relevanz
Kurz: Sofern sich derartige Zyklen der Wirtschaft analytisch „festmachen“ lassen, sind sie von großer prognostischer, zeitanalytischer, wirtschaftspolitischer Relevanz. Diese erstreckt sich auf Unternehmensentscheidungen, öffentliche Investitionen, die Währungspolitik der Zentralbanken und nicht zuletzt die Zukunftsplanungen der privaten Haushalte. – Aber es ist bislang bei einer potentiellen Relevanz geblieben. Denn der bisherige Forschungsstand weist offene und ungeklärte Fragen auf.
Offene und ungeklärte Fragen
Diese offenen Fragen – man könnte auch sagen, dieser „Klärungsbedarf“, diese wissenschaftlichen Desiderate –
betreffen sowohl die genaue zeitliche Gestalt der Zyklen
als auch ihre Erklärung durch stringente Ursachen.
Beschleunigt sich die Abfolge der Zyklen möglicherweise? Wie gut trifft die Wellenform zu? Beginnt bereits ein weiterer Zyklus (wie von Leo Nefiodow postuliert)? [4] Überlagern sich verschiedene Zyklen? Fallen sie künftig ganz aus? Oder waren sie – auch das wird diskutiert – ohnehin eher ein theoretisches Konstrukt? [5]
Zyklen über die Wirtschaft hinaus: Zivilisationszyklen
Dazu möchte dieser Essay neue Aspekte beitragen: Im „Hintergrund“ der Wirtschaftswelt vollzieht sich nämlich, wie zu zeigen ist, ein machtvoller Zivilisationswandel. Wer sich – wie der Autor – der Analyse dieses Vorgangs verschrieben hat, erkennt daran unschwer dessen partiell-zyklische Gestalt.
Und weiter: In vielfältiger Weise unterliegt die Welt der Wirtschaft diesen Einflüssen des Zivilisationswandels – ohne dass es sich um deterministische Einflüsse handeln würde (nicht anders als in der Kultur, der Politik, der Religion). Eine ganze Reihe von Wirtschaftsphänomenen lassen sich, wie zu argumentieren ist, auf diese Weise besser – oder überhaupt – verstehen. Auch solche, die Konjunkturverläufe betreffen. Doch genauer:
0.2. Zyklen in vielen anderen Zivilisationsbereichen – koextensiv
Neuer breiterer Ansatz
Von Anfang an – bereits von Kondratieff selbst – wurde der gewissermaßen „interdisziplinäre“ Charakter der Konjunkturzyklen bemerkt, gehen sie doch mit kulturellen, wertmäßigen, strukturellen und offenbar selbst politischen Veränderungen einher. [6] D.h., das Thema der großen Zyklen in der Wirtschaft
weist von Anfang an über die wirtschaftliche Konjunktur
und sogar über die Wirtschaft hinaus.
Wie im ersten Teil zu zeigen ist, kennzeichnet dies den Erklärungsbedarf: nämlich den an sinnvolle Erklärungen gestellten Anspruch. Entsprechende Anstöße gab es bereits. [7] D.h., die Zivilisationsforschung wäre schon seit langem am Zug; doch es ist die Aufgabe unserer Zeit, dass man interdisziplinäre Ansätze entwickelt.
Zyklen auch in vielen weiteren Zivilisationsbereichen zu beobachten
Der Autor möchte zu dieser Diskussion auf der Basis eigener – qualitativer, interdisziplinärer – Forschungen, beitragen. Denn wer andere Zivilisationsbereiche auf ihre „Prozesseigenschaften“ hin analysiert – von der Kultur über die Ideengeschichte bis zur Politik – macht frappierende Beobachtungen:
Auch dort gibt es zyklische Vorgänge (die natürlich in eine „lineare“ Entwicklung einbeschrieben sind).
Und legt man diese „Geschichtsstränge“ gewissermaßen „übereinander“ (= Abgleichungsforschung), so zeigt sich, dass sie eine verwandte Gestalt besitzen: In den unterschiedlichsten Bereichen treten, jeweils zeitnah, charakteristische Brüche (Neuerungen, Wendungen) ein.
Folglich ist die Wirtschaft in einen übergreifenden, in Zyklen strukturierten Zivilisationswandel einbezogen.
Zyklen des menschlichen Wandels
Der Gedanke liegt nahe, dass hier eine gemeinsame Ursache – für diesen gesamten Zivilisationswandel – am Werk sein muss. Doch die „üblichen“ Erklärungsmuster – politische, ökonomische, kulturelle, soziologische – greifen nicht wirklich. Sie sind rasch widerlegbar.
Schließlich führen weitere Analysen zu folgender Ursache: Man wird gewahr, dass in den unterschiedlichsten Zivilisationsbereichen ein verwandter Stand des Menschen zum Ausdruck und zur Auswirkung kommt. Aus forschungsgeschichtlicher Sicht sei an dieser Stelle angemerkt, dass dies bereits von der entstehenden Geschichtsforschung des 19. Jahrhunderts bemerkt worden war (Hippolyte Taine) – die oft noch einen wacheren Sinn für interdisziplinäre Zusammenhänge besaß als spätere Zeiten; wir heutigen AnalytikerInnen sind gerade dabei, uns diese interdisziplinäre Sicht wieder anzueignen – nun jedoch mit neuen, besseren Methoden.
U. a. regelmäßige Orientierungskrisen
Und weiter: Durch geeignete (diachronische) Analysen stellt man fest, dass dieser Stand des Menschen einem zyklischen Wandel unterliegt:
So zeigt sich, dass unterschiedliche Zeiten ein ganz verschiedenes Lebensgefühl aufweisen. Es gibt Zeiten eines verzagten, krisenhaften – und Zeiten eines selbstbewussten, beflügelten, zuversichtlichen Menschseins.
Viele weitere Merkmale des Menschseins sind davon ebenfalls betroffen: Bedürfnisse, Verhaltensweisen, die Neigung zu Kooperation oder Konflikt.
Diese Veränderungen des Menschseins folgen einem festen Schema: Sie sind zyklischer Natur.
Und sie strahlen machtvoll auf Gesellschaft, Wirtschaft, Politik aus.
Die – für das menschliche Selbstverständnis – ungünstigen Zeiten lassen sich auf Orientierungskrisen zurückführen, die günstigen Zeiten hingegen auf deren Bewältigung (durch eine Neuorientierung). Im Übrigen befinden wir uns derzeit (seit 2015) am Beginn einer solchen Krisenphase. – Krisenphasen münden immer – nach einer Abfolge von festen Stadien – in eine Neuorientierung.
0.3. Thesen und Folgerungen
Neue Befunde: Wandel der Zivilisation, des Menschen, seiner Orientierung
Ich fasse dies nochmals thesenartig zusammen: Der entscheidende Befund besteht darin,
dass zeitlich-koextensive – Zyklen
in vielen weiteren Zivilisationsbereichen
festzumachen sind.
Als dessen Ursache lassen sich Veränderungen unseres kollektiven Menschseins in der westlichen Zivilisation feststellen. – Hinweise auf diesen im Verborgenen wirkenden
„Megafaktor“ menschlicher Wandel
reichen bis zur beginnenden Geschichtsforschung des 19. Jahrhunderts zurück.
Was den menschlichen Wandel seinerseits auslöst, sind – höchst lapidare, immer gleich strukturierte – Veränderungen unserer Orientierungsgrundlagen:
Orientierungszyklen
.
Die Wirtschaft ist also in einen umfassenden, zyklisch strukturierten Zivilisationswandel eingebettet. Diese Einbettung ist allerdings differenziert zu beurteilen. Beispielsweise sind Krisenphasen des Menschen gleichzeitig Hochphasen der Innovation – also keineswegs als wirtschaftlich ungünstig einzuschätzen.
Erst die Logik des Orientierungswandels erklärt viele jener Verläufe und Strukturen des Wandels, die uns in so vielen Zivilisationsbereichen begegnen – von der Wirtschaft über die Politik bis zu den Kulturgattungen.
Folgerungen für das Bild der Wirtschaft
Dem Autor entgeht nicht, dass sich damit das Bild der Wirtschaft selbst verändert:
Der Prozess der Wirtschaft hat einen hochwirksamen (weil auf das Gesamte der Zivilisation wirkenden) Impulsgeber: den menschlichen Wandel (Orientierungswandel).
Und kaum ein anderer Zivilisationsbereich erscheint dessen prägendem Einfluss gegenüber derart offen zu sein wie die Wirtschaft; denn sie ist mit nahezu allen anderen Lebensbereichen vernetzt, ist „multidisziplinär“, ist allen Facetten des Menschseins ausgesetzt.
Von hier aus eröffnen sich neue Perspektiven der Erforschung der Konjunkturzyklen. Möglicherweise rücken diese – bislang ein eher randständiges Thema – näher ins Zentrum des Faches.
Prognostische Anwendung
Damit verbindet sich auch ein prognostischer Wert. Die am Ende dieses E-Books dargestellten Zeittafeln (für die kommenden Jahre wie Dekaden) stellen – wirtschaftsbezogen – Anhaltspunkte zum menschlichen Wandel und Zivilisationswandel zusammen. Sie mögen sowohl zur Orientierung als auch zur kritischen Überprüfung dienen.
Dieser Aufsatz ist insofern der Beginn eines nie endenden Projekts: um die vorgebrachten Modelle mit dem Zukunftsverlauf, so wie er eintritt, abzugleichen. Oder anders gewendet: um diese heranzuziehen, um seine Zeitsituation zu analysieren.
Kurzer Überblick
Einleitung
1. Kapitel: Zum bisherigen Modell der großen Zyklen in der Wirtschaft und dessen Klärungsbedarf
2. Kapitel: Zyklischer Wandel der menschlichen Orientierung – regelmäßig und machtvoll
3. Kapitel: Ausstrahlung des menschlichen Wandels auf die Zivilisation und die Wirtschaft
4. Kapitel: Zyklische Einflüsse auf das Wirtschaftsgeschehen
5. Kapitel: Für ein neues Bild unserer Zukunft: Einflüsse auf Zivilisation und Wirtschaft
1. Zum bisherigen Modell der großen Zyklen in der Wirtschaft und dessen Klärungsbedarf
1.1. Zusammengesetzt aus Befunden und Erklärungen
Warum kommt es im Wirtschaftsgeschehen zu Einbrüchen, Störungen, Schwankungen? Bis heute wird über die Theorie der großen Konjunkturzyklen diskutiert (der sog. Kondratieff-Zyklen, Kondratieff-Wellen). Demnach gibt es unterschiedlich günstige Zeiten, für die man plastisch die Begriffe „Kondratieff-Sommer“ und „Kondratieff-Winter“ geprägt hat: einen Wechsel von Expansion und Kontraktion. [8]
Kondratieffs elementare Beobachtungen
Die Theorie der großen Zyklen erhielt ihre Gestalt durch Kondratieff und Schumpeter. Erstmals hatte vor 90 Jahren Nikolai Kondratieff seine Beobachtungen bekannt gemacht: In verschiedenen Aufsätzen (davon zwei auf Deutsch) veröffentlichte er sein seither vieldiskutiertes Konjunkturmodell. [9] Gegründet auf statistische Forschungen, war er zu einem neuen Bild des wirtschaftlichen Prozesses gelangt: Offenbar nimmt dieser keine kontinuierliche Entwicklung; vielmehr vollzieht sich der Konjunkturverlauf in großen Wellen (Zyklen) – mit ungefähr zwei Zyklen je Jahrhundert.
Exkurs: Prognostisch erfolgreich
Diese entdeckte Gesetzmäßigkeit ermöglichte Kondratieff, für die Mitte des 20. Jahrhunderts einen erneuten großen Aufschwung vorherzusagen: einen vierten Zyklus (nach seiner Zählung), wie er tatsächlich eintrat und damit die Prognose in überwältigender Weise bestätigte – man denke an Begriffe wie „Wirtschaftswunder“ und „Golden Age“ (Eric Hobsbawm). Und auch der Abschwung in den 1970ern sowie ein fünfter „Kondratieff“ in den letzten Dekaden des Jahrtausends fügte sich in das Schema der Zyklen ein. [10]
Nikolai Kondratieff, ursprünglich Jurist, hatte in der russischen Revolution kurzzeitig ein hohes Regierungsamt bekleidet und dann ein eigenes Institut zur statistischen Wirtschaftsforschung gegründet. Vergleichende Analysen von Wirtschaftsdaten ab den 1780er Jahren bis in seine Zeit führten ihn zu seiner neuen Theorie: zur Einsicht, dass es zeitlich-großräumige (zyklische) Schwankungen in der kapitalistischen Wirtschaft (der wichtigsten modernen Länder) gibt: lange „Wellen“ der Konjunktur. [11]
Feststellung langer Zyklen (Wellen)
Für Kondratieff stand im Vordergrund, diese Zyklizität zu beweisen bzw. zu erhärten: „Wir betonen, dass wir diesen Regelmäßigkeiten nur empirischen Charakter beilegen und dass wir keineswegs meinen, in ihnen läge eine Erklärung der langen Wellen.“ [12]
Dabei ging er nicht nur ökonometrisch, sondern auch geschichtsanalytisch vor. Der erste Aufsatz (von 1926) vermeidet jede Kausaltheorie – außer in abwehrender Hinsicht. Wie Kondratieff eingehend – und ganz richtig – betonte, spricht der festgefügte zyklische Charakter dagegen, dass zufällige Vorgänge diese konjunkturellen Schwankungen ausgelöst haben könnten. [13] Sie können nicht auf „'äußeren', 'zufälligen', 'episodischen' Ursachen“ [14] beruhen – weder neuen Technologien noch Kriegen und Revolutionen noch Einbeziehungen von Neuländern in die Weltwirtschaft noch der Vergrößerung der Goldgewinnung. [15] –
In seinem späteren Werk standen also „endo-ökonomische“ Ursachen im Fokus: Investitionszyklen (durch Konkurrenz angetrieben), die zur ansteigenden Welle, dann zum Überangebot, dann zu Syndromen eines problematischen Wirtschaftszustandes führen, bevor eine Rückbildung einsetzt, woran sich der nächste Zyklus anschließt. [16]
Messung – und Erklärung
Wenig später, in den 1930ern, befasste sich Joseph A. Schumpeter mit den großen „business cycles“ [17]. Aus der österreichischen Grenznutzenschule hervorgegangen, später in Bonn, war er damals bereits in Harvard und galt als einer der international führenden Ökonomen [18]. In Anknüpfung an Kondratieff entwickelte er die vorherrschende Erklärung dieser Zyklen: nämlich durch industrielle Basisinnovationen (Schlüsselinnovationen) – auf die nun der Investitionszyklus bezogen wurde.
Auf Schumpeter geht der Vorschlag zurück, diese Zyklen nach Kondratieff als ihrem ersten Beobachter zu benennen, der damals, wie viele andere sowjetische Wirtschaftsforscher, dem großen Terror der Dreißigerjahre zum Opfer gefallen war.
Vertiefung: Schlüsselinnovationen und Investitionen in sie
Schumpeters Deutung hat den Vorzug, eine stärkere Erklärung anzubieten: Basierend auf technologischen Revolutionen, die die gesamte Wirtschaft beflügeln, wird ein darauf bezogenes zyklisches Geschehen ausgelöst: von zunächst besonders glücklichen Investitionen – später, wenn die Märkte mehr und mehr mit den neuen Produkten gesättigt sind – zu immer weniger rentablen Investitionen in diese Produkte.
Eine Beobachtung war für ihn augenfällig und leitete seine Theoriebildung:
Die Wirtschaftsentwicklung der modernen Welt ist höchst „innovationsgetrieben“: Nur so entstand die industrielle Produktion. Dabei gab es je Zyklus einige wenige prägende technisch-wissenschaftliche Innovationen (heute als
general purpose technologies
bezeichnet), die je neue Industrien begründeten: ab 1780 die Dampfmaschine, Textil- und Bekleidungsindustrie; um 1850 einsetzend, die Eisenbahn, Stahl, Transport; um 1900 die Elektrizität, Chemie, die aufsteigende Automobilindustrie und Petrochemie usw.
Durch Investitionen in diese basalen neuartigen Produkte wurde der Aufschwung befeuert, der wiederum vielfältige weitere, die Wirtschaft belebende Innovationen, Bedürfnisse, Käufe nach sich zog.
Der Übergang vom „Kondratieff-Sommer“ zum „Kondratieff-Herbst“, also der fallenden Periode des jeweiligen Zyklus, wird durch allmählich abnehmende Erträge von (zu) spät getätigten Investitionen erklärt; dazu kämen verschärfende Faktoren wie etwa Kreditausfälle.
Vertiefung: Zwei Theorien
Die sog. Theorie der langen Wellen erweist sich somit, bei näherer Beschäftigung mit ihr, als Verbindung von (mindestens) zwei sehr unterschiedlichen Theorien:
Die eine (auf Kondratieff zurückgehend) gilt der ökonometrischen, aber auch geschichtsanalytischen Feststellung langer Zyklen.
Die andere Theorie versucht, diese Zyklen zu erklären: u.a. (in der Deutung von Schumpeter) als Folge von technischen Innovationen. Und in gewisser Weise ist diese erklärende Theorie ihrerseits ein hybrides Gebilde aus unterschiedlichen Theorieelementen.
1.2. Probate und problematische Elemente
Die bisherige Theorie als Zeugnis eines fachlichen Ringens um Erklärung
Beide Theorie-Elemente erfuhren schon frühzeitig Kritik: Man bemängelte zeitnah die von Kondratieff angewendeten zu einfachen stochastischen Methoden [19]. – Und man monierte Defizite von Schumpeters Erklärungen. [20] Gleichwohl enthalten diese aber auch stringente, sinnvolle Elemente.
1. Faktische Basis
Trotz aller Einwände gibt es gewisse faktische Anhaltspunkte, die eine weitere Beschäftigung mit den Zyklen motivieren können:
Unbestreitbar erlebte man ab der Mitte des 19. Jahrhunderts wie ab der Mitte des 20. Jahrhunderts ausgeprägte, langanhaltende Zeiten der Prosperität.
Ebenso können uns die bekannten Krisenzeiten (1873ff, 1929ff, 1973ff) als Eckpunkte dienen, nach denen die sonst übliche rasche Erholung ausblieb.
[21]
Dies sind starke Indizien dafür, dass an den Zyklen „etwas dran“ sein muss – auch wenn Kondratieff und Schumpeter selbst den Erklärungsbedarf nicht befriedigen können.
2. Mächtige Ursachen der Entwicklung
Nächstes Theorieelement: Schumpeter bringt diese Zyklen nun mit dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt in Verbindung: Grundlegenden, revolutionären Innovationen wird eine Schlüsselrolle zuerkannt. – Und in der Tat: Wer könnte daran zweifeln, wie bedeutsam die Dampfkraft, der Eisenbahnbau usw. waren? Es handelt sich um die großen Triebkräfte, ja überhaupt die Voraussetzungen für die Industriegesellschaft. –
3. Beobachtete Schlüsselrolle in den Aufschwung- und Boomzeiten
So lässt sich sicherlich sagen: In den jeweiligen Zeiten der Prosperität und Beflügelung spielte die Diffusion bestimmter Technologien und ihrer Produkte eine Schlüsselrolle – man denke eben an den Eisenbahnbau in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Dies deckt sich mit neuesten Forschungen dazu. [22] Man denke später an die Elektrizität, an den Siegeszug der modernen Chemie.
4. Erklärungslücke: Warum Zyklen?
Doch über die zweifellos probaten (jedenfalls dem Autor probat erscheinenden) Elemente der Theorie hinaus gibt es auch klärungsbedürftige Aspekte: Warum sollten technisch-wissenschaftliche Innovationen ein zyklisches Wirtschaftsgeschehen auslösen? Nochmals:
Man stellt – mit Recht – fest, dass es Zyklen gibt.
Man betont – wieder mit Recht – die Schlüsselrolle der Innovationen für die allgemeine Entwicklung.
Und man beobachtet – wieder mit guter Evidenz –, dass diese Innovationen (bzw. deren Diffusion) innerhalb der Zyklen eine wichtige Rolle spielen: Die Zeiten des Aufschwungs und des Booms sind ganz wesentlich auf sie bezogen.
Aber dann ist, nicht minder nüchtern, festzuhalten: Es gibt keinen intrinsischen – also in diesen Innovationen selbst angelegten – Grund dafür, warum ein zyklisches Geschehen daraus hervorgehen sollte. Dieser Kritikpunkt wurde schon sehr früh – bereits im Folgejahr von Schumpeters Veröffentlichung (von 1939) von Kuznets vorgebracht. [23] Und man könnte hinzusetzen: Selbst wenn dabei zyklische Momente im Spiel wären – dann fehlen gleichwohl die Gründe, warum es zu Zyklen von dieser temporalen Struktur kommen sollte.
Zu bedenken wäre sogar, ob sich das Argument nicht sogar ins Gegenteil wenden ließe: Hatte der technologische Fortschritt nicht womöglich eine verstetigende Wirkung, über alle Zyklen hinweg? [24]
5. Fortsetzung: Investition als Investitionszyklen?
Die „klassische“ (Schumpetersche) Theorie der Zyklen bringt einen weiteren Faktor ins Spiel, nämlich die Notwendigkeit zu investieren, damit diese Innovationen industriell realisiert werden können; damit sie also von rein wissenschaftlichen Innovationen zu wirtschaftlich verwirklichten Innovationen werden. (Der moderne Innovationsbegriff hat ja immer diese Doppeldeutigkeit bzw. doppelte Bedeutung.) Und nun ist wiederum klar:
Innovationen lösen Investitionen aus.
Investitionen können bekanntlich zur optimalen Zeit getätigt werden und höchste Gewinne lukrieren („Pioniergewinne“); können aber auch zu spät kommen; und sie können womöglich zu Blasen führen – wenn weiterhin Gelder in bereits übersättigte Märkte gepumpt werden. So gehören Fehlinvestitionen zur wirtschaftlichen Realität. Kredite können ausfallen.
Indes erneut: Warum ein derart zyklisches Geschehen? Warum in so großen Zeiträumen? Und warum nicht Zyklen von sehr unterschiedlicher Dauer, einmal kürzer, dann länger? Warum sollte, wie man gesagt hat, auf jede Kontraktion wieder notwendig eine Expansion folgen – und umgekehrt? [25]
6. Fortsetzung: Viel umfassenderes Geschehen
Und es besteht, wenn wir uns das Gesamtphänomen betrachten, weiterer Klärungsbedarf:
Warum entstehen Innovationen oft im Abschwung eines Zyklus – wie Kondratieff bereits bemerkt hatte
[26]
? (Man diskutierte u.a. eine stärkere Risikobereitschaft in dieser Situation; `Not macht erfinderisch`, könnte man hinzusetzen. Doch reicht diese Erklärung aus?)
Warum gehen oft politische und militärische Ereignisse mit den Zyklen einher, wie ebenfalls immer wieder – und von Anfang an – bemerkt wurde? Man hat an die Napoleonischen Kriege (bis 1815) und den Spanischen Erbfolgekrieg (bis 1714) erinnert, die jeweils in der analogen Situation stattfanden.
[27]
In jüngerer Zeit wurde auf diesen Aspekt intensiv durch Joshua Goldstein eingegangen.
[28]
Und eine weitere Frage muss beantwortet werden: Warum sind diese Zyklen auch mit gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklungen verknüpft? Können technologische Innovationen wirklich etwas so Spezifisches wie einen Stilwandel in der Kultur einer Zeit auslösen?
[29]
(Aus kulturanalytischer Sicht ist dies gleich zu beantworten: natürlich nicht.)
D.h., es besteht eine Asymmetrie zwischen den gebotenen Erklärungen – und den weitaus reichhaltigeren, erklärungsbedürftigen Befunden. So wurde von Manfred Neumann vorgeschlagen, viel genauer auf die Bedeutung der je vorherrschenden (gesellschaftlichen) Einstellungen zu achten, die die Wirtschaft prägen: Zu manchen Zeiten stehe die Akkumulation von Kapital im Vordergrund, zu anderen dessen Verteilung. [30]
7. Zu geringe Erklärungsleistung – zu umfassende Phänomene
Und d.h., man beobachtete ja längst (und von Anfang an), dass es sich um ein umfassenderes Geschehen handelt, einen „gesamtgesellschaftlichen Struktur- und Wertewandel“ [31], der viele Zivilisationsbereiche und selbst menschliche Einstellungen mit einbegreift. Unschwer sieht man, dass technische Innovationen und Investitionsfragen keine Erklärungskraft für etwas so Großes besitzen wie solche interdisziplinären Zyklen:
Sie erklären weder das Wirtschaftsgeschehen