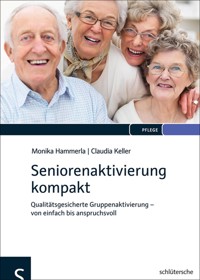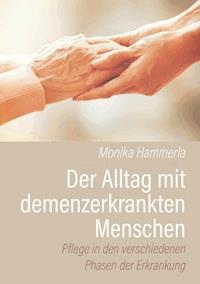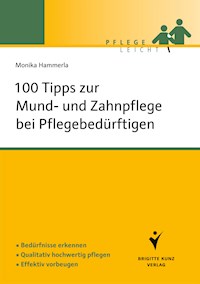
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Schlütersche
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Brigitte Kunz Verlag - Pflege Leicht
- Sprache: Deutsch
Mund- und Zahnpflege gehören zur täglichen Grundpflege. Dennoch werden sie in der Pflegepraxis oft „nebenbei“ und nach Gutdünken erledigt – sind vielfach „Stiefkinder“ der Körperpflege. Genau das ist ein Risiko: Schlechte Mundpflege kann der Beginn von Mangelernährung sein und Entzündungsprozesse im Körper bedingen, mit teils lebensgefährdenden Konsequenzen für die Pflegebedürftigen. Hier muss dringend Abhilfe geschaffen werden. Dieses Buch hilft – gefüllt mit praktischen, schnell umzusetzenden Hinweisen und Anleitungen für den Alltag –, eine gute, gesunde Zahnpflege in Pflegeeinrichtungen und auch zu Hause zu gewährleisten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 109
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Monika Hammerla
100 Tipps zur Mund- und Zahnpflegebei Pflegebedürftigen
Bedürfnisse erkennen
Qualitativ hochwertig pflegen
Effektiv vorbeugen
BRIGITTE KUNZ VERLAG
Die Autorin:
Monika Hammerla ist Fachpflegekraft für Gerontopsychiatrie und Geriatrische Rehabilitation, Fachtherapeutin für Gedächtnistraining (Stengel Akademie Stuttgart) sowie Fachbuchautorin.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der DeutschenNationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet überhttp://dnb.ddb.de abrufbar.
ISBN 978-3-89993-799-2 (Print) ISBN 978-3-8426-8506-2 (PDF)ISBN 978-3-8426-8581-9 (EPUB)
© 2014 Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG,Hans-Böckler-Allee 7, 30173 Hannover
Alle Angaben erfolgen ohne jegliche Verpflichtung oder Garantie des Autoren und des Verlages. Für Änderungen und Fehler, die trotz der sorgfältigen Überprüfung aller Angaben nicht völlig auszuschließen sind, kann keinerlei Verantwortung oder Haftung übernommen werden. Alle Rechte vorbehalten. Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der gesetzlich geregelten Fälle muss vom Verlag schriftlich genehmigt werden. Die im Folgenden verwendeten Personen- und Berufsbezeichnungen stehen immer gleichwertig für beide Geschlechter, auch wenn sie nur in einer Form benannt sind. Ein Markenzeichen kann warenrechtlich geschützt sein, ohne dass dieses besonders gekennzeichnet wurde.
Reihengestaltung:
INHALT
Danksagung
Vorwort
1Basiswissen Zahngesundheit
1. Tipp:Gönnen Sie sich einen Grundkurs in Anatomie – Aufbau der Mundhöhle und ihre Organe
2. Tipp:Informieren Sie sich über verschiedene Arten von Prothesen bzw. Implantaten – wann ist was möglich bzw. sinnvoll?
3. Tipp:Klären Sie die finanziellen Belastungen für Zahnersatz vorab
2Prophylaxen der Mundhygiene
4. Tipp:Verwenden Sie die richtige Putzmethode bei eigenen Zähnen
5. Tipp:Pflegen Sie die Prothese richtig
6. Tipp:Verwenden Sie Haftcreme optimal
7. Tipp:Nachts rein … oder besser raus?
8. Tipp:Kennzeichnen Sie die Prothese
9. Tipp:Tragen Sie Handschuhe und Mundschutz
10. Tipp:Sorgen Sie für geeignete Nahrungsmittel
11. Tipp:Nutzen Sie die Möglichkeiten der Vorsorgeuntersuchungen
12. Tipp:Zahngesundheit setzt regelmäßige Kontrolle beim Zahnarzt voraus
13. Tipp:Nutzen Sie das Bonusheft
14. Tipp:Richten Sie im Heim ein festes Behandlungszimmer ein – haben Sie Visionen!
3Reinigung und Pflege
15. Tipp:Wählen Sie die passende Zahnbürste aus
16. Tipp:Bei MRSA: Einmalzahnbürsten verwenden
17. Tipp:Bei Schluckstörungen Bürsten mit Absaugfunktion verwenden
18. Tipp:Reinigen Sie die Zahnzwischenräume
19. Tipp:Setzen Sie Zungenbürsten ein
20. Tipp:Stellen Sie das richtige Mundpflegeset zusammen
21. Tipp:Vermeiden Sie Mundduschen
22. Tipp:Lassen Sie sich immer durch Apotheken beraten
23. Tipp:Achten Sie auch bei Arzneimitteln und anderen Mitteln auf Hygiene
24. Tipp:Wählen Sie Pflegemittel nach biografischen Vorlieben aus
25. Tipp:Sorgen Sie für die richtige Lippenpflege
4Veränderungen an Zähnen, Mund und Schleimhaut
4.1Risiken
26. Tipp:Rechnen Sie mit den normalen Veränderungen im Alter
27. Tipp:Gleichen Sie nachlassende Sinneswahrnehmungen aus
28. Tipp:Geben Sie Hilfestellung bei degenerativen Veränderungen des Bewegungsapparats
29. Tipp:Gehen Sie depressive Verstimmungen aktiv an
30. Tipp:Achten Sie auf gut eingestellte Blutzuckerwerte
31. Tipp:Nehmen Sie Wesensveränderungen wahr
32. Tipp:Sprechen Sie Suchtproblematik offen an
33. Tipp:Achten Sie auf Nebenwirkungen und Wechselwirkungen von Medikamenten
34. Tipp:Greifen Sie bei Altersarmut aktiv ein
4.2Defizite
35. Tipp:Erkennen Sie mögliche Defizite der Mundhöhle im Vorfeld
36. Tipp:Achten Sie auf Mundgeruch als Alarmsignal
37. Tipp:Sprechen Sie Mundgeruch taktvoll an
38. Tipp:Kontrollieren Sie die Wangentaschen regelmäßig
39. Tipp:Reinigen Sie auch die Zunge
40. Tipp:Gehen Sie gegen Mundtrockenheit vor
41. Tipp:Schaffen Sie Abhilfe bei vermehrtem Speichelfluss
42. Tipp:Bekämpfen Sie Infektionen der Mundhöhle
4.3Erkrankungen
43. Tipp:Ordnen Sie Veränderungen an Zähnen und Zahnfleisch richtig ein
5Besonderheiten in der ambulanten Pflege
44. Tipp:Bieten Sie Unterstützung und klären Sie Angehörige immer wieder auf
45. Tipp:Nehmen Sie Ekel ernst
46. Tipp:Klären Sie alles im Erstgespräch
47. Tipp:Seien Sie Ansprechpartner bei Problemen
48. Tipp:Falls die Prothese verloren geht – bitte erst suchen
6Besonderheiten bei Krankenhausaufenthalten
49. Tipp:Befragen Sie Angehörige zur Zahnpflege
50. Tipp:Berücksichtigen Sie Pflegevorlieben und -gewohnheiten
51. Tipp:Nehmen Sie Beschwerden als Chance
52. Tipp:Erkennen Sie das kurzzeitige Delir (ehem. Durchgangssyndrom)
53. Tipp:Fördern Sie die Selbstständigkeit
7Einzug ins Heim
54. Tipp:Sorgen Sie für die richtige Qualitätssicherung
55. Tipp:Schaffen Sie Klarheit mit einer Ist-Analyse
56. Tipp:Achten Sie bei der Anamnese auf die Details
57. Tipp:Kontrollieren Sie die Hilfsmittel nach jedem Klinikaufenthalt
58. Tipp:Erleichtern Sie die Heimaufnahme mit einer Checkliste
59. Tipp:Erstellen Sie einen genauen Standard für die Zahnpflege
60. Tipp:Nehmen Sie die Angehörigenarbeit ernst
61. Tipp:Profitieren Sie vom Beschwerdemanagement
62. Tipp:Pflegen Sie aktiv den Austausch mit Kollegen
8Qualifikation der Pflegekräfte
63. Tipp:Gehen Sie mit gutem Beispiel voran
64. Tipp:Qualifizieren Sie sich als Fachpflegekraft
65. Tipp:Nehmen Sie regelmäßig an Fortbildungen teil
66. Tipp:Versuchen Sie es mal mit Rollentausch
67. Tipp:Vernetzen Sie sich mit anderen Professionen
68. Tipp:Dokumentieren Sie konsequent und nachvollziehbar
69. Tipp:Arbeiten Sie mit Bezugspflege
70. Tipp:Gestalten Sie die Kontaktaufnahme freundlich und wertschätzend
71. Tipp:Haben Sie Geduld bei der Mundpflege
72. Tipp:Lassen Sie sich nicht hetzen
9Spezielle Erkrankungen/spezielle Situationen
9.1Schluckstörungen
73. Tipp:Handeln Sie bei Anzeichen von Schluckstörungen sofort!
74. Tipp:Beachten Sie eine spezielle Mundhygiene bei Schluckstörungen
9.2Sehminderung
75. Tipp:Unterstützen Sie Bewohner mit Sehminderung
9.3Morbus Parkinson
76. Tipp:Machen Sie sich mit der Parkinsonkrankheit vertraut
9.4Chorea Huntington
77. Tipp:Reagieren Sie richtig bei Chorea Huntington
9.5Demenz
78. Tipp:So pflegen Sie bei Demenz im frühen Stadium richtig
79. Tipp:Achten Sie auf Altbewährtes
80. Tipp:Versuchen Sie, Verwechslungen zu vermeiden
81. Tipp:Kennen Sie die Defizite – schätzen Sie die Fähigkeiten im mittleren Stadium richtig ein
82. Tipp:Führen Sie Pflegehandlungen an die Demenz angepasst aus
83. Tipp:Passen Sie Ihre Vorgehensweise an die Demenz im späten Stadium an
84. Tipp:Regen Sie den Geschmackssinn an
85. Tipp:Pflegen Sie bei Bettlägerigkeit richtig
86. Tipp:Lassen Sie unter Umständen die Prothese weg
87. Tipp:So gelingt die Zungenreinigung bei Demenz
9.6Schlaganfall
88. Tipp:Informieren Sie sich über Schlaganfall
89. Tipp:Begreifen Sie bei Schlaganfallpatienten die Pflege als Therapie
90. Tipp:Ziehen Sie mit allen Therapeuten an einem Strang
91. Tipp:So funktioniert Mundpflege bei Schlaganfallpatienten – Führen nach Affolter
9.7Intensiv- oder schwerst pflegebedürftige Patienten
92. Tipp:Nutzen Sie in der Intensivpflege (Intubation, künstlicher Ernährung mit PEG) Basale Stimulation® (BS)
93. Tipp:Setzen Sie Basale Stimulation® bei der Mundpflege ein
94. Tipp:So gehen Sie bei Tracheostoma vor
95. Tipp:Achten Sie auf Nebenwirkungen der Chemotherapie
9.8Palliativpflege
96. Tipp:Ermutigen Sie die Patienten, Hilfe anzunehmen
97. Tipp:Arbeiten Sie in der Palliativpflege mit dem Patienten zusammen
98. Tipp:Nehmen Sie Rücksicht auf die Bedürfnisse von Sterbenden
99. Tipp:Achten Sie die Würde und die Wünsche des Sterbenden
100. Tipp:Nehmen Sie regelmäßige Supervision in Anspruch
Literatur
Register
DANKSAGUNG
Ein herzlicher Dank gebührt Annette Berghoff, die das Projekt von Anfang an wohlwollend und kritisch begleitet hat. Dr. Dusan Bogojevic danke ich für die zahnmedizinischen Beiträge und meiner Nichte Annette Löhnert für die Beiträge im Bereich der zahnmedizinischen Prophylaxen. Meinen Kolleginnen Edith Hermann und Kathrin Prediger herzlichen Dank für die fachlichen Anregungen.
Meinem Mann Prof. Dr. Dr. Horst Claassen danke ich für die fundierten, gestrafften Anatomiekenntnisse zu Beginn des Buches.
Ahorn, Mai 2014
Monika Hammerla
VORWORT
Die Zahngesundheit der deutschen Bevölkerung hat sich in den letzten Jahrzehnten zum Teil erheblich verbessert. Die Karieshäufigkeit bei Kindern und Jugendlichen ist durch regelmäßige Kontrolluntersuchungen in Kindergärten und Schulen um bis zu 80 Prozent zurückgegangen. Aber auch die Eltern legen heutzutage viel mehr Wert auf gründliche Zahnpflege ihrer Kinder. Vor allem die Sensibilisierung der Erwachsenen für ihre eigene Gesundheit durch verschiedene Kampagnen der Kassenzahnärztlichen Vereinigungen und Bonusprogramme der Krankenkassen haben viel zu dieser positiven Bewusstseinsveränderung beigetragen.
Für den älteren Bevölkerungsteil hingegen, insbesondere die über 60-Jährigen, kam dieser Wandel leider zu spät. Da die tägliche und gründliche Mundhygiene in ihrer Jugendzeit, natürlich oft bedingt durch Armut oder die Kriegs- und Nachkriegszeit, keine große Rolle spielte, kommen nun viele mit den unweigerlichen Folgeschäden in Alten- und Pflegeheime. Dies bedeutet: oft schlechter Gebisszustand und die notwendigen Automatismen von klein auf nicht verinnerlicht. Verstärkt wird das Problem noch durch die höhere Lebenserwartung und die dadurch bedingte Zunahme von schwierigen »Fällen« wie Herzinfarkt-, Schlaganfall- und Demenzpatienten. Was früher in Großfamilien meist belächelt oder gar nicht beachtet wurde (»Oma hat halt keine Zähne mehr«), tritt heutzutage ans grelle Licht einer Öffentlichkeit, die Perfektion in allen Lebenslagen erwartet, aber das erforderliche Engagement und materielle Hilfeleistung nur von anderen einfordert.
Dass Angehörige ein Recht auf bestmögliche Versorgung ihrer Nächsten haben, vor allem dann, wenn sie selbst materiell ziemlich gefordert werden, sieht jedermann ein. Jedoch werden diese Mittel oft zweckentfremdet oder nicht sinnvoll eingesetzt.
Daraus ergibt sich das größte Problem, nämlich die oft katastrophale Situation im Altenpflegebereich. Wenn die finanziellen Mittel nicht ausreichen bzw. zweckentfremdet werden, fehlt es automatisch sowohl an der notwendigen Ausstattung als auch an ausreichend Personal für immer mehr Patienten. Wenn man an die demografische Entwicklung der nächsten 20 Jahre denkt, kann einem angst und bange werden. Es müsste viel mehr Personal eingestellt und speziell geschult werden, denn eine qualifizierte Kraft ist ungleich effektiver als eine ungelernte. Für den Mundpflegebereich sollten die Kassenärztlichen Vereinigungen (KZV) diese Schulungen übernehmen, am besten zweimal pro Jahr. Das Engagement der Pflegekräfte könnte ebenfalls – durch eigene regelmäßige Zahnarztbesuche – wesentlich gesteigert werden, denn wer selbst ausreichend motiviert ist, kann dies viel leichter an seine Patienten weitergeben!
Dies alles kann aber nur gelingen, wenn die Pflegekräfte nicht durch zu viele Aufgaben – auch bürokratischer Art – überlastet werden, denn die wichtigsten Faktoren bei der Altenpflege sind fachliche Kompetenz, ausreichend Zeit und geeignete Räumlichkeiten. Erst dann kann Pflege funktionieren. Wenn man bedenkt, dass einem Zahnarzt bei seinem oft aufwendigen, schwierigen und zeitraubenden Besuch im Pflegeheim nur ein Bruchteil dessen erstattet wird, was er in seiner Praxis bei ungleich leichteren Bedingungen bekommt, muss man sich schon sehr wundern. An dieser Stelle möchte ich meinen Kolleginnen und Kollegen, die sich mit Idealismus und Hingabe dieser schwierigen Aufgabe widmen, meinen höchsten Respekt bezeugen.
Abschließend möchte ich diesem vor allem für das pflegende Personal geschriebenen Handbuch viel Erfolg und eine möglichst weite Verbreitung wünschen. Allein die Tatsache, dass dieses doch recht umfangreiche Buch gerade jetzt erscheint, zeigt mir, dass sich allmählich ein Bewusstseinswandel hinsichtlich einer ganzheitlichen Altenpflege vollzieht, der sich in den nächsten Jahren hoffentlich noch verstärken wird.
Bamberg, im Mai 2014
Dr. med. dent. Dusan Bogojevic
1BASISWISSEN ZAHNGESUNDHEIT
1. Tipp:Gönnen Sie sich einen Grundkurs in Anatomie – Aufbau der Mundhöhle und ihre Organe
(Text Tipp 1: Professor Dr. med. Dr. rer. nat. Horst Claassen, Institut für Anatomie und Zellbiologie der Medizinischen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Große Steinstraße 52, 06097 Halle/Saale, Tel: 0345-557-1708, Fax: 0345-557-1700, E-Mail: [email protected])
Mundhöhle
Die Mundhöhle reicht von der Mundspalte mit den Lippen bis zur Schlundenge. Die Vorder- und Seitenwände der Mundhöhle werden von Lippen und Wangen begrenzt. Das Dach wird vom harten und weichen Gaumen, der Boden vom muskulären Mundboden gebildet. Die beiden Zahnreihen und die von Zahnfleisch überzogenen knöchernen Fortsätze des Ober- und Unterkiefers unterteilen die Mundhöhle in einen Vorhof – zwischen Lippen und Wangen einerseits und Zahnreihen andererseits – sowie in eine Mundhöhle im engeren Sinn innerhalb der Zahnreihen. Der weiche Gaumen, der bei Betrachtung im Spiegel sichtbar ist, trennt die Mundhöhle vom Rachen.
Zähne
Die Entstehung der Zähne beginnt schon im Mutterleib. Beim Menschen entstehen zwei Generationen von Zähnen: das Milchzahngebiss und das Dauergebiss. Aus der Milchzahnleiste entstehen 4 x 5 verschiedenartig geformte Zähne, wobei in einer Kieferhälfte 5 Zähne untergebracht sind. In jeder Kieferhälfte entstehen jeweils 2 Milchschneidezähne, 1 Milcheckzahn und 2 Milchmahlzähne.
Die bleibenden Zähne des Erwachsenengebisses entstehen aus der Ersatzzahnleiste und aus der Milchzahnleiste. Es handelt sich um 4 x 8 Zähne. In jeder Kieferhälfte sind folgende Zahntypen vorhanden: 2 Schneidezähne, 1 Eckzahn, 2 Backenzähne und 3 Mahlzähne. Schneidezähne, Eckzähne und Backenzähne des bleibenden Gebisses gehen aus der Ersatzzahnleiste hervor. Die Mahlzähne, auch als Zuwachszähne bezeichnet, stammen von der Milchzahnleiste ab. Der Durchbruch dieser dauerhaften Zähne reicht vom 6. bis zum 20. Lebensjahr und beginnt mit dem ersten Dauermolaren, der auch als Sechsjahresmolar bezeichnet wird. Der Weisheitszahn kommt heutzutage oft nur unvollständig zum Durchbruch, was zum Teil auf Platzmangel in den jeweiligen Kieferhälften zurückgeht.
Der Aufbau eines Zahnes kann in Zahnkrone, Zahnhals und Zahnwurzel gegliedert werden. Die Zahnkrone ist vom Schmelz, der härtesten Substanz des Körpers, überzogen. Sie ragt in die freie Mundhöhle und hat je nach Zahntyp eine Schneidefläche oder eine Kaufläche. Als Zahnhals wird der Teil des Zahnes bezeichnet, an dem Schmelz und Zement aneinandergrenzen; hier ist das Zahnfleisch befestigt. Schmelz und Zement werden in allen Bereich des Zahnes vom Zahnbein unterfüttert, das einen inneren Körper des Zahnes bildet und die Hauptmasse des Zahnes ausmacht.
Innerhalb des knöchernen Zahnfachs ist der Zahn durch ein spezielles Gelenk befestigt, das eine federnde Aufhängung des Zahnes gewährleistet. Die Aufhängung des Zahnes erfolgt über die kollagenfaserige Wurzelhaut, deren Fasern in dem die Zahnwurzel umgebenden Raum vom Zement zum Kieferknochen ziehen. Zusätzlich ziehen noch Kollagenfasern zum Zahnfleisch.