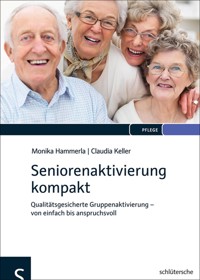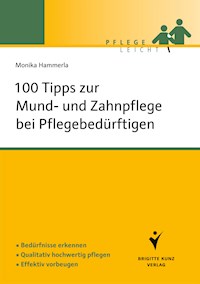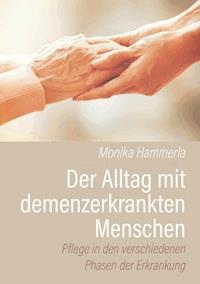
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das Erkennen von Demenz ist der Grundstein für das richtige Handeln. Unsicherheit erzeugt Hilflosigkeit oder sogar Angst. Ein sicherer Umgang mit demenzerkrankten Menschen verringert den Stress bei Pflegenden wie bei der demenzerkrankten Person selbst. Dieses Buch vermittelt Angehörigen und allen Interessierten schnell kompetenten Rat und Hilfe. Schwerpunkte im Buch sind: - Fachgerechter Umgang mit demenzerkrankten Menschen - Schulung für pflegende Angehörige und Interessierte - Schulung für Seniorenbetreuung - Schulung bei schwierigen Fragen, Abwehr, Sexualität - Ressourcenorientierte Schulung - Mobilität, Erinnerung und Vermittlung von Freude
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über die Autorin
Fachpflegekraft für Gerontopsychiatrie und geriatrische Rehabilitation
Gedächtnistrainerin nach Dr. F. Stengel
Fachbuchautorin „Der Alltag mit demenzerkrankten Menschen“, „Seniorenaktivierung kompakt“, „100 Tipps zur Mundpflege“, „Bewegen ist Leben“.
Patent für den „Greifzopf“ Firma Wehrfritz
Seit über 40 Jahren im medizinisch-sozialen Bereich tätig.
Bis Oktober 2017 Leitung der sozialen Betreuung im Team der Flenderschen Stiftung in Seßlach
Dozentin in verschiedenen Einrichtungen
Ausbildung zur Palliativkraft im multiprofessionellen Team in Dresden 2017
Workshops in Senioreneinrichtungen, Tagespflegen, Demenz-WG
Ehrenamtliche Betreuung von pflegenden Angehörigen seit 2003.
Von 2003 bis 2016 bei der FQA Kronach und Hof - Auditorin der FQA a.D.
Mitglied bei der Deutschen Expertengruppe für Demenzbetreuung seit 2015
Inhalt
Vorwort
Einführung
Zum Gebrauch des Buches
Kapitel 1
1. Phase
Diagnostische Werkzeuge bei dementiellen Syndromen
1.1 Kommunizieren
1.2 Sich bewegen
1.3 Vitale Funktionen
1.4 Sich pflegen
1.5 Essen und trinken
1.6 Ausscheiden
1.7 Sich kleiden
1.8 Ruhen und schlafen
1.9 Sich beschäftigen und Tagesstruktur
1.10 Sich als Mann/Frau fühlen
1.11 Für eine sichere Umgebung sorgen
1.12 Soziale Bereiche des Lebens sichern
1.13 Mit existenziellen Erfahrungen des Lebens umgehen
Kapitel 2
2. Phase
2.1 Kommunizieren
2.2 Sich bewegen
2.3 Vitale Funktionen
2.4 Sich pflegen
2.5 Essen und trinken
2.6 Ausscheiden
2.7 Sich kleiden
2.8 Ruhen und schlafen
2.9 Sich beschäftigen und Tagesstruktur
2.10 Sich als Mann/Frau fühlen und verhalten
2.11 Für eine sichere und fördernde Umgebung sorgen
2.12 Soziale Bereiche des Lebens
2.13 Mit existenziellen Erfahrungen des Lebens umgehen
Kapitel 3
3. Phase
3.1 Kommunizieren
3.2 Sich bewegen
3.3 Vitale Funktionen
3.4 Sich pflegen
3.5 Essen und trinken
3.6 Ausscheiden
3.7 Sich kleiden
3.8 Ruhen und schlafen
3.9 Sich beschäftigen und Tagesstruktur
3.10 Sich als Mann/Frau fühlen und verhalten
3.11 Für sichere und fördernde Umgebung sorgen
3.12 Soziale Bereiche des Lebens sichern
3.13 Mit existentiellen Erfahrungen des Lebens umgehen
Kapitel 4
4. Phase
4.1 Kommuninizieren
4.2 Sich bewegen
4.3 Vitale Funktionen
4.4 Sich pflegen
4.5 Essen und trinken
4.6 Ausscheiden
4.7 Sich kleiden
4.8 Ruhen und schlafen
4.9 Sich beschäftigen und Tagesstruktur
4.10 Sich als Mann /Frau fühlen und verhalten
4.11 Für eine sichere Umgebung sorgen
4.12 Soziale Bereiche des Lebens sichern
4.13 Mit existenziellen Erfahrungen des Lebens umgehen
Kapitel 5
5. Phase
5.1 Kommunizieren
5.2 Sich bewegen
5.3 Vitale Funktionen
5.4 Sich pflegen
5.5 Essen und trinken
5.6 Ausscheiden
5.7 Sich kleiden
5.8 Ruhen und schlafen
5.9 Sich beschäftigen und Tagesstruktur
5.10 Sich als Mann / Frau fühlen und verhalten
5.11 Für eine sichere Umgebung sorgen
5.12 Soziale Bereiche des Lebens sichern
5.13 Mit existenziellen Erfahrungen des Lebens umgehen.
Kapitel 6
6. Phase
6.1 Kommunizieren
6.2 Sich bewegen
6.3 Vitale Funktionen
6.4 Sich pflegen
6.5 Essen und trinken
6.6 Ausscheiden
6.7 Sich kleiden
6.8 Ruhen und schlafen
6.9 Sich beschäftigen und Tagesstruktur
6.10 Sich als Mann /Frau fühlen und verhalten
6.11 Für eine sichere Umgebung sorgen
6.12 Soziale Bereiche des Lebens sichern
6.13 Mit existenziellen Erfahrungen des Lebens umgehen
Kapitel 7
7. Phase
7.1 Kommunizieren
7.2 Sich bewegen
7.3 Vitale Funktionen
7.4 Sich pflegen
7.5 Essen und trinken
7.6 Ausscheiden
7.7 Sich kleiden
7.8 Ruhen und schlafen
7.9 Sich beschäftigen und Tagesstruktur
7.10 Sich als Mann /Frau fühlen und verhalten
7.11 Für eine sichere Umgebung sorgen
7.12 Soziale Bereiche des Lebens sichern
7.13 Mit existenziellen Erfahrungen des Lebens umgehen
Literatur
Register
Vorwort
Demenz – ein Schreckenswort unserer Zeit für Betroffene, Angehörige und Pflegende.
Im gleichen Maß, in dem unsere Gesellschaft altert, steigt die Häufigkeit der typischen Krankheiten des Alters. Dazu gehört auch die Demenz – früher als Altersschwachsinn bezeichnet und dem Alter in ähnlicher Weise zugeordnet wie Altersschwäche, Verschleiß des Bewegungsapparats oder nachlassendes Seh- oder Hörvermögen.
Mittlerweile wissen wir jedoch: Demenz ist keine Alterserscheinung, Demenz ist eine fortschreitende Erkrankung des Zentralnervensystems und eher mit Erkrankungen wie Multipler Sklerose oder Morbus Parkinson vergleichbar, jedoch sind die medikamentösen Behandlungsansätze von eher bescheidenem Effekt.
In Deutschland leiden heute etwa 1, 3 Millionen Menschen an Demenz, und diese Zahl wird weiter zunehmen.
Für den Kranken ist es ein allmähliches Versinken in eine eigene Welt, die Vertrautheit mit den Dingen und Personen des Alltags geht unwiederbringlich verloren. Unmerklich zuerst, sorgsam verborgen vor anderen, beschämt von den fragenden Blicken der Kinder und Freunde, vom Kichern und Lachen der Enkel, dann Angst und Ratlosigkeit in den kleinsten Dingen. . .
Es ist kein fröhliches Vergessen, es macht ratlos, rastlos, wütend, ängstlich, die vertraute Welt geht aus den Fugen. . .
Für Angehörige und Pflegende wird es zunehmend schwieriger, in die Welt des Kranken vorzudringen.
Wir wissen fast nichts über diese innere Welt, aber wir wissen sehr genau, welches Leid für die Betroffenen, Angehörigen und Pflegenden entsteht, wenn es nicht gelingt, Brücken der Verständigung als Zugänge in diese Welt zu bauen.
Demenzkranke können unsere Welt der Worte und Begriffe nicht mehr entschlüsseln, nichts mehr anfangen mit Gesichtern, Namen und Daten, mit den Gegenständen des Alltags. Sie haben aber oft erstaunliche Ressourcen in ihrer emotionalen Erinnerung, die Angehörige und Pflegende nutzen können, um ein Leben mit Lebens-Wert zu ermöglichen – Klänge, Gerüche, Rituale von früher, die mit Wohlbefinden und Glück verwoben sind.
Die Lebensgeschichte des demenzkranken Menschen enthält oft den Schlüssel, der selbst in fortgeschrittenen Stadien der Krankheit seine emotionale Welt öffnen kann und seine Bedürfnisse verstehen und erfühlen lässt.
Achtsam und einfühlsam beobachten und reagieren – kann über Musik, Berührung, Bewegung, aber auch religiöse Ansätze ein neuer Kommunikationsweg zum dementen Patienten geschaffen werden, der besseres Verstehen und Eingehen auf seine Wünsche und Bedürfnisse ermöglicht.
Dieses Buch soll Sie beim vorsichtigen Ertasten und Erfühlen dieses Weges zum Kranken anleiten, ob Sie nun als pflegende Angehörige oder als beruflicher Betreuer mit Demenzkranken umgehen.
Eine solche Anleitung hätte mir nach meiner Niederlassung als Allgemeinarzt manche Erlebnisse der Hilflosigkeit und manchen aus Verlegenheit erfolgten Griff zum Rezeptblock erspart – Demenzkranke brauchen die richtige Pflege nötiger als all die vermeintlichen Errungenschaften der Pharmaindustrie.
Oberhausen, 6. 1. 2009
Ulrich E. Hammerla
Facharzt für Allgemeinmedizin
Naturheilverfahren
Hausarzt-Psychosomatische Grundversorgung
Einführung
Verehrte Leserinnen und Leser,
im Rahmen meiner bisherigen Berufstätigkeit konnte ich in verschiedenen, aufeinander aufbauenden Phasen über fast vier Jahrzehnte Erfahrung im Umgang mit der Pflege und Betreuung von Demenzkranken sammeln.
Während meiner Ausbildung zur Arzthelferin in einer Praxis für Allgemeinmedizin in den 1970er Jahren war eine aktivierende und rehabilitierende Behandlung von Patienten mit dementiellen Symptomen noch eher die Ausnahme. In meiner späteren Tätigkeit als Fachkraft in der Ambulanz bildete die Betreuung alter und damit auch von Demenz betroffener Menschen den Schwerpunkt der Arbeit. Hier war besonders auffällig, dass manche Familien mit der Aufgabe der Pflege eines Erkrankten gut zurechtkamen und damit eine Pflegeatmosphäre tendenziell allseitiger Zufriedenheit erzielt wurde.
Für andere Familien hingegen war diese Aufgabe eine starke Belastung, z. T. eine Überforderung. Gleichzeitig konnte ich die Beobachtung machen, wie langjährig tätige, erfahrene Gemeindeschwestern mit den betreuten Personen, unabhängig von deren Zustand und Reaktionen, intensiv einen zugewandten wertschätzenden Umgang pflegten. Dies war eine Haltung, die mir später während meiner Weiterbildung als »validierender Umgang« in der Fachliteratur wieder begegnete. Diese wertschätzende Haltung wurde mir in ihrer Bedeutung sowohl für die Lebensqualität der betreuten Personen als auch für die langfristige Arbeitszufriedenheit und damit Einsatzbereitschaft der pflegenden Personen während meiner Ausbildung und Tätigkeit in der Altenpflege immer bewusster und wertvoller.
Daraus ergaben sich für mich zwei Folgerungen:
Zum einen die kontinuierliche Weiterbildung, zunächst zur Fachpflegekraft für Gerontopsychiatrie und Geriatrische Rehabilitation, später zur Fachtherapeutin für Gedächtnistraining nach Dr. Franziska Stengel und Palliativpflegekraft.
Durch die Weiterbildungen wurde ich in die Lage versetzt, im Sinne eines wertschätzenden Umganges mit den Kranken dabei zu helfen, ihre noch vorhandene Fähigkeiten zu nützen und durch Training und Herausforderung ohne Überforderung so lange wie möglich zu erhalten und damit den Krankheitsverlauf zu verlangsamen. Gleichzeitig wird dadurch das Wohlbefinden der Kranken in ihrer Situation des Verlustes ihrer gewohnten Fähigkeiten entschieden verbessert.
In der letzten Lebensphase muss sich das Angebot der Pflege verändern, das Umsorgen und begleiten des zu betreuenden Menschen nimmt hier den wichtigsten Raum ein.
Zum anderen widmete ich mich mehrere Jahre der Arbeit mit Angehörigen von dementiell Erkrankten, um ihnen das notwendige Wissen über das Krankheitsbild »Demenz« zu vermitteln. Durch ausreichende Kenntnisse und daraus erwachsende Konsequenzen für die eigene Haltung zu der betreuten Person und für den Ablauf der täglichen Pflege und Betreuung kann eine Situation tendenzieller Belastung und Überforderung für alle Beteiligten entscheidend verbessert und entspannt werden. Hierzu gehört auch das Wissen um die Möglichkeit externer Hilfen, wenn pflegende Angehörige selbst nicht weiter wissen. Durch das genannte Wissen können zeitliche und emotionale Freiräume entstehen, die Kranken und Pflegenden zugutekommen. Das Bemühen, pflegenden Angehörigen Rat und Hilfe zu vermitteln, war für mich auch der Impuls, dieses Buch zu schreiben, in dem vielfältige praktische Informationen, vom allgemeinen zu beobachtenden Krankheitsverlauf der Demenz bis hin zu detaillierten Hinweisen im medizinisch/diagnostischen Bereich, zu rechtlichen Fragen und technischen Hilfsmitteln kurz und übersichtlich zusammengestellt sind.
Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern, dass sie aus der Lektüre Rat und Hilfe für die täglichen Aufgaben in der Betreuung und Pflege von Menschen mit Demenz ziehen können. Für Anregungen zur Erweiterung und Vertiefung einzelner Teilbereiche bin ich dankbar.
Zum Gebrauch des Buches
Die sieben Phasen der Alzheimerdemenz nach Barry Reisberg
B. Reisberg hat die Alzheimerdemenz in sieben Phasen genau beschrieben. Diese Phasen werden anhand der vorhandenen Fähigkeiten und Defizite festgestellt; Auf dieser Basis werden die jeweils geeigneten Pflege-und Betreuungsmaßnahmen ermittelt und durchgeführt.
Dieses Buch gliedert sich in sieben Kapiteln den genannten sieben Phasen entsprechend.
Kapitel 1
1. Phase
In der ersten Phase der Krankheit haben die Betroffenen keinerlei Einschränkungen im Leben. Alle Aktivitäten im Beruf und im privaten Bereich sind ohne Probleme durchzuführen. Die Persönlichkeit und die Intelligenz sind völlig unauffällig. Konzentration, Kurzzeitgedächtnis, Langzeitgedächtnis, Orientierung, Alltagskompetenz und selbständige Versorgung der Person, die Sprache, die gesamte Psychomotorik, Stimmung und Verhalten sowie die konstruktive Rechenfähigkeit zeigen keine subjektiven oder objektiven Veränderungen. (#http: //doctorchat. de/cms/pic/bcrs. htm, 18. Juni2006. #) Die Symptome setzen schleichend ein und schreiten allmählich fort. Jeder Mensch hat sein persönliches Krankheitsbild, geprägt durch seine Ressourcen, die zum einen genetisch, zum anderen durch erlernte Fähigkeiten bedingt sind. In Abhängigkeit davon kommen Symptome der Demenz früher oder später geistig und körperlich zum Tragen. Die erste Phase nach B. Reisberg wird auch die symptomfreie Phase genannt. Diese kann sich über Jahrzehnte erstrecken.
Bei erstem Verdacht auf eine dementielle Erkrankung ist eine fachgerechte Diagnose unerlässlich.
Steht die Diagnose fest, wird bei allen Beteiligten, trotz Betroffenheit, auch Erleichterung zu spüren sein. So kann manches merkwürdige Verhalten der Vergangenheit jetzt leichter eingeordnet werden.
Wichtig ist es nach der Diagnose »Demenz« festzustellen in welcher Phase sich der Betroffene befindet, darauf sind alle Aktivitäten der Betreuung und Pflege abzustimmen.
Alle Aktivitäten, Elemente der Betreuung und Pflege sollen vor allem dazu dienen, Menschen mit Demenz die Fortsetzung eines selbständigen Wohnens unter Beibehaltung ihrer Würde und Lebensfreude zu ermöglichen. (# technische Hilfen für Demenzkranke #)
Durch entsprechende Betreuungskonzepte ist es möglich, ein Fortscheiten der Krankheit zu verlangsamen und die nur wenig beeinträchtigten Phasen zu verlängern.
In den folgenden Kapiteln werden für jede Krankheitsphase 13 »Aktivitäten des täglichen Lebens« beschrieben, in denen die Pflegenden durch Aufgreifen biographischer Merkmale eine Brücke zum Betroffenen schlagen können. Dazu ist es wichtig, zu wissen, wie das Leben des Betroffenen früher aussah. Angehörige und Pflegende sollten wissen, dass im Verlauf einer Demenzerkrankung Verhaltensweisen, die in der Kindheit erlernt wurden, wieder verstärkt erscheinen. Je mehr die Krankheit Demenz fortschreitet und das aktuelle Wissen untergeht, desto wichtiger wird für den Betroffenen die Vergangenheit und desto hilfreicher sind möglichst genaue biographische Informationen über den Erkrankten.
Die Identität des Betroffenen kann durch Einbeziehen detaillierter Biographiekenntnisse noch lange aufrechterhalten werden. Jahrzehntelange gepflegte Gewohnheiten in allen Lebensbereichen sind meist fest in einer Person verankert. Ein möglichst umfassendes und genaues Wissen kann so für die betreuende/n Person/en eine wichtige Brücke zur Persönlichkeit des Betreuenden bilden. Jede noch so unwichtig erscheinende Einzelinformation kann ein wertvolles Steinchen im Lebensmosaik darstellen, über das der Kontakt zur betreuenden Person gelingen kann. Biographische Kenntnisse zur betreuten Person sind zunächst von den Angehörigen zu erfragen. Hierzu kann das Ausfüllen eines klar strukturierten und detaillierten Fragebogens dienen.
Wenn Informationen von Angehörigen nicht zur Verfügung stehen, müssen sich Pflegende selbst ein Bild von der Persönlichkeit des Betreuten machen. Hierzu ist die genaue Beobachtung gerne ausgeführter Tätigkeiten (z. B. Kochen, Handarbeit, Putzen, Aufräumen, Schreiben), die gut in Erinnerung geblieben sind, und gut gekonnte Gedichte oder Lieder sowie Vorlieben beim Essen hilfreich. Hierzu kommt die Art und Weise, wie der Betreute auf eine bestimmte Ansprache, ein bestimmtes Aktivierungsprogramm reagiert.
Entsprechende Aufnahme und Mitgehen sind genauso aussagefähig wie Desinteresse und Abwehr und sollten wahrgenommen werden.
Eine abgerundete Information über die Biographie und Persönlichkeit eines Betreuenden entsteht nicht unter dem Druck des Abfragens, sondern wächst durch sensible Aufmerksamkeit über längere Zeit.
Wichtig ist es auch, dass die biographischen Details nicht nur einer pflegenden Person bekannt sind, sondern auch möglichst detailliert niedergelegt werden (Pflegeplanungen bzw. Tagesstruktur), so dass bei einem Wechsel in der Pflege auch andere Personen darauf zurückgreifen können.
Diagnostische Werkzeuge bei dementiellen Syndromen
Von Prof. Dr. J. Kraft, Zentrum für Geriatrie, Coburg
Derzeit beträgt die durchschnittliche Dauer zwischen ersten merkbaren Symptomen einer Demenz und dem Beginn einer qualifizierten Diagnostik in Deutschland über vier Jahre. »Warum überhaupt (Früh)-Diagnostik der Demenz?« Mit dieser Frage wird man auch heute noch selbst in Fachkreisen gelegentlich konfrontiert.
Alle, die dementiell Erkrankte und deren Bezugspersonen betreuen, geben hier eindeutige Antworten, die durch die gerontologische Forschung gestützt werden:
Die Diagnose ist die Basis einer adäquaten und stadiengerechten Therapie.
Verlauf und Auswirkungen der Demenz sind bei allen Betroffenen mit stadiengerechter Therapie und adäquaten Interventionen positiv zu beeinflussen.
Ca. 10 % aller dementiellen Syndrome sind bei rechtzeitiger Diagnose heilbar.
Durch die Diagnosestellung bekommen viele Patienten überhaupt erst die Chance einer psychosozialen, medizinisch-therapeutischen und pflegerischen Unterstützung.
Eine Diagnosestellung macht erfolgreiche Coping-Strategien möglich: Der Teufelskreis von Scham, Frustration, Depression und Aggression, den derzeit die allermeisten Betroffenen auf Grund fehlender Diagnostik durchlaufen müssen lässt sich insbesondere bei kompetenter früher Intervention positiv beeinflussen und selbst bei noch (nicht) heilbaren Formen erträglicher gestalten.
Zusammengefasst besteht kein Zweifel, dass die Frühdiagnostik kognitiver Beeinträchtigungen essentiell ist und den Verlauf positiv beeinflusst.
Wer diagnostiziert? Primärer Ansprechpartner auch bei Gedächtnisstörungen sollte der behandelnde Hausarzt, Neurologen und Gedächtnisambulanzen sein. Alle Berufsgruppen, die mit älteren Menschen arbeiten, entwickeln zunehmende Kompetenz beim Umgang mit dementiell Erkrankten. Daher ist von Beginn an der Austausch und die enge Zusammenarbeit sehr wichtig.
Welches sind die essentiellen Schritte einer Demenzdiagnostik?
Im Zentrum steht die Eigen- u. Fremdanamnese. Entscheidend ist stets der Einbezug der Bezugspersonen, was mit Sensibilität und Feingefühl geschehen soll.
Eine weitere unabdingbare Säule ist die körperliche Untersuchung, die die Voraussetzung dafür ist, Funktionsdefizite zu erkennen und zu bewerten. Hierzu gehören neben der üblichen Einschätzung von Herz-/Kreislaufsystem, Sinnesorganen, und einem auch von Hausarzt und Internist durchführbaren neurologischen Befund insbesondere auch Elemente des geriatrischen Assessments.
Das Assessment enthält die Funktionsdiagnostik (Organ- und Alltagsfunktionen wie z. B. Mobilität, Kontinenz, Ernährung), die pflegerische Diagnostik bzgl. Kompetenz und Hilfsbedürftigkeit bei der Selbst- und Fremdpflege, die Einschätzung einer evtl. Rehabilitationsmöglichkeit, die Erfassung der persönlichen Lebensplanung des Betroffenen und die gemeinsame Erarbeitung eines individuellen Zieles. Die Erhebung des Barthel-Index, einer genauen Pflegeanamnese u. ggfs. auch Selbsteinschätzungsskalen wie die Bayer-Skala erlauben es, den Hilfs- und Unterstützungsbedarf fachgerecht einzuschätzen. Besonders bewährt hat sich die Reisberg-Skala
Psychometrischen Screeningtests kommt eine besondere Bedeutung zu. Der am häufigsten geführte Test, der allerdings erst mittelschwere Stadien detektiert, ist der MMSE nach Folstein. Weitere Kurz-Screening-Tests sind der Clock-Test z. B. in der Auswertung nach Shulman, der GDS (Geriatrische Depressions-Skala) in der Kurzform nach Yesavage, der DemTect oder der TFDD.
Vertiefende Testverfahren, die meist nur in psychiatrischen oder geriatrischen Gedächtnisambulanzen durchgeführt werden, erlauben wesentlich differenziertere Aussagen als die vorgenannten Screeningtests, allerdings ist ihr zeitlicher Umfang deutlich größer. Genannt seien hier unter anderem die Testbatterie CERAD, das Nürnberger Altersinventar (NAI) und SIDAM und ADAS. Eine fachgerechte Diagnostik beinhaltet neben einer Beurteilung von Affekt und Verhalten differenzierte Aussagen zu den Funktionsbereichen visuell-räumliche Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Gedächtnis/ lernen intellektuelle und exekutiven Leistungen. Gerade in der Frühdiagnostik lassen sich bestimmte Demenzformen testpsychologisch oft sehr gut unterscheiden, wohingegen beim weiteren Fortschreiten der Erkrankungen sich die unterschiedlichen Demenztypen immer uniformer verhalten.
Die Labordiagnostik gehört zu den Basismaßnahmen. Ihr Wert liegt vor allem darin, andere differentialdiagnostisch zu berücksichtigende Erkrankungen wie Schilddrüsenfunktionsstörungen, Elektrolytstörungen und Exsikkose, sowie weitere internistische Ursachen akuter und chronischer Verwirrtheit abzugrenzen. Als obligat gelten hier die Bestimmung des Blutbildes einschließlich Differentialblutbild, der Blutsenkung, Natrium, Kalium, Kalzium, der Leberwerte (Gamma-GT, AST, ALT, AP), der Nierenwerte (Kreatinin, Kreatinin-Clearance, Harnstoff), der Glukose evtl. einschließlich HbA1c, des TSH sowie der Vitamin B12 u. Folsäurespiegel. Bei klinischem Verdacht kommen fakultativ z. B. hinzu: Borrelien-Titer, Harnsäure, Lipidstatus, Urinstatus, HIV-Test, Toxikologie, Drogenscreening, Liquordiagnostik, Lues-Serologie. Der Wert von Bestimmungen z. B. des Tau-Proteins und anderer v. a. mit M. Alzheimer verbundenen Proteinen (in Liquor und Serum) ist derzeit Gegenstand intensiver Forschung.
Zumindest einmal in der Krankengeschichte sollte eine Bildgebung des Gehirns erfolgen. Dies ist insbesondere wichtig zur Unterscheidung von Verwirrtheitszuständen, die auf Tumore, ein Hydrocephalus, ein Schlaganfall oder multiple Ischämien, subdurale Hämatome oder Atrophien zurückzuführen sind. Im MRT sind kleinere Läsionen sowie Schrankenstörungen besser beurteilbar als im CCT. Kostenaspekte müssen hierbei beachtet werden. Andere Verfahren wie SPECT oder PET sind derzeit Gegenstand der Forschung und können die wissenschaftliche Diagnostik bereichern. Eine EEG-Diagnostik soll bei klinischem Verdacht auf Anfallsgeschehen erfolgen, trägt aber meist sonst zur Diagnostik der Demenz nur wenig bei.
Es ist zu hoffen, dass sich insbesondere mit der weiteren Verbreitung von psychiatrischen und geriatrischen bzw. auch interdisziplinären Gedächtnissprechstunden die derzeit noch fatal lange Zeit bis zu einer qualifizierten Diagnose verkürzen wird. Eine besondere Chance liegt darin, interdisziplinäre Demenznetzwerke zu etablieren, durch die niederschwellig und mit praktikablem Aufwand die Qualität der Versorgung nicht nur in den Metropolen, sondern auch im kleinstädtischen und ländlichen Bereich verbessert wird. Gerade durch die aktuellen Forschungsergebnisse zeigt sich, dass sich der Verlauf vieler verschiedener dementieller Erkrankungen umso besser beeinflussen lässt, je eher eine spezifische Therapie erfolgt. »Zeit ist Hirn«!
Prof. Dr. med. Johannes W. Kraft 10/16
1.1 Kommunizieren
Kommunikation bedeutet laut Duden: Verständigung untereinander, Verbindung, Zusammenhang.
Miteinander zu reden ist ein menschliches Grundbedürfnis. Funktionieren verbale Kommunikationstechniken nicht mehr, können nonverbale Formen erfolgreich sein. Pflegende zu Hause wissen, wie die Kommunikation früher funktionierte. Im Verlauf einer dementiellen Erkrankung wird sich das Kommunikationsverhalten verändern. Ein wortkarger Mensch verändert sich vielleicht im Laufe der Krankheit, teilt sich vielleicht stärker mit oder wird ganz stumm.
Menschen mit Demenz verlieren ihre bisherigen Fähigkeiten zu kommunizieren. Pflegende müssen diese Tatsache immer wieder mit einbeziehen. Hilfreich sind hier auf die Fähigkeiten des Betreuten abgestimmte Kommunikationstechniken, die die Betreuungsperson lernen kann.
Alle technischen Hilfsmittel, die die Kommunikation verbessern, sollten genutzt werden.
Hierzu gehören Brillen, Hörgeräte, Prothesen, die die Artikulation verbessern.
Auf regelmäßige Erneuerung bzw. Wartung ist dabei zu achten.
In Bezug auf die Sehkraft ist auch der Abstand bei der Kommunikation von Bedeutung:
Weitsichtige ohne Sehhilfe sehen in der Nähe bis 40 cm Abstand verschwommen, Kurzsichtige ohne Korrekturbrille sehen in einem Abstand über 60 cm nur mehr ungenau unter großer Anstrengung.
1.2 Sich bewegen
Hierbei ist zu beachten, dass es verschiedene Bewegungstypen gibt:
Sportliche Menschen haben Freude an der Bewegung, solange sie sie ausführen können. Gleichzeitig haben sie körperliche Grundkondition, die im Alter eine Ressource an Vitalität sein kann.
Menschen dieses Typs sind leicht zur Bewegung und zu angemessenen sportlichen Aktivitäten zu motivieren. Es gibt jedoch auch das Gegenteil, den Typ des Bewegungsmuffels. Entweder hatte dieser Typ nie Freude an der körperlichen Bewegung, vielleicht weil ihm diese nie vermittelt worden ist, oder er ist durch körperliche Verschleißerscheinungen wie Arthrose oder Krankheiten wie Rheuma in seiner Bewegungsmöglichkeit und -freude stark eingeschränkt. Hier könnten angepasste, sanfte Bewegungsangebote in einer Gruppe ähnlich körperlich Beeinträchtigter zu einer Aktivierung führen.
Grundsätzlich bewirkt Bewegungsmangel eine rasche Abnahme der Muskelsubstanz, ein Nichtbewegen eines Gelenkes führt zu dessen Versteifung, die nach vier bis sechs Wochen nicht mehr zu beheben ist.
Seit Jahren beobachten Sportwissenschaftler, dass sportliche Senioren leistungsfähiger und mental fitter sind als Bewegungsmuffel. Regelmäßiges moderates aerobes Training führt zu einer Erhöhung des Proteins BDNF(Brain-Derived Neurothropic Faktor), dieses Eiweiß ist im Gehirn vor allem in den Nervenzellen des Hippocampus, der Hirnrinde nachweisebar. Das Absinken der BDNF-Produktion in Folge von Alterungsprozessen setzt die Fähigkeit des Gehirns zur Verknüpfung und Neubildung von Nervenzellen herab. (Focus S. 122, 2015)
Zu Beginn der Erkrankung ist ein gezieltes Trainieren gut möglich. Hier kann Teilnahme an Seniorensportgruppen und Physiotherapie hilfreich sein. Je beweglicher der Erkrankte ist, desto mehr kann ihm diese Fähigkeit später helfen, solange wie möglich ein selbständiges Leben zu führen, auch wenn nach und nach Einschränkungen auftreten. Beratungen in Stadtteilen nach Neigungsgruppen sind sinnvoll
Gezieltes Training erhält vorhandene Fähigkeiten und trägt dadurch positiv zu Selbstwertgefühl und Lebensfreude bei.
Im stationären Bereich wird zum Einzug auf eine Erhaltung der Ressourcen geachtet. Die Fachkraft kennt im Umfeld geeignete Angebote, sie hat ein Verzeichnis und kennt durch ein gutes Netzwerk die jeweiligen Kontaktpersonen, die für eine individuelle Bewegung für den neuen Bewohner in Frage kommen.
Buchtipp: Monika Hammerla, Bewegen ist Leben, Schlütersche Verlagsgesellschaft 2016
1.3 Vitale Funktionen
Ältere Menschen sind es aus ihrer früheren Erfahrung selten gewohnt, dass dem eigenen Körper und seiner Funktion große Aufmerksamkeit gewidmet wird. Deshalb ist ihnen auch häufig nicht bewusst, dass sich bestimmte Krankheiten durch eine gesunde Lebensführung vermeiden lassen. Aus diesem Grunde werden überwiegend von älteren Menschen die empfohlenen Vorsorgeuntersuchungen, durch die sich entwickelnde Krankheiten in einem frühen, gut behandelbaren Stadium erkannt werden können, nicht im ausreichenden Maße wahrgenommen. Der menschliche Körper kann Funktionsstörungen über lange Zeit kompensieren, bis er krankheitsbedingte Ausfallerscheinungen zeigt. Als Beispiele seien hier Stoffwechselkrankheiten wie Diabetes, Gicht und krankhafte Veränderungen der Blut-Cholesterinwerte, aber auch hoher Blutdruck, Rheumatismus, Arthrose und Demenz genannt. Veränderten Blutwerten bei Altersdiabetes kann mit Bewegung und Diät begegnet werden, schon bevor eine medikamentöse Behandlung nötig ist. Erhöhter Blutdruck muss wegen des damit verbundenen Schlaganfallrisikos durch geeignete Medikation auf eine verträgliche Höhe eingestellt werden. Rauchen sollte schon wegen der Gesundheitsrisiken unterlassen werden, mit dem zunehmenden Verlust bisher gewohnter Fähigkeiten des Gehirns im Laufe der Demenzerkrankung stellt Rauchen durch die damit verbundene Brandgefahr auch ein Sicherheitsrisiko für den Betroffenen und andere Personen dar. *. *(Kap. 6. Phase 6. 11. ) Alkoholgenuss in Maßen ist zunächst unbedenklich, Richtwert ist hier ein Schoppen Wein, d. h. 0, 25 l am Tag bei Männern, bei Frauen hiervon nur zirka die Hälfte. Gewarnt werden muss jedoch vor Alkoholgenuss bei Einnahme von Medikamenten, die in Verbindung mit dementiellen Abbauprozessen im Gehirn zu akuten Verwirrtheitszuständen führen kann.
1.4 Sich pflegen
Die Hygienevorstellungen älterer Menschen, die diese vor 60, 70 oder noch mehr Jahren erworben haben, unterscheiden sich oft deutlich von heutigen Körperhygiene- und Körperpflegegewohnheiten.
Vor 60 Jahren musste das Badewasser auf dem Land teilweise noch vom Brunnen geholt werden, es gab einen Badetag in der Woche, an dem das Badewasser erwärmt wurde, so dass ein wöchentliches Vollbad schon die Obergrenze der Ganzkörperpflege darstellte. Auch hierbei zeigt sich die große Bedeutung biographischer Kenntnisse bei den Pflegenden. Seit den 50-iger Jahren wird eine Bad- und Pflegekultur wahrgenommen.
Wichtig ist auch das früher, bis auf die Ausnahme der Freikörperkultur-Bewegung, schambesetzte Verhältnis zum nackten menschlichen Körper. Kinder sahen ihre Eltern nie nackt, auch in den Massenmedien gab es selten Darstellungen nackter Menschen, diese beschränkten sich auf Werke der bildenden Kunst. Sie wurden nur von Angehörigen der Bildungsschicht zur Kenntnis genommen und hatten auch in diesen Fällen kaum Auswirkungen auf die alltäglichen Gewohnheiten.
1.5 Essen und trinken
Mit zunehmendem Alter verändert sich der menschliche Körper, die eigenen Zähne werden locker, Zahnprothesen können nach längerem Gebrauch ihre Passform und ihren Halt verlieren. Regelmäßige Besuche beim Zahnarzt sind zu Beginn der Krankheit noch kein Problem. Buchtipp: 100 Tipps zur Mund-und Zahnpflege bei Pflegebedürftigen, Monika Hammerla, Brigitte Kunz Verlag 2014
Die Speichelproduktion kann, manchmal durch Medikamente verstärkt, herabgesetzt sein. Die Geschmacks- und Geruchswahrnehmung sind häufig vermindert, dadurch kann der Appetit verändert sein. Bei verändertem Appetit, aber noch vorhandenem
Geruchssinn ist eine Anregung der Esslust über Geruchseindrücke, die direkt Erinnerungen hervorrufen können, möglich. Die Essensvorlieben können sich verändern, häufig tritt eine Neigung zu Süßspeisen auf. Grundsätzlich jedoch sind meist althergebrachte Gerichte aus der Kinder- und Jugendzeit besonders beliebt. Häufig ist das Wissen um lebensnotwendige Inhaltsstoffe der Nahrung nicht vorhanden. Die Altersarmut beziehungsweise Kauschwierigkeiten stellen ein weiteres Problem bei der ausgewogenen Nahrungsaufnahme dar. Für die aus neueren medizinischen Erkenntnissen bekannte Bedeutung der Flüssigkeitsaufnahme ist es wichtig, zu wissen, dass früher regelmäßiges und ausreichendes Trinken, auch bei sommerlicher Hitze, eher ungewohnt oder gar v. a. bei Frauen verpönt war.
Die Neigung, zu wenig zu trinken, kann ihren Grund auch im Vermeiden häufiger Toilettengänge haben.
Bei zunehmender Demenz wird das Trinken häufig vergessen, was im Extremfall zu einer Verstärkung der Verwirrtheitssymptome führen kann.
Bei Essen sollte eine entspannte Atmosphäre herrschen. Wichtig ist auch die Tischkultur, die der Erkrankte gewohnt ist. Wurde in der Küche gegessen oder gab es ein Esszimmer, gab es besonders gutes Geschirr nur für festliche Anlässe?
1.6 Ausscheiden
Für die heute um die 85-jährigen ist der Bereich der Verdauungssauscheidungen häufig mit Ekel- und Schamgefühlen besetzt.
Eine oft zu frühe oder zu strenge Sauberkeitserziehung hat zu einer Tabuisierung dieser Körperfunktionen geführt. Daraus können massive Abwehrreaktionen beim Erkrankten, z. B. bei der Begleitung zur Toilette resultieren. Je mehr Wissen der Pflegende von dem Betroffenen hat und je mehr er peinliche Situationen zu vermeiden sucht, bzw. unvermeidliche Peinlichkeit durch Freundlichkeit, Zuwendung oder Ablenkung mildern kann, desto entspannter kann dieser kritische Bereich behandelt werden.
1.7 Sich kleiden
Kleidungsgewohnheiten gehen durch die tägliche Wiederholung des Anziehens in Fleisch und Blut über. Auch die fest eingespielten in immer gleicher Reihenfolge ablaufenden Vorgänge des An- und Auskleidens spielen bei zunehmender Demenz eine wichtiger werdende Rolle als bekanntes Element. Für die ältere Generation gehörte die Unterscheidung von Alltags- bzw. Arbeitskleidung und »Sonntagsstaat« zum Verlauf einer Woche. Frauen trugen Schürzen zur Arbeit, ältere Frauen, besonders Witwen, kleideten sich v. a. in gedeckten und dunklen Farben, wurden dadurch tendenziell unsichtbar. Die Menschen hatten weniger Kleidungstücke, so dass die einzelnen Teile länger getragen werden mussten, mit der Notwendigkeit wiederholter Reparatur. Von früher gewohnte Kleidung gibt Sicherheit und vermittelt Vertrautheit, man fühlt sich wohl in seiner Haut.
1.8 Ruhen und schlafen
Ruhe und Schlaf sind anfangs nicht verändert. Die Notwendigkeit eines altengerechten Bettes sollte erwogen werden. Pragmatische Lösungen, wie unter jedem Bettfuß ein ca. 15 cm hoher, durch große Auflageflächen nicht kippgefährdeter Holzquader, helfen schon beim Zubettgehen und Aufstehen.
1.9 Sich beschäftigen und Tagesstruktur
Wie verbrachten die Menschen vor 50, 60, 70 Jahren ihre Freizeit? Welchen Berufen gingen sie nach, wo und wie erwarben sie Geschicklichkeit und Fähigkeiten? In Auszügen aus der Facharbeit (#Häusliche Pflege von dementen Angehörigen und Möglichkeiten der Entlastung in der Stadt Rödental für pflegende Angehörige, M. Hammerla, 2002#) siehe Anhang.
Hobbies wurden von allen Befragten gepflegt, jeder Befragte hatte seinen Bereich, dem er in seiner Freizeit zur Entspannung nachging. Es wurde viel gesungen. Die Lieder der Kindheit, Kirchenlieder, ein vertrautes Instrument oder die Schlager von früher zu hören, sind ein wichtiger Schlüssel, um mit einem Menschen mit Demenz in Kontakt zu treten. Musik wird bei zunehmender Demenz immer wichtiger, um Kontakt zum Betroffenen aufzunehmen.
Beschäftigungen, die jahrzehntelang eingeübt wurden, sind lange abrufbar.
Die Frauen arbeiteten im Garten oder hatten Handarbeit als Ausgleich. Bei den männlichen Befragten war Wandern der Favorit.
Arbeit und Hobbies sind für spätere Aktivitäten eine große Ressource. Was gerne getan wurde, geht noch lange von der Hand, motiviert noch, wenn kognitive Einschränkungen schon da sind. Bekannte und beliebte Fähigkeiten werden noch lange verrichtet und gerne gezeigt. Die Inhalte der Beschäftigung sollten den Interessen der Menschen mit Demenz angepasst sein. Die Emotionalität bleibt gegenüber dem Gedächtnisvermögen erhalten, deshalb sollten Gruppenaktivitäten (nicht > 10 Personen) mit heiteren Beiträgen, Biographie, Singen im Vordergrund stehen. Im häuslichen Bereich können pflegende Angehörige durch ihr Wissen um die Familiengeschichte viel zur Entspannung des Betroffenen beitragen. Das Wissen der Angehörigen ist ein wichtiger Schlüssel zur Ressource der Betroffenen.