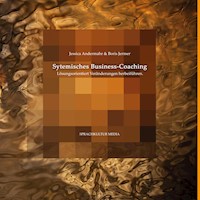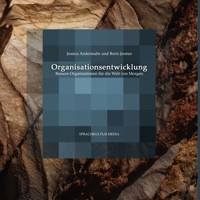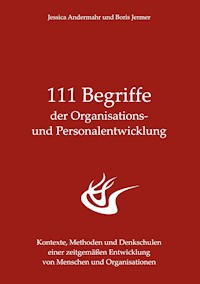
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die individuelle Sprache in einer Organisation ist immer Zugang zum Denken, zu Logiken, zur Haltung und zu der Art, wie wir die Welt sehen. Wollen wir den Blick auf unser Umfeld verändern, ist es ein vielversprechender Ansatz, bei der eigenen Sprachkultur zu beginnen. Seit 2016 entwickeln wir im SPRACHKULTUR-Team unseren gemeinsamen Wortschatz - ein Glossar oder Wörterverzeichnis - im fortlaufenden Dialog, auch mit unseren Kunden. Was sind Elemente und Praktiken von besseren Organisationen in der Welt von morgen mit menschlichem Maß? Wir haben alle im Glossar enthaltenen Inhalte lange Jahre in der Praxis erprobt, reflektiert und weiterentwickelt. Zu jedem Glossar-Eintrag gehört ein Absatz darüber, welche konkrete Bedeutung der Begriff für unsere Praxis bei SPRACHKULTUR und für unsere Kunden hat. Manchen Begriff hören Sie vielleicht zum ersten Mal oder haben sich einfach noch nie intensiver damit beschäftigt, bei anderen könnten Sie erstaunt sein, dass sie in diesem Kontext auftauchen - ein Anfang neu und weiterzudenken. Das SPRACHKULTUR-Glossar erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, und es enthält die für uns und die Arbeit mit unseren Kunden wichtigsten Begriffe und Inhalte - und damit das, woraus wir in unserer Arbeit schöpfen, was uns antreibt und womit wir Sie bewegen möchten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 244
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
EINLEITUNG
ACHTSAMKEIT
AGILE WERTE, TECHNIKEN UND METHODEN
AGILITÄT/AGILE TRANSFORMATION
AIKIDO
AMBIDEXTRIE
AUFTRAGSKLÄRUNG
AUTHENTIZITÄT
BERATUNG/CONSULTING
BLENDED LEARNING/NEUE LERNFORMEN/LERNTYPEN
CHANGE/VERÄNDERUNG/WANDEL
COACHING
COMMON GROUND
DIGITALISIERUNG
DIVERSITÄT/VIELFALT
EFFIZIENZ UND EFFEKTIVITÄT
ENTWICKLUNG
ERFOLG
ENTSCHEIDUNGEN IM KONSENS
FEEDBACK
FRAGEN
FÜHRUNG/LEADERSHIP
FÜHRUNGSLEITLINIEN
FÜHRUNGSSTIL
GENERATIONEN Y UND Z
GESUNDHEITSMANAGEMENT
GEWALTFREIE KOMMUNIKATION
GLAUBENSPOLARITÄTEN - GPA
GROSSGRUPPE
HERAUSFORDERUNG
HIERARCHIE/MACHT
HOLOKRATIE
HYPNOTHERAPIE
INDUSTRIE 4.0
INNOVATION
INTERVENTIONSPYRAMIDE
ITERATION/EVOLUTION
JOB CRAFTING
KOGNITIVE VERHALTENSTHERAPIE
KOMMUNIKATION
KOMMUNIKATIONSKULTUR/SPRACHKULTUR
KOMPETENZ
KOMPLEXITÄT
KONFLIKT/DILEMMA
KONSTRUKTIVISMUS
KONTEXT
KPI - KEY PERFORMANCE INDICATOR/OKR
KULTUR/UNTERNEHMENSKULTUR
LEISTUNG
LERNENDE ORGANISATION/ PREVENTION THROUGH DESIGN
LÖSUNGSFOKUSSIERUNG
MÄEUTIK/SOKRATISCHER DIALOG
MEDIATION
MENSCH-MASCHINE-KOMMUNIKATION
MENSCHENBILD / HALTUNG
MENTORING
METANOIA
MITARBEITER/MITARBEITERBEURTEILUNG
MITARBEITERBINDUNG RETENTION-MANAGEMENT
MODERATION
MOTIVATION
NACHFOLGE/GENERATIONENÜBERGANG
NÄHE UND DISTANZ
NEUROBIOLOGIE
NEW PAY/NEUE VERGÜTUNGSMODELLE
NEW WORK
ORGANISATIONS ENTWICKLUNG
PARTIZIPATION
PERSONALENTWICKLUNG
PLATTFORMÖKONOMIE
POSITIVE PSYCHOLOGIE
POSTWACHSTUMSÖKONOMIE
POTENZIAL
PRIMÄRE AUFGABE/PRIMARY TASK
PRODUKTIVITÄT/PRODUKTIVITÄTS-MANAGEMENT
PROZESSBEGLEITUNG/PROZESSBERATUNG
PSYCHOLINGUISTIK/SPRECHERZIEHUNG
RAUM UND MENSCH
RECRUITING/ASSESSMENT
RESILIENZ
RESONANZ
RHETORIK
ROLLE
SCHNITTSTELLE/NAHTSTELLE
SELBSTORGANISATION
SINN/PURPOSE/WHY/VISION
SPIRAL DYNAMICS
STRATEGIE
STRESSMANAGEMENT
SUPERVISIO/KOLLEGIALE BERATUNG
SYSTEMISCHES DENKEN
TEAMTEAMENTWICKLUNG
THEORY U/PRESENCING
TRAINING
TRANSAKTIONSANALYSE
TRANSVERBALE SPRACHE
TYPOLOGIEN
UNTERNEHMEN/ORGANISATION
VUCA
WERTEWERTEQUADRAT
WISSEN
ZEITKANÄLE
ZEITMANAGEMENT
ZIELE
ZIRKULARITÄT
ZUKUNFTSORGANISATION
ZÜRCHER RESSOURCEN MODELL
EIN TANGO ZUM SCHLUSS
EINLEITUNG
Die individuelle Sprache in einem Unternehmen ist immer Zugang zum Denken, zu Logiken, zur Haltung und zu der Art, wie wir die Welt sehen. Wollen wir den Blick auf unser Umfeld verändern, ist es ein vielversprechender Ansatz, bei der eigenen Sprachkultur zu beginnen. Seit 2016 entwickeln wir im SPRACHKULTUR-Team unseren gemeinsamen Wortschatz – ein Glossar oder Wörterverzeichnis – im fortlaufenden Dialog, auch mit unseren Kunden.
Erstens möchten wir damit informieren und Hintergrundwissen geben. Wir arbeiten bei SPRACHKULTUR auf aktuellen Grundlagen und mit verschiedensten erprobten und in ihrer Wirkung belegten Methoden. Manchen Begriff hören Sie vielleicht zum ersten Mal oder haben sich einfach noch nie intensiver damit beschäftigt, bei anderen könnten Sie erstaunt sein, dass sie in diesem Kontext auftauchen – daher dieses Glossar zum Nachschlagen.
Zweitens möchten wir unsere Haltung und unsere Schwerpunkte näherbringen. Wir haben alle im Glossar enthaltenen Inhalte lange Jahre in der Praxis eingesetzt und weiterentwickelt. Zu jedem Glossar-Eintrag gehört daher ein Absatz darüber, welche konkrete Bedeutung der Begriff für die Arbeit von SPRACHKULTUR und für unsere Kunden hat – daher dieses Glossar zum Eintauchen in unser Handeln.
Das SPRACHKULTUR-Glossar erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber es enthält die für uns und die Arbeit mit unseren Kunden wichtigsten Begriffe und Inhalte – und damit das, woraus wir in unserer Arbeit schöpfen, was uns antreibt und womit wir Sie bewegen möchten.
Anmerkung
Wie es sich für ein Glossar gehört, sind die Einträge alphabetisch geordnet. Um inhaltliche Zusammenhänge zwischen Begriffen herzustellen, verweisen wir an manchen Stellen in Klammern auf eine andere Stelle. So zum Beispiel: (→ Common Ground). Kommen im Text Begriffe vor, die einen eigenen Glossareintrag haben, heben wir diese fett hervor.
ACHTSAMKEIT
Achtsamkeit ist ein Begriff, der in den letzten Jahren schon fast ein wenig zum Trend geworden ist. Dabei ist er alles andere als neu. Die wissenschaftliche Rückendeckung über ihre Wirkung hat die Aufmerksamkeit allerdings zunehmend erst innerhalb der letzten Dekade erhalten. Eine einheitliche Definition, was Achtsamkeit ist, besteht in der Wissenschaft nicht. Eine der in der Forschungsliteratur am häufigsten zitierten Definitionen stammt vom Meditationsforscher und -lehrer Jon Kabat-Zinn. Er definiert Achtsamkeit als eine bestimmte Form der Aufmerksamkeit, die
absichtsvoll ist,
sich auf den gegenwärtigen Moment bezieht (statt auf die Vergangenheit oder die Zukunft) und
nicht wertend ist.
In anderen Definitionen geht es insbesondere um die Bewusstheit von Vorgängen und Erfahrungen, die gerade gemacht werden. Der US- amerikanische klinische Psychologe Daniel Goleman arbeitet in seinen Veröffentlichungen mit der Emotionalen Intelligenz, die auf intrapsychischen und empathischen Fähigkeiten basiert. Für ihn bedeutet Achtsamkeit:
die eigenen inneren Zustände wahrnehmen
eigene Emotionen kontrollieren
eigene Emotionen zum Handeln nutzen
Empathie anderen Menschen gegenüber aufbauen
Der Buddhismus unterscheidet vier „Grundlegungen der Achtsamkeit“:
die Achtsamkeit auf den
Körper
die Achtsamkeit auf die
Gefühle/Empfindungen
(Bewertung als wohl, weh oder weder-wohl-noch-weh)
die Achtsamkeit auf den
Geist
(dessen aktueller Zustand bzw. Veränderungen des Zustands, z. B. abgelenkt, konzentriert, verwirrt)
die Achtsamkeit auf die
Geistesobjekte
(d. h. alle äußeren und inneren Objekte/Dinge, die im Moment wahrgenommen werden)
Verschiedene Studien lassen darauf schließen, dass sich Achtsamkeitstraining und Meditation günstig auf verschiedene Aspekte der Gesundheit auswirken können, wie zum Beispiel auf Stimmung, Lebenszufriedenheit oder die Emotionsregulation. Für uns bei SPRACHKULTUR hat Achtsamkeit eine Bedeutung im Coaching von Einzelpersonen, aber auch als Basisidee für alle unsere Arbeiten mit Gruppen und Organisationen.
Wer achtsam ist, ist bewusst bei dem, was er in diesem Moment gerade tut, und kann sein Handeln aktiv gegenüber seinem Gesprächspartner und entsprechend seinem Ziel in voller Bewusstheit steuern. Er kann die Situation und auch sich selbst dabei quasi von außen betrachten sowie im Kontakt mit Leib und Seele sein. Er wertet dabei nicht. Wir unterscheiden hier auch nach den beiden Begriffen Leib und Körper. Während Körper ein eher dissoziierter Begriff der heutigen Zeit zu sein scheint, beinhaltet der Begriff Leib eher das Lebendige, in Resonanz Seiende. Wir halten dieses Bild für grundlegend, um überhaupt achtsam sein zu können.
Wir folgen hier Viktor Frankl: „Die größte Freiheit entsteht zwischen Reiz und Reaktion“. Denn hier können wir aktiv Verhalten und Handlungen steuern. Achtsamkeit ist ein spielerischer Wechsel zwischen Wahrnehmung über den Leib, Regungen in der Seele, Kontext und aktueller gestalteter Beziehung zu meinem Gegenüber. Dies schafft Freiräume, die echte, lebendige Kontakte mit Situationen und Lebewesen ermöglichen. Innerhalb dieses Raumes kann man dann die Wahrnehmung unterschiedlich üben – in Richtung Assoziation (Ich Fokus) oder ganz beim Gegenüber sein (Empathie) oder auch die Dis-Assoziation (im Beobachter sein).
Für uns ist daher Achtsamkeit eine gute Basis für gelingende Kommunikation und gutes Miteinander zwischen Menschen, beispielsweise in Teams. Achtsam sein zu können, erfordert immer wieder Übung und ermöglicht den Eintritt in den Raum der Freiheit.
Ideen zum Weiterlesen
Jon Kabat-Zinn: Im Alltag Ruhe finden: Meditationen für ein gelassenes Leben. Meditation für Anfänger: Lernen und verstehen wie Achtsamkeit das positive Denken stärkt und Gelassenheit die innere Ruhe fördert von Martina Kirsch
Viktor E. Frankl, Joachim Bauer et al. (2021): Über den Sinn des Lebens.
AGILE WERTE, TECHNIKEN UND METHODEN
Werte. Im damals nur auf Software gemünzten Agilen Manifest von 2001 geht es um das Balancieren zwischen vier Werten/Leitgedanken:
Bei der Softwareentwicklung soll der Fokus mehr auf den
Individuen und deren Interaktionen
als auf den Prozessen und Werkzeugen liegen.
Funktionierende Software
ist wichtiger als umfassende Dokumentation.
Zusammenarbeit mit Kunden
ist wichtiger als Vertragsverhandlung.
Reagieren auf Veränderung
ist wichtiger als das Befolgen eines Plans.
In den Quellen zum Thema Agilität finden sich weitere Werte und Prinzipien, die sich auch auf Bereiche außerhalb der Softwareentwicklung beziehen. Genannt werden häufig: Commitment (Zusage), Einfachheit, Feedback, Fokus, Mut, Kommunikation, Offenheit und Respekt.
Ein Leitgedanke für uns bei SPRACHKULTUR ist es, Unternehmen von außen nach innen zu denken und dabei Wertespannungen im Kontext der Interaktion mit den Kunden innerhalb eines Marktes zu sehen. Agile Werte bieten uns genau diese Blick-Perspektiven. Wichtig ist für uns, dass abhängig vom jeweiligen Kontext ein gemeinsames und einheitliches Verständnis über das grundlegende Wertesystem geschaffen wird (→ Common Ground), um in der Folge auf dieser gemeinsamen Basis weiterzuarbeiten.
Techniken und Methoden. Agile Methoden sollten abhängig vom Kontext des Projekts und der Organisation angepasst werden. Insbesondere gilt dies, wenn agile Methoden außerhalb der Softwareentwicklung angewendet werden. Agile Techniken sind konkrete Verfahren zur Umsetzung der Handlungsgrundsätze aus den Werten und Prinzipien.
Ein Kanban Board ist einfach ausgedrückt eine interaktive und sichtbare Form der To-Do-Liste. Durch sie lässt sich ein Workflow planen, überblicken und steuern. Im Grunde ist es in seiner einfachsten Form eine für alle sichtbare Tabelle mit den Spalten To Do, Doing und Done, die visualisiert, welche Aufgabe/welcher Prozess sich gerade in welchem Stadium befindet.
Scrum ist ein Vorgehensmodell, insbesondere zur agilen Softwareentwicklung, wird aber auch in anderen Bereichen angewendet. Scrum ist eine Antwort auf hochkomplexe und sich verändernde Kontexte, in denen ein klassisches Projektmanagement (Pflichtenheft, Wasserfallmethode etc.) nicht mehr funktionieren kann. Gearbeitet wird dabei eher in Erzählkapiteln (inkrementell, iterativ) als komplett neu über die Dinge nachzudenken und basierend auf den aktuellen Erfahrungen (empirisch) vorzugehen. Dieses scheinbar komplexere Vorgehen erhöht bei gekonnter Anwendung das Tempo und die Qualität von Ergebnissen und Produkten.
Design Thinking wird als Methoden-Set und zugleich als Denkansatz beschrieben. Es will im Innovationsprozess kreatives Potenzial bei allen Beteiligten freisetzen. Dabei geht es nicht um die fachliche Kompetenz von Experten, sondern um verschiedene Kompetenzen unterschiedlicher Personen, die multidisziplinär/crossfunktional zusammenarbeiten. Dabei wird gefordert, anders – und vom Kunden her – zu denken: Vorhandenes Wissen wird vernetzt, Werte und Bedürfnisse in neuen Kontext gestellt, bisher Unverknüpftes miteinander verknüpft und dadurch Raum für neue Lösungsansätze und Ideen geschaffen. Durch das Infragestellen des scheinbar Offensichtlichen soll Design Thinking neue Lösungen, bessere Produkte, Dienstleistungen und sogar ganze Unternehmenssysteme erschaffen. Der Kunde, der möglichst früh im Prozessverlauf einbezogen wird, spielt eine wesentliche Rolle.
Weitere Techniken und Methoden sind das Daily Stand Up Meeting, Time Boxing, Planning Poker, Definition of Done, Persona-Methode, Business Model Canvas und andere. Bei SPRACHKULTUR setzen wir gezielt agile Techniken und Methoden ein. Diese stimmen wir immer auf den jeweiligen Kontext, die gesetzten Ziele, die individuellen Bedarfslagen der Zielgruppen und die Experimentierfreude der Beteiligten ab.
Ideen zum Weiterlesen
Ulf Brandes, Pascal Gemmer, Holger Koschek, Lydia Schültken (2014). Management Y. Agile, Scrum, Design Thinking & Co.: So gelingt der Wandel zur attraktiven und zukunftsfähigen Organisation. Frankfurt/New York
AGILITÄT/AGILE TRANSFORMATION
Agilität ist weniger eine Technik, sondern eher die Beschreibung einer Geisteshaltung oder neudeutsch ein Mindset. Es geht darum, im Denken und Handeln eine möglichst hohe Anpassungsfähigkeit an die Umwelt zu erreichen. Agilität stellt einen seit einigen Jahren populärer werdenden Ansatz dar, der bei Unsicherheit und ständiger Veränderung geeignet ist, schnelleres und flexibleres Handeln zu ermöglichen. Ziele werden in kleinen Etappen, durch adaptives und Schritt-für-Schritt-Vorgehen erreicht, anstatt detaillierte und zeitintensive Planungen durchzuführen, die dann an der Realität zerschellen.
In Organisationen kann das agile Mindset mit seinen agilen Werten und Methoden zur Prozessverbesserung und zur Erhöhung der Anpassungsfähigkeit genutzt werden. Agilität bedeutet hier, mutiger und kleinschrittiger vorzugehen, Fehler und Experimente absichtsvoll zu machen, um zu lernen, schnelle Feedbackschleifen zu nutzen und in jedem Zyklus auf die Integration der Lernerfahrungen zu achten. Ebenso bedeutet Agilität, einen deutlich stärkeren Fokus auf den Sinn der Arbeit oder den Sinn (→ Sinn/Purpose/Why) hinter einer bestimmten Tätigkeit zu legen.
Der Hauptfokus in der agilen Welt liegt auf den Menschen in einer Selbstorganisation. Gefördert wird ein höheres Maß an Autonomie. Die Orientierung erfolgt über Werte und Prinzipien, begleitet von diversen, sich ständig erweiternden Methoden und Techniken.
Nach der bereits in den 80er Jahren gewonnen Erkenntnis von Peter F. Drucker wirkt Agilität in zwei Richtungen: „Einerseits fördert sie, die richtigen Dinge zu tun und andererseits, die Dinge richtig zu tun.“
Agile Transformation ist die Umwandlung einer klassisch arbeitenden Organisation (hier ist meist der Kunde aus dem Fokus geraten) in eine agile und kundenzentrierte Organisation. Sie startet in der Regel mit Prototypen und Experimenten in Teilbereichen. Es geht um eine gesamtheitliche Veränderung der Organisation unter Zuhilfenahme digitaler Technologien und neuerer Arbeitsmethoden. Es geht darum, agile Werte, Prinzipien und Methoden zu vereinen, in den Alltag zu integrieren und umzusetzen, sowie Organisation und Geschäftsmodelle neu zu denken, um eine optimale Anpassung an den Markt und die Kundenbedürfnisse zu finden. Häufig ist es sinnvoll, nicht der gesamten Organisation ab morgen Agilität aufzuzwingen, sondern im aktiven Dialog mit Kunden und Mitarbeitenden einen gemeinsamen Lern- und Erkenntnisweg zu beschreiten, dessen Dauer und Ende zu Beginn nicht erkennbar ist. Ein weiterer häufiger Irrtum ist das Kopieren von vermeintlich erfolgreichen Organisationsmodellen (z.B. Spotify), die aber häufig sehr weit vom eigenen Geschäftsmodell entfernt sind und beim genaueren Hinsehen vor allem aus unternehmenskulturellen Gründen nicht übertragbar sind.
Für uns gehört die Begleitung der agilen Transformation zu den zentralen Aufgaben von SPRACHKULTUR. Da es dabei immer um grundlegende Veränderungen geht, ist für uns die agile Transformation nichts, was „über Nacht“ geschehen kann. Beginnen muss sie mit der Haltung und mentalen Einstellung eines jeden Menschen innerhalb einer Organisation im Bewusstsein der jeweils primären Aufgabe. Bei diesem und bei allen weiteren Schritten begleiten wir unsere Kunden im Sinne einer nachhaltigen Ausrichtung der Organisationen auf Wirksamkeit innerhalb des jeweiligen Marktumfeldes. Die Grundfrage hierbei lautet: Was würde fehlen, wenn es uns nicht gäbe? Also die permanente Suche nach dem echten Kundennutzen, an dem sich dann konsequent die Architektur des Geschäftsmodells und der Organisation ausrichtet.
Ideen zum Weiterlesen
Thorsten Scheller (2017): Auf dem Weg zur agilen Organisation. München.
Svenja Hofert (2018): Das agile Mindset: Mitarbeiter entwickeln, Zukunft der Arbeit gestalten. Springer Gabler.
Franziska Fink und Michael Moeller (2018): Purpose Driven Organizations: Sinn – Selbstorganisation – Agilität. Schäffer-Poeschel.
Frederic Laloux und Etienne Appert (2016): Reinventing Organizations visuell: Ein illustrierter Leitfaden sinnstiftender Formen der Zusammenarbeit.
AIKIDO
Das japanische Wort Aikido besteht aus drei kurzen Silben; drei Silben, die die gesamte Philosophie dieser Kampfkunst beinhalten: ai meint „Bewegung“ und „Harmonie“, ki bezeichnet „Leben“ sowie „Geist“ und „Energie“, do ist der „Pfad“, der „Weg“. Ai-ki-do kann somit als „Der Weg der Harmonie“ oder auch als „Der Weg des harmonischen Geistes“ übersetzt werden.
Aikido ist nicht nur eine Kampfkunst, sondern zugleich eine mentale Haltung, den Herausforderungen des Lebens zu begegnen. So lautet die Devise von Ueshiba Morihei, dem Vater des Aikido: „Wenn du angegriffen wirst, schließe deinen Gegner ins Herz.“
Ein wichtiges Merkmal des Aikido ist eine auf sein Gegenüber gerichtete zugewandte und übende Geisteshaltung. Angriffe werden wahrgenommen und geführt kontrolliert abgewehrt, indem die Angriffsenergie (ki) des Angreifers umgelenkt oder an ihn harmonisch (ai) zurückgeleitet wird – mit so wenig eigener Körperkraft wie möglich. Damit dies effektiv gelingt, ist der Weg (do) das kontinuierliche Üben. Der Lernende (Aikidoka) entwickelt die Fähigkeit, zunehmend im Moment präsent zu sein, aus seinem Zentrum (Körpermitte) heraus zu agieren, sowie seine Achtsamkeit auf die körperlichen und emotionalen Signale seines Gegenübers zu richten, sie zu lesen und den Kontext auf mehreren Ebenen situativ exakt einzuschätzen.
Üben ist im Aikido ein zirkuläres Voranschreiten und ein beständiges Sich-Verbessern, weniger ein Mittel zum Erreichen eines hart umkämpften Ziels. Schüler dieser Kampfkunst bekunden daher immer wieder, dass sie durch kontinuierliches Üben zu einem anderen Sprechen, Denken, Fühlen und Bewegen gelangen (vgl. Kohn 2001).
Zentrale Aspekte des Aikido fließen in die tägliche Arbeit von SPRACHKULTUR ein:
Eine Haltung von kontinuierlichem Lernen und Üben und ein permanentes Streben nach „Wie kann es noch etwas besser mit Leichtigkeit gelingen?“
Ständiger Wechsel zwischen dem eigenen Standpunkt und Fokus sowie dem Standpunkt des anderen und dessen Fokus
die Konzentration auf guten Kontakt und Energieflüsse statt auf Gegnerschaft. Bewusstsein über einen gemeinsamen Kontext und die jeweilige Sichtbarkeit und Verantwortung
Haltung und Verhalten sind für uns zwei Entwicklungsebenen
Das Schulen von Achtsamkeit und Präsenz macht Führungskräfte und Teams resilienter und selbstwirksamer
Auf Wunsch integrieren wir Elemente des AIKIDO in Seminare, Trainings und Coachings. Dies ermöglicht besonders gute Weiterentwicklung und Erfahrung für die Themen: Haltung und Wirkung, Führung, Konfliktmanagement, Umgang mit Widerstand und Management von Emotionen.
Ideen zum Weiterlesen
Tamara Kohn (2001): Don’t talk – Blend. Ideas about Body and Communication in Aikido Practice. In: An Anthropology of Indirect Communication. Ed. by Joy Hendry und C.W. Watson. London, S. 163-178.
Heinz Patt (2007): Aikido – Harmonie und Erfahrung. Reuverton Editions Bonn
Morihei Ueshiba (1997): Budo. Das Lehrbuch des Gründers des Aikido. Werner Kristkeitz Verlag.
AMBIDEXTRIE
Das Wort Ambidextrie setzt sich zusammen aus den lateinischen Begriffen ambo für „beide“ und dextra für „rechte Hand“ und bedeutet soviel wie Beidhändigkeit. Funktioniert die rechte Hand nicht richtig, so kann man die linke Hand stärken, um die neue Situation zu meistern und letztendlich beidhändig gestärkt zu agieren.
Ambidextrie ist der Versuch, die Balance zwischen Effizienzsteigerung und Innovation in Organisationen herzustellen. Es geht darum, Kräfte des Wandels und Kräfte der Beständigkeit in Einklang zu bringen. Nach O’Reilly und Tushman wie auch Christensen ist die Ambidextrie die Fähigkeit eines Unternehmens, gleichzeitig forschen (exploration) und optimieren (exploitation) zu können, um langfristig anpassungsfähig zu sein.
Unternehmen stehen heute vor der Herausforderung, ihr Kerngeschäft mit linearen und detaillierten Prozessen und agiles Arbeiten mit schnellen Zyklen und einem hohen Maß an Unwissen innerhalb einer Organisation in Einklang zu bringen. Dieses Spannungsfeld zwischen altem und neuem Denken wird immer mehr zur Pflichtaufgabe, um zukunftsorientiert in einer schnelllebigen und digitalen Welt arbeiten zu können. Unmoderiert oder ignoriert wird es zur Bedrohung für die meisten Organisationen.
Kompetenzen, die Ambidextrie fördern, sind Experimentierfreude, Offenheit für Veränderung und ganzheitliches Denken. Eine Balance kann man immer wieder finden, wenn vorhandene Kompetenzen genutzt und gleichzeitig neue ausgebaut werden. Statt in der alten „Entweder-Oder-Welt“ zu verharren, betreten wir den Raum von „Sowohl-als-Auch“.
Ideen zum Weiterlesen
Clayton Christensen (2016): The Innovators Dilemma.
Michael L. Tushman, Charles A. O’Reilly (2013): Organizational Ambidexterity: Past, Present and Future.
Wolfgang H. Güttel (2017): Erfolgreich in turbulenten Zeiten: Impulse für Leadership, Change Management & Ambidexterity.
Rebekka Reinhard (2020): Wach denken: Für einen zeitgemäßen Vernunftgebrauch, Edition Körber
AUFTRAGSKLÄRUNG
Bei der Auftragsklärung geht es um die Klärung der Erwartungen aller Beteiligten in einem Auftrag, einer Beratung oder einem Projekt.
Bei Projekten hat sie häufig vertraglichen Charakter und klärt alle wesentlichen Parameter des Projektes. Dazu gehören vor allem:
Projektziel (gem. der SMART-Kriterien)
grober Kostenrahmen
zur Verfügung stehende Ressourcen (Zeit, Geld)
Meilensteinplan (sofern keine agile Vorgehensweise gewählt wird)
Projektteam, Organe und Gremien
weitere Rahmenbedingungen
erste Einschätzung Umfeld, Chancen und Risiken
Bei SPRACHKULTUR kommt es uns bereits bei der Auftragsklärung darauf an, die genaue Zielsetzung zu klären. Im nächsten Schritt klären wir die Rollen im Prozess sowie Möglichkeiten und Grenzen unserer Arbeit. Nicht selten werden Wundertaten von uns erwartet: jahrelange Versäumnisse sollen in einem halbtägigen Workshop „ein für allemal“ geklärt werden. Weiterhin installieren wir ein „Beratungssystem“, sodass wir auch innerhalb des geplanten Prozesses Feedbackschleifen nutzen können. Wir erstellen Räume für die Lösungsentwicklung und unterstützen unsere Kunden beim Kreieren einer Lösung mit optimaler Passung.
Eine gelungene Auftragsklärung ist eine Kunst. Als wesentliche Tools kommen gutes Zuhören und gezieltes Fragen zum Einsatz, um das „Denksystem“, in dem das Problem aufgetaucht ist, verstehen zu können. Durch Fragen setzen wir Interventionen um, „anders zu denken“ – die Grundlage für das Entstehen von Lösungen (→ Lösungsfokussierung). Wir stellen so viele Fragen wie nötig, um einen guten Ausgangspunkt und ersten Zielpunkt für unsere Zusammenarbeit zu definieren.
Neben klassischen Auftragssettings, in denen Ziel und Vorgehensweise klar bestimmbar sind, kommen in der Prozessbegleitung – also der schrittweisen Begleitung von Organisationen über einen längeren Zeitraum und weniger präzise beschreibbaren Zielen – auch immer wieder agile Vorgehensweisen in der Auftragsklärung zum Einsatz.
So wird nur ein erster Baustein sozusagen als Prototyp erarbeitet und erst danach über eine Fortsetzung der gemeinsamen Arbeit entschieden.
Wünscht ein Mandant beispielsweise die Begleitung einer agilen Transformation, ist eine exakte Bestimmung von Meilensteinen und Zielzeitpunkten kaum möglich oder sinnvoll. In solchen Fällen installieren wir eine sogenannte Veränderungsarchitektur mit mehreren Ebenen, in denen wir schrittweise vorgehen und immer wieder abgleichen, ob das aktuelle Vorgehen mit den übergeordneten Zielen (z.B. wir wollen mehr von Y und weniger von X) übereinstimmt. Dazu installieren wir mehrere Plattformen (Termine für Arbeitstreffen) mit unterschiedlichen Beteiligten und Interessensgruppen. In einem „Steuerkreis“ werden unter Beteiligung des Auftraggebers die Gesamtausrichtung betrachtet und Entscheidungen getroffen. In „Spurgruppen“ werden Workshops und Trainings vorbereitet, und in weiteren Plattformen wird z.B. in (Klein-)Gruppen (ca. 3-30 Personen) oder Großgruppen (ca. 30-500 Beteiligte) dann konkret an Themen gearbeitet.
Die Plattformen können analog und digital stattfinden, werden üblicherweise lange im Vorfeld geplant und terminiert, währen die Inhalte der Treffen erst kurz vor den jeweiligen Terminen festgelegt werden. Dieses Vorgehen sichert eine kontinuierliche Umsetzung von Veränderungsprozessen und bietet gleichzeitig sehr viel Flexibilität in der inhaltlichen Ausgestaltung und der Reaktion auf spontan auftretende Entwicklungen.
AUTHENTIZITÄT
Authentizität (von griechisch authentikós „echt“; spätlateinisch authenticus „verbürgt, zuverlässig“) bedeutet Echtheit im Sinne von „als Original befunden“.
Authentizität setzt voraus, den Gegensatz von Schein und Sein als Möglichkeit zu Täuschung und Fälschung wahrzunehmen. Als authentisch gilt ein Gegenstand oder auch ein Mensch, wenn beide Aspekte der Wahrnehmung, unmittelbarer Schein und eigentliches Sein, in Übereinstimmung befunden werden.
Im Rahmen unserer Arbeit interessiert uns bei SPRACHKULTUR, wie jemand authentisch sein und dennoch dabei Neues in sein Repertoire integrieren kann. Gemeinhin wird authentisches Verhalten als „über einen langen Zeitraum zur Person zugehörig“ verstanden. Die Grenze des Begriffs besteht darin, dass dann jegliche neuen Verhaltensweisen nicht integrierbar wären, da alle neuen Verhaltensweisen zu Beginn des Erwerbs ja nicht authentisch erschienen.
Die Sozialpsychologen Michael Kernis und Brian Goldman identifizierten vier Komponenten der Authentizität, die sie in einem schriftlichen Test messen konnten:
Bewusstsein: Ein authentischer Mensch kennt seine Stärken und Schwächen, seine Gefühle und Motive für sein Verhalten. Er ist sich seiner selbst und seines Handelns bewusst.
Ehrlichkeit: Wer authentisch ist, sieht der Realität, das eigene Selbst betreffend, ins Auge und nimmt auch unangenehmes Feedback an.
Konsequenz: Authentisch ist, wer nach seinen Werten und Überzeugungen handelt, auch dann, wenn für ihn selbst dabei Nachteile entstehen (Gegenteil: Opportunist).
Aufrichtigkeit: Authentische Menschen sind bereit, ihr wahres Selbst mit seinen positiven wie negativen Seiten in sozialen Beziehungen offen zu zeigen und nicht zu verleugnen.
Wer authentisch ist, wirkt „echt“, weil er ausstrahlt, dass er zu sich selbst mit seinen Stärken und Schwächen steht und im Einklang mit sich selbst handelt. Authentisch zu werden heißt nach Kernis und Goldman, nicht nur Widerspruch und Unbehagen zu akzeptieren, sondern auch persönliche Fehler und Misserfolge.
Bei SPRACHKULTUR arbeiten wir mit Menschen im Hinblick auf Authentizität zum Beispiel durch eine klare Spezifikation ihrer Ziele, Werte und Rollen (Bewusstsein), aber auch an Kompetenzen, die sie wirkungsvoll kommunizieren und selbstbewusst ihre jeweiligen Aufgaben angehen lassen.
Eine besondere Rolle spielen für uns in diesem Zusammenhang die Fehlerkultur und das Lernen. Dazu bewegen wir uns in folgendem Rahmen: Wer Fehler macht, weil er etwas Neues versucht, sollte dies im Rahmen einer Lernerfahrung als Gegeben akzeptieren. Menschliche Kommunikation und Kompetenzentwicklung ist ein lebenslanger Prozess, der nie aufhört und von zahlreichen Sackgassen und Fehlern geprägt ist. Auch wenn sich zu Beginn jedes veränderte Verhalten zunächst fremd und unauthentisch anfühlt – wer es bewusst akzeptiert und seine Schwäche nicht verleugnet, der wird – wie ein Kleinkind, das durch häufiges Hinfallen zu laufen lernt – seine Möglichkeiten entscheidend vergrößern können und so mehr er selbst sein können. Um besser zu verstehen, ob etwas authentisch ist oder werden sollte, ist eine Beschäftigung mit dem persönlichen „Wofür bin ich da?“ sowie auch für Organisationen mit dem Sinn/Purpose/Why lohnend.
Ideen zum Weiterlesen
Olaf Cordes (2018): Sind Sie noch ganz echt? Mut zur Authentizität. Olaf Cordes.
Simon Sinek (2018): Finde dein Warum: Der praktische Wegweiser zu deiner wahren Bestimmung.
BERATUNG/CONSULTING
Beratung ist ein Prozess professioneller, methodengestützter und kompetenter Begleitung von Menschen, Organisationen und Teams bei der Entwicklung von individuellen Handlungs-, Entscheidungs- und Lösungsoptionen für konkrete Lebens- und Arbeitssituationen. Es kann dabei zwischen einer rein betriebswirtschaftlichen Beratung, dem Consulting, und der personenzentrierten Beratung unterschieden werden.
Bei ersterer handelt es sich häufig um die individuelle Aufarbeitung rein betriebswirtschaftlicher Problemstellungen von Organisationen, die nicht selten ein Informationsgefälle vom Berater zum Klienten aufweist, und daher auch häufig in ein Abhängigkeitsverhältnis seitens des Ratsuchenden mündet. Der Berater tritt hier als Fachmann und Spezialist auf, der sein Fachwissen anbietet und darauf aufbauende Handlungsempfehlungen gibt. Die personenzentrierte Beratung rückt hingegen stärker den in Organisationen handelnden Menschen und Dynamiken einer Organisation in den Mittelpunkt.
Ihr liegt ein Menschenbild zugrunde, das auf die humanistische Philosophie zurückgeht. Der Mensch wird dort als ein selbstbestimmtes Wesen gesehen, das grundsätzlich in der Lage ist, sich selbst zu leiten und zu regulieren. Beratung erschöpft sich in diesem Verständnis nicht in der Weitergabe eines durch einen Fachmann vermittelten Fachwissens in Form von Ratschlägen, die der Ratsuchende zu befolgen hat. Personenzentrierte, systemische Beratung geht von der Basis aus, dass Menschen und auch Organisationen, die Rat suchen, die Lösung ihres Problems bereits in sich tragen und ihre besten Ratgeber sie selbst sind. Berater und Klient begegnen sich daher auf Augenhöhe und selbstbestimmt. Sie bilden ein sogenanntes „Beratungssystem“.
Der in unserem Verständnis professionelle und methodisch versierte systemische Berater begleitet Klienten auf dem Weg der für sie persönlich besten Lösungsfindung. So können in der Beratung blinde Flecken beleuchtet, Ressourcen erkannt und gemeinsame Lösungen entwickelt werden.
SPRACHKULTUR berät und begleitet Menschen und Organisationen bei der strategischen Ausrichtung, Veränderung der Unternehmenskultur, Implementierung und Verbesserung von Prozessen und bei der Personalentwicklung. Zum anderen unterstützen wir Menschen in Organisationen dabei, ihre Potenziale zu entfalten, Spannungen zu balancieren und lösungsbringende Handlungsoptionen zu vermehren.
Für SPRACHKULTUR ist Beratung
eine Dienstleistung, die die Bedürfnisse, Wünsche, Anliegen, Fragen und Ziele des Klienten in den Mittelpunkt stellt.
ein sich auf Augenhöhe mit gegenseitiger Wertschätzung und Respekt Begegnen, mit dem Ziel, für den Klienten sinnvolle Handlungs-, Entscheidungs- und Lösungsoptionen zu finden, auf die er, aus seiner momentanen Situation heraus, nicht von selbst kommt.
Out of The Box-Denken mit teilweise radikalen Ideen
die Arbeit an und mit den aktuell einer Person oder einem System (Team, Organisation) zur Verfügung stehenden Ressourcen
ein partizipativer Prozess, in dem es genauso wichtig ist,
wie
die Angelegenheiten zwischen Menschen oder Gruppen geregelt werden wie
das, was
zu regeln ist. Für uns sind Lösungen immer nur dann Lösungen, wenn sie für alle Beteiligten ein „Besser“ bedeuten.
Ideen zum Weiterlesen
Joachim Ritter, Karlfried Gründer und Gottfried Gabriel (1992).: Historisches Wörterbuch der Philosophie. Basel
Edgar H. Schein (2010): Prozessberatung für die Organisation der Zukunft. Der Aufbau einer helfenden Beziehung. 3. Aufl. Bergisch-Gladbach.
Eckard König, Gerda Volmer (2008): Handbuch Systemische Organisationsberatung. Weinheim und Basel.
BLENDED LEARNING/NEUE LERNFORMEN/LERNTYPEN
Wörtlich übersetzt heißt Blended Learning „vermischtes Lernen“. Der Bedeutung gerecht wird jedoch eher der Ausdruck „integriertes Lernen“. Blended Learning bezeichnet eine Lernform, bei der die Vorteile von Präsenzveranstaltungen und E-Learning verbunden werden. Dabei werden die Effektivität und Flexibilität von digitalen Lernformen mit den sozialen Aspekten der Face-to-Face-Kommunikation sowie dem praktischen Lernen/Üben verknüpft. Grundlagen für integriertes Lernen sind vor allem neurowissenschaftliche Erkenntnisse. Beim Blended Learning steht nicht das reine Vermitteln von Inhalten (im Extremfall Auswendiglernen) im Fokus, sondern das Verständnis des Lernstoffes und damit die Zusammenhänge zwischen den Wissenselementen.
Die Digitalisierung eröffnet neue Formen des Lernens. Scheiterte die erste Blended Learning-Welle in den 80-90ern noch an einer schwachen IT- Infrastruktur und fehlenden internetfähigen Endgeräten, kann heute nicht nur wann und wo es der Lernende gerade möchte, sondern zudem in seinem eigenen Tempo gelernt werden. Von den Anfängen des E-Learnings bis heute haben sich die technologischen Möglichkeiten, aber auch die Umsetzung pädagogischer Aspekte in Lernsoftware, immens erweitert und verbessert. Seit den 2010er Jahren sind ganze Weiterbildungen und auch Studiengänge mit digitalen Lernplattformen möglich. Durch die Einbindung von Video- und Chatfunktionen erhält auch E-Learning eine kommunikative Komponente, die nicht nur zwischen Mensch und Maschine besteht, sondern Lernen in Gruppen und Dialoge zwischen Tutoren und Lernenden ermöglicht.
Bei allem technologischen Fortschritt: Präsenzveranstaltungen haben nach wie vor Vorteile, die am Bildschirm nicht erreicht werden können. Dies sind insbesondere der soziale Kontakt und der Aufbau von Beziehungen zwischen Dozent und Teilnehmer und innerhalb der Teilnehmer. Des Weiteren sind dem Erlernen und Üben von praktischen Fähigkeiten mit reinem E-Learning Grenzen gesetzt.
Wir bei SPRACHKULTUR halten Blended Learning besonders in der Vor- und Nachbereitungsphase von Präsenzveranstaltungen für sinnvoll, aber auch, um Lerninhalte den individuellen Bedürfnissen von Unternehmen anpassen zu können. In den letzten Jahren haben wir allerdings auch immer wieder vollständig digitale Distanzformate (Trainings, Coachings, Seminare, Workshops) mit kleinen und auch großen Gruppen (auch über 100 Personen) durchgeführt.
Mit den SPRACHKULTUR-ZündFunken haben wir eine digitale Ergänzung zu unseren Seminaren und Trainings entwickelt. Durch unsere selbst produzierten Videos und Audioformate wird Lernen einfacher, nachhaltiger und durch kurzweilige Impulse zusätzlich motivierend.
Unser Konzept
Ansprache unterschiedlicher Lerntypen
Lernen, wo und wann dafür Zeit und Raum ist
Schneller und nachhaltiger Alltagstransfer
Einheitliches Wissensmanagement mit Ihrer „Sprachkultur“
Platzierung als zeitgemäßer und innovativer Arbeitgeber
Unsere ZündFunken-Plattform
Für alle:
Begleitend zum Coaching oder Training können Sie, wann und wo immer Sie möchten, aktuell über 500 „ZündFunken“ flexibel abrufen und Ihr Wissen ausbauen, auffrischen und nochmal neu entdecken – auf Laptop, Tablet oder Smartphone.
Individuell:
Wir bereiten individuelle Inhalte für Ihre Organisation didaktisch auf, produzieren sie als Text, Grafik oder Video und ergänzen sie mit Online-Tests. „Botschafter“ aus Ihrem Haus können wir in Videopräsentationen einbeziehen – Kameratraining inklusive.
Um auf verschiedene Lerntypen einzugehen, ist das 4-Mat-System sehr hilfreich. David Kolb und Bernice McCarthy haben in ihren Arbeiten festgestellt, dass Menschen unterschiedlich lernen und daher Informationen unterschiedlich aufnehmen. Mit dem 4-MAT-System können vier Lernstile spezifisch angesprochen werden: die Typen WARUM, WAS, WIE und WAS WÄRE WENN.
Ideen zum Weiterlesen
John Erpenbeck, Simon Sauter (2015). E-Learning und Blended Learning. Selbstgesteuerte Lernprozesse zum Wissensaufbau und zur Qualifizierung. Springer Gabler.
Bernice McCarthy, Dennis McCarthy (2006). Teaching Around the 4MAT® Cycle: Designing Instruction for Diverse Learners