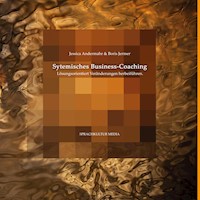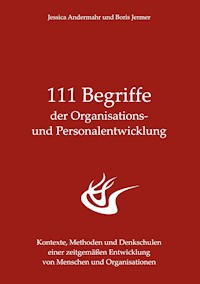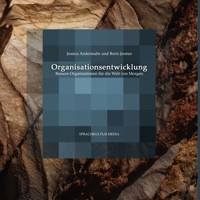
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sprachkultur Gmbh
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
20 Jahre Forschung und praktische Arbeit in und an Organisationen: Jessica Andermahr und Boris Jermer geben in diesem Buch einen umfassenden Blick auf das spannende und dynamische Tätigkeitsfeld der Organisationsentwicklung und der Prozessbegleitung. Schritt für Schritt erfahren Sie, wie Sie Raum für Entwicklung aufbauen - zeitgemäß, umfassend und praktisch. Das Buch lädt Sie ein, eine Veränderungsbegleitung professionell zu leiten, und öffnet Türen zu unterschiedlichen bewährten und wirksamen Interventionen. Einblicke in neurobiologische Grundlagen, Formate, Steuerung bis hin zur Darstellung von Großgruppenmethoden machen die Lektüre leicht und inspirierend. Zahlreiche Übungen und Tipps sorgen für eine gute Stärkung im Alltag und bringen die eigene Kompetenzentwicklung voran. Dieses Buch richtet sich an Menschen, die Organisationen im Innen oder als Externe in Veränderungen begleiten, die ihre (neue) Rolle als Organisationsentwickler/Facilitator strukturiert erlernen oder ihr Repertoire erweitern möchten. Es dient auch als Begleitbuch zur SPRACHKULTUR-Weiterbildung zur systemischen OrganisationsberaterIn. Für Fortgeschrittene ist es eine Einladung, an den inneren Bildern, am Methodenrepertoire und an der eigenen Haltung weiter zu feilen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 414
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort
Jede Organisation ist als lebendiges soziales System nicht fixierbar und damit schwer beobachtbar und auch schwer veränderbar – alles ändert sich permanent. Manche Organisationen sind massiv „verspannt“, und so braucht es Begleiter, die diese Verspannungen lösen und Organisationen helfen, sich selbst wieder in die Geschmeidigkeit und in den Fluss zu bringen. Das ist im Wesentlichen die Aufgabe der Organisationsentwicklung, die wir hier in diesem Buch beschreiben.
Das Telefon brauchte knapp 30 Jahre, um die erste Million Nutzer zu finden, ChatGPT ganze fünf Tage im Dezember 2022. Dieses Buch haben wir vor der öffentlichen Verfügbarkeit der großen generativen Sprachmodelle geschrieben, und während wir an den letzten Korrekturen feilen, bahnt sich im Feld der KI eine weitere deutliche Veränderung mit sicherlich großen Auswirkungen auf unsere Arbeits- und Lebenswelt an. Die Herausforderungen, die heute schon da sind und auf uns zukommen, brauchen andere, neue und bessere Strukturen; Praktiken mit menschengerechten Orten und Räumen.
Wir sehen jeden Tag das Potenzial der Organisationen und Menschen, mit denen wir in unseren Projekten arbeiten und die uns erst diese Erkenntnisse und Lernerfahrungen ermöglichen. Wie wir vorgehen, welche Plattformen dafür nützlich sind, wie wir die Räume aufspannen und echten Dialog herstellen, das legen wir im Detail offen und berichten aus nunmehr über 20 Jahren Praxis. So arbeiten wir jeden Tag daran, bessere Organisationen für die Welt von Morgen zu stärken.
Viel Spaß bei der Lektüre – wir sind dankbar für Rückmeldungen oder Hinweise.
Köln im Winter 2023/24
Jessica Andermahr und Boris Jermer
Inhalt
VORWORT
TEIL I: WO ORGANISATIONEN STEHEN – UND WO SIE STEHEN KÖNNTEN
1. Was sichtbar wird: Es knirscht im Getriebe
Unzufriedenheit als Triebfeder für Veränderung
Komplexität und Unsicherheit erschweren Veränderung
Neue Sichtweisen in der Organisationsentwicklung
2. Die Welt dreht sich immer schneller – Mithalten zwecklos?
Geschichte der Arbeit
VUCA
(
Digitale) Transformation
Megatrends
3. Teil einer besseren Welt werden
4. Organisationale Resilienz
5. Dimensionen des Wandels
Was Wandel bezweckt – Ebenen von Veränderung
Zwei Arten von Wandel – Change und Transformation
Wann Wandel beginnt – Der Motor der Veränderung
Wie Wandel verläuft – Das Loop-Modell
Wie Wandel verläuft – Die „Emotionskurve“
TEIL II: WIE SYSTEME SICH VERÄNDERN
6. Spiral Dynamics
Acht Entwicklungsstufen in Farbe
Bedingungen für Wandel
Quo vadis – Wohin wird das führen?
7. Organisationen als Systeme
Ein System entsteht durch seine Grenzen
Psychische und soziale Systeme funktionieren unterschiedlich
Kontexte – Jede Situation ist einmalig
(
Radikaler) Konstruktivismus – Es gibt kein richtig und falsch
Die Lösung ist bereits im System enthalten
Blickwinkel – Den Zeitkanal wechseln
Partizipation – Menschen aktiv beteiligen
Systemische Interventionen – Steuern durch freundliches Verstören
8. Die lernende Organisation
9. Fazit: Den Startschuss hören
TEIL III: PROZESSBEGLEITUNG FÜR GUTES GELINGEN
10. Worauf es im Prozess ankommt
Wie Prozessbegleiter arbeiten
Aufgaben und Kompetenzen
11. Veränderungsarchitektur – Strukturen installieren
Die Plattformen
Fünf Komponenten für erfolgreichen Wandel
12. Fallstricke – Wenn es schiefläuft
Pseudobeteiligung und Hineinregieren
Keine Zeit zum Schärfen der Axt
13. Dialog- und Entwicklungsräume zur Zukunftsgestaltung
Common Ground
Großgruppenmoderation
Voraussetzungen für das Gelingen in der Großgruppe
Virtuelle Großgruppenmoderation
Workshops
Einzelcoaching
Teamcoaching
Retrospektive
Mentoring
Sparring
Supervision und Kollegiale Beratung
Feedback – Sounding Board oder Resonanzraum
Kooperative Methoden
Betrachtungen zur Kulturdiagnose
TEIL IV: WAS ORGANISATIONEN BESSER MACHT
14. Haltung – Veränderung beginnt im Kopf
Menschenbild: Theory X und Y
Growth-Mindset-Theorie
Offenheit – Dem Neuen Raum geben
Transparenz: Alles zugänglich machen
Vertrauen: Sicherheit geben und finden
Irrtums-/Fehlerkultur: Scheitern erwünscht!
Feedback: Rückmeldungen geben und erhalten
Eigenverantwortung – Triebfeder für selbstorganisiertes Arbeiten
Nichts steht für sich allein
15. Lernen – Bedingung für Veränderung
16. Sinn/Purpose – Wofür sind wir da?
Emotionale und inhaltliche Ebene von Sinn
Was nutzt Purpose der Organisation?
17. New Work – Was wir „wirklich wirklich“ wollen
18. Agilität – Die Antwort auf VUCA
Agile versus klassisch
Kernelement Anpassen durch Lernen
Kernelement Selbstorganisation
Ebenen von Agilität
19. Organisationsdesign – Strukturen für Selbstorganisation
Holacracy – Holokratie
Crossfunktionale Teams
Arbeiten in Labor und Werkstatt
20. Beteiligung/Partizipation
Empowerment
Job Crafting
Gemeinsam Entscheidungen treffen
Beispiele für Beteiligung
21. New Leadership – Ermöglichen statt Bestimmen
Führungsstile
Host Leadership
22. Diversity – Die Zutat, die Organisationen besonders macht
Dimensionen von Diversity
Exkurs: Unconscious bias – Was Diversity schaden kann
Was für Diversity förderlich ist
23. Kultur soll wachsen können
TEIL V: BALANCE ALS VERBINDENDES ELEMENT
24. Dynamisches Gleichgewicht – OE und PE Hand in Hand
Spannungen im Organisationsalltag
Gleichgewicht kommt nicht von selbst
Kontext- und phasenabhängig handeln
Ambidextrie – Parallele Entwicklungsstufen zulassen
25. Schemata zum gekonnten Balancieren
Das Wertequadrat – Jeder Wert hat einen Gegenspieler
Das Tetralemma
Das Syst-Dreieck – Glaubenspolaritäten
ZUM GUTEN SCHLUSS
QUELLEN UND WEITERFÜHRENDE LITERATUR
TEIL I: WO ORGANISATIONEN STEHEN – UND WO SIE STEHEN KÖNNTEN
Müssen sich Organisationen heute neu erfinden? Und das auch noch immer schneller? Zu diesem Schluss könnte man kommen angesichts der immer kürzeren Zyklen von Veränderungen. Egal ob Strategie, Strukturen oder Prozesse: Kaum ist etwas fertig, könnte es bereits wieder angepasst werden. Immer häufiger zeigen Veränderungen zu wenig oder sogar gar keine erwünschte Wirkung. Trifft das mehrfach zu, stellen sich fast zwangsläufig Frustration und mangelnde Motivation ein, und zwar auf allen Hierarchieebenen. In unseren Köpfen besteht hier der tiefe Wunsch nach Ruhe, Normalität und Stabilität. Doch immer seltener – so kommt es uns vor – können wir uns ein Verweilen im Status quo erlauben.
Das Tempo, in dem sich das Umfeld von Organisationen verändert, ist immens hoch. Das muss es wohl auch sein angesichts der grundlegenden ökologischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Fragen, die immer mehr an Gewicht zunehmen. Die äußeren Bedingungen werden immer komplexer, und auch im Inneren von Unternehmen bewegt sich vieles. Disruptive Veränderungen, Agilität, New Work, Diversity, Environmental Social Governance, Ausrichtung auf die 17 Ziele der UN, Reaktionen auf globale und regionale Krisen und organisationale Resilienz sind nur einige der Schlagwörter, die breit besprochen, aber nicht immer tief gedacht werden. Nachhaltigkeitsanforderungen führen zu neuen Modellen wie etwa Postwachstumsökonomie und Donut-Ökonomie.
In der Zeit nach dem 2. Weltkrieg haben die Wissenschaften der Kybernetik und der Systemtheorie weite Verbreitung gefunden. Diese haben den Anspruch, die vorhandenen Grenzen der Einzeldisziplinen zu überschreiten, ohne sie zu missachten. Fritz Simon folgend arbeiten wir daran, Dinge zu verbinden, die in den Einzeldisziplinen oft geteilt und getrennt wurden und werden. Die Trennung in Führungskraft und Mitarbeiter, Management und Belegschaft, Außen und Innen, Einkauf und Verkauf erschwert in Zeiten von Veränderung die Entwicklung von wirksamen Konzepten und Interventionen.
Organisationsentwicklung steht heute im ständigen Spannungsfeld zwischen der Notwendigkeit, etwas zu verändern, und dem Wunsch, die Identität des Unternehmens nicht zu verlieren. Eine gute Balance zwischen notwendigem Neuen und bewährtem Alten zu finden, ist eine dauernde Herausforderung.
Dabei nehmen wir, Douglas Mc. Gregor folgend, eine menschenorientierte, humanistische Grundhaltung ein und verstehen die Angehörigen einer Organisation als prinzipiell lernfähig, motiviert, kreativ und verantwortungsvoll – auch wenn diese Eigenschaften manchmal durch jahrelanges „Abtrainieren“ im Verborgenen liegen können.
Ziel der Organisationsentwicklung ist es,
Kontexte zu schaffen, in denen Menschen im Sinne der primären Aufgabe der Organisation produktiv sein können.
die Verbesserung der organisationalen Leistungsfähigkeit zur Erreichung der strategischen Ziele der Organisation zu ermöglichen.
die Qualität der Arbeit zu verbessern.
kontinuierlich Strukturen, Prozesse und Kultur an die sich ändernden Außenbedingungen anzupassen; im Sinne einer menschengemäßen Arbeit, die den Menschen nicht im Bild des Homo Ökonomikus sieht, sondern als kreatives, lernendes und kooperatives Wesen.
den organisationalen Gesamtkontext von Gesellschaft, Markt und Politik mit der immanenten primären Aufgabe in Verbindung zu bringen.
die Vision und individuelle Zukunftsgestaltung zu erzeugen und zu klären, damit Sogkraft entstehen kann.
„Gerade wenn man glaubt, etwas ganz sicher zu wissen,
muss man sich um eine andere Perspektive bemühen.“
(aus dem Film „Der Club der toten Dichter“)
1. WAS SICHTBAR WIRD: ES KNIRSCHT IM GETRIEBE
Wir stellen immer deutlicher fest, dass es in Organisationen aller Art an vielen Stellen gleichzeitig knirscht. Für uns macht das offenbar, dass wir uns in einem massiven gesellschaftlichen Wandel befinden. Während sich Organisationen mühen, durch Elemente etwa aus Agilität und New Work diesem Wandel durch Transformation zu begegnen, brechen die Rahmenbedingungen teilweise in sich zusammen: Pandemie, Inflation, Energie- und Nahrungsmangel, Krieg.
Die systemische Beraterin Ruth Seliger betrachtet in ihrem Buch „Systemische Beratung der Gesellschaft“ (2022) die drei Dimensionen Ökologie, Ökonomie und Demokratie, die sie als besonders zukunftsrelevant einstuft. Die Themen sieht sie komplex miteinander verbunden und verflochten. Das Klima wird mitbestimmt durch unsere Art zu wirtschaften. Aber auch die Wirtschaft wird umgekehrt von den klimatischen Bedingungen beeinflusst. Corona, steigende Preise, Wohnungsmangel – all das hat Auswirkungen auf die Gesellschaft und lässt in vielen Ländern der Welt autokratische Systeme und/oder antidemokratische Parteien und Bewegungen entstehen und wachsen.
Wir müssen uns fragen: Was passiert hier gerade? Und: Brauchen wir vielleicht ein anderes Weltbild, weil wir diese Welt mit unserem gewohnten technischen und linearen Denken nicht mehr beschreiben und verstehen können? Seliger beschreibt unsere aktuelle Situation mit der Zeit vor Magellan. Bis der portugiesische Seefahrer vor rund 500 Jahren die Südspitze von Südamerika umschiffte und dabei die nach ihm benannte Magellanstraße entdeckte, galt die Erde als Scheibe. Mit Magellan änderte sich das Weltbild, pulverisierten sich bislang angenommene „Wahrheiten“ und Narrative.
Möglicherweise befinden wir uns derzeit auf einem ähnlichen Weg, an dessen Ende mit unseren alten Wahrheiten gebrochen werden wird und an dem ein neues (vorzugsweise besseres) Weltbild steht. Was wir dafür mit Sicherheit brauchen, ist ein kollektives Arbeiten an den großen Themen mit gesellschaftlicher Dimension.
Wir widmen uns in diesem Buch der Organisationsentwicklung und setzen damit einen starken Schwerpunkt auf den ökonomischen Aspekt. Dennoch können und dürfen wir auch in Organisationen nicht die ökologische und schon gar nicht die gesellschaftlich-demokratische Dimension ausblenden. Im Gegenteil: Wir müssen sie aktiv mitdenken und auch mitgestalten. Daher werden wir immer wieder Impulse geben, an welchen Stellen sich Chancen und Möglichkeiten zu Perspektivwechseln und einer anderen Weltsicht auftun. In der Konsequenz ist für uns die aktuelle Lage unserer Gesellschaft und unserer Organisationen auch eine weitere Bestätigung dafür, dass eine systemische Sicht auf Organisationen und ihr Umfeld die einzige sinnvolle Betrachtungsweise ist.
Unzufriedenheit als Triebfeder für Veränderung
Jeder Wunsch nach Veränderung in einer Organisation beginnt mit Unzufriedenheit, und zwar aus unterschiedlichen Gründen. Etwas funktioniert nicht, Ziele – häufig in „harten Fakten“ (Umsatz, Marktanteil, Ertrag …) – werden nicht erreicht, die Stimmung ist schlecht, gute Mitarbeitende verlassen die Organisation, das Thema „Führung“ läuft nicht rund, Informationen kommen nicht da an, wo sie hinsollen. Zunehmend äußert sich Unzufriedenheit aber auch in einer generellen Zukunftsangst oder Unsicherheit, einem eher diffusen Gefühl, für die Zukunft nicht mehr richtig gut aufgestellt zu sein. Kurz: Es knirscht im Getriebe, mal lauter, mal leiser.
Die Anlässe, die das Bedürfnis nach Veränderung entstehen lassen, sind in vielen Organisationen immer wieder die gleichen. Sie sind so etwas wie die Symptome der Unzufriedenheit. Meist kündigen sich die eher kulturellen Themen über einen längeren Zeitraum an (häufig über mehrere Jahre), während exogene Ereignisse oder Krisen sehr plötzlich eintreten. Was nicht funktioniert, ist meist offensichtlich und lässt sich teilweise sogar messen:
Es wird immer schwieriger, neue Mitarbeitende zu finden, die bezahlbar und qualifiziert sind und in die Organisation passen.
Die Kennzahlen sind nicht zufriedenstellend (Umsatz, Gewinn, Produktivität etc.).
Das Betriebsklima war schon deutlich besser – meist in Form des Zufriedenheitsgrades zum Beispiel in Mitarbeiterbefragungen gemessen.
Mitarbeiterbefragung liefert unerwünschte Ergebnisse in Bezug auf Weiterempfehlungen/Zufriedenheitsgrad/Zielklarheit/Ort, an dem es gute Beziehungen gibt etc.
Konflikte werden häufiger, verhärten sich, eskalieren.
Der Krankenstand ist hoch.
Steigende Fehlerquoten/Reklamationen.
Überstundenkonten sind voll und können nicht abgebaut werden.
Fach- und Führungskräfte wandern ab.
Innovationszyklen werden länger, die „Time-to-Market“ ist zu lang.
Die Imagewerte der Organisation verschlechtern sich.
Entscheidungen werden nicht oder nicht zeitnah getroffen.
Keine Zeit für wichtige Dinge, Organisationen werden vom Tagesgeschäft getrieben und haben keine Zeit, an der Organisation zu arbeiten.
Externe Auslöser
Zu diesen eher „inneren“ Auslösern (endogene Faktoren) kommen – gefühlt vor allem in den letzten 20 Jahren – prägende Einflüsse von außen (exogene Faktoren) hinzu. Krisen unterschiedlichster Art führen zu massiven Veränderungen und unliebsamen „Überraschungen“, zum Beispiel in den Lieferketten, der Verfügbarkeit von Vorprodukten oder aber zu Wegfall ganzer Märkte. Aktuell stellen wir fest, dass es fast überall knirscht – was für einen größeren Paradigmenwechsel in unserem gesamten Denken, Fühlen und Handeln in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft spricht.
Wir alle spüren, dass die Denkweise des permanenten Wachstums und der Profitoptimierung mittlerweile nicht nur in unseren zentralen Institutionen wie Krankenhäusern, Schulen, Universitäten und Altenpflege, sondern im Denken eines jeden Menschen vorherrscht. Es geht zu oft um Selbstoptimierung. Tätigkeiten wie Kunst, Musik etc., die kein „Ergebnis“ versprechen, finden keine Anerkennung mehr. Alle spüren, dass sich das nicht gut anfühlt. Wir sind der Meinung, dass es eine erwachsenere Haltung braucht; eine, die in Kooperation, in Resonanz mit dem Umfeld geht. Was wir stattdessen sehen, ist eine eher infantile Begegnung mit der Welt, in der diese als Objekt des Ausschöpfbaren und uns zur Verfügung Stehenden gesehen wird.
Diese Haltung erleben wir auch in Unternehmen mit erwachsenen Menschen – hieran zu arbeiten, stellt oft eine Herausforderung dar, weil wirkliche Lösungen, die nachhaltig fundiert sind, einer „erwachsenen Haltung“ bedürfen.
Diese Einflüsse führen zu Veränderungen, die vorher kaum denkbar waren. Der millionenfache Umzug ins Homeoffice bedingt durch die Covid-Pandemie sei hier nur als ein Beispiel angeführt. Kleiner Exkurs am Rande dazu: Man könnte diesen Homeoffice-Umzug als gigantischen Feldversuch der Wirksamkeit von Changefaktoren verstehen: Wenn klar ist, wozu etwas gut ist (Schutz vor Ansteckung plus Aufrechterhalten der Betriebsfähigkeit), dann sind Menschen in der Lage, innerhalb von Stunden und Tagen tiefgreifende Verhaltensänderungen wie selbstverständlich umzusetzen. Dass es in der Folge zu weiteren Faktoren (Verlust der sozialen Bindung, Vereinsamung, Stress durch paralleles Home-Schooling etc.) führt, sei unbestritten.
Und dennoch können wir nach Gesprächen mit Personalern und Führungskräften aus Hunderten von Organisationen feststellen, dass dieser Change bei fast allen Organisationen erfolgreich geklappt hat. Ob dies nun die Zukunft der Zusammenarbeit sein wird, bleibt zu diskutieren. Aus unserer Sicht sinnvollerweise vor dem Hintergrund der gemeinsamen Aufgabe. Denn diese gibt Feedback zu sinnvollen Optionen und erfolgversprechenden Formen für die Zusammenarbeit.
Zurück zum Thema: Unzufriedenheit und externe Einflüsse sind Anlass, etwas zu verändern, etwas besser zu machen – die Organisation weiterzuentwickeln. Daher ist es gar nicht zwingend der optimale Zustand, wenn alles vordergründig „wie geschmiert“ läuft. Dies könnte dazu verleiten, sich in Sicherheit zu wiegen, Verbesserungspotenziale nicht im Blick zu halten, Risiken zu ignorieren oder zu spät zu erkennen und Veränderungen erst anzugehen, wenn es fast oder ganz zu spät ist.
Ein extremes Beispiel ist der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Trotz des bereits langwährenden Konflikts wurden die wirtschaftlichen Abhängigkeiten von einem Großteil der deutschen Wirtschaft und auch der Bevölkerung vollständig ignoriert. Dabei geht es nicht nur um Öl und Gas, sondern auch um Weizen und Kabelbäume für die PKW-Produktion. Getreu dem Satz Christian Morgensterns, dass „nicht sein kann, was nicht sein darf“, verschließen wir als Gesellschaft und damit auch in den Organisationen häufig die Augen vor grundlegenden Veränderungen oder seltenen Ereignissen, sogenannten „schwarzen Schwänen“ (Nassim Taleb).
Eine gewisse Unvollkommenheit einer Organisation trägt daher dazu bei, so etwas wie ein ständiges Grundrauschen an Veränderungslust zu halten – und das wäre durchaus ein produktiver Zustand.
FALLBEISPIELE AUS DER PRAXIS:
„Hilfe, wir wachsen!“
Eigentlich läuft bei der Prima GmbH alles bestens: Der Umsatz steigt, die Kunden sind zufrieden, die Zahlen sind hervorragend. Der Grund dafür: Das Unternehmen wächst. Intern jedoch hakt es an allen Ecken und Enden. Die Produktion läuft am Limit, der Service kommt nicht hinterher, das Team fühlt sich überfordert, weil das, was von den neuen Mitarbeitenden verlangt wird, nicht mehr „gelernt“ wurde, oder weil die Organisation nun eine deutlich andere Atmosphäre bietet als die, die Mitarbeitende „der ersten Stunde“ mal angezogen hat. Die Überstunden steigen, die Stimmung sinkt. Erste Mitarbeitende haben frustriert gekündigt.
„Bei uns wird jede Veränderung blockiert!“
Nichts bewegt sich in der kommunalen Verwaltung der Stadt Hinterberg. Wo auch immer Veränderung angestoßen wird, verläuft jedes Handeln im Sand oder kommt nicht zu einem erfolgreichen Abschluss, obwohl dafür nicht unerhebliche personelle Ressourcen in Anspruch genommen wurden. Es wird mehr geredet als gehandelt. Neue Vorschläge rufen inzwischen eher Augenrollen als Interesse hervor. Bürger hören am Telefon immer wieder (wenn denn überhaupt jemand ans Telefon geht), dass der entsprechende Mitarbeitende „nicht am Platz“ sei und man nicht wisse, wann er wieder da sein werde.
„Wir finden nicht zueinander!“
Nach vier Jahrzehnten konstanter Leitung in einer Doppelspitze übergeben die Gründer der Radermacher GmbH ihr Unternehmen an ihre Nachfolger. Zu diesen gehört neben dem Sohn eines der Gründer ein externer Experte mit Schwerpunkt Innovation und Agilität. Seither sinkt die Stimmung im ganzen Unternehmen. Führungskräfte sehen sich allein gelassen mit Entscheidungen, Mitarbeitende bangen um ihren Arbeitsplatz oder erhalten Aufgaben, denen sie sich nicht gewachsen sehen. Zwischen den beiden Nachfolgern kommt es zu Konflikten.
Es entsteht eine Zweiklassengesellschaft, in der die „Agilen“ ausprobieren dürfen, kommen und gehen, wann sie wollen, und zwar unter dem Deckmantel der „Selbstorganisation“. Die anderen machen hingegen ganz regulär mit der Hälfte der Leute die komplette Arbeit und werden bei mangelnder Kundenzufriedenheit und Zielerreichung zur Verantwortung gezogen.
„Das Neue entsteht aus dem Zweifel am Alten.“
Stephan Schulmeister, Jurist und Ökonom
Komplexität und Unsicherheit erschweren Veränderung
Was als Anlass zu Unzufriedenheit nach außen sichtbar wird, kann in unterschiedlichen Organisationen völlig unterschiedliche, sehr individuelle Ursachen haben – und diese sind häufig längst nicht so sichtbar wie das, was sie bewirken.
Mögliche Ursachen für unerwünschte Wirkungen im Unternehmen:
unklare operative Zielemangelnde Übereinstimmung zwischen Kommunikation der Ziele und den Handlungenfehlende Sinnhaftigkeit – wo ist der Nutzen, den wir (auch gesellschaftlich) stiften?Strategie greift nicht beziehungsweise wird in den Ebenen unter dem Topmanagement nicht fortgeführtkeine oder zu geringe Beteiligung der Mitarbeitenden (Partizipation) mit der Folge: keine Identifikation der Mitarbeitenden mit den Zielen der Organisationfehlende Ausrichtung auf ein gemeinsames Ziel (Vision, Purpose, primäre Aufgabe)Wechsel im Management gefolgt von Schnellschüssen, die aus Sicht der Belegschaft nicht nachvollziehbar erscheinennicht skalierbare Strukturengrößenbedingte Limitierungen (bestehende Muster funktionieren nicht mehr)unzulängliche Kommunikationnicht angegangene, schwelende KonflikteFührungsschwäche, Einknicken bei Widerstand gegen Entscheidungenunklare Verantwortlichkeiten/Rollen und lange, intransparente Entscheidungswegeverwandtschaftliche Beziehungen im Unternehmen mit der Folge, dass nicht aktiv geführt wirdstarre Hierarchieninformelle Hierarchien hebeln die formelle Hierarchie ausfehlende Eigenverantwortungschlechtes Zeit- und Selbstmanagementunterschiedliche Werte(-systeme) in der OrganisationEntscheidungsschwächemangelnde Transparenz bezüglich der Information aller Mitarbeitendenzu wenige (oder zu viele) Informationenfehlendes Wissen bezüglich „weicher Faktoren“Unwissenheit über Emotionen und unbewusste Verzerrer (Unconscious Bias/Noise) beziehungsweise deren IgnorierenMachen sich die Verantwortlichen nun daran, die spezifischen Wirkzusammenhänge in ihrer Organisation zu untersuchen, stellen sie häufig fest, dass die unerwünschten Wirkungen gleich ein ganzes Bündel an Ursachen haben, die sich zudem noch gegenseitig beeinflussen. Immer öfter verschwimmt auch der Ursache-Wirkung-Zusammenhang: Stellschrauben, die früher vermeintlich zuverlässig griffen, bewirken nun nichts mehr oder – fast noch schlimmer – sie greifen nur manchmal. Auf steigende Fluktuation mit einem „dann bezahlen wir halt noch mehr Gehalt“ zu reagieren, löst das Problem im Regelfall nicht. Auch der generelle Wunsch des Topmanagements nach einer „klaren Analyse der Tatsachen“ ist zwar nachvollziehbar, bringt aber aufgrund der komplexen Lagen selten mehr Klarheit.
Sogenannte Kulturdiagnosen sind dann eher ein Pacingelement (dem Kunden zunächst einen Einblick in den Status-Quo bzw. in die Vergangenheit zu liefern) als wirklich inhaltlich relevant, um die Lösung zu kreieren. Da aber das Pacing (im Sinne von Angleichen und Verstehen) und der gute Kontakt Basis für Veränderung sind, halten wir sie selbstverständlich für nützlich. Die inhaltlichen Ergebnisse sollte man hier aber nicht absolut setzen, da ja meister weniger Vergangenheitsbewältigung sondern mehr Zukunftsgestaltung erreicht werden soll.
Komplexität und Unsicherheit können dazu führen, dass Veränderungsprozesse sich in die Länge ziehen, Entscheidungen nicht getroffen oder gleich wieder in Frage gestellt werden. Projekte laufen ins Leere und trotz erheblicher Anstrengungen wendet sich wenig zum Besseren.
Wo aber, fragen sich die Verantwortlichen zu Recht, sollen sie beginnen, wenn sie sich nicht einmal sicher sein können, wo sie ansetzen müssen, um tatsächlich etwas zu verändern? Diese Fragen werden wir in diesem Buch aufnehmen und zu beantworten versuchen. Wir werden aufzeigen, welche neuen Denkweisen und Modelle helfen, die Komplexität anzunehmen und mit ihr umzugehen (Teil II), und was ganz konkret Organisationen besser macht (Teil III und IV). Wir bleiben aber nicht bei der Theorie, sondern werden in Teil V ein Plattformmodell vorstellen, mit dessen Hilfe sich Prozessbegleitung so gestalten lässt, dass sie ein Höchstmaß an Flexibilität bietet und dennoch Regeln und Verhaltensweisen aufstellt, die schrittweise Veränderungen vorantreiben und effizient umzusetzen helfen.
Neue Sichtweisen in der Organisationsentwicklung
Aus unserer Praxis heraus sehen wir einige wesentliche Fortschritte in der Organisationsentwicklung, die sich für die veränderten Bedingungen bewährt haben.
Organisationen werden als Systeme betrachtet
In unseren über zwei Jahrzehnten Beratungspraxis in der Veränderung von Organisationen haben wir kein einziges Projekt erlebt, in dem eine einzige Ursache Auslöser für ein unerwünschtes Symptom war. Es sind immer Bündel von auslösenden und verstärkenden Faktoren, die über die Zeit hinweg den organisationalen Schmerzpunkt verstärken, bis dazu schließlich eine „Bearbeitung“ als notwendig erachtet wird.
In der Analogie könnte man die Organisation als einen Körper verstehen, der sich zu wenig bewegt, sich etwas ungesund ernährt und dann nach Jahren über diverse Zipperlein klagt, die sich schließlich zu einer handfesten Erkrankung ausbilden, die dann erst zum Besuch eines Arztes führen, wenn das Leid groß ist. Je „männlicher“ die Kultur, desto später der Gang zum Arzt, ließe sich noch hinzufügen. Und um im Bild zu bleiben: Jetzt verlangen wir vom Arzt eine Pille, die uns rasch wieder gesund macht, statt unsere Lebensweise grundsätzlich zu verändern, mehr Sport und Bewegung sowie eine bessere Ernährung in unseren Alltag zu integrieren. So ähnlich verhält es sich in der Organisationsberatung: Schnelle Hilfe, Quick-Wins und Symptomlinderung sind erbeten, grundlegende Änderungen bitte nicht. Diese Betrachtung ist überholt – und war es eigentlich schon immer.
Organisationen sind komplexe soziale Systeme und werden durch die Interaktionen von Menschen gestaltet und aufrecht erhalten. Durch eine systemische Sichtweise wird die Organisation (wieder) als eine lebendige Einheit betrachtet, die über die letzten Jahrhunderte durch unsere Tendenz zur Abtrennung und Strukturierung aus dem Blick geraten ist. Systemische Organisationsentwicklung betont hier die Einheit und die Verbindung der unterschiedlichen Elemente und deren Beziehung zueinander. Sie fokussiert auf die Beziehungen innerhalb der Organisation, und zwar im Hinblick auf eine zweck- und zieldienliche Ausgestaltung der Kommunikation.
Also weg von der Ab-Teilung oder einem getrennten Bereich oder einer Division – hin zu einem ganzheitlichen Organismus. Nur wenn wir Strukturen und Prozesse unter Einbeziehung der sozialpsychologischen Wirkungen betrachten, werden wir Organisationen besser, nachhaltiger und am Ende auch produktiver machen. Diese Perspektive wird noch häufig ausgeblendet. Aber: Funktionierende Beziehungen sind per se agil und flexibel. Strukturen ohne diese aufs Ziel gerichtete, positive Energie sind hingegen leicht brüchig. Wir arbeiten konsequent und durchgängig systemisch. In diesem Buch werden wir uns daher immer wieder auf die systemische Betrachtung beziehen, sie erläutern und konkret machen.
PE und OE werden gemeinsam betrachtet
Ohne eine Basis, mit der sich eine Organisation Rahmen, Ziele, Sinn und Werte gibt, werden konkrete Maßnahmen kaum Wirkung entfalten. Andersherum nutzen die schönsten Ziele wenig, wenn die Menschen sie in der Organisation nicht auch mit entsprechenden Kompetenzen, Motivation und Leistungsbereitschaft verfolgen. Organisationen neu zu denken und auf deren Zieldienlichkeit hin zu hinterfragen (Organisationsentwicklung), heißt daher für uns immer auch, Menschen Räume für ihre persönliche Weiterentwicklung anzubieten (Personalentwicklung).
Wenn Personalentwicklung das systematisch-strategische Entfalten des in einem Menschen vorhandenen Potenzials zum Inhalt hat, besteht für die Organisationsentwicklung folglich die Aufgabe, die in einer Organisation vorhandenen Potenziale zur Entfaltung zu bringen, und zwar, indem sie einen Kontext kreiert, in dem Menschen im Sinne der gemeinsamen „primären Aufgabe“ wirksam sein können.
Unserer Erfahrung nach arbeiten in erfolgreichen Unternehmen die Verantwortlichen für Personal- und Organisationsentwicklung nicht mehr getrennt voneinander. Aus unserer Sicht muss der Ausgangspunkt jeder Betrachtung sein: Organisationen sind für Menschen da. Ein übergeordneter unternehmerischer Zweck (zum Beispiel basierend auf den 17 Zielen der UN oder den ESG-Kriterien) ist in einer modernen Organisation genauso notwendig wie das Schaffen von menschenorientierten Orten (Büros, Gebäude) und Strukturen für gute Führung.
Unsere Hypothese lautet, dass Organisationen, die nicht den Menschen und der Welt dienen, auf lange Sicht keinen Bestand haben werden. Der seit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts propagierte Shareholder-Value-Ansatz hat als alleiniger Antreiber von Organisationen ausgedient.
Rolle von Führung ändert sich
Eine Organisation selbst kann sich nicht verändern. Es sind die Menschen, die die Organisation verändern, allen voran die Führungskräfte als Teil des Systems Organisation. Immer wieder begegnet uns im Beratungsalltag der rührende Irrtum, dass die Organisation – etwas dinglich Abstraktes – sich zu verändern habe. In einem sozialen System sind es die Menschen, die dazulernen und sich verändern. Dabei den eigenen Stellenwert zu hinterfragen, oder gar selbst zu initiieren, dass Verantwortlichkeiten, Rollen und Zusammenarbeit neu sortiert werden, kann Unbehagen oder Schmerzen bereiten: Führungskräfte befürchten, an Kontrolle oder Status zu verlieren, kommen nicht aus der eigenen Komfortzone oder empfinden Veränderungen gar als einer Art persönlicher Kränkung und Gesichtsverlust. Die Reaktionen sind so vielschichtig wie die Gründe, die nicht ungehört bleiben dürfen.
Andererseits obliegt genau diesen Führungskräften die Verantwortung dafür, dass alle von der Veränderung Betroffenen zu Beteiligten werden und dass Veränderung und Organisationsentwicklung von einer breiten Basis der Beschäftigten mitgetragen werden. Sie sind gefragt, die Eigentümerschaft (Ownership) für den Wandel zu übernehmen – Führung ist nichts für Feiglinge.
Wir sind der festen Überzeugung, dass – anders als in der Vergangenheit – eine reine Top-down-Veränderung einer Organisation nur noch sehr geringe Erfolgsaussichten hat und es eine breite Koalition für die Veränderung braucht, wenn sie gelingen soll.
Wir erleben immer wieder, welche Katalysatorwirkung Führungskräfte haben können – oder eben auch nicht. Immer aber prägen sie die Art der im System Organisation gelebten Beziehungen maßgeblich. Führungsstil, Veränderungskompetenzen und die Verantwortung in der Vorbildrolle machen unserer Erfahrung nach einen entscheidenden Unterschied zwischen Gelingen und Scheitern wichtiger Entwicklungen in der Organisation.
„Führung und Lernen bedingen sich gegenseitig.“
John F. Kennedy, ehemaliger US-Präsident
2. DIE WELT DREHT SICH IMMER SCHNELLER – MITHALTEN ZWECKLOS?
Eingebettet in einen globalen Wirtschafts- und Kundenraum sind Organisationen immer stärker davon abhängig, was sich außerhalb der eigenen Strukturen – ohne ihren Einfluss – verändert. Autonom handeln kann kaum mehr jemand. Dabei spielen neben der ökonomischen Dimension zunehmend die gesellschaftliche und die ökologische Dimension entscheidende Rollen. Die Welt, in der wir leben, ist eine chancenreiche, jedoch zugleich zunehmend anstrengende geworden, die sowohl beherztes Handeln als auch Fingerspitzengefühl und eine gute Nase erfordert. Zum Teil ist diese Erhöhung des Tempos aus unserer Sicht auch auf die Versäumnisse der letzten 70 Jahren zurückzuführen, wenn es um unsere grundsätzlichen ökologischen, ökonomischen wie gesellschaftlichen Fragestellungen geht.
Zumindest vermeintlich ist das Tempo der Entwicklung und auch die Relevanz ihrer Auswirkungen auf die Unternehmen in den vergangenen zehn bis 20 Jahren massiv gestiegen. Welches sind die Themen, die Einfluss auf Organisationen ausüben? Welches die Leuchttürme, an denen sie Orientierung finden können? In diesem Kapitel betrachten wir die Herausforderungen, die das Umfeld an Organisationen stellt. Welche konkreten, machbaren Veränderungen wollen wir angehen? Wo kann unser Beitrag sein? Wie können wir und unsere Organisationen die Welt mitgestalten – in einer guten, ethischen Art und Weise?
Um zu verstehen, wie sich Arbeit in den letzten Jahrhunderten entwickelt und verändert hat, lohnt sich ein Blick in die Geschichte ...
„Falls Gott die Welt geschaffen hat,
war seine Hauptsorge sicher nicht,
sie so zu machen,
dass wir sie verstehen können.“
Albert Einstein, Physiker
Geschichte der Arbeit
Die Geschichte der Arbeit verdeutlicht, wie sich Arbeit über die Jahrzehnte und Jahrtausende verändert hat. Insbesondere aber kann sie das Bewusstsein dafür schärfen, dass sich das Verständnis und die Ausgestaltung von Arbeit immer wieder verändern und dass dies, kommt es einmal ins Rollen, fast unaufhaltsam stattfindet. Und in diesem Moment gilt stets, dass alte Muster nicht mehr greifen und nur tiefgreifende und kreative Entwicklungen zu etwas wirklich Neuem führen.
Die Geschichte der Arbeit beginnt damit, dass die Menschen sesshaft wurden. Damals waren es drei Dinge, die alles veränderten: erstens Werkzeuge, zweitens Wissen und Erfahrung und drittens die Spezialisierung auf bestimmte Aufgaben mit bestimmten Kompetenzen. Seither sind etwa 12.000 Jahre vergangen.
In der Antike galt Lohnarbeit mit den Händen als unfein und niedrige Tätigkeit. Die Philosophen des Altertums werteten sie ab, weil sie nicht auf Selbstverwirklichung und Erkenntnisgewinn des Menschen gerichtet sei. Der Römer Cicero erhob einige Jahrhunderte später hingegen die Arbeit zur allgemeinen Tugend, da sie dem Gemeinwohl diene. Dieser Gedanke findet sich mit religiösem Hintergrund auch in der Reformation wieder („Wer nicht arbeitet, ist nicht mein Nächster“, Martin Luther). Dazwischen lag das Mittelalter mit seinen Zünften und Gilden, die der Ausbildung der Arbeiter und der Qualität der Ware einen hohen Stellenwert zumaßen. In dieser Zeit war es übrigens normal, dass Familie und Arbeiten an einem Ort verbunden war. Die Trennung von Privatem und Beruflichem wurde in der Folge als Errungenschaft gesehen.
Die Industrialisierung änderte alles: Monotone Akkordarbeit und katastrophale Arbeits- und Lebensbedingungen ließen Karl Marx von der „Entfremdung der Arbeit“ schreiben und deren „bewusste Gestaltung“ fordern. Stattdessen schuf Frederick Winslow Taylor, der rein auf die Steigerung der Produktivität menschlicher Arbeit setzte, so etwas wie den Superlativ der Marx’schen Entfremdung. Der höhere Zweck oder Sinn einer Tätigkeit war in diesen Fabriken kaum noch spürbar; die Arbeit stark entkoppelt vom einzelnen Menschen.
Mit den Auswirkungen des Taylorismus vor Augen prägte in den 1970er Jahren der österreichisch-amerikanische Philosoph Frithjof Bergmann den Begriff „New Work“. Unter anderem forderte er sinnstiftende Arbeit mit Handlungsfreiheit und Selbstständigkeit. Um dies zu erreichen, müsse der Mensch wissen, was er „wirklich wirklich will“.
Zur gleichen Zeit, nämlich 1972, wurde eine Studie im Auftrag des Club of Rome veröffentlicht. Unter dem Titel „Die Grenzen des Wachstums“ zeichnete er ein beklemmendes Bild von Überbevölkerung, Umweltverschmutzung und dem Versiegen von Rohstoffen.
In den folgenden Jahrzehnten wurde der ein oder andere Versuch unternommen, das Credo zu durchbrechen, dass es ohne Wachstum keinen Wohlstand geben könne. Für den Bereich der Ökonomie wurden beispielsweise die folgenden Konzepte als visionäre Ansätze entwickelt: Postwachstums- und Gemeinwohlökonomie, Donut-Ökonomie nach Kate Raworth, Glücksökonomie und menschengerechtere Ökonomie etc. Sie alle beziehen sich auf einen Wandel von Lebensstil, Versorgung und Produktion.
Gemeinwohlökonomie
Das Konzept der Gemeinwohlökonomie geht zurück auf das gleichnamige Buch von Christian Felber (2010), Mitgründer von „attac“, einem internationalen Netzwerk, das sich mit den negativen Auswirkungen globalisierter und ungeregelter Finanzmärkte auseinandersetzt. Es sieht die Wirtschaft nicht als ein über der Gesellschaft stehendes, eigenes autonomes System, sondern strebt die Wiedereinbettung der Wirtschaft in das gesellschaftliche Wertesystem an. Wirtschaft, so der Grundgedanke, hat die Aufgabe, den Menschen zu dienen und das Gemeinwohl, also das Wohl aller, sicherzustellen. Die Gemeinwohlökonomie hat drei inhaltliche Zugänge: Werte, Struktur und Messbarkeit.
Die Wertebasis der Gemeinwohlökonomie sind Vertrauensbildung, Wertschätzung, Kooperation, Solidarität und Teilen.Diese Werte sollen sich in der konsequenten Umsetzung einer neuen Wirtschaftsordnung zeigen. Dazu gehören etwa die Umpolung wirtschaftlicher Anreizsysteme und eine Steuerregelung für Unternehmen vom größtmöglichen Gewinn hin zum größtmöglichen Beitrag zum Gemeinwohl.Die wirtschaftliche Erfolgsmessung wird umgestellt von Tauschwert-Indikatoren zu Nutzwert-Indikatoren. Die Gemeinwohlökonomie will das messen, was Menschen grundlegend benötigen; was sie zufrieden und glücklich macht. Das Gemeinwohlprodukt einer Volkswirtschaft und die Gemeinwohlbilanz eines Unternehmens lösen BIP und Finanzgewinn ab. Werte und Prinzipien werden gemeinsam, demokratisch und transparent bestimmt. Die Kooperation der Unternehmen ist nicht von Konkurrenz, sondern von Kooperation im Sinne der gemeinsamen Schaffung von Gemeinwohl bestimmt. Basierend auf diesen Ideen entstehen heute im Rahmen der ESG-Kriterien konkret messbare Zahlen, die in Zukunft zunächst von Kapitalgesellschaften (inklusive Audit) veröffentlicht werden müssen.Donut-Ökonomie
Die britische Wirtschaftswissenschaftlerin Kate Raworth stellt die Welt als ein rundes, frittiertes Gebäck dar – einen Donut. In dessen Zentrum sieht sie das gesellschaftliche Fundament, darum einen Kreis aus Ökologie, Politik und Wirtschaft, die harmonisch im Einklang stehen. In der Mitte stehen ein gerechter und sicherer Raum für die Menschen und eine regenerative und distributive Ökonomie, die nach außen von einer „ökologischen Decke“ und nach innen von einem „sozialen Fundament“ begrenzt werden. Was weiter nach außen oder innen geht, überschreitet in der Donut-Ökonomie Grenzen, die planetarer und sozialer Art sein können. Zu den planetaren Grenzen gehören etwa Klimawandel, Verlust an Biodiversität und Artenvielfalt, Luftverschmutzung und Umwandlung von Landflächen. Für Raworth dürfen diese Grenzen nicht überschritten werden. Soziale Grenzen sind beispielsweise Gesundheit, Bildung, Einkommen, Gerechtigkeit und politische Teilhabe. Bei diesen Grenzen gilt: Es darf kein Defizit geben.
Die Grenzen und die Form des Donuts visualisieren den Handlungsspielraum für ökonomisches Handeln. Was über die (äußere) planetarische Grenze hinaus geht, gilt als Exzess. Was in den mittigen Kreis hineinreicht (zum Beispiel Hunger, soziale Ungleichverteilung, Krieg), wird für die Gesellschaft zum Mangel. Raworth stellt die Einhaltung des durch die Donutform definierten Bereichs des „gerechten und sicheren Raums“ als alternative Zielvorgabe dem reinen Wachstum des BIP gegenüber. Einfach gesagt: Gesamtwohlergehen ist wichtiger als „mehr Euros auf dem Konto“. Mit dieser Neuauslegung der Wirtschaft will sie die Sicht darauf ändern, wer wir sind, wo wir stehen und was wir sein wollen.
Und heute?
Der Begriff „New Work“ war oder ist zwar in aller Munde, wird aber selten mit all seinen Facetten betrachtet. Tischkicker und Homeoffice mögen irgendwie dazugehören, sind aber als Symbole weit überschätzt. Es geht um viel mehr: Es geht um eine neue Weltanschauung, in welcher Arbeit als sinnstiftendes und zukunftsgerichtetes Element in unser aller Leben gesehen wird.
Die Gemeinwohlökonomie findet sich zum Beispiel in immer wiederkehrenden Diskussionen über ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und der Club of Rome hat ein halbes Jahrhundert später seine Nachfolge und Weiterentwicklung in Greta Thunberg und der Fridays-for-Future-Bewegung gefunden – das Ganze in einem Kontext, in dem Einzelne ohne größeren Aufwand „auf Sendung“ gehen können und die Transformation der Medienlandschaft einen beschleunigenden Effekt mit sich bringt.
Ob das reicht, um den tiefgreifenden wirtschaftlichen und kulturellen Wandel durch Digitalisierung, Vernetzung, Globalisierung und demografischen Wandel zu verstehen und ihn bewusst wie sinnstiftend zu begleiten, wird sich zeigen. Die Politik scheint in einem, wenn auch langsamen, Wandel von Prioritäten – aus unserer Sicht aber eher durch die äußeren Bedingungen getrieben und weniger durch klares visionäres Handeln für ein zieldienlicheres Stattdessen.
Organisationen befinden sich auf der Suche nach einer neuen Positionierung. Die Fragen lauten: Was wollen wir wirklich? Und wie kommen wir aus der eigenen vergangenheitsgeprägten Denkweise heraus, damit wir nicht Gleiches in immer wieder vermeintlich neuen Formen produzieren? Wie müssen wir denken, um das zu erreichen?
Klar ist zunächst nur: Klassische Konzepte von Arbeit wie Zeit, Raum, Führung und Strukturen müssen für die Zukunft neu gedacht werden. Wir brauchen neue Worte für unser Zukunftsbild sowie Fantasie, um ein Stattdessen zu gestalten. Visionsentwicklung und Purpose werden eine entscheidende Rolle in der Organisation der Zukunft spielen – und damit auch für ihren gesamtgesellschaftlichen Beitrag. Denn wenn wir weiterhin ausschließlich das eigene Innenleben unserer Organisationen als gestaltbar betrachten, unterschätzen wir die Zusammenhänge, die das Umfeld auf die Organisation, aber eben auch die Organisation auf das größere Ganze haben können. Auch Organisationen stehen heute in der Pflicht, die „Welt ein bisschen besser zu machen“, indem sie diese Welt, ihr Wohlergehen und ihre Funktionsfähigkeit in ihr aktuelles und zukünftiges Handelns aktiv einbeziehen.
VUCA
Wie bereits beschrieben, leben wir in einer Welt, in der Veränderungen ständig ablaufen – und zwar teils in atemberaubendem Tempo. Zusätzlich haben wir in den vergangenen Jahren versucht, uns den Veränderungen durch eine Illusion der Konstanz zu entziehen. Daher erscheint uns das Tempo heute besonders hoch. Wie auch immer: Anforderungen lassen sich zunehmend nicht mehr durch herkömmlich gelerntes Verhalten meistern. Das Akronym VUCA (wie auch andere, zum Beispiel BANI) will helfen, diese Welt zu beschreiben, indem es ihr vier Eigenschaften zuordnet. Diese Eigenschaften gelten grundsätzlich für die relevanten Themen und Systeme unserer Zeit. Sie lassen sich auf Ökonomie genauso projizieren wie auf Ökologie, Demokratie und die Gesamtheit der Gesellschaft.
Was verbirgt sich hinter dem Akronym VUCA?
Volatility/Unbeständigkeit: Die Welt verändert sich ständig, und zwar immer drastischer und schneller. Die Beziehungen von Ursache und Wirkung sind schwer, manchmal gar nicht, einsehbar und verständlich.
Uncertainty/Unsicherheit: Ereignisse sind immer weniger vorhersehbar und berechenbar. Was früher an Planungen, Prognosen und Erfahrungen relevant war, ist für die Gestaltung der Zukunft immer seltener nutzbar. Es wird daher immer schwieriger, klar zu sehen, wohin die Reise geht.
Complexity/Komplexität: Aufgaben und Probleme werden vielschichtiger, und es wird schwierig und aufwendig, sie zu durchdringen. Zusammenhänge werden unübersichtlicher, Entscheidungen immer schwieriger.
Ambiguity/Mehrdeutigkeit: Immer seltener sind Situationen eindeutig und exakt bestimmbar. Wo einst ein Ja-Nein oder Schwarz-Weiß möglich war, gilt es heute, vielfältig bunte Optionen zu berücksichtigen. Entscheidungen fordern Mut, Bewusstheit und Fehlerfreudigkeit.
Schon jedes einzelne der vier Merkmale für sich genommen, wäre eine Herausforderung für jede Organisation. Alle vier zusammen ergeben (gemischt mit weiteren Themen) einen, wie es Sebastian Jungers in seinem Bestseller nennt, „perfekten Sturm“ – und sind eine große Herausforderung. Das Management quer durch alle Branchen und Unternehmensgrößen stellt fest: Altbekannte Strukturen und Prozesse sind in einer instabilen Umgebung immer seltener geeignet.
Um in diesem Umfeld zu manövrieren, gilt es, Unternehmensstrategien und -strukturen unablässig an sich ständig im Wandel befindende Umwelten anzupassen. Das ist anstrengend, aufwendig und letztlich auch teuer. Zudem besteht das ständige Risiko, dass auch die neue Strategie, die neue Struktur, die neue Veränderung im Unternehmen nicht zum gewünschten Erfolg führen.
Unserer Meinung nach führt kaum ein Weg daran vorbei, diese Entwicklungen in den festen Takt der Managementroutinen einzubauen, anstatt die Bearbeitung solcher Themen als unerwünschte, einmalige Randerscheinung zu behandeln. Genauso wie es das Innovationsmanagement in den letzten Jahrzehnten aus dem Schatten ins Licht geschafft und einen „ordentlichen“ Platz in allen modernen Organisationen gefunden hat, braucht es nun einen Raum für das Transformationsmanagement, in dem (nicht nur) die Führung einer Organisation über die aktuellen und zukünftigen Ereignisse nachdenken, reflektieren und auch streiten kann.
„In einem komplexen System sind wohl die Beziehungen der
Elemente zueinander wichtiger als die Elemente selbst.“
Frederic Vester, Biochemiker
(Digitale) Transformation
Das „digital“ steht bewusst in Klammern, denn die Transformation ist ein grundlegender Wandel, der allerdings häufig durch die zunehmende Digitalisierung angefeuert wird. Daher laufen fast alle Transformationsaktivitäten auch heute unter dem Banner „Digitalisierung“.
Etwa 40 Jahre hat es gedauert, bis das Telefon von zehn Millionen Menschen genutzt wurde – Skype hat dies innerhalb eines Jahres erreicht. Mehr als hundert Jahre hat es gedauert von der Patentierung des ersten Telefons (1876) bis zum ersten massenproduzierten Mobiltelefon (1992). 2007 begann mit dem ersten iPhone der rasante Siegeszug des Smartphones. Bereits zehn Jahre später werden jährlich 1,5 Milliarden Geräte verkauft. Nahezu jeder hat heute einen kleinen Supercomputer in der Tasche, auf dem das Wissen der Welt ist, mit dem wir über den ganzen Globus kommunizieren können und nebenbei an der Supermarktkasse unsere Einkäufe bezahlen. In nicht einmal 15 Jahren hat die Welt der Technologie einen gigantischen Sprung gemacht, der die gesamte Gesellschaft betrifft. Funfact aus technologiehistorischer Sichtweise am Rande: In beiden Fällen sind die kommerziell erfolgreichen Personen (Alexander G. Bell/Steve Jobs) beziehungsweise Unternehmen (Bell, Apple) nicht deckungsgleich mit denjenigen, die die Geräte erfunden beziehungsweise entwickelt haben.
Wer heute sein Gegenüber fragt, welche wohl 2006 die beliebteste App war, wird fast immer Nachdenken und Raten hervorrufen. Nur, dass es halt 2006 noch gar keine Apps gab. Wir adaptieren Änderungen und vergessen sogar, wie schnell sie verlaufen. Hätte uns 2006 jemand die Welt von 2022 erklärt, hätten die meisten von uns milde gelächelt. Das macht einerseits Mut, dass Menschen in der Lage sind, auch schnelle, massive Änderungen mitzugehen. Andererseits zeigt es, dass ohne Begleitung auch immer Menschen (nicht nur ältere) auf der Strecke bleiben. Und obendrein lässt es vermuten, dass wir uns vieles von dem, was in 15 Jahren möglich sein wird, heute noch nicht im Entferntesten vorstellen können. Unter diesem Blickwinkel verlieren strategische Fünf- oder Zehn-Jahres-Pläne als OE-Mittel deutlich an Gewicht (wenngleich eine strukturierte Beschäftigung mit Richtungen und Wünschen einer Organisation durchaus sinnvoll ist – nur eben ohne den Irrglauben, dass es dann auch so kommen wird).
Erfindungen und Veränderungen (auch disruptive!) gab es schon immer. Es ist jedoch aktuell nicht nur die Technologie, sondern verstärkt das fundamentale Geschäftsmodell, das die Transformation bestimmt. Neue Wettbewerber treten (höchst erfolgreich!) auf den Markt, Marktführerschaften wechseln. Ob Musikindustrie, Fotoindustrie, Automobilbranche oder auch das Geschäft rund um die diversen Onlineplattformen und Onlineshops: Alle Branchen sind betroffen.
Die Masse der digital gespeicherten Daten, die wirtschaftlich genutzt werden können, steigt rasant an. Die Rechengeschwindigkeit nimmt dem Mooreschen Gesetz folgend immer noch exponentiell zu. Ein Smartphone ist inzwischen mindestens zehnmal schneller als der Computer, der 1997 erstmalig einen menschlichen Schachweltmeister schlug. Und die Welt vernetzt sich kontinuierlich immer stärker: Forschungsinstitute wie Statista gehen von aktuell über 30 Milliarden über das Internet vernetzten Geräten aus – und von 75 Milliarden im Jahr 2025.
Die digitale Transformation ist eine der größten Aufgaben für Gegenwart und Zukunft. Sie zwingt dazu, nahezu alle Bereiche einer Organisation zu hinterfragen und auf ihre Wirkmechanismen und Zusammenhänge hin zu analysieren, um sie dann gegebenenfalls zu verändern. Anmerkung: Das Wort „digital“ dem Wort „Transformation“ vorangestellt versucht das Betrachtungsfeld etwas einzugrenzen, allerdings können wir auch allgemein von Transformation sprechen. Nur als Beispiel: Immer mehr elektronische Geräte brauchen auch immer mehr seltene Erden, was heute an anderen Orten der Welt viel Leid und Ausbeutung verursacht.
Das jüngste und fast jedem bekannte Beispiel ist die in wenigen Tagen und Wochen weitverbreitete Verfügbarkeit von großen Sprachmodellen verbunden mit maschinellem Lernen. Pionier OpenAI hat hier mit ChatGPT (Textgenerator) und DaleE (Bildgenerator) den Stein ins Rollen gebracht und andere große Konzerne in einen Wettlauf um das beste Sprachmodell getrieben, dessen Ende nicht absehbar ist – hingegen absehbar ist, dass diese Technologie einen tiefgreifenden Einfluss auf unsere Arbeits- und Lebenswelt haben wird, zum ersten Mal auch für kreative Berufe, die sich bislang sicher vor den Fortschritten der Automatisierung und Digitalisierung glaubten.
Eine ganzheitliche digitale Transformation bearbeitet aktiv auch die dahinterliegenden Wertschöpfungs- und Lieferketten und bemüht sich um eine nachhaltigere Transformation. Und: Starke Organisationen transformieren sich, wenn sie können, und nicht, wenn sie müssen.
Megatrends
Niemand kann in die Zukunft sehen. Aber angenommen die Welt dreht sich in etwa so weiter wie im Moment, können wir zumindest Prognosen wagen, welche Themen sich entwickeln werden, wie wichtig sie werden und in welchen Beziehungen und Abhängigkeiten sie zueinander stehen. Einen wichtigen Anhaltspunkt dafür bieten die sogenannten Megatrends.
Megatrends sind mächtige transformative Kräfte, die auf Prioritäten wirken, die sich Gesellschaften setzen, Innovationen vorantreiben und Geschäftsmodelle neu denken lassen. Megatrends umfassen Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Technik und Kultur und sind in der Lage, die Welt zu verändern – zwar langsam (innerhalb von Jahrzehnten), dafür aber grundlegend und nachhaltig. Viele Megatrends sind untereinander verwoben. Die wichtigsten, wie sie beispielsweise das Zukunftsinstitut von Mathias Horx erforscht, möchten wir Ihnen kurz und knapp vorstellen. Dies könnte die Welt sein, in der wir uns in den kommenden Jahrzehnten bewegen:
Mobilität
Auch in einer vernetzten Gesellschaft ist Mobilität notwendig. Andere Megatrends wie Urbanisierung und Ökologie führen zu einer Vielzahl an Mobilitätskonzepten für umweltfreundliches, smartes und vergemeinschaftetes Bewegen von A nach B. Car-/Ridesharing, E-Mobilität, kostenfreier ÖPNV, fahrerlose Autos, Radwegekonzepte und vieles mehr bestimmen diesen Megatrend. Neue Geschäftsmodelle und neue Arbeitsmodelle entstehen.
Konnektivität
Vernetzung ist einer der Haupttreiber für gesellschaftlichen Wandel und Voraussetzung für Digitalisierung und Globalisierung. Sie lässt neues Verhalten und neue Lebensstile entstehen. Organisationen stehen vor der Aufgabe, ihre Organisation systemisch zu betrachten, um der Komplexität gerecht zu werden.
Globalisierung
Der Fokus liegt hier nicht nur auf wirtschaftlichen Vernetzungen, sondern auch auf Aspekten wie Bevölkerungswachstum, Migration, Weltordnung, Neonationalismus, Wachstum und Postwachstum. Kaum ein Megatrend steht mehr in der Diskussion (und Kritik) als die Globalisierung.
Individualisierung
Individualisierung berührt Wertesystem, Alltagskultur und Konsumverhalten. Sie steht letztlich für die Freiheit, nach eigenem Willen zu handeln. Dahinter stecken jedoch eine Vielzahl komplex verwobener Faktoren von Achtsamkeit über Diversity, Do-it-Yourself und Singlegesellschaft bis zu Lebensphilosophie und Resonanzgesellschaft.
Ökologie (beziehungsweise Neoökologie)
Bio, Öko, Umweltschutz, Energiewende – der Megatrend Ökologie findet sich in nahezu jedem Bereich des Alltags. Ökologie und Nachhaltigkeit entwickeln sich zu mächtigen Treibern, die gesellschaftliche Werte und Unternehmensstrategien ebenso wie Kultur und Politik beeinflussen. Unternehmerisches Denken und Handeln können dadurch grundlegend verändert werden.
Urbanisierung
Immer mehr Menschen leben in Städten und machen sie zu Drehscheiben in der Weltwirtschaft. Neue Formen von Mobilität und Vernetzung lassen neue, pulsierende Zentren entstehen mit einer ebenso neuen Lebens- und Denkweise. Rural Citys, Smart Citys, Third Places, Architektur, Urban Farming und Fahrradboom sind nur einige Aspekte, die auch einen erheblichen Einfluss auf die Veränderung von Arbeit und Arbeitsräumen haben.
Gesundheit
Gesundheit ist ein zentrales Lebensziel und aus Kultur und Selbstverständnis von Gesellschaften nicht wegzudenken. Gezielte Ernährung, Flexitarier, Alternativmedizin, Digital Health, Selftracking, Balance von Körper und Geist sind Aspekte, die zunehmend auch als Anforderungen von Menschen an ihren Arbeitsalltag und ihre Organisation gestellt werden.
Gender Shift
Das Geschlecht eines Menschen spielt eine zunehmend geringere Rolle gegenüber individuellen Vorlieben und Talenten. Rollenmuster und Stereotype werden aufgebrochen. Für die Arbeitswelt gilt die Diversity von Mitarbeitenden zunehmend als wichtiger Erfolgsfaktor hinsichtlich Innovationsfähigkeit und Resilienz. Es wächst eine neue Kultur einer pluralistischen Gesellschaft.
Sicherheit
Auch wenn es medial nicht so wirken mag: Wir leben in der sichersten aller Zeiten. Und doch streben wir mehr als je zuvor nach Sicherheit: beim Umgang mit Daten, beim autonomen Fahren, beim Wunsch nach öffentlicher Reputation. Der Begriff „Flexicurity“ spiegelt das Spannungsfeld von Organisationen zwischen angestrebter Sicherheit und notwendiger Agilität und Risikobereitschaft wider.
Silver Society
Die Demographie spielt insbesondere in den westlichen Ländern eine herausragende Rolle. Die Menschen werden immer älter und die Lebensphase nach der Arbeit immer länger. Sie bietet Raum für neue Entfaltung und Weiterentwicklung einer vitalen Generation, die Alter und Altern umdeutet – ein beachtliches Potenzial auch für Unternehmen.
3. TEIL EINER BESSEREN WELT WERDEN
Nachhaltiges, verantwortungsvolles Handeln gewinnt für Organisationen zunehmend an Bedeutung. Ein respektvoller Umgang mit Ressourcen – seien es Rohstoffe, Energie oder Arbeitskräfte – gehört heute zu den Grundsätzen der Unternehmensführung. Mal mehr, mal weniger.
Ein Treiber sind die Kunden der Organisation. Je mehr für die Kunden Aspekte der Nachhaltigkeit an Bedeutung gewinnen, desto entscheidender bis überlebenswichtig wird es für Unternehmen, die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden zu bedienen. Und damit ist weit mehr als eine Verpackung aus brauner Ökopappe gemeint. Ein Treiber sind Regeln, die die Politik vorgibt und bei deren Nichteinhaltung mit Sanktionen zu rechnen ist. Wie schnell solche Themen akut werden können, spürten weite Teile der produzierenden Wirtschaft, als durch den Ukrainekrieg über Nacht Rohstoffe und Energie massiv verteuert oder gar nicht mehr verfügbar waren – obwohl die Regeln nicht einmal direkt den eigenen Markt betrafen. Ein weiterer und einflussreich werdender Treiber sind schließlich die Investoren in Unternehmen, die mit Einführung wirkungsvoller Taxonomien für ESG-Kriterien über ihr Investment oder auch eine gezielte Desinvestition mehr Einfluss auf die Ausrichtung einer Organisation und auf das Management gewinnen.
Dauerhaft kann es jedoch nicht nur um Strafvermeidung (Recht) gehen, sondern auch, beziehungsweise insbesondere darum, in welcher Haltung in Organisationen entschieden wird. Die authentische Haltung, sich der eigenen Verantwortung für eine bessere Welt bewusst zu sein, wird mit jeder Umweltkatastrophe, jeder Hungersnot und jeder Pandemie größer.
Sustainable Development Goals
Über Nachhaltigkeit und ihre zahllosen Facetten sind bereits viele Bücher geschrieben worden. Wir möchten uns an dieser Stelle auf die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, die sogenannten Sustainable Development Goals (SDGs) konzentrieren, weil sich mit ihnen Verbindungen zu allen Organisationen – unabhängig von Branche und Größe – herstellen lassen. Die SDGs rufen weltweit Regierungen, Wirtschaftsunternehmen und die Zivilgesellschaft zum Handeln auf.
Kurz erklärt: UN-Agenda 2030
Die „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ ist ein globaler Aktionsplan der Vereinten Nationen, den die UN-Generalversammlung im September 2015 verabschiedete. Mit der Agenda 2030 haben die Mitgliedstaaten der UN einen Weg hin zur „Transformation der Welt zum Besseren“ bis zum Jahr 2030 entwickelt – für die Menschen, den Planeten und auch für den Wohlstand, und zwar im Sinne einer nachhaltigen Veränderung von Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt. Bestandteil der Agenda 2030 sind 17 globale Ziele, unterteilt in 169 Unterziele.
Die 17 Ziele der Vereinten Nationen (siehe UNRIC, Informationszentrum der vereinten Nationen):
SDG 1: Keine Armut
Armut in all ihren Formen und überall beenden.
SDG 2: Kein Hunger
Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern.
SDG 3: Gesundheit und Wohlergehen
Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.
SDG 4: Hochwertige Bildung
Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle fördern.
SDG 5: Geschlechtergleichheit
Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestimmung für alle Frauen und Mädchen erreichen.
SDG 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen
Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten.
SDG 7: Bezahlbare und saubere Energie
Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern.
SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern.
SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur
Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen.
SDG 10: Weniger Ungleichheiten
Ungleichheit in von und zwischen Ländern verringern.
SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden
Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.
SDG 12: Nachhaltige/r Konsum und Produktion
Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen.
SDG 13: Maßnahmen zum Klimaschutz
Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen.
SDG 14: Leben unter Wasser
Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Entwicklung erhalten und nachhaltig nutzen.
SDG 15: Leben an Land
Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodendegradation beenden und umkehren und dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende setzen.
SDG 16: Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen
Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen.
SDG 17: Partnerschaften zur Erreichung der Ziele
Umsetzungsmittel stärken und die Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung mit neuem Leben erfüllen.