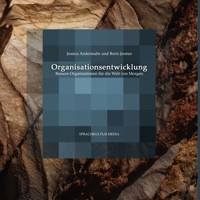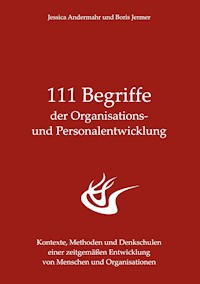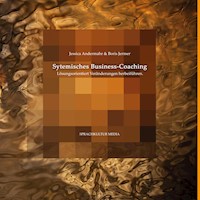
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sprachkultur Gmbh
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch ist aus der Praxis für die Praxis geschrieben. Für uns ist Coaching Beruf und Berufung. Auch nach vielen Jahren und ungezählten Gesprächen mit Menschen, die sich uns anvertraut haben, ist jeder neue Coachee wie der Beginn einer neuen Reise - zu neuen Ufern und neuen Lösungen, zu Veränderung und Entwicklung, zu Kontakt und Beziehung. Bei diesen Reisen dabeizusein und zu beobachten, wie sich immer wieder neue Etappen, Erfahrungen und Ausblicke ergeben, macht das Coaching für uns zu einer stets aufs Neue spannenden und erfüllenden Aufgabe. Wohin die "Reise" gehen soll, bestimmt immer der Coachee. Sein Anliegen, seine Ressourcen und seine Lösungen stehen im Mittelpunkt eines jeden Coachings. Der Coach ist ein Begleiter, der "Reiseerfahrung" und einen vollen Methodenkoffer einbringt. Was er aus diesem Koffer hervorholt, braucht ein feines und erfahrenes Gespür für den Menschen und seine Situation. Keine noch so erprobte Methode hat ein Recht auf Selbstzweck. Die Kunst des Coachings liegt nicht nur in einem reichhaltigen Fundus an Methoden. Sie liegt vor allem darin, die in diesem einen Moment für diesen besonderen Menschen mit seinem individuellen Anliegen beste Methode auszuwählen und gekonnt anzuwenden. Mit diesem Buch richten wir uns an Menschen, die ihre neue Rolle als Coach strukturiert kennenlernen und aufbauen möchten. Es dient als Begleitbuch zu unserer Coaching-Ausbildung und als Basis, um die eigene Entwicklung voranzutreiben. Auch für Fortgeschrittene ist es eine Einladung, an eigenen inneren Bildern, am Methodenrepertoire und an der eigenen Haltung weiter zu feilen. Jessica Andermahr & Boris Jermer
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 376
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
VORAB
Dieses Buch ist aus der Praxis für die Praxis geschrieben. Für uns ist Coaching Beruf und Berufung. Auch nach vielen Jahren und ungezählten Gesprächen mit Menschen, die sich uns anvertraut haben, ist jeder neue Coachee wie der Beginn einer neuen Reise - zu neuen Ufern und neuen Lösungen, zu Veränderung und Entwicklung, zu Kontakt und Beziehung. Bei diesen Reisen dabeizusein und zu beobachten, wie sich immer wieder neue Etappen, Erfahrungen und Ausblicke ergeben, macht das Coaching für uns zu einer stets aufs Neue spannenden und erfüllenden Aufgabe.
Wohin die „Reise“ gehen soll, bestimmt immer der Coachee. Sein Anliegen, seine Ressourcen und seine Lösungen stehen im Mittelpunkt eines jeden Coachings. Der Coach ist ein Begleiter, der „Reiseerfahrung“ und einen vollen Methodenkoffer einbringt. Was er aus diesem Koffer hervorholt, braucht ein feines und erfahrenes Gespür für den Menschen und seine Situation. Keine noch so erprobte Methode hat ein Recht auf Selbstzweck.
Die Kunst des Coachings liegt nicht nur in einem reichhaltigen Fundus an Methoden. Sie liegt vor allem darin, die in diesem einen Moment für diesen besonderen Menschen mit seinem individuellen Anliegen beste Methode auszuwählen und gekonnt anzuwenden.
Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.
Paul Watzlawik, Kommunikationswissenschaftler
Mit diesem Buch richten wir uns an Menschen, die ihre neue Rolle als Coach strukturiert kennenlernen und aufbauen möchten. Es dient als Begleitbuch zu unserer Coaching-Ausbildung und als Basis, um die eigene Entwicklung voranzutreiben. Auch für Fortgeschrittene ist es eine Einladung, an eigenen inneren Bildern, am Methodenrepertoire und an der eigenen Haltung weiter zu feilen.
Jessica Andermahr & Boris Jermer
Inhalt
1. BEGRIFFSKLÄRUNG
Coaching
Systemisches/systemischeres Coaching
Lösungsfokussiertes Coaching
Menschenbild und Haltung
Rolle des Coaches und Abgrenzung
2. WAS MACHT EIGENTLICH EIN COACH?
3. COACHINGANLIEGEN UND -KONTEXTE
Konflikte
Zielbestimmung
Rollenwechsel
Resilienz
Diversity
Querschnittsthema: Kompetenzentwicklung
Querschnittsthema Transformation & Change
Zwei statt Einem: Dyadencoaching
Teamcoaching
4. AUSGANGSLAGEN: BEVOR ES ÜBERHAUPT LOSGEHEN KANN
Eigenes Konzept
Das System des Kunden
Betriebswirtschaftliche Grundlagen
5. PHASEN DES COACHINGPROZESSES
Vor dem Coaching – Beteiligte und Fallstricke
Erstgespräch – Verbindung herstellen
Auftragsklärung – Klarheit schaffen
Angebotserstellung
Vorbereitung auf die Gespräche
Coachinggespräche
6. SPRACHE UND KOMMUNIKATION
Arten der Kommunikation
Die Welt des Spiegelns
Gespräche voranbringen
Schweigen nutzen
Interventionspyramide
7. PSYCHOLOGISCHE UND NEUROBIOLOGISCHE GRUNDLAGEN
Vorbemerkung zum Gehirn
Realität als Konstruktion
Spiegelneuronen
Embodiment
Somatische Marker
Priming
Bewältigungsstrategien (Coping)
8. FRAGEN ALS GRUNDELEMENT DES COACHINGS
Zuhören und Beobachten als Voraussetzung
Systemische Fragen
Weitere Arten von Fragen
9. LÖSUNGSFOKUSSIERUNG ALS HALTUNG UND METHODE
Grundsätzliches
Die Welt der Lösungen
Ablauf des lösungsfokussierten Interviews
10. DEN LEIB EINBEZIEHEN
Perls: Gestalttherapie
Moreno: Psychodrama und Soziodrama
Satir: Skulpturarbeit
Satir: Parts Party
Arbeit mit dem inneren Team
Somatische Marker
11. HYPNOTHERAPEUTISCHE ELEMENTE
Grundbegriffe der Hypnotherapie
Was ist eigentlich Trance?
Problem- und Lösungstrance
Umdeuten/Umerzählen
Innere Einstellungen/Glaubenssätze und der kleine Unterschied
Arbeit mit der Timeline
Arbeit mit Submodalitäten
Geschichten und Metaphern
12. TRANSVERBALE SPRACHE
Grundlagen transverbaler Sprache
Elemente und Ablauf von systemischen Strukturaufstellungen
Einzelarbeit und transverbale Sprache
Tetralemma
Syst-Dreieck®
Problemaufstellung
Zielannäherungsaufstellung
Partielle Strukturaufstellung
13. SCHWIERIGE SITUATIONEN
Intransparente Auftragslage
Übertragung
Blaming
Ungeduld
Rubikon-Prozess
Energielosigkeit
Stakeholdermanagement
14. SELBSTSORGE COACH
Selbstreflexion
Resilienz
Grenzen setzen
Grundbedürfnisse
Entspannungstechniken - Körper & Geist im Gleichklang
AUF EIN WORT: GENDERGERECHTE SPRACHE
„Der*die Coach*in ist - wie ein*e Gärtner*in - ein*e Begleiter*in für seine*n/ihre*n Klienten*in.“
Vor diesem und ähnlichen korrekt gegenderten Sätzen standen wir, als wir uns daran gemacht hatten, in diesem Buch die Teilhabe aller Geschlechter auch in der Sprache umzusetzen. Letztendlich haben wir uns gegen eine konsequente Umsetzung entschieden. Aber wir haben uns diesen Entschluss nicht einfach gemacht.
Unsere Organisation heißt SPRACHKULTUR, und in der Sprache spiegelt sich für uns alles, was Menschen und Organisationen prägt. Wir sind sicher, dass Sprache das Bewusstsein verändern kann. Den Argumenten, verschiedenen Geschlechtern in der Sprache Gleichberechtigung verschaffen zu wollen, können wir gut folgen.
Auf der anderen Seite ist Sprache unser Hauptwerkzeug, um miteinander zu kommunizieren und in Beziehung zu treten. Sollen unsere Botschaften ankommen, muss Sprache klar und verständlich sein. In diesem Spannungsfeld haben wir versucht, einen gangbaren Weg für dieses Buch zu finden.
Wir haben sie alle Ernst genommen: Gender-Gap, Doppelpunkte, Sternchen, Binnen-I, Verlaufsform und kontinuierliche Doppelnennung. Wir haben mit ihnen gearbeitet und gespielt und sie offen und wertfrei ausprobiert.
Bislang haben uns alle diese Lösungen noch nicht überzeugt. Nehmen wir die Grammatik ernst, wird der Text überfrachtet von Genderzeichen-Konstruktionen und Bandwurmsätzen. Verständlichkeit, Lesefluss und Lesespaß leiden darunter. Wir haben uns daher dazu entschieden, das „generische Maskulinum“, das die deutsche Sprache uns anbietet, zu nutzen. Generisch bedeutet, ein Wort (für Personen oder Berufsbezeichnungen) soll als allgemeingültiger Oberbegriff für alle Geschlechter verstanden werden. Wenn wir von „Coach“ schreiben, meinen wir coachende Menschen jeden Geschlechts. Wo es sprachlich gut möglich ist, insbesondere bei unseren Beispielen und Übungen, verwenden wir gezielt unterschiedliche Geschlechter.
Wir stellen uns damit nicht auf eine „Seite“ der Befürworter oder Gegner gendergerechter Sprache. Im Gegenteil. Wie auch in unserer Beratungs- und Coachingtätigkeit sehen wir in Spannungsfeldern immer Energie für Veränderungen. Es gilt, diese Spannung auszuhalten und zu nutzen, um aus ihr heraus zu sinnvollen Lösungen zu gelangen. Irgendwann wird sprachlich eine Lösung entstehen, über die unsere Nachfahren nicht mehr diskutieren werden, weil Realität und Sprache übereinstimmen. Bis dahin sollte es erlaubt sein, auszuprobieren und das individuell Passende ohne Ideologie und Schublade verwenden zu können. Dazu gehört auch, es immer wieder zu reflektieren und zu hinterfragen.
Wir bei SPRACHKULTUR stehen im täglichen Miteinander unserer Arbeit für eine Kommunikation, die auf Respekt und Wertschätzung fußt - unabhängig vom Geschlecht oder einem der vielen anderen Unterschiede bei unseren Gesprächspartnern. Stellen Sie sich bitte jetzt vor Ihrem geistigen Auge eine Gruppe von Coaches unterschiedlichen Geschlechts vor, die alle fröhlich miteinander kommunizieren. Mit diesem Bild wünschen wir Ihnen viel Vergnügen beim Lesen!
1. BEGRIFFSKLÄRUNG
» Was ist überhaupt Coaching, und was muss ich als Coach können?
» Warum setzen wir auf systemisch(eres) und lösungsorientiertes Coaching – und was genau ist das eigentlich?
» Warum machen das Menschenbild und die persönliche Haltung des Coaches den entscheidenden Unterschied?
» Wie unterscheidet sich der Coach von Trainer, Berater, Moderator und Führungskraft
Die Kraft des Gedanken ist unsichtbar wie der Same, aus dem ein riesiger Baum erwächst. Sie ist aber der Ursprung für die sichtbaren Veränderungen im Leben des Menschen.
Leo Tolstoi, Schriftsteller
Coaching
Wortherkunft
Coaching leitet sich ab von engl. coach, der „Kutsche“, was wiederum auf Französisch „coche“ und ungarisch kocsi“ zurückgeht. Es hat die Bedeutung „von einer Kutsche bewegt werden“. Im Englischen meint Coaching ursprünglich „trainieren“ und bezieht sich auf die Entwicklung von Fertigkeiten im Sport und Beruf.
Der Begriff Coaching wurde zunehmend in den allgemeinen Sprachgebrauch aufgenommen. Das ist gut, weil es Coaching zu etwas macht, was im Alltag eine Rolle spielt. Weniger gut ist, dass der Begriff zunehmend unscharf geworden ist. An jeder Ecke meint man, Coaching-Angebote für jede Lebenslage erhalten zu können. Aber ist das wirklich alles Coaching?
Eine allgemeingültige wissenschaftliche Definition für Coaching gibt es nicht. Wir halten es daher für wichtig, Ihnen einige grundlegende Merkmale an die Hand zu geben, um unser Verständnis vom „Wesen“ des Coachings greifbarer zu machen. Los geht’s:
Coaching ist freiwillig und begrenzt
Grundsätzlich ist Coaching freiwillig und kann vom Coachee jederzeit ohne sichtbare Konsequenzen beendet werden. Es ist ein zeitlich begrenzter Prozess, der endet, wenn das vom Coachee definierte Coachingziel erreicht ist, kann jedoch mit gleicher, ähnlicher oder neuer Zielsetzung verlängert oder zu einem späteren Zeitpunkt fortgeführt werden. Bei einem guten Vertrauensverhältnis kann ein Coach seine Coachee durch weite Teile seines Arbeitslebens begleiten.
Coaching bedeutet Veränderung
Sie als Coach unterstützen Ihren Klienten (auch Coachee genannt) dabei, neue Lösungen und Wege zu finden. Es geht beim Coaching also immer darum, einen aktuellen Zustand in einen zukünftigen zu führen, der vom Coachee als besser, angenehmer, zielführender empfunden wird. Sie wirken als Begleiter Ihres Coachee und bieten ihm einen Raum, in dem Veränderung möglich ist und Menschen über sich hinauswachsen können.
Coaching zielt auf „Hilfe zur Selbsthilfe“
Die Inhalte des Coachings bestimmt der Coachee. Es liegt auch nicht beim Coach, die „richtige“ oder „beste“ Lösung zu kennen oder gar zu nennen. Über diese entscheidet nur der Klient selbst. Ziel des Coachings ist es dementsprechend, den Coachee zu unterstützen, eigene Lösungen finden zu können. Dafür bieten Sie ihm zum Beispiel Reflexionsfläche und Sparring für sein Handeln, Denken und Verhalten, helfen ihm, seine eigenen Stärken und Ressourcen zu entdecken sowie Blickwinkel zu wechseln.
Coaching ist Interaktion
Coaching geht immer nur im persönlichen Kontakt. Es braucht (mindestens) zwei Menschen, die zusammensitzen und kommunizieren. Das klingt selbstverständlich, aber es ist wichtig, sich explizit darüber im Klaren zu sein, dass Coaching immer eine intensive Beziehung zwischen Coach und Coachee erfordert, die im permanenten Wechselspiel den Veränderungsprozess vorantreiben. Kommunikation auf verschiedenen Ebenen ist das A und O des Coachings, weil Kommunikation im „Dazwischen“ entsteht. Auch ein „Out-of-the-Box-Denken“ ist nur möglich, wenn eine Beziehung zwischen Coach und Coachee besteht.
Coaching ist individuell
Kein Klient ist wie der andere. Selbst wenn die Ausgangssituationen sich stark ähneln sollten, ist die relevante Komponente die individuelle Wahrnehmung des Coachee – und die kann von Mensch zu Mensch äußerst unterschiedlich sein. Als Coach werden Sie also keine 08/15-Gespräche führen können, die alle beim gleichen Ergebnis enden. Jede neue Konstellation fordert ein neues Einstellen auf die Situation und den Coachee und wird mit anderen Resultaten enden.
Coaching ist professionell
Coaching ist anspruchsvoll und muss von Verantwortung getragen sein. und praktische Ausbildung, die Ausgangspunkt für die weitere pratische Übung, Erfahrung uns permanent Selbstreflexion ist. Coaching braucht daher eine theoretische und praktische Ausbildung, die Ausgangspunkt für Übung, Erfahrung und permanente Selbstreflexion ist. Ein Coachinggespräch ist immer methodisch geleitet und bei weitem nicht „einfach nur reden“ – egal für wie einfühlsam Sie sich halten. Coaching erfordert fundiertes Wissen über Kommunikation, Psychologie, Soziologie und Neurobiologie und neben Lebenserfahrung verschiedene Quellen, aus denen methodisch geschöpft werden kann. Zur Professionalität gehört auch, von einem bestimmten Menschenbild und bestimmten Werten geleitet zu werden, und nicht von eigenen unreflektierten Meinungen.
Darüber hinaus ist die Fähigkeit, einen antreiberfreien Raum entstehen zu lassen, ein Kennzeichen für professionelles Coaching. Antreiberfrei bedeutet, eigene Themen der eigenen Biografie sind weitestgehend aufgearbeitet und der Coach begegnet dem Klienten offen und frei.
Business Coaching und Life Coaching
Coaching wird abhängig von Anlass und Zielgruppe nach Business Coaching und Life Coaching unterschieden. Beim Business Coaching stehen berufliche Themen im Vordergrund, und es wird meist über ein Unternehmen bezahlt. Beim Life Coaching geht es eher um Themen aus dem privaten Umfeld. Scharf lassen sich die beiden Lebensbereiche nicht trennen, da sie sich gegenseitig beeinflussen können und die Grenzen fließend sind. In diesem Handbuch befassen wir uns dennoch explizit mit dem Business Coaching.
Einzelcoaching und Teamcoaching
Neben dem „traditionellen“ Coachen von Einzelpersonen kann es auch vorkommen, dass zwei oder mehr Personen Unterstützung erhalten möchten. Dies kann beispielsweise ein neues Führungsduo sein, dass besser zusammenfinden möchte, oder auch ein ganzes Team. Häufig gehen Einzel- und Teamcoaching Hand in Hand (systemisch!). Ein Teamcoaching ist komplexer und setzt noch mehr Erfahrung voraus, weil Sie gleich verschiedene Systeme im Raum sind. Dies braucht als Coach besonders viel Freude an Komplexität, der methodisch klar und durch gute Prozessbegleitung begegnet werden sollte. Trotz Interaktion und Gruppendynamik bleiben die Grundlagen und Methoden beim Teamcoaching die gleichen wie beim Einzelcoaching. Wir werden das Teamcoaching in diesem Handbuch berücksichtigen und wenn nötig auf Besonderheiten hinweisen.
REFLEXIONSFRAGEN
? Warum coachst du andere Menschen bzw. möchtest lernen, es zu tun?
? Welche der obigen Aussagen sind für dich klar, welche noch unklar?
? Was verstehst du selbst unter Coaching? Formuliere es mit deinen eigenen Worten.
? Wer bist du als Coach? Welche inneren Bilder verknüpfst du mit dem Coach sein?
≡ Erkläre jemand anderem, was Coaching ist.
≡ Finde Beispiele, die deine Erklärungen erläutern (erlebt oder erfunden).
Systemisches/systemischeres Coaching
Auch „systemisch“ ist ein Wort, das im Beratungs- und Coachingumfeld schon seit geraumer Zeit immer häufiger genannt und angeboten wird – ebenfalls häufig unscharf definiert und ebenfalls mit unterschiedlich professionellem Background in der Umsetzung.
Systemisches Denken ist eine Denkschule, die mittlerweile weite Teile der westlichen Wissenschaftstheorie durchdrungen hat. Es ist keine modische Attitüde, sondern ein seit den 1950er Jahren die Sozial-, Geistes- und Naturwissenschaften gleichermaßen prägendes Denkmuster (für tieferes Eintauchen finden Sie Materialien in den Literaturtipps am Ende des Buches).
Auf den Punkt gebracht bedeutet systemisches Coaching, dass Sie als Coach nicht nur Ihren Coachee und sein inneres System betrachten, sondern sein ganzes soziales Umfeld, seinen Kontext (äußeres System) mit in den Blick nehmen – und zwar wiederum nicht so, wie Sie es sehen, sondern so, wie Ihr Klient es wahrnimmt.
Auch ohne „systemisch“ im Namen wird Coaching nie das Umfeld ausklammern können, denn jeder Coachee wird sich mit seinem Anliegen innerhalb seiner Organisationsstruktur und in Beziehung zu anderen Menschen orientieren (müssen). Coaching -Erfolg wird immer in Handlungen und Haltungen sichtbar. Diese wiederum zeigen sich erst in Kontexten, in Situationen und relevanten Beziehungen
Systemisch oder „systemischer“ zu arbeiten, bedeutet für uns, die Wirkungsweisen innerhalb von Systemen bewusst, systematisch und methodisch in die Arbeit mit dem Coachee einzubeziehen. Wir sehen den Coachee, sein Denken und sein Handeln immer im Zusammenhang mit anderen Menschen und Einflüssen in Vergangenheit und Zukunft sowie unterschiedlichen äußeren wie inneren Refenzsystemen.
Für die Arbeit als Coach haben wir die folgenden Prämissen als Grundlage, auf denen wir dieses Handbuch aufbauen:
» Wir legen den Blick nicht nur auf Einzelpersonen oder Probleme, sondern immer auch auf Kontexte und Wirkzusammenhänge im Innen und im Außen.
» Dass wir systemisch arbeiten, erkennt man am besten an unseren Fragen. Wir arbeiten weniger kausal (Warum? Weil x so, muss y so), sondern unsere Frage ist: Welche Intention hat X, und inwieweit ist das zieldienlich? Durch was an X fühlt sich Y gestört? Was ist das Ziel von Y? Gab es Zeiten wo X und Y in einer anderen, vielleicht besseren Form, verbunden waren?
» Es gibt keine objektive Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist das, was jeder Einzelne – speziell unser Coachee – beim Betrachten der Elemente und ihrer Verbindungen als wahr erachten. Ob wir als Coaches anderer Meinung sind oder nicht, spielt eine untergeordnete Rolle.
Systemisches Arbeiten setzt eine sehr klare, antreiberfreie Arbeitshaltung voraus – sie braucht viel Reflexion, Übung, Erfahrung und Energiearbeit. Je klarer wir dem Coachee antreiberfreie Gesprächsräume bieten können, desto mehr Erkenntnis ist für ihn möglich, und desto besser wird er für sich neue Möglichkeiten und Lösungen sehen. Als systemisch arbeitender Coach sind Sie demnach sozusagen „Möglichkeitskonstrukteure“.
Unsere Arbeit bei SPRACHKULTUR und auch dieses Handbuch fußen unter anderem auf den Theorien und Methoden des Konstruktivismus, der Lösungsfokussierung, der Kybernetik, der System- und Kommunikationstheorie sowie der Systemischen Strukturaufstellung nach Insa Sparrer und Matthias Varga von Kibéd. Sie werden die systemischeren Gedanken in jedem Kapitel wiederfinden, und wir sind sicher, dass Sie sie am Ende spielend verinnerlicht haben.
Erfahrung ist nicht das, was mit einem Menschen geschieht.
Sie ist das, was ein Mensch aus dem macht,
was mit ihm geschieht.
Aldous Huxley, Schriftsteller
Lösungsfokussiertes Coaching
Woher kommt es?
Der lösungsfokussierte Ansatz entstand vollständig in der Praxis. Er wurde durch die Psychotherapeuten und Sozialarbeiter Steve de Shazer und Insoo Kim Berg am Brief Family Therapy Center in Milwaukee weltweit bekannt. Philosophische Anleihen nahmen sie bei Ludwig Wittgenstein. Der lösungsfokussierte Ansatz, der sich fundamental von etablierten Ansätzen wie Problemanalyse unterscheidet, findet nach und nach auch Eingang in Wirtschaft und moderne Organisationsentwicklung.
Natürlich will jeder Coach für seinen Coachee Lösungen finden – Sie werden aber nicht wesentlich weiterkommen, wenn Sie sich endlos von Ihrem Coachee seine Probleme erzählen lassen und dann versuchen, diese detailliert zu analysieren. Das lösungsfokussierte Coaching setzt von Beginn an auf die Lösung. Theoretisch ist es dabei sogar möglich, dass der Coachee eine Lösung findet, ohne das Problem überhaupt zu thematisieren. In der Praxis wird Ihnen der Coachee meist zunächst das Problem zur Sprache bringen. Ihre Aufgabe besteht dann darin, sich nicht an diesem Problem festzufressen, und auch bei einer spannenden Lebensgeschichte nicht Ihrer eigenen „literarischen Neugierde“ zu verfallen, sondern immer wieder vom Problem- in den Lösungsraum zu wechseln. Je besser es gelingt, das „Stattdessen“ mit allen Sinnen zu erleben, desto wahrscheinlicher wird die Umsetzung
Anstatt die Konzentration auf ein Problem und damit auf die Vergangenheit oder die Gegenwart zu richten, nehmen Sie die Lösung und die erwünschte Zukunft in den Blick – und nehmen in Gedanken an eine bestimmte erwünschte Situation, ein erwünschtes Ziel oder einen erwünschten Zeitraum die zukünftige Veränderung vorweg. Wie das geht und welche Fragen Sie dabei weiterbringen, erfahren Sie ausführlich im Rahmen dieses Handbuchs.
Erste Grundannahmen der Lösungsfokussierung können Sie sich schon merken:
» Die Zukunft wird erschaffen und ist verhandelbar, da wir nicht Sklaven unserer Vergangenheit sind.
» Menschen haben alle Ressourcen, Fähigkeiten und das Wissen, um ihr Leben besser zu machen, wenn sie entscheiden, dass dies gut für sie ist, und sie es wollen.
Zur Lösungsfokussierung gehört auch, Lösungen immer wieder in Frage zu stellen, beziehungsweise in ihrer Wirkung zu überprüfen. Wenn eine vermeintliche Lösung zu keiner positiven Veränderung führt, ist es kontraproduktiv, dieses Verhalten noch weiter zu verstärken. An dieser Stelle ist es Ihre Aufgabe als Coach, mit Ihrem Klienten danach zu suchen, welche Alternativen eher hilfreich wären.
„Nun bist du mit dem Kopf durch die Wand.
Und was wirst du in der Nachbarzelle tun?“
Stanislaw J. Lec, Lyriker und Aphoristiker
Mit systemischem, lösungsorientierten Blick helfen Sie dem Coachee, weitere, vielleicht unbewusste, Netzwerke zu aktivieren, in denen er mehr Handlungsmöglichkeiten und Kompetenzen sieht. Aus diesem Lösungsraum heraus lassen sich Fragestellungen, die sich vielleicht im ursprünglichen Zustand als Problem gezeigt haben, anders lösen und auflösen. Lösungsmöglichkeiten in Systemen entstehen nämlich meist im „Dazwischen“ und weniger in der einen oder anderen Position. Auch dies wird ein Schwerpunkt dieses Handbuchs sein.
ÜBUNG
≡ Nimm drei beliebige Gegenstände und stelle sie so auf, dass sie ein Dreieck bilden. Betrachte das Dreieck. Es ist das Problem. Nimm nun einen der Gegenstände wieder auf und lege ihn in eine Reihe mit den beiden anderen. Wo ist nun das Dreieck?
≡ Überlege – am besten in der Gruppe – was dieses kleine Beispiel über Problem, Lösung, Raum, Beziehungen, Möglichkeiten aussagen könnte.
Menschenbild und Haltung
Die innere Haltung
Als innere Haltung ist ein Begriff aus der Psychologie. Er steht für die Einstellung, mit der ein Mensch anderen Menschen und Situationen begegnet, und wie er sie aufgrund dieser Einstellung bewertet. Die innere Haltung findet ihren Ausdruck in Verhalten, Emotionen und Wertesystem. Mit Aspekten wie Kommunikation und subjektive Wahrnehmung greift sie tief in alles ein, was wir tun – und was wir lassen.
Eine Einstellung oder Haltung entsteht dadurch, dass wir Erfahrungen immer wieder machen. Unsere innere Haltung, mit der wir durch unser Leben gehen, ist durch positive und negative Erfahrungen und Situationen in der Vergangenheit entstanden und teilweise tief und fest in unserem Denken, in unseren inneren Bildern, die wir von uns und der Welt haben, und in unserem Verhalten verankert.
ÜBUNG
Um zu verstehen, was Coaching mit Menschenbild und Haltung zu tun hat, stell dir kurz Coach Klaus vor. Klaus ist hochengagiert, sympathisch und empathisch, und er möchte nichts mehr, als seinem Coachee bei der Lösungsfindung zu helfen. Da er glaubt, dass einige seiner Coachee aktuell (oder manchmal auch grundsätzlich) nicht in der Lage sind, ihre Probleme selbst zu lösen, lässt er sich viel einfallen, um ihnen möglichst gute Vorschläge zu machen, wie sie handeln sollten, damit ihre Situation besser wird. Er nutzt dazu seinen Erfahrungsschatz und seine Menschenkenntnis. Doch gerade die besonders „schwierigen“ Fälle, denen er so gern helfen möchte, brechen immer wieder frustriert das Coaching ab.
≡ Welche inneren Glaubenssätze scheinen hier handlungsleitend zu sein?
≡ Was könnte Coach Klaus anders machen?
≡ Was bräuchte er dazu, um es anders zu machen?
Wie unter dem Begriff Coaching erläutert, ist es der Coachee, der sowohl die Inhalte des Coachings bestimmt als auch die Lösungen findet und bewertet. Unter Lösungsfokussierung haben Sie gelesen, dass jeder Mensch Ressourcen und Fähigkeiten hat, um positive Veränderungen herbeizuführen. Aus diesen Prämissen ergibt sich, dass der Coach dem Coachee dies alles auch zutrauen muss. Sobald Sie glauben, mehr (besser) zu wissen als Ihr Klient, ist es ratsam, vorsichtig zu werden, und sich auf das zu besinnen, was Sie im Coachee als Menschen sehen und wie Sie ihm entgegentreten.
Mein Coachee schafft das!
Im Menschenbild, das dem systemischen, lösungsfokussierten Coaching zugrunde liegt, steht ganz obenan der Glaube, dass jeder Mensch Ressourcen und Stärken hat, die sich so ordnen lassen, dass die Lebensqualität des Coachee sich verbessert. Mit anderen Worten: Trauen Sie Ihrem Coachee mit einer ermutigenden, staunenden Haltung richtig viel zu!
Ich trete einen Schritt zurück!
Wenn Sie Ihren Coachee unterstützen wollen, als eigener Experte seines Lebens seine eigenen Lösungen zu finden, dann braucht dies eine Haltung, die Ihren eigenen Bezugsrahmen weitestgehend beiseitestellt. Für diesen Zustand haben die US-amerikanischen Psychologen Harlene Anderson & Harold A. Goolishian 1992 im Buch „The Client ist the Expert“ den Begriff „Nicht-Wissen“ geprägt. Er drückt aus, dass der Coach die Erfahrungen, Handlungen und Bedeutungen seines Coachee nie vorab kennen kann. Er muss sich auf die Wahrnehmung und Erklärung seines Klienten verlassen. Die Haltung des „Nicht-Wissens“ beschreiben die Autoren mit „aufrichtiger Neugier“. Der Coach positioniert sich dabei selbst in einer Weise, die es ihm erlaubt, durch den Coachee „informiert“ zu werden.
Im Gegensatz etwa zu Nichtstun erfordert Nicht-Wissen eine gehörige Portion Übung und Erfahrung. Auch hierbei sind Fragetechniken das A und O. Wir werden Ihnen in diesem Handbuch noch viele Möglichkeiten geben, das Wesen des Nicht-Wissens zu verstehen.
Ich bin kein Richter!
Nicht nur im Artikel 1 unseres Grundgesetzes, auch in unserem Artikel 1 der Coachee-Haltung, steht das Respektieren der menschlichen Würde. Jeder Mensch hat das Recht, als wertvolles Wesen behandelt zu werden. (Nicht nur) im Coaching bedeutet dies, die Menschen so zu akzeptieren „wie sie sind“ – mit ihren Stärken und Grenzen, ihrem augenscheinlich gesunden oder ungesunden Verhalten, ihren individuellen Haltungen und Gewohnheiten. Akzeptanz ist dabei nicht gleichbedeutend mit Billigung. Ein Coach kann akzeptieren, ohne zustimmen zu müssen.Zum Nicht-Wissen kommt nun noch das Nicht-Urteilen. Für das Coaching spielt es keine Rolle, ob der Coachee in den Augen des Coaches „schuldig oder nicht schuldig“ an seinem Problem oder seiner Situation ist. Akzeptanz und eine nicht-urteilende Haltung sind beste Voraussetzungen für eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Coach und Klient.
„Wer die Welt bewegen will, sollte erst sich selbst bewegen.“
Sokrates, Philosoph
Rolle des Coaches und Abgrenzung
Zum Abschluss des Kapitels möchten wir nochmal genauer abgrenzen, was einen Coach von anderen, vermeintlich oder tatsächlich ähnlichen, Rollen unterscheidet.
ÜBUNG
≡ Wenn du Führungskraft, Trainer, Berater oder Moderator bist oder warst – warum interessierst du dich nun (stattdessen oder zusätzlich) für Coaching?
≡ Wenn du nie Führungskraft, Trainer, Berater oder Moderator warst, warum interessierst du dich nun für Coaching und strebst nicht eine der anderen Rollen an?
Zur Erinnerung: Coaching ist freiwillig und auf Augenhöhe. Es kann jederzeit ohne sichtbare Konsequenzen beendet werden. Den Coach kennzeichnet Nicht-Wissen. Er handelt absichtslos in dem Sinne, dass er den Coachee nicht zu einer bestimmten Handlung oder Wahrnehmung führen möchte. Stattdessen führt er den Coachee mithilfe von Fragen zu mehr Optionen im Wahrnehmen, Denken und Handeln.
Ein Berater hingegen vermittelt Wissen – und zwar absichtsvoll und vom Klienten gewünscht. Berater werden meist wegen ihres Wissens- und Erfahrungsvorsprungs in Bezug auf eine Fragestellung oder Situation engagiert (neue oder komplexe Aufgaben, besonderes Fachwissen, besondere Expertise oder Kompetenzen).
Ein (systemischer) Moderator zeichnet sich wie ein Coach durch Neutralität aus. Seine Aufgabe ist es, Verbindungen im Kommunikationsraum zu strukturieren und sichtbar zu machen. Auch er kann – zum Beispiel in Konflikten – Menschen dabei begleiten, selbst die für sie passende Lösung zu finden. Der wesentliche Unterschied liegt darin, dass Moderatoren aufgrund ihrer insbesondere kommunikativ strukturierenden Aufgabe mit Gruppen, während Coaches in den allermeisten Fällen mit Einzelpersonen arbeiten. In einem Teamcoaching sind häufig die Moderatoren- und Coachrolle in Verbindung gebracht. Ein flüssiger Wechsel erhöht hier den Anspruch.
Ein Trainer vermittelt methodisch Wissen und Können durch Unterweisung und Übung. Er unterstützt dabei, zielgerichtet das Kompetenz-, Motivations- oder Leistungsniveau zu steigern. Trainer sind am ehesten aus dem Sportbereich bekannt – es bleibt in der Rolle jedoch gleich, ob der Trainer eine Fußballmannschaft oder ein Vertriebsteam trainiert.
Ein Coaching kann auch Beratungs- und Trainingsaspekte integrieren. Dies sollte der Coach transparent kenntlich machen.
Eine Führungskraft hat Personal- und Sachverantwortung und formal eine Machtposition inne, die mit Weisungsrecht gekoppelt ist. Führen hat Unternehmensziele im Fokus. Augenhöhe und Neutralität sind dadurch eher nicht gegeben. Dennoch kann eine Führungskraft ihren Mitarbeitern durchaus mit Hilfe von Coachingtechniken zu mehr Wirksamkeit im Alltag verhelfen, und sie in ihrer Aufgabenbewältigung unterstützen. Das Angebot einer Führungskraft, als Coach zu fungieren, sollte explizit mit dem Mitarbeiter besprochen werden, damit die Freiwilligkeit gewährleistet wird.
ÜBUNG
Max Sternberg leitet einen kleinen Buchverlag und stellt fest, dass sich das Kerngeschäft immer mehr in Richtung E-Book und Hörbücher verschiebt. Strategisch wird beschlossen, in Zukunft ebenfalls stärker auf digitale Medien zu setzen. Im Haus gibt es keine Experten für digitale Themen.
Welche Rolle kann Max am besten unterstützen?
Elke Kollmann ist gerade befördert worden und soll nun ein Team von zehn Mitarbeitern leiten. Sie hat jedoch das Gefühl, dass Sie nicht so richtig als Führungskraft akzeptiert wird und fühlt sich noch unwohl in der Führungsrolle.
≡ Welche Rolle kann Frau Kollmann am besten unterstützen?
Nachdem Sie nun bereits einen recht guten Überblick über das haben, was Coaching bedeutet, steigen wir im nächsten Kapitel konkret ein mit der Frage, wer ein Coaching in Anspruch nimmt – und vor allen Dingen wofür.
2. WAS MACHT EIGENTLICH EIN COACH?
» In Kürze: Worum geht es im Coaching?
» Welche Rolle spielt der Coachee im Prozess?
» Was bedeutet „Raum der Möglichkeit“?
» Warum ist die Beziehung das A und O im Coaching?
» Wie sollte ein guter Coach sein, was sollte er oder sie können?
In diesem Kapitel möchten wir einige wichtige Grundlagen schaffen, wie ein systemischer Coach arbeitet und was er dafür mitbringen sollte. Sie lernen nachhaltig, wenn Sie dieses Kapitel immer wieder aufschlagen und nochmal nachlesen.
Was macht nun eigentlich ein Coach? In einem Satz gesagt:
Ein Coach befähigt den Coachee dazu, aus dem Raum von Möglichkeiten heraus zu handeln.
unsere Definition bei SPRACHKULTUR
Das klingt zunächst einmal recht überschaubar. Doch bedeutet es eine immense Herausforderung, erfordert professionelles Handwerk und einen hohen Anspruch beim Coach sowie Mut und Lernbereitschaft beim Coachee. Gelingt der Coachingprozess, ist aber das Ergebnis von entsprechend hohem Wert und Nutzen.
Um uns heranzutasten, machen wir im obigen Satz als „Akteure“ den Raum der Möglichkeiten, den Coachee, den Coach und - ganz wichtig - ihre Beziehung zueinander aus. Diese vier Akteure wollen wir nun näher betrachten.
1. Der Coachee
Voraussetzung dafür, dass der Coachee überhaupt freiwillig zum Coach kommt und damit den Prozess initialisiert, ist das Erleben eines sogenannten Stuck State (einer Blockade). Folglich ist das Ziel des Coachee, mit sich selbst, in seinem Kontext und System wieder wirksam zu werden. Bildlich gesehen möchte er „wieder im Fluss“ sein.
Kurz erklärt: Stuck State
Ein Stuck State ist ein festgefahrener mentaler Zustand, gekennzeichnet durch Blockaden und eingeschränkten Zugang zu den eigenen Ressourcen. Häufig hinterlässt er auch körperliche Spuren in Form von Anspannung und Verspannung. Meist wird es auch verbal geäußert: Ich komme nicht mehr weiter. Ich drehe mich im Kreis etc.
2. Der Raum der Möglichkeit
Im Raum der Möglichkeit findet der Coachee Lösungen und Handlungsalternativen (in sich selbst), die ihn aus seinem Stuck State befreien können. Der Raum der Möglichkeit ist antreiberfrei, zutrauend und klar. Der Coachee spürt keine Barrieren, die ihm vom Coach gesetzt werden (etwa in Form von „Ich weiß, wie’s läuft; da müssen Sie das und das machen“).
Was im Raum der Möglichkeit tatsächlich möglich ist, hängt vom Potenzial des Coachees ab. Alles, was passiert, richtet sich immer nach den zur Verfügung stehenden Ressourcen und dem Kontext. Die hier gefundenen Lösungen (und auch bereits die avisierten Ziele) gehen immer über die aktuell bestehenden Möglichkeiten des Coachee hinaus.
Um in den Raum der Möglichkeit einzutreten, ermöglicht der Coach dem Coachee, neuen Denkweisen und Haltungen zu begegnen und diese kennenzulernen, damit bei ihm Lernbereitschaft, Lernfähigkeit und Leidenschaft aktiviert werden. Basis dafür ist, dass der Coach selbst im Raum von Möglichkeit ist – frei nach dem Motto „Zustände übertragen sich“.
Der Coach hat dafür ein großes Repertoire an Interventionen, die dem Coachee den Zugang zu den eigenen Ressourcen und möglichen Lösungen erleichtern. Die Wahl der Interventionen ist stark abhängig vom Coachee. Er muss damit umgehen können und die Art der Intervention befürworten. Standardprozesse gibt es hier eher nicht – jeder Coachee mit seinen Potenzialen und in seinem Kontext ist eine neue, individuelle Herausforderung für den Coach.
Was aus dem Raum der Möglichkeit konkret in Bezug auf das Anliegen gestaltet werden kann, hängt sehr stark vom Coachee, dessen Anliegen und Bedarfslage und der Fähigkeit des Coaches, seinem Reifegrad und seiner Erfahrung ab. Lösungen entstehen immer in Beziehungen, also zwischen Coach und Coachee. Die Qualität dieser Beziehung bestimmt den Erfolg des Coachings.
3. Die Beziehung Coach-Coachee
Gelungenes Coaching bedeutet immer eine Veränderung von Beziehungen. In diesem Sinne ist Coaching keine Dienstleistung, sondern eine Energie- und Herzensleistung. Bereits bei der Auftragsklärung muss der Coach entscheiden: Kann ich mit diesem Menschen in eine Beziehung eintreten? Der gute Kontakt, und dabei insbesondere die Fähigkeit des Coaches, sich fluide und geschmeidig bewegen zu können, bestimmt die Qualität des Coachings.
Was bedeutet das? Grundsätzlich passiert Lernen nur in einer guten Beziehung. Sprünge im Entwicklungsprozess machen wir nur dort, wo ein klarer Kontakt ist, wo wir uns selbst ganz sicher fühlen, wo wir auch Ängste, Sorgen und Barrieren benennen und unsere Energie auf das zu Lernende richten können.
Der Coach hat dabei immer eine Feldwirkung. Durch seine Präsenz beeinflusst er die Qualität der Kommunikation und damit der Beziehung. Elementar ist dabei eine zutrauende, bejahende Haltung gegenüber dem Menschen und der Situation.
Der Coach bestimmt die Beziehung zunächst dadurch, dass er selbst leer und offen in das Gespräch mit dem Coachee geht. Er gestaltet das Gespräch auf Basis von Resonanz stärkenorientiert und ermutigend. Immer ist ein Coaching eine gemeinsame Lernerfahrung, die nur in echer Beziehung erfolgt.
Grundsätze für klare Kommunikation:
» Zustände übertragen sich.
» Hören steuert Sprechen.
» Wertschätzung erhöht Leistung.
» Die Absicht der Kommunikation bestimmt das Ergebnis.
» Kommunikation ist ein Handwerk und kann erlernt werden.
Peter Senge und Otto Scharmer bringen es wunderbar auf den Punkt:
Presence
„We’ve come to believe that the core capacity needed to access the field of the future is presence. We first thought of presence as being fully conscious and aware in the present moment. Then we began to appreciate presence as deep listening, of being open beyond one’s preconceptions and historical ways of making sense. We came to see the importance of letting go of old identities and the need to control and, as Salk said, making choices to serve the evolution of life. Ultimately, we came to see all these aspects of presence as leading to a state of “letting come,” of consciously participating in a larger field for change. When this happens, the field shifts, and the forces shaping a situation can shift from recreating the past to manifesting or realizing an emerging future.“
Übersetzung: „Wir sind zu der Überzeugung gelangt, dass die Kernkapazität für den Zugang zum Raum der Zukunft die Präsenz ist. Zuerst dachten wir an Präsenz als voll bewusst und bewusst im gegenwärtigen Moment. Dann begannen wir, Präsenz als tiefes Zuhören zu schätzen, als offen zu sein, jenseits von Vorurteilen und historischen Sinnen. Wir kamen zu der Erkenntnis, wie wichtig es ist, alte Identitäten und Kontrolldrang loszulassen und, wie Salk sagte, Entscheidungen zu treffen, die der Evolution des Lebens dienen. Letztendlich sahen wir all diese Aspekte der Präsenz als einen Zustand des „Hereinkommens“, der bewussten Teilnahme an einem größeren Raum der Veränderung. Wenn dies geschieht, verschiebt sich der Raum, und die Kräfte, die eine Situation gestalten, können sich von der Neuerschaffung der Vergangenheit hin zur Manifestation oder Verwirklichung einer aufkommenden Zukunft verschieben.“
(Aus: Awakening Faith in an Alternative Future. A Consideration of Presence: Human Purpose and the Field of the Future. By Peter M. Senge, C. Otto Scharmer, Joseph Jaworski, and Betty Sue Flowers)
4. Der Coach
Der Coach macht also dem Coachee den Raum der Möglichkeit zugänglich. Wir möchten hier kurz noch einmal ein paar Punkte herausstellen, die wir für besonders entscheidend halten, damit Sie und Ihr Coachee in gutem Kontakt die Coachingziele erreichen.
Der Coach agiert „nichtwissend“
Der Coach ist immer in einer Haltung des „Nichtwissens“. Das ist durchaus besonders, denn diese Haltung unterscheidet sich vermutlich von den meisten anderen, die Sie in anderen Rollen in Ihrem Berufsleben einnehmen und eingenommen haben. Die Expertenhaltung als Coach beschränkt sich ausschließlich auf den Prozess; aus den Inhalten der Themen halten Sie sich sowohl mit Bewertungen als auch mit Empfehlungen heraus. Wir können diesen Aspekt nicht oft genug betonen: Sie sind als Coach kein Berater und auch kein Therapeut – Sie verhelfen Ihrem Coachee dazu, dass dieser Lösungen in sich selbst findet. Dabei hilft Ihnen die ressourcenorientierte Grundhaltung. Es gehören aber auch Respekt, vielleicht sogar Demut dazu, die Welt und Wirklichkeit des Coachee so stehenzulassen und zu achten, wie er sie empfindet.
Aus der Haltung des Nichtwissens heraus sammeln Sie Informationen aus der Welt des Coachee – in etwa so wie ein Forscher in einem bislang unbekannten Urwald, der noch nicht weiß, welche Bedeutung was im neuen System hat.
Damit Ihnen dies immer wieder gelingt, ist die eigene Psychohygiene von hoher Bedeutung. Sie müssen in der Lage sein, im Coachingprozess loslassen zu können und auch für sich selbst einen antreiberfreien Raum zu schaffen. Der Psychohygiene und Selbstsorge widmen wir ein eigenes Kapitel gegen Ende dieses Buches.
Der Coach ist Generalist.
Als Coach sind Sie Generalist und verfügen über ein ganzheitliches Können. Sie sind derjenige, der aufgrund seines Vernetzungshintergrunds in der Lage ist, große sinnvolle Muster zu erkennen und strukturiert zu denken. Sie unterscheiden sich durch Ihre breite Gesamtperspektive und Ihre Lebenserfahrung von Ihrem Gesprächspartner. Das hat nicht unbedingt mit dem Alter zu tun, sondern mit der Fähigkeit, Erfahrungen, die man im Leben gemacht hat, zu reflektieren und auf viele reflektierte Lebenserfahrungen zurückgreifen zu können – ganz persönlich und auch aus den unterschiedlichen Coachingkontexten.
„Dass ich seit über zwei Jahrzehnten Menschen in
herausfordernden Situationen des Lebens begegnen darf,
erlebe ich als spannende Erfahrungen
und empfinde dies jedes Mal neu als Geschenk.“
Jessica Andermahr
Der Coach ist glaubwürdig.
Als Coach sind Sie überdurchschnittlich gut darin, soziale Prozesse wahrzunehmen, sie sinnvoll zu deuten, und Sie haben den Mut, klare und ehrliche Aussagen entsprechend Ihrer Kenntnisse zu treffen. Dafür brauchen Sie ein enormes Maß an Glaubwürdigkeit. Glaubwürdigkeit wird nicht durch kognitives, technisches Lernen alleine aufgebaut, sondern ist Ausdruck Ihrer gelebten Werte, dass Sie lesbar sind und – schon wieder – die Fähigkeit zur Selbstreflexion entwickelt haben und immer weiter pflegen.
Der Coach lernt nie aus.
Die Grundhaltung, permanent zu lernen und sich selbst in Frage zu stellen, ist eine Voraussetzung, um als Coach agieren zu können. Als Coach sind Sie ein Lernender, der sich in einen eigenen schöpferischen Prozess begibt, der begleitet wird von kreativer Spannung, Schwankung, Erfahrung und Veränderung. Diese Haltung hat ihre Ursprünge eher in der östlichen Tradition als im analytisch-westlichen Denken. Sie findet sich aber auch bei Peter Senge und seiner Beschreibung von Personal Mastery wieder.
Personal Mastery nach Senge
Peter M. Senge (*1947) ist Senior Lecturer of Behavioral and Policy Sciences am MIT. Er war Direktor des 1991 gegründeten Center for Organizational Learning an der MIT Sloan School of Management in Cambridge (Massachusetts) und ist Vorsitzender der Society for Organizational Learning (SoL). Seine Forschungsgebiete sind die Organisationsentwicklung und Systemforschung. Er gilt als einer der einflussreichsten Vordenker in Managementfragen.
Personal Mastery heißt so viel wie individuelle Selbstentwicklung. Senge bezeichnet damit die Fähigkeit und Bereitschaft zu lernen und die persönliche Verpflichtung, geistig zu wachsen. Prägend dabei ist die kontinuierliche Erweiterung und Entwicklung, aber auch die regelmäßige Reflexion der eigenen Kompetenzen. Personal Mastery ist dabei als lebenslanger Prozess zu verstehen. Elemente, die Senge dafür nennt, sind beispielsweise: persönliche Vision, Empathie, Nutzen des Unterbewusstseins, Offenheit, Integration Intuition und Vernunft und Verbundenheit mit der Welt erkennen.
Personal Mastery legt den Fokus auf Erblühen des Potenzials. Sie wird gefördert durch einen klaren Geist, der die Dinge sehen kann, wie sie sind, und nicht, wie er sie gerne hätte. Wer im Sinne von Personal Mastery handelt, geht das Leben an wie an ein schöpferisches Werk. Hindernisse werden im Sinne des „Growth mindset“ eher als Herausforderung, schwierige Situationen als Chance zum Wachsen angesehen.
Zur eigenen Entwicklung gehören zwei grundsätzliche Verhaltensweisen: Erstens immer wieder aufs Neue klären, was einem wirklich wichtig ist. Zweitens kontinuierlich lernen, die gegenwärtige Realität deutlicher wahrzunehmen.
Der Coach denkt systemischer.
Systemisches Denken als Coach praktizieren Sie, indem Sie die Beziehungen in einem System in seinen Wechselwirkungen berücksichtigen. Das heißt, Sie schauen eher auf Beziehungen und deren Verknüpfungen und weniger auf Tatsachen. Die Beziehungen zwischen den verschiedenen Teilen des Systems bestimmen die Arbeitsweise des Systems. Jedes noch so kleine Teil kann das Verhalten des Ganzen beeinflussen. Je mehr Verknüpfungen es gibt, desto größer ist die Möglichkeit der Einflussnahme.
Der Coach trifft Unterscheidungen
Ein Teil des Coachings besteht darin, automatisiertes unbewusstes Denken zu unterbrechen und/oder ins Bewusstsein zu bringen, damit sich Denken neu organisieren kann. Veränderung ist also auch die Neuordnung von Denken. Jede Art von Veränderung ist von Abwehrmechanismen begleitet. Diese werden zum Beispiel sichtbar durch Glaubenssätze oder Überzeugungen, Ideen, Weltbilder, Vorstellungen, Erwartungen, emotionale Reaktionen, Beschwichtigen und Anklagen.
Sie als Coach führen daher lernintensive Gespräche, in denen der Coachee klar zum Ausdruck bringen kann, was er denkt und sein Denken für neue Möglichkeiten öffnet. Durch genaues Zuhören unterstützen Sie die Fähigkeit zu differenzieren, denn die Kommunikation im Coaching erfordert genaue Unterscheidungen. Je mehr Unterscheidungen Sie treffen können, desto mehr können Sie beurteilen, was in einem bestimmten Kontext möglich ist. Unterscheidungen zu treffen, bedeutet, mehr Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung zu haben und sein Handeln besser am Ziel ausrichten zu können. Betrachten Sie es wie eine Art Skulpturierungsprozess, der je nach Methodik verbal beschreibend oder, zum Beispiel mit Aufstellungen oder Bildern, auf körpersprachlicher Ebene entwickelt werden kann.
Der Coach soll verstören
Eine große Bandbreite an möglichen Interventionen nutzt Ihnen nur, wenn Sie diese selbst flüssig und authentisch einsetzen können - sonst funktionieren sie nicht. Sie sollten möglichst ein Repertoire auf allen Ebenen haben, damit Sie die Ebenen des Erlebens des Coachee bespielen können: Holen Sie ihn raus aus der Box und wirken Sie verstörend auf seine aktuelle Welt, ohne den guten Kontakt zu verlieren
Coaching hat viel mit Mut zu tun, weil der Coachee die Komfortzone verlassen muss. Daher ist es wichtig, verstörend auf das Konstruktionsprinzip des Coachee einzuwirken, damit er die Grenzen verlässt. Ermutigen Sie ihn, Neuland zu betreten. Coaching ist gut, wenn der Coachee verwirrt aus dem Gespräch geht. Es ist ein Zeichen dafür, dass er für Veränderung bereit ist. Sie erkennen dies zum Beispiel daran, wenn der Coachee nicht mehr direkt antworten kann und zum Beispiel sagt „Keine Ahnung, weiß ich nicht, darüber habe ich so noch nie nachgedacht“.
Der Coach hat eine persönliche Vision
In Ihrer Rolle als Coach brauchen Sie zunächst selbst eine Vision, damit Sie motivierend den Raum von Möglichkeit aufspannen können. In der Vision des Coaches ist die Absicht enthalten, dass Sie Ihrer Arbeit eine tragende Qualität geben und das Ganze nicht nur reiner Broterwerb ist. In jedem Coachinggespräch findet auch eine Exploration Ihres eigenen Wertesystems statt.
Zur Personal Mastery nach Senge gehört es auch, permanent an der eigenen Vision zu arbeiten. Das lässt sich beschreiben als ein permanentes Fragenstellen sich selbst gegenüber. Dadurch können Sie Energie bündeln, Geduld entwickeln und die eigene Vision immer wieder festigen.
Gleichzeitig braucht auch jeder Coachee eine Einbettung der jeweiligen Ziele in eine höhere Vision. Je besser Ihr Zugang zu Ihrer Vision ist, desto besser kann auch der Coachee den Zugang zu seiner Vision finden.
Der Coach, Commitment und die Liebe
Als Coach verpflichten Sie sich dem Raum der Möglichkeit, der Lösungen im Sinne des Coachee hervorbringen kann. Das Potenzial, das in jedem vorhanden ist, bestimmt, welche Möglichkeiten vorhanden sind und was außerhalb der Umsetzbarkeit ist. Als Coach haben Sie den Auftrag, diesen Raum so aufzuspannen, dass der Coachee sein Potenzial selbst erkennen kann. Sie stellen sich dabei komplett in den Dienst des Coachee (Commitment). Dafür richtet sich Ihre Aufmerksamkeit immer auf das Potenzial des Coachee innerhalb der Situation.
Als Coach sind Sie - wie ein Gärtner - ein Begleiter in den Phasen des Wachstums und Wandels. Doch Commitment ohne Liebe wird zur trockenen Verpflichtung. Tun Sie Dinge von Herzen, und haben Sie die Bereitschaft, „dabei“ zu sein, um zum wirklich guten Coach zu werden. Denn echte Coachingkultur wird erst dann zu einer Kultur und außerordentlichen Leistung, wenn Sie eine Art „Love Affair“ mit dem verbinden, was Sie tun. Sonst bleibt es mittelmäßiges Anwenden von Tools und Techniken.
3. COACHINGANLIEGEN UND -KONTEXTE
Nach diesem ersten Überblick zu systemischerem, lösungsfokussierten Coaching, möchten wir nun einen Blick darauf werfen, mit welchen Anliegen die Klienten zu Ihnen als Coach kommen können.
Warum kommt ein Klient oder eine Klientin zum Coach?
Welche Anliegen haben die Klienten, die sie gemeinsam mit Ihnen lösen möchten?
Welche Aufgaben können Sie vom Anliegen für das Coaching ableiten?
Welche Kontexte im System des Coachee fördern den Bedarf für ein Coaching?
Für ein Coaching entscheiden sich Menschen immer dann, wenn sie sich in einer Situation erleben, die sie als veränderungsbedürftig ansehen. Häufig wird ein Coaching gewünscht, wenn jemand aus seinen Denk- und Verhaltensgewohnheiten nicht herauskommt. Er hat sich verstrickt und weiß gerade nicht, wie er es besser oder einfach nur anders machen soll. Auch wenn viele irgendwann selbst eine Lösung finden, so kann der Gang zum Coach doch wertvolle Lebenszeit und - energie sparen. Der zukünftige Coachee nimmt Unterstützung in Anspruch, weil er sich von der strukturierten und objektiven Anleitung und dem Gesprächsraum des Coaches ein möglicherweise schnelleres und besseres Herauskommen aus seiner ungewünschten Situation verspricht. Im Businesscoaching kommt es nicht selten vor, dass dem potenziellen Coachee auch ein Coaching empfohlen oder nahegelegt wird.
Achtung vor Schubladen!
Für Ihr Ziel als Coach ist es gar nicht so entscheidend, mit welchem Anliegen der Klient kommt. Ihre Aufgabe ist es immer, dass Sie Ihr Know-how kompetent für die gewünschte Veränderung einsetzen. Diese Änderung entsteht durch die Einführung von Unterschieden in die vorhandenen Muster, und zwar so, dass die eigenen Ressourcen des Coachee zielführend aktiviert werden.
Dazu kommt, dass Ihr Klient zwar vermutlich mit einem konkreten Anliegen kommt, das Problem aber irgendwo ganz anders liegen kann. Das Anliegen ist quasi das Symptom, das ihm (und/oder anderen) auffällt, aber dahinter können völlig andere Themen und Aspekte als Ursache des Symptoms stehen oder mit ihm verwoben sein. Ihre Aufgabe ist es, sich innerlich nicht auf das erstgeschilderte Anliegen zu fixieren, sondern in Ihren Gesprächen mit dem Coachee Raum für Zusammenhänge offen zu lassen. Die Kunst im Businesscoaching ist es, dabei ausreichend tiefgründige und dennoch dem Rahmen (im Regelfall wenige Sitzungen) entsprechende Themenstellungen herauszuarbeiten.
Schlussendlich sind die Übergänge zwischen den verschiedenen Anliegen fließend, und es können mehrere Anliegen gleichzeitig eine Rolle spielen.
FALLBEISPIEL
Die Führungskraft Marc Keller kommt mit dem Anliegen „Wirkung und Performance“ zu dir. Im Verlauf des Coachings stellt sich heraus, dass das eigentliche Thema ein generelles Unwohlsein in der Führungsrolle ist, er Menschen eigentlich nicht wirklich führen möchte und eigentlich viel mehr Freude an einer fachlich tieferen Tätigkeit hat. Er wurde zur Führungskraft „gemacht“, da er über Jahre sehr gute fachliche Leistungen erreichen konnte und dann die Beförderung als Kompliment an seine Leistungen verstanden hat. Die eigentlichen Aufgaben einer Führungskraft liegen ihm nicht und er sieht seine Zukunft eher in einer fachlichen Karriere.
Besprechen Sie das Anliegen des Klienten in der Auftragsklärung. Klären Sie dort auch, was passieren soll, wenn sich die Themen im Verlauf des Coachings ändern. Ohne diesen spezifischen Handlungsrahmen könnte sich das Coaching „verselbstständigen“, und ihr Auftraggeber ist anschließend nicht zufrieden mit Ihnen, obwohl Sie den Klienten vorangebracht haben.
ÜBUNG
? Wo hast Du schon einmal eine Situation erlebt in denen es auf den zweiten Blick um etwas ganz anderes ging als zunächst gedacht?
? Wie bist Du damit umgegangen, als Du das bemerkt hast?
? Fiel es dir leicht, die neue Situation als Ausgangslage zu übernehmen?
Vor diesem Hintergrund nehmen Sie die folgenden „Kategorien“ von Anliegen gerne als grundsätzliche Anhaltspunkte, warum Klienten zu Ihnen kommen. Halten Sie aber im Hinterkopf, dass es sich vielleicht nur um den Anlass, aber nicht um den Grund handeln kann. Ganz generell interessieren uns in der Lösungsfokussierung die „wahren Gründe“ auch weniger, denn wir arbeiten ja in die Zukunft und fragen danach, was es braucht, damit X oder Y besser funktioniert.
Konflikte
Konflikte im Innen und Außen sind nichts grundsätzlich Negatives, sondern bis zu einem gewissen Grad sogar nötig, da sie Anstöße zur Weiterentwicklung geben. Dennoch können Konflikte am Arbeitsplatz die Beteiligten stark belasten. Sie schaukeln sich gern hoch, und wer mittendrin steht, weiß häufig nicht, mit wem er sich auf sicherem Boden über das Problem austauschen kann. Konflikte sind daher ein „Klassiker“ unter den Coachinganliegen, und wir bezeichnen sie auch gerne als Spannungen, da sie (sofern gekonnt bearbeitet) immer Energie für Neues enthalten.
Was passiert bei einem Konflikt?