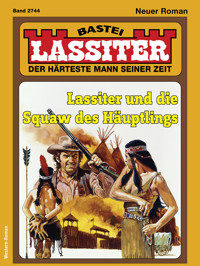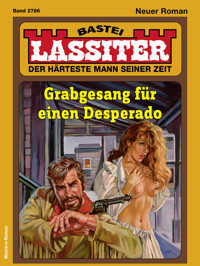Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alfredbooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dieses Ebook enthält folgende Romane: Pete Hackett: Hass, der in die Hölle führt Pete Hackett: Im Banne des Hasses Pete Hackett: Die Aasgeier von Junction City Pete Hackett: Das Gesetz des Stärkeren Pete Hackett: Das blutige Gesetz der Colts Pete Hackett: Die Höllenhunde von Anaconda Pete Hackett: Partner bis in den Tod Pete Hackett: Männerhass Pete Hackett: Trag den Stern für Wichita George Owen Baxter: Gestohlenes Gold Max Brand: Der Mann aus Mustang Max Brand: Einsamer Reiter am Rifle Pass In Shadoe Rankin war nur noch Hass. Wie einen räudigen Straßenköter hatten ihn die Yankees einige Monaten nach General Lees Kapitulation aus dem Gefangenenlager in Kansas gejagt. Ohne Pferd, ohne Waffen, ohne Geld und ohne einen Bissen Proviant. Nicht einmal vernünftige Kleidung hatten sie ihm gegeben. Auf seinem Weg nach Süden stahl er sich seine Nahrung zusammen oder lebte von dem, was ihm die Natur bot. Er war abgemagert. Die graue Uniform, auf die er einst so stolz gewesen war, hing in Fetzen an seinem knochigen Körper. Die Augen lagen tief in den Höhlen. Shadoe Rankin, der zuletzt als Captain für die Sache des Südens gekämpft hatte, war so ziemlich am Ende. Seit vielen Wochen war er unterwegs. Verfilztes Bartgestrüpp wucherte in seinem eingefallenen Gesicht. Er war schmutzig und verschwitzt. Sein Ziel war die Farm am Mustang Draw, in der Nähe von Seminole im Gaines County, Texas. Dort war er zu Hause. Dort wollte er seine Wunden lecken und düstere Vergeltungspläne schmieden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1645
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pete Hackett, Max Brand, George Owen Baxter
12 Super Western April 2024
Inhaltsverzeichnis
12 Super Western April 2024
Copyright
Hass, der in die Hölle führt
Im Banne des Hasses
Die Aasgeier von Junction City
Das Gesetz des Stärkeren
Das blutige Gesetz der Colts
Die Höllenhunde von Anaconda
Partner bis in den Tod
Männerhass
Trag den Stern für Wichita
Gestohlenes Gold
Der Mann aus Mustang
Einsamer Reiter am Rifle Pass
12 Super Western April 2024
Pete Hackett, George Owen Baxter, Max Brand
Dieses Ebook enthält folgende Romane:
Pete Hackett: Hass, der in die Hölle führt
Pete Hackett: Im Banne des Hasses
Pete Hackett: Die Aasgeier von Junction City
Pete Hackett: Das Gesetz des Stärkeren
Pete Hackett: Das blutige Gesetz der Colts
Pete Hackett: Die Höllenhunde von Anaconda
Pete Hackett: Partner bis in den Tod
Pete Hackett: Männerhass
Pete Hackett: Trag den Stern für Wichita
George Owen Baxter: Gestohlenes Gold
Max Brand: Der Mann aus Mustang
Max Brand: Einsamer Reiter am Rifle Pass
In Shadoe Rankin war nur noch Hass. Wie einen räudigen Straßenköter hatten ihn die Yankees einige Monaten nach General Lees Kapitulation aus dem Gefangenenlager in Kansas gejagt. Ohne Pferd, ohne Waffen, ohne Geld und ohne einen Bissen Proviant. Nicht einmal vernünftige Kleidung hatten sie ihm gegeben.
Auf seinem Weg nach Süden stahl er sich seine Nahrung zusammen oder lebte von dem, was ihm die Natur bot. Er war abgemagert. Die graue Uniform, auf die er einst so stolz gewesen war, hing in Fetzen an seinem knochigen Körper. Die Augen lagen tief in den Höhlen.
Shadoe Rankin, der zuletzt als Captain für die Sache des Südens gekämpft hatte, war so ziemlich am Ende. Seit vielen Wochen war er unterwegs. Verfilztes Bartgestrüpp wucherte in seinem eingefallenen Gesicht. Er war schmutzig und verschwitzt. Sein Ziel war die Farm am Mustang Draw, in der Nähe von Seminole im Gaines County, Texas. Dort war er zu Hause. Dort wollte er seine Wunden lecken und düstere Vergeltungspläne schmieden.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Bathranor Books, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
© dieser Ausgabe 2024 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Hass, der in die Hölle führt
Pete Hackett
Auf den Tag genau fünf Jahre nach seiner Verurteilung öffneten sich für Dick Wetham die Zuchthaustore. Drei Freunde erwarteten ihn. Sie hatten ein Pferd für ihn dabei. Am Sattelknauf hing ein Revolvergurt mit einem schweren, langläufigen 44er im Halter, im Scabbard steckte eine fabrikneue Winchester.
Einer der Kerle grinste und sagte: „Fünf Jahre, Dick. Hoffentlich haben sie dich nicht kleingekriegt oder bekehrt da drin.“ Er wies mit einer knappen Geste auf den riesigen Backsteinbau mit den vielen vergitterten Fenstern, der von hohen Mauern umgeben und mit Stacheldraht auf den Mauerkronen gesichert war.
Wethams Züge vereisten. „Sie haben es versucht, und manchmal war ich nahe daran, zu zerbrechen. Es war hart - höllisch hart. Aber der Gedanke an Quincannon hat mich durchhalten lassen.“ Aus der Tiefe seiner Augen stieg ein hässliches, bösartiges Funkeln. Seine Stimme war zuletzt von einer wilden, ungebändigten Leidenschaft verzerrt, und sein glitzernder Blick verlor sich für kurze Zeit in der Ferne, als würde er in bitteren Erinnerungen versinken.
Dick Wetham war voll Hass. Es war ein Hass, den die Jahre nicht zum Erlöschen zu bringen vermochten - ein Hass, der mit jedem Tag im Zuchthaus geschürt worden und höhergebrannt war wie eine verzehrende Flamme.
Plötzlich riss er sich los von seinen düsteren Überlegungen, er schaute wie ein Erwachender, es kam wieder Leben in seine Miene. Er sagte kehlig: „Es ist schön, dich zu sehen, Bill. Du hast meinen Brief also erhalten. Aber warum bringst du nur zwei Burschen mit?“
Er musterte die beiden abschätzend und sah zwei Kerle, die einen hartgesottenen, wenig vertrauensverweckenden Eindruck vermittelten, die dem äußeren Anschein nach aber im Großen und Ganzen seiner Vorstellung entsprachen.
„Ich habe vier Freunde von mir für den Ritt nach San Marcial gewinnen können, Dick. Ben Smith und Stuart Boddam habe ich schon in die Stadt vorausgeschickt, damit sie sich dort etwas umsehen und Quincannon auf deine Ankunft vorbereiten.“ Bill Haggan kicherte spöttisch. „Der verdammte Sternschlepper soll ruhig wissen, dass die bittere Stunde der Wahrheit für ihn nicht mehr fern ist.“
Dick Wetham schnallte sich den Revolvergurt um und band das Halfter am Oberschenkel fest. Er rückte den Colt zurecht, drückte den Knauf etwas nach außen, und dann zog er. Ansatzlos, gedankenschnell und glatt. Es war eine fließende Bewegung von Hand, Arm und Schulter. Mit dem Hochschwingen des Colts spannte er den Hahn, er schlug das Eisen an. Wie fest damit verwachsen lag es in seiner Faust.
Bill Haggan nickte anerkennend und schmunzelte beeindruckt: „Du hast es nicht verlernt, Dick. Was das Zaubern mit dem Sechsschüsser anbelangt, kann dir so schnell keiner das Wasser reichen.“
Wetham ließ den Hahn in die Ruherast gleiten, der Colt rotierte einmal um seinen Zeigefinger, er versenkte ihn im Futteral und lächelte geschmeichelt.
Einer sagte grinsend: „Mein Name ist McPherson - Cole McPherson. Wir kennen dich nur aus Bills Erzählungen, Wetham. Aber er hat wohl nicht übertrieben, als er dich als Akrobat mit dem Schießeisen beschrieb. Wenn du auch so gut triffst, wie du ziehst ...“
„Keine Sorge“, murmelte Wetham und zog das Gewehr aus dem Scabbard. Es war eine Winchester 73, erst ein halbes Jahr auf dem Markt, kinderleicht zu handhaben und sehr zielgenau. Er riegelte eine Patrone in den Lauf, hob das Gewehr an die Schulter und peilte ein imaginäres Ziel an. „Sehr gut“, lobte der alternde, hagere Bandit mit dem schmalen, hohlwangigen Raubvogelgesicht. Schulterlange, angegraute Haare fielen unter dem verschwitzten und verbeulten Stetson hervor. Ein unstetes, ruheloses Leben und die fünf Jahre in den Steinbrüchen hatten unübersehbare Spuren bei ihm hinterlassen. Tiefe Furchen zogen sich von seinen Nasenflügeln bis zu den Mundwinkeln. Eine helle Messernarbe auf der eingefallenen Wange bildete einen scharfen Kontrast zur sonnenverbrannten Haut.
Er senkte das Gewehr. In seinen pulvergrauen Augen irrlichterte es. „Morgen können wir in San Marcial sein. Reiten wir. Fünf Jahre lang habe ich diesen Tag herbeigesehnt wie sonst nichts auf der Welt. Die Hölle hat mich wieder ausgespuckt, Bill. Und nun gilt es, abzurechnen.“
Er stieß die Winchester in den Scabbard, warf sich in den Sattel und trieb das Pferd an. Dick Wetham war besessen von dem Gedanken an Rache. Mit diesem Gedanken war er Abend für Abend todmüde unter seine zerschlissene Decke gekrochen, mit ihm war er am Morgen wieder aufgewacht. Er hatte ihm geholfen, nicht durchzudrehen und zu verzweifeln unter der glühenden Sonne und den Peitschenschlägen der Aufseher. Jeder Schlag und jede Demütigung hatten seinem Hass neue Nahrung gegeben.
Mit jedem Schritt ihrer Pferde kamen sie San Marcial ein Stück näher. Und mit ihnen näherten sich Hass und Tod der friedlichen Stadt im Socorro County am Westufer des Rio Grande ...
*
Steve Quincannon, der Town Marshal von San Marcial, hatte seinen letzten Tagesrundgang hinter sich gebracht. Es ging auf den Abend zu. Die Sonne hing über dem westlichen Horizont. Von Osten kam schnell die Dämmerung. Die Schatten waren lang und begannen zu verblassen, das Land verlor seine Farben.
Steve bog in die Main Street ein. Es war die Stunde des Feierabends und San Marcial war ruhig. Auf der Straße war um diese Zeit kaum etwas los. Die Stadt war arglos. Niemand erinnerte sich des tödlichen Versprechens, das Dick Wetham vor fünf Jahren gegeben hatte. Dick Wetham war in Vergessenheit geraten. Und so ahnte niemand, dass sich das Verhängnis bereits auf stampfenden Hufen näherte, personifiziert in der Gestalt einiger Banditen, deren Lebenselexiere Hass, Gewalt und Terror waren.
Der einzige, der Wetham nicht vergessen hatte, war Steve. Und als er den Mann sah, der lässig am Stützpfosten des Vorbaudaches des Office lehnte, ahnte er sogleich das Unheil. Er verspürte eine jähe Anspannung.
Der Bursche war groß und wirkte abgerissen und verwahrlost. Staub haftete an seiner Kleidung. Er hatte sich den Stetson tief in die Stirn gedrückt, und so war von seinem stoppelbärtigen Gesicht nur der untere Teil zu sehen. Im ersten Moment durchfuhr wie ein Stromschlag der Name Wetham Steves Verstand. Im nächsten Augenblick aber wusste er, dass es sich nicht um den Banditen handelte. Steve stockte etwas im Schritt und schaute schnell in die Runde.
Der Fremde schien allein zu sein.
Steve beschleunigte seine Schrittfolge wieder. Als er an dem Fremden vorbei ins Office wollte, ließ dieser seine Stimme erklingen: „Sorry, Marshal, auf ein Wort.“
Es war eine klanglose Stimme ohne Höhen und Tiefen, weder freundlich noch auf irgendeine Art aggressiv. Dennoch brachte sie Steves Nerven zum Schwingen. Er blieb stehen, fixierte den anderen, und jetzt konnte er auch sein Gesicht sehen. Was er sah, gefiel ihm nicht. Bei dem Burschen handelte es sich um einen Sattelfalken, einen Langreiter, wahrscheinlich einen Gesetzlosen. In den Jahren als Marshal hatte Steve genug Menschenkenntnis erworben, um ihn richtig einzustufen. Und er dachte wieder an Dick Wetham.
„Was ist?“, fragte Steve.
Der andere lächelte und zeigte dabei die Zähne. „Ein schöner Ort, Marshal. Ruhig, friedlich und beschaulich. Früher soll San Marcial ein ziemlich wildes Nest gewesen sein. Haben Sie hier mit eisernem Besen gekehrt? Waren Sie die zähmende Hand hier?“
„Die Zeiten ändern sich eben“, versetzte Steve kühl. „Die Städte werden größer und zivilisierter. Die wilden Burschen sterben langsam aus, denn mehr und mehr zeigt man ihnen ihre Grenzen auf.“
„Ja, so scheint es“, erwiderte der Fremde. Sein Lächeln schien zu gefrieren. „Dennoch sollte man sich in solchen Städten nicht in Sicherheit wiegen, Marshal. Denn der eine oder andere wilde Hombre taucht überraschend wieder aus der Versenkung auf, um irgendwelche alte Rechnungen zu begleichen. Und dann ist es oftmals vorbei mit Ruhe, Frieden und Beschaulichkeit.“
Steve nickte gelassen. „Warum nennen Sie das Kind nicht beim Namen, Stranger? Sie schickt Dick Wetham, nicht wahr?“
„Nicht direkt“, dehnte der Bursche. „Wethams alter Freund Haggan meinte, wir sollten vorausreiten und dieses Nest - vor allen Dingen Sie, Marshal -, auf die Stunde der Abrechnung einstimmen.“
„Wir?“, entfuhr es Steve und seine Wirbelsäule versteifte jäh.
„Mein Freund Ben Smith und ich. Mein Name ist übrigens Boddam.“ Er deutete über die Straße, und als Steve den Kopf drehte, nahm er in der Mündung einer Gasse einen weiteren Burschen wahr, der vorher nicht dort gestanden hatte.
Ben Smith hatte die Hände flach hinter den Gurt mit dem tiefhängenden Halfter geschoben. Sein Gesicht war ausdruckslos. Um seinen Mund lag ein brutaler Zug. Eine unausgesprochene Drohung ging von ihm aus, etwas Gefährliches, ein Strom von Härte, Skrupellosigkeit und Gnadenlosigkeit.
Steve wandte sich Boddam wieder zu, als dieser erneut anhub. „Hatten Sie Wetham etwa aus Ihrem Gedächtnis gestrichen, Marshal? Rechneten Sie nicht mehr damit, dass er seinen Schwur erfüllt?“
„Wann kommt Wetham?“
„Morgen.“
Hinter Steve waren das Knarren von Stiefelleder, das leise Klirren von Radsporen und das Mahlen von Staub unter Ledersohlen zu hören. Ben Smith näherte sich mit schleppenden Schritten.
„Nun“, murmelte Steve, „dann sind wir ja gewarnt hier in der Stadt. Die Bürger San Marcials werden nicht dulden, dass ihr hier einen faulen Zauber abzieht. Sie werden euch geschlossen wie ein Mann gegenübertreten und euch mit Pauken und Trompeten zum Teufel jagen.“
Boddam lachte verächtlich auf. „Darauf würde ich mich nicht verlassen, Ouincannon. Es wird wohl eher so sein, dass sich eine ganze Reihe der ehrenwerten Gentleman hier in die Hosen machen und sich vor uns verkriechen.“
Hinter Steves Rücken lachte auch Ben Smith. Dann gab er zu verstehen: „Er spricht aus Erfahrung, Sternschlepper. Ich denke, du stehst ziemlich einsam und verlassen da, wenn es zum Treffen kommt. Es ist überall das selbe. Man wird dich daran erinnern, dass du derjenige bist, der für Ruhe und Ordnung zu sorgen hat. Sie bezahlen dich, damit du sie beschützt. Und sie machen keinen Finger krumm, wenn du für sie dein Fell zu Markte trägst. Es ist dein Job. Und das ist für sie die Rechtfertigung.“
Steve vollführte eine halbe Drehung. „Ich frage mich, woher Sie Ihre Sicherheit nehmen, Mister.“
„Ich war schon in vielen solchen Städten“, antwortete Smith fast sanft. Und dann fügte er klirrend hinzu: „Du wirst es selbst erleben, Quincannon. Morgen, wenn Wetham hier ist. Fang langsam an zu beten und komm mit dir ins Reine, Amigo. Denn deine Stunden sind gezählt.“
„Ich verstehe“, knurrte Steve. „Ihr seid vorausgeritten, um im Vorfeld die Menschen hier einzuschüchtern, zu verunsichern, sie ängstlich zu machen. Leider habe ich gegen euch Schufte nichts in der Hand. Ein Steckbrief scheint von euch in diesem Staat nicht zu existieren. Seid nur zurückhaltend und friedfertig, solange ihr in der Stadt weilt.“
Steve sprach es mit aller Entschiedenheit und setzte sich wieder in Bewegung. Er beachtete die beiden Banditen nicht mehr. Als sich die Officetür hinter ihm schloss, stieß Smith hervor: „Wir werden ihm seinen Hochmut austreiben. Ich sah schon ganz andere Burschen als ihn zerbrechen. Es ist nur eine Frage der Mittel. Komm, spülen wir uns den Staub aus der Kehle. Und dann sehen wir weiter.“
Sie lenkten ihre Schritte auf den Saloon zu.
*
Die Dunkelheit kam. Steve machte im Office kein Licht. Angie wartete mit dem Abendessen auf ihn. Er konnte sich nicht entschließen, nach Hause zu gehen. Er wollte alleine sein mit all seinen nagenden Gedanken. Auch wusste er nicht, wie er Angie beibringen sollte, dass über ihm das Damoklesschwert einer tödlichen Gefahr hing.
Er dachte daran, die maßgeblichen Männer der Stadt aufzusuchen, um mit ihnen über eine Bürgerwehr zu sprechen. Aber auch diesen Gedanken schob er beiseite. Ungute Ahnungen erfüllten ihn. Er wusste nicht, wie die Reaktionen ausfielen. Und tief in seinem Innersten fürchtete er sich davor, dass es so kommen könnte, wie der Bandit auf der Straße es prophezeit hatte.
Die Zeit schritt fort. Steves Gedanken bewegten sich im Kreis. Er spürte Verunsicherung, und das zermürbte seine Nerven und machte ihn gereizt. Aus dem Saloon war verschwommenes Stimmengewirr und Gelächter zu vernehmen. Boddam und Smith hatten also noch nicht begonnen, die Saat des Schreckens und der Angst in die Herzen und Gemüter zu streuen. Wahrscheinlich wollten sie nichts herausfordern. Möglicherweise wollten sie es auch ihm, Steve, überlassen, die Hiobsbotschaft in San Marcial zu verbreiten.
Plötzlich erklang lautes Kreischen, eine wütende Stimme schrie etwas, jemand lachte schallend. Schwerfällig erhob sich Steve. Er holte sein Gewehr, ging zur Tür und trat auf den Vorbau. Ein kühler Luftzug streifte ihn. Ein ganzes Stück die Straße hinunter lag eine Gestalt auf der Fahrbahn. Sie wurde vom Licht, das aus dem Saloon fiel, umflossen. Steve hörte den Mann hüsteln und ächzen, und nun kroch er auf allen vieren davon, auf den nachtschwarzen Schlund einer Gasse zu.
Steve seufzte. Er hatte den Mann erkannt. Er sprang vom Vorbau und schritt schräg über die Fahrbahn auf ihn zu. Der Mann lag nun im Maul der Gasse, röchelte und gurgelte, und bewegte sich nicht mehr, als hätte ihn sämtliche Kraft verlassen.
„Telly“, murmelte Steve bitter, als er ihn erreichte, „du hast dich also wieder sinnlos betrunken. Und sie haben dich wie so oft schon auf die Straße geworfen, als du ihnen lästig wurdest mit deiner Bettelei nach einem Brandy oder ein paar Cents.“
Der Betrunkene lallte unartikulierte Laute vor sich hin.
Steve beugte sich über ihn. „Es wird immer schlimmer mit dir, Telly. Ich muss dich wieder einmal zur Ausnüchterung ins Gefängnis stecken. - Du lieber Himmel, wie kann sich ein Mensch nur so sinnlos betrinken?“
Er packte Telly am Kragen der zerschlissenen, schmutzstarrenden Jacke, da lachte jemand leise hinter ihm, und dann sprang ihn eine spöttische Stimme an: „Quincannon der Samariter. Sieh an, sieh an. Liebe deinen Nächsten, wie? Du machst dem biblischen Grundsatz alle Ehre. Willst du dir damit einen Platz im Himmel erkaufen?“
Steve identifizierte diese Stimme auf Anhieb. Sie gehörte Ben Smith. Und Steve wusste, dass ihn die beiden Kerle beobachteten und überwachten.
Er nahm die Hand von Tellys Jackenkragen und versuchte, mit den Augen die Dunkelheit in der Gasse zu durchdringen. Es gelang ihm nicht.
Ben Smith sagte: „Es wird Wetham ein Leichtes sein, dir das Licht auszublasen, Quincannon. Du bist ziemlich unachtsam. Wir könnten dich jetzt kaltmachen. Du hebst dich gut ab gegen den helleren Hintergrund der Main Street. Aber keine Sorge: Wir wollen Dick Wetham nicht vorgreifen.“
Den Worten folgte wieder ein dumpfes, höhnisches Lachen.
„Ich rate euch zu verschwinden“, stieß Steve hervor, als er den Aufruhr seiner Gefühle wieder unter Kontrolle hatte. „Eure Taktik hat nämlich einen Fehler. Ihr könnt mich nicht mürbe machen. Es gelingt euch nicht, mich in ein Nervenbündel zu verwandeln. Ich habe Dick Wetham schon einmal kleingekriegt, obwohl ihm ein Rudel Kerle von eurer Sorte den Rücken stärkten. Und er wird sich auch diesmal die Zähne ausbeißen.“
Aus der Finsternis lösten sich zwei Schemen. Sie näherten sich langsam. Als sie einen Schritt vor Steve anhielten, sagte Stuart Boddam: „Du versuchst dir Mut zu machen, Quincannon.“
Wenn der Bandit am Nachmittag noch die Form gewahrt hatte, so zeigte er Steve jetzt seine Geringschätzung und Missachtung, indem er ihn mit ‘du’ anredete.
Zorn, den er nur mühsam im Zaum halten konnte, ergriff von Steve Besitz. „Psychoterror funktioniert bei mir nicht“, knirschte er. „Eure drohenden Verheißungen könnt ihr für euch behalten. Reitet Wetham entgegen und warnt ihn. Bestellt ihm von mir, dass er gut daran täte, nicht nach San Marcial zu kommen. Ich will euch zwei morgen nicht mehr in der Stadt antreffen. Wenn doch ...“
Er verstummte, denn die Erkenntnis, dass er keine Handhabe gegen Smith und Boddam hatte, traf ihn und machte ihn ratlos.
„Mach dich nicht lächerlich, Quincannon!“, giftete Boddam. „Dir sind die Hände gebunden. Yeah, der Stern an deiner Brust lässt es nicht zu, dass du zwei unbescholtenen Bürgern eines freien Landes auf die Zehen trittst. Du bist machtlos, Amigo. Du kannst nicht so, wie du gerne möchtest. Und das macht dich wütend. Dazu kommt die Angst. Noch ist sie vielleicht nur unterschwellig. Aber sie wächst mit jeder Stunde, und sie zersetzt deinen Verstand. Und wenn Metham in die Stadt kommt, wirst du halb verrückt sein vor Angst. Es ist wie bei einem, der in der Todeszelle sitzt und dem der Termin seiner Hinrichtung mitgeteilt wird. Ich schätze, innerhalb der nächsten zwölf Stunden bist du mit deinen Nerven so ziemlich am Ende.“
Sie setzten sich in Bewegung, schritten an Steve vorbei und verschwanden gleich darauf um die Ecke des Saloons. Abgesehen von dem Betrunkenen war Steve mit seinen aufgewühlten Empfindungen allein. Er knirschte mit den Zähnen. Und er sagte sich, dass die Schufte vielleicht gar nicht so unrecht hatten. Möglich, dass die Angst schon in ihm wurzelte. Schicksalhafte Stunden lagen vor ihm. Und am Ende stand vielleicht der Tod ...
Gewaltsam konzentrierte Steve sich auf den Augenblick. Er half Telly hoch. Der Trinker konnte sich kaum auf den Beinen halten. Steve hatte alle Mühe, ihn in den Jail zu schaffen.
*
Der Tag erwachte mit strahlender Schönheit. Die Sonne schleuderte ihre Flammenbündel in das Land und vertrieb die Kälte der Nacht. Die gleißende Helligkeit griff nach San Marcial.
Steve Quincannon hatte an diesem Morgen kein Auge für dieses prächtige Naturschauspiel. Er würgte an seinem Frühstück. Angie beobachtete ihn sorgenvoll. Seit nicht ganz drei Jahren waren sie verheiratet. Er hatte ihr nichts von den beiden Kerlen und ihrer bösen Prophezeiung erzählt. Mit dem untrüglichen Instinkt der liebenden Frau aber spürte sie, dass etwas nicht stimmte.
Sie schenkte ihm Kaffee nach. Draußen erwachte die Stadt zum Leben. Vögel zwitscherten. Forschend schaute sie in sein Gesicht. Er wirkte gedankenverloren, als wäre er im Geiste ganz woanders.
„Was ist los, Steve?“, fragte sie. „Etwas stimmt doch nicht. Seit gestern bist du so verändert, so in dich gekehrt. Du sprichst kaum noch und grübelst nur. Gibt es Probleme? Was verschweigst du mir?“
Er spülte den Bissen mit einem Schluck Kaffee hinunter, legte den Toast auf den Teller zurück, blinzelte und sah Angie voll an. Dann brach es über seine Lippen: „Gestern wurde Dick Wetham aus dem Zuchthaus entlassen. Und heute wird er in San Marcial eintreffen.“
Angie erbleichte. „Gütiger Gott“, entrang es sich ihr, und ihre Hände wischten fahrig über den Tisch. Aus der Tiefe ihrer blauen Augen stieg das blanke Entsetzen, unter ihrem linken Auge begann ein Nerv zu zucken. Mehr als die beiden Worte brachte sie nicht heraus. Die würgende Angst ließ ihre Stimmbänder versagen.
Steve nickte schwer. „Gestern kamen zwei Fremde in die Stadt. Sie erwarteten mich am Abend vor dem Office. Es sind Kumpane von Wetham, und ihre Aufgabe ist es, mich mürbe zu machen. Ich soll nervlich am Ende sein, wenn Wetham aufkreuzt. Sie sollen mit mir spielen wie die Katze mit der Maus. Den Rest will Wetham dann selbst besorgen.“
Steve erhob sich.
„Wo willst du hin?“ Angies Stimme klang schrill und unnatürlich. Ihre Nasenflügel bebten. Ihr hübsches, gleichmäßiges Gesicht mutete in dieser Minute verkrampft an. Ihre Brust hob und senkte sich unter heftigen Atemzügen.
„Ich will versuchen, einige Männer zu mobilisieren“, murmelte er. „San Marcial drohen Terror und Gewalt. Ich bin zwar der Marshal, aber alleine stehe ich gegen ein Rudel Banditen auf ziemlich verlorenem Posten. Darum ist diese Stadt gefordert.“
Zuletzt klang seine Stimme hart und scharf.
„Keiner wird dir helfen. Keiner!“ Angie knetete ihre Hände. Sie sprach abgehackt, und was sie sagte, kam im Brustton der Überzeugung. „Sie sind feige. Sie lassen sich lieber terrorisieren und demütigen, als dass sie eine Waffe in die Hand nehmen und ihre Haut zu Markte tragen.“ Sie stemmte sich am Tisch in die Höhe. „Steve, bitte, lass uns die Stadt verlassen, solange noch Zeit ist. Es gibt hier kaum etwas, was uns hält.“
Zuletzt hatte Angies Stimme beschwörend, fast flehend geklungen. Angst und Verzweiflung, die in ihrem Blick lagen, trafen ihn bis in den Kern. Er schluckte trocken. Das Abzeichen an seiner Weste mutete ihn plötzlich zenterschwer an. „Du vergisst die beiden Strolche, die Wetham vorausschickte, Angie“, murmelte er rau. „Sie beobachten mich auf Schritt und Tritt. Wir kämen nicht aus der Stadt. Es ist aber auch nicht notwendig, dass wir davonlaufen. In San Marcial gibt es ...“
„Rechne nicht mit den Männern dieser Stadt!“, unterbrach Angie ihn fast hysterisch. Und plötzlich sank sie auf ihren Stuhl zurück, als würden ihre Beine sie nicht mehr tragen. „Du wirst allein sein, Steve, mutterseelenallein, und Wetham wird dich töten. Mein Gott, Steve, allein der Gedanke daran ist mir unerträglich.“
Ihr Gesicht war Spiegelbild der Empfindungen, die sie quälten. Die Angst um ihn drohte ihr den Verstand zu rauben. Sie streckte ihm die zitternden Hände hin. „Bitte, Steve“, kam es brüchig und losgelöst, fast hauchend über ihre zuckenden Lippen. „Lass uns fliehen.“
Bei ihm stritten sich Gefühl und Verstand. Ein peinigender Zwiespalt war in ihm aufgerissen. Er wollte einerseits Angie nicht weh tun. Denn er liebte sie mehr als sein eigenes Leben. Andererseits konnte er nicht fliehen. Dick Wetham war voll Hass und Rachegier. Den Platz gab es nicht auf der Welt, wo er ihn nicht finden würde. Heiser sagte Steve: „Egal, wohin wir gehen, Angie: Wetham findet mich. Soll ich den Rest meines Lebens damit verbringen, vor ihm zu flüchten? Nein, Angie, das wäre kein Leben. Hier ist unser Platz - und diesen Platz verteidige ich.“
Angie schlug die Hände vor das Gesicht. Ihr ganzer Körper erbebte. Sie konnte die Tränen nicht mehr zurückhalten. Steve umrundete den Tisch, stellte sich hinter sie und legte ihr beide Hände auf die Schultern. „Hör bitte zu weinen auf, Angie“, presste er hervor. „Wir wussten beide, dass Wetham eines Tages seinem Schwur getreu nach San Marcial kommen würde, um sich für die Jahre im Zuchthaus zu rächen. Den Gedanken daran haben wir immer nur zur Seite geschoben, aber wir lebten ständig mit ihm. Wir wussten auch, dass die Zeit nicht still steht. Und jetzt sind die fünf Jahre um. Wir müssen jetzt stark sein, Angie - beide. Und wir müssen uns an dem Gedanken aufrichten, dass ich Wetham schon einmal besiegte. Auch damals stärkten ihm fast ein halbes Dutzend coltschwingender Schufte den Rücken. Dennoch brachte ich ihn vor Gericht.“
„Er wird dich töten“, keuchte sie. „Ich spüre es. Er wird dich dort draußen auf der Straße zusammenschießen - und die Stadt wird zusehen.“
Sein Griff auf ihren Schultern wurde härter. Er presste die Lippen zusammen, dass die Backenknochen scharf hervortraten. „Niemand kann seinem Schicksal davonlaufen oder ihm ausweichen, Angie“, sagte er mit Nachdruck. „Ich gehe jetzt. Es gibt genügend aufrechte Männer in dieser Stadt, die nicht zulassen werden, dass eine Horde skrupelloser Banditen hier einen höllischen Reigen aufführen. Du wirst es sehen, Angie.“
Er ging zur Tür. An der Wand daneben, an einem Hacken, hingen sein Revolvergurt mit dem Sechsschüsser im Halfter und sein Hut. Er stülpte ihn sich auf den Kopf, dann schnallte er sich den Gurt um. Er rückte das Halfter zurecht und band es am Oberschenkel fest. Seine Gestalt straffte sich, er reckte die breiten Schultern, sog die Luft in seine Lungen und drehte sich noch einmal zu Angie um. Sie starrte ihn aus tränenumflorten Augen an, Tränen rollten auch über ihre Wangen.
„Es ist schon schwer genug, Angie“, murmelte er betrübt. „Mach es für uns nicht noch schlimmer. Bitte ...“
„Ohne dich werde auch ich nicht mehr leben wollen“, flüsterte sie.
Er spürte ein Würgen in der Kehle und ging schnell hinaus. Und als er auf dem Sidestep seinem Office zustrebte, echoten ihre Worte noch durch seinen Verstand.
Eine kalte Hand schien nach ihm zu greifen und ihn nicht mehr loszulassen.
*
Nur vereinzelt begegneten Steve Passanten. Es war noch früh am Morgen. Er wurde gegrüßt, aber er war viel zu sehr mit seinen Gedanken beschäftigt, um darauf zu achten. Verdutzte Blicke folgten ihm. Dann betrat er das Office. Abgestandene Luft schlug ihm entgegen und er ließ die Türe offen, damit frische Luft in den Raum strömen konnte.
Aus dem Zellenanbau war röchelndes, gequältes Husten zu vernehmen. Und dann ein langgezogenes Stöhnen. Es riss Steve aus seiner gedanklichen Versunkenheit. Er betrat den Jail. Leise quietschte die Tür in den Angeln. In einer der Zellen saß Telly Bradlow zusammengekrümmt auf der Kante einer Pritsche und hielt sich den Kopf mit beiden Händen. Er ächzte und brabbelte unverständliche Worte vor sich hin, dann stöhnte er wieder gequält auf.
Unwillkürlich musste Steve grinsen. „Na, Telly, wieder von den Toten aufgewacht? Du lieber Himmel, du warst wieder einmal betrunken wie ein ganzer Indianerstamm.“
Vorsichtig drehte Telly Bradlow den Kopf. Seine Augen waren wässrig und gerötet, die Nase war großporig und bläulich verfärbt, wirr fielen ihm die grauen Haare in die runzlige Stirn, und den unteren Teil des Gesichts verdeckte ein verfilztes Bartgestrüpp.
„An meinem Brummschädel gemessen muss es wohl so gewesen sein, Steve“, murmelte der Oldtimer und seufzte. „Mein Kopf fühlt sich an wie ein leeres Whiskyfass, gegen das jemand ununterbrochen mit einem Paukenschlegel hämmert.“ Er holte rasselnd Luft, hüstelte, und versprach: „Nie wieder rühre ich einen Tropfen Brandy an, nie wieder. Und nun lassen Sie mich raus, Steve. Ich muss meinen Kopf ins Wasser halten. Und dann ...“
„... musst du wieder etwas gegen deinen Kater trinken, Telly, nicht wahr?“ Steve war wieder ernst geworden. Er nahm den Schlüssel vom Haken und schloss die Zellentür auf. „Es ist ein Teufelskreis, Telly. Mit dir nimmt es noch mal ein schlimmes Ende. Du solltest künftig tatsächlich die Finger von der Schnapsflasche lassen. Nun verschwinde, Telly.“
„Sie - Sie lassen mich tatsächlich gehen?“ Der Trinker war erstaunt. Seine Hände sanken nach unten. Ungläubig musterte er Steve. Und dann erhob er sich langsam, schwankte leicht und wiederholte: „Sie lassen mich wirklich frei, Steve? In der Vergangenheit haben Sie mich doch immer drei Tage lang in diesem Käfig schmoren lassen.“
„Und was hat es genützt?“, fragte Steve bitter. „Du bist raus aus dem Knast und hast sofort wieder zu saufen begonnen wie ein Loch. Man kann dich nicht mehr umerziehen, Telly. Bei dir ist Hopfen und Malz verloren. Und der Tag ist sicher nicht mehr fern, an dem ich dich irgendwo in einer Gasse finde, und du bist tot.“
Telly setzte sich in Bewegung. Er torkelte an Steve vorbei in das Office. Er war noch immer nicht richtig nüchtern. Er atmete keuchend, fast asthmatisch. Es war wohl so, dass er sich irgendwann totgetrunken haben würde. Sein ausgemergelter Körper hielt das Schindluder, das Telly mit ihm trieb, gewiss nicht mehr lange durch.
Steve blickte dem Oldtimer nach, als er über die Straße schwankte und sich bei einem Tränketrog niederkniete. Telly steckte seinen Kopf in das kalte Wasser. Als er wieder hochkam, schnaubte und prustete er. Dann wiederholte er die Prozedur. Und schließlich verschwand er in einer Hofeinfahrt.
Es war immer das selbe mit dem alten Trunkenbold, dem man in San Marcial nur mit Verachtung begegnete, den Steve aber irgendwie ins Herz geschlossen hatte. Er mochte den Alten, trotz allen Ärgers, den er laufend mit ihm hatte. Vielleicht war es auch Mitleid. Möglicherweise wusste Steve es selbst nicht so genau.
Steve nahm sein Gewehr, prüfte die Ladung, dann verließ auch er das Office.
Sein erster Weg führte ihn zu Jim Hopkins, dem Town Major. Missis Hopkins, eine rundliche Person mit freundlichem Gesicht, ließ ihn ins Haus. Der Bürgermeister saß noch beim Frühstück. Er erwiderte Steves Gruß, dann fragte er kauend: „Was führt Sie in aller Herrgottsfrühe schon zu mir, Marshal?“
Mrs. Hopkins bot Steve einen Stuhl an, dieser aber lehnte dankend ab und erwiderte an den Town Major gewandt: „Dick Wetham hat durch zwei Kumpane sein Kommen anmelden lassen. Er wurde gestern aus dem Zuchthaus entlassen, und heute schon wird er in San Marcial aufkreuzen.“
Sekundenlang vergaß Jim Hopkins zu kauen. Dann aber schluckte er, und es mutete an, als bliebe ihm der Bissen im Hals stecken. Die Augen quollen ihm aus den Höhlen, schließlich aber brach es über seine Lippen: „Dick Wetham kommt nach San Marcial?“
Entsetzt fixierte er Steve.
Dieser nickte. „Yeah. Und der Grund, der ihn hertreibt, ist allgemein bekannt. Er will sich an mir, und wahrscheinlich auch an der Stadt rächen.“
„Gott steh uns bei“, entrang es sich Mrs. Hopkins und sie musste sich setzen.
„Auf Gott können wir in diesem Fall nicht bauen, Mrs. Hopkins“, murmelte Steve. Und dann schaute er wieder den Bürgermeister an. „Die beiden Kerle, die gestern ankamen, waren sozusagen die Vorhut. Wetham wird weitere Burschen dieser Spezies mitbringen.“
„Nun haben wir den Salat“, knirschte Hopkins. „Hätten Sie damals die aufgebrachte Meute nicht zurückgehalten, Quincannon, dann wären wir das Problem Wetham längst los. So aber ...“
Steve versetzte achselzuckend und ohne auf den Vorwurf des Town Majors einzugehen: „Wir müssen eine Bürgerwehr auf die Beine zu stellen. Nur wenn die Stadt Wetham und seinem Verein gegenüber geschlossen auftritt, nötigt ihnen das Respekt ab und sie verschwinden wieder, weil sie ja Kopf und Kragen riskieren würden, ließen sie hier den Teufel von der Leine.“
Wie gebannt saß Jim Hopkins auf seinem Stuhl. „Bürgerwehr!“, echote er. Nur langsam setzte sich dieses Ansinnen in seinem Verstand durch.
„Ich denke an Männer wie Sie, Town Major. An Jack Bowden, den Sattler, Hank Chapman, den Schmied, Elliott Fuller vom ‘San Marcial Express’, an den Barbier, den Salooner, den Mietstallbesitzer und all die anderen, die in dieser Stadt leben und arbeiten und die ganz gewiss nicht wollen, dass hier Terror, Hass und Gewalt fußfassen.“
Der Bann fiel von Hopkins ab. Er wischte sich mit dem Handrücken über den Mund. Dann sagte er mit kratzender Stimme: „Man müsste mit den in Frage kommenden Männern reden. Aber man wird sie überzeugen müssen. Es sind keine Kämpfer. Sie haben Familien zu versorgen, sind rechtschaffen, redlich und arbeitsam - aber eben keine Kämpfernaturen. Reden Sie mit ihnen, Marshal. Versuchen Sie ihnen klarzumachen ...“
Steve unterbrach ihn schroff: „Es fehlt an der Zeit, um langwierige Überzeugungsarbeit zu leisten, Hopkins. Darum will ich, dass Sie unverzüglich eine Bürgerversammlung einberufen und zu den Männern dieser Stadt sprechen.“
Der Town Major rang die Hände.
„Und Sie sollten mit gutem Beispiel vorangehen und der erste Freiwillige in der Bürgerwehr sein, Town Major“, kam es von Steve. In seiner Stimme lag ein zwingender Unterton, sein Blick übte Druck auf den korpulenten Mann aus, dem er nicht standhalten konnte.
„Mein Mann geht auf die sechzig zu“, begehrte Mrs. Hopkins auf, und der freundliche Ausdruck ihres Gesichts war abweisender Verschlossenheit gewichen. „Außerdem ist er nicht der Gesündeste, und mit einer Waffe kann er schon gar nicht umgehen. Ziehen Sie ihn da nicht mit hinein, Marshal. Es ist nicht seine Aufgabe, in San Marcial eine Waffe zu schwingen.“
Steve sah sie betroffen, aber auch erstaunt an, dann kam der kalte Zorn und schließlich entfuhr es ihm: „Ich ziehe Ihren Mann in nichts hinein. Bei Gott, Ihr Mann war damals Obmann der Jury, die Wetham schuldig sprach. Es wird Wetham kaum interessieren, dass er zwischenzeitlich auf die sechzig zugeht und kränklich ist. Aber natürlich, Mrs. Hopkins. Die Waffe in dieser Town zu schwingen ist Job des Marshal. Er wird dafür bezahlt. Das wollten Sie doch zum Ausdruck bringen, nicht wahr?“
Ja, der Zorn hatte ihn übermannt, und er hatte schärfer gesprochen als er es eigentlich beabsichtigt hatte. Denn irgendwie konnte er die Frau verstehen. Auch Angie hatte Angst um ihn. Und weshalb sollte Mrs. Hopkins nicht ebenso an ihrem Mann hängen wie Angie an ihm?
Die Augen der Frau blitzten ihn kriegerisch an. „Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen, Quincannon!“, stieß sie hart und leidenschaftlich hervor. „Ihre Aufgabe ist es, in San Marcial dem Recht Geltung zu verschaffen. Nicht die Aufgabe meines Mannes, oder des Sattlers oder des Schmieds oder wessen auch immer.“
„Und wie stehen Sie dazu, Hopkins?“, kam Steves scharfe Frage.
„Nun - ja - ich weiß nicht“, stammelte der Town Major betreten, und es war wohl so, dass er sich in dieser Sekunde am liebsten in einem Mausloch verkrochen hätte. „Grundsätzlich hat meine Frau recht. Andererseits aber ...“ Seine Rechte wischte durch die Luft, er blinzelte, und als er weitersprach, versuchte er, seiner Stimme einen festen Ton zu verleihen, was jedoch deutlich misslang. Er krächzte: „Nun, man muss Wetham frühzeitig bremsen. Andernfalls gibt er sehr schnell den Ton an in unserer Stadt und ...“
„Bist du verrückt?“, fauchte ihn seine Gattin wütend an. Ihr Gesicht hatte sich gerötet, und sie wirkte ganz und gar nicht mehr gütig und wohlwollend. Sie erinnerte Steve jetzt an eine Furie, und er beobachtete, dass der Bürgermeister den Kopf zwischen die Schultern zog und regelrecht zusammenschrumpfte. Seine Lippen bewegten sich, als wollte er etwas sagen, aber seine Frau ließ ihn nicht zu Wort kommen. Sie kreischte: „Schweig! Wenn du nicht genug Rückgrat hast, das Ansinnen des Marshals abzulehnen, ich besitze es. Und ich sage nein, nein, nein und nochmals nein. Du wirst keine Waffe in die Hand nehmen und dich zusammenschießen lassen.“
Steves Mundwinkel sackten geringschätzig nach unten. Sicher, er konnte die Haltung der Frau verstehen, aber Hopkins Verhalten wollte er nicht akzeptieren. Er empfand plötzlich Verachtung. Kaum die Lippen bewegend gab er zu verstehen: „Wie ich schon sagte: Sie waren damals Obmann der Geschworenen, die den Schuldspruch fällten, Hopkins. Sie müssen Dick Wetham und seinen Anhang fürchten. Jetzt aber hat Ihre Frau ein Machtwort gesprochen. Ich denke, ich kann nicht mit Ihnen rechnen.“
„Ich - ich ... Meine Frau - sie will doch nur ...“
Steve winkte ab. Ohne ein weiteres Wort zu verlieren machte er abrupt kehrt, und ohne das Ehepaar noch eines Blickes zu würdigen verließ er den Raum.
Er begab sich zur Sattlerei. Jack Bowden hatte schon geöffnet und nahm gerade den Auftrag eines Mannes entgegen. Als der Marshal eintrat, hob Bowden die linke Braue und sagte: „Einen Augenblick, Marshal. Wallace bestellt gerade einige Sättel und Zaumzeuge und ...“
„Was ich zu sagen habe, geht Sie beide an, Gentleman“, knurrte Steve und er hatte noch immer gegen den Zorn anzukämpfen, der ihn seit seiner Vorsprache beim Town Major erfüllte. Darum lag auch wenig Freundlichkeit in seinem Tonfall. „Dick Wetham ist im Anmarsch auf San Marcial. Den Grund, der ihn hertreibt, brauche ich Ihnen sicherlich nicht zu nennen. Alleine bin ich aufgeschmissen. Denn Wetham kommt wahrscheinlich mit einer ganzen Horde schnellschießender Schufte. Ich brauche einige Männer, die bereit sind, Wetham entgegenzutreten.“
Jeff Wallace, der Mietstallbesitzer, starrte Steve an, als käme dieser geradewegs von einem fremden Stern. Jack Bowdens Miene verdüsterte sich schlagartig. Er nagte kurz an seiner Unterlippe, entschied sich im nächsten Moment und murmelte: „Ich glaube nicht, dass ich dazu bereit bin, Marshal. Wie käme ich auch dazu, meine Haut gegen einen Verbrecher wie Wetham zu Markte zu tragen? Sie tragen den Stern, Quincannon. Sie haben geschworen, gegen Unrecht und Gesetzeswidrigkeit einzutreten. Nicht die Stadt hat ihren Marshal zu schützen. Der Marshal hat die Stadt vor Terror und Gewalt zu bewahren. So ist es doch, oder gilt dieser Grundsatz nicht mehr?“
Steve kniff die Lippen zusammen. Die Worte des Sattlers waren wie Hammerschläge gefallen. Bowden hatte seinen Standpunkt klargemacht und keinen Zweifel darüber aufkommen lassen, dass er jedes Wort genauso meinte, wie er es gesprochen hatte.
Steves Blut geriet in Wallung. Der gehässige Ton in Jack Bowdens Stimme jagte eine Welle heißer Wut in ihm hoch, die er nur mit Mühe bezähmen konnte. Er erzitterte innerlich. Herzschlag und Puls beschleunigten sich, seine Wangenmuskulatur vibrierte. „Das war klar und deutlich“, presste er hervor, und es klang ausgesprochen herb. „Wie stehen Sie dazu, Wallace?“
Der Mietstallbesitzer druckste herum und vermied es, Steves herausfordernden Blick zu erwidern. Er hob die Schultern und meinte lahm: „Ich habe nie gelernt, mit einer Waffe umzugehen. Ich wäre Ihnen keine Hilfe, Marshal, eher ein Klotz am Bein. Außerdem glaube ich nicht, dass ich genug Mut aufbrächte, gegen ein Rudel Gunslinger anzutreten. Ich - ich war mein Leben lang kein Kämpfer und ...“
Wallace brach ab, vollführte einige unbeholfene, marionettenhafte Gesten mit beiden Händen und trat von einem Bein auf das andere.
Der Zorn verrauchte. Enttäuschung befiel Steve, und ein niederschmetterndes Gefühl von Verlorenheit gesellte sich hinzu. Allein die Nennung des Namens Dick Wetham genügte, um ihn zum einsamsten Menschen in San Marcial zu machen.
Er begann noch einmal, nachdem er tief durchgeatmet hatte, als könnte er sich so von dem immensen Druck befreien, der seine Brust plötzlich einzuengen schien: „Es geht nicht nur um mich, Leute. Wetham hat sicher nicht vergessen, dass man ihm in dieser Stadt am liebsten einen Strick geknüpft hätte. Er hat am Spieltisch einen Mann dieser Stadt erschossen, und wäre ich nicht dazwischen gegangen, würde man ihn kurzerhand aufgeknüpft haben. Waren nicht sogar Sie einer der vorlautesten Schreihälse, Wallace, die nach Richter Lynch brüllten?“
Steve legte den Kopf etwas schief und beobachtete die Reaktion des Mietstallbesitzers. Dieser zuckte zusammen wie unter einem Einschuss und sein Gesicht entfärbte sich bis in die Lippen. Mühsam schluckte er. Hilfesuchend verkrallte sich sein Blick an Jack Bowden. Dessen Brauen schoben sich düster zusammen, er stemmte sich mit beiden Armen auf die Ladentheke und ließ seine Stimme ertönen: „Was bezwecken Sie damit, Quincannon? Wollen Sie uns Angst einjagen, uns einschüchtern und verunsichern? Die Bürger San Marcials interessieren Wetham nicht. Er will Ihren Skalp. Mit Derartigem jedoch mussten Sie rechnen, als Sie damals den Stern nahmen. Oder nahmen sie das Abzeichen nur, um auf Kosten der Bürgerschaft ein sorgenfreies, ruhiges Leben zu führen?“
Steve schüttelte den Kopf. „Sie wissen genau, dass es nicht so ist“, versetzte er kratzig. „Ich will Ihnen auch nicht Angst machen. Ich will Sie nur warnen. Die Gesichter der Männer, die damals lautstark nach einem Strick schrien, hat Wetham wahrscheinlich ebenso wenig vergessen wie die Gesichter der Geschworenen, die ihn für schuldig befanden. O ja, ich trage den Stern, und ich werde alles tun, um die Stadt und ihre Bürger vor brutaler Gewalt, Demütigung und Terror zu schützen. Aber gegen eine Kugel bin auch ich nicht gefeit. Wetham wird alles daransetzen, mich zuerst aus dem Verkehr zu ziehen. Und wenn ihm das gelingt, dann seid ihr an der Reihe. Einen nach dem anderen von euch wird er sich vorknöpfen. Und niemand wird euch helfen.“
Er nickte den beiden zu, ließ sie seine Verachtung spüren, schwang herum und ging.
Sein nächster Weg führte zu Hank Chapman, dem Schmied ...
*
„Noch zwanzig Meilen bis San Marcial“, erklärte Dick Wetham triumphierend, wie von wilder, unbeherrschter Vorfreude erfüllt.
Sie lagerten an einem schmalen Creek. Die Gesichtszüge seiner drei Begleiter waren Spiegelbild von Verworfenheit und Niedertracht. Da war Bill Haggan, der früher schon mit Wetham geritten war. Haggan war um die vierzig, mittelgroß und untersetzt. Cole McPherson dagegen war groß und schlaksig. Tom Logan besaß vorstehende Zähne und schien ständig zu grinsen. Sein Blick war frettchenhaft unstet, in seinen Augen lauerte Verschlagenheit. Sie waren Ausdruck seiner niedrigen Gesinnung.
Jetzt sprangen seine dünnen Lippen auseinander, und er sprach mit seltsam scheppernder Stimme: „Zwanzig Meilen, yeah. Vier, fünf Stunden. Nur befürchte ich, dass mein Gaul bald schlapp macht. Er hat gestern schon gelahmt. Wahrscheinlich eine Entzündung - weiß der Teufel.“
Die Pferde standen beim Creek in einem Corral, den sie aus Lassos errichtet hatten und der zum Fluss hin offen war. Sie grasten oder knabberten an den jungen Trieben des Ufergestrüpps. Die Tiere waren verstaubt und abgetrieben. Die Banditen hatten ihnen lediglich die Sättel abgenommen und sie getränkt.
Dick Wetham rollte sich eine Zigarette und zündete sie an. Er warf den Tabakbeutel Bill Haggan zu. Nach der ersten Qualmwolke, die er ausstieß, sagte Wetham: „Einige Meilen vor San Marcial gibt es eine kleine Ranch. Sie gehört einem gewissen Wes Holliday.“ Er fuhr sich mit der Zungenspitze über die rissigen Lippen. „Auf der Ranch Hollidays besorgen wir dir einen frischen, gesunden Gaul, Tom. Wir reiten eben langsam. Smith und Boddam werden Quincannon einstweilen auf Sparflamme weichkochen. Er läuft uns nicht davon.“
„Vielleicht sollten Cole und ich ebenfalls vorausreiten, Dick“, mischte sich Bill Haggan ein und grinste. „Wir drängen Quincannon für dich langsam aber sicher in die Ecke, und wenn du ihm gegenübertrittst, wird er nur noch ein halbwertiges Nervenbündel sein, mit dem du leichtes Spiel hast. An seinem Beispiel kannst du dann einigen Gentleman San Marcials gleich vor Augen führen, was auf sie zukommt.“
„Yeah“, pflichtete Cole McPherson bei, „wir bereiten dir Quincannon für die Schlachtung vor wie einen Schafhammel für die Schlachtbank. Wir erschließen ihm sozusagen das Fegefeuer als Vorgeschmack auf die Hölle. Gönn uns den Spaß, Dick. Du willst doch kein Spielverderber sein.“
„Ganz und gar nicht“, lachte Wetham auf. „Reitet nach San Marcial. Tom und ich kommen nach, sobald wir für Tom ein frisches Pferd besorgt haben. Aber merkt euch: Quincannon gehört mir. Kocht ihn weich, zerstört ihn meinetwegen seelisch und moralisch, aber hebt ihn mir auf. Ist das klar?“
„Natürlich“, erwiderte McPherson und erhob sich mit einem Ruck.
„In Quincannons Haut möchte ich bei Gott nicht stecken“, frohlockte Tom Logan.
Eine Viertelstunde später verließen sie den Platz. Bill Haggan und McPherson ließen ihre Pferde traben. Dick Wetham und Tom Logan fielen mehr und mehr zurück.
Nach fünf Meilen blieb Logans Pferd einfach stehen. Es hatte den linken Vorderlauf angehoben, der Huf hing dicht über dem Boden. Das Tier prustete. Logan saß ab und zerrte an der Leine, das Pferd machte einen Schritt nach vorn und wieherte von tobenden Schmerzen gequält schrill auf.
Dick Wetham, der angehalten hatte, rief: „Es hat keinen Sinn, Tom. Der Gaul ist fertig. Erschieß ihn und steig bei mir auf. Die sieben oder acht Meilen bis zu der Ranch trägt mein Brauner uns beide.“
Logan zog den Colt und setzte dem Pferd die Mündung an den Kopf. Der Schuss peitschte. Wie vom Blitz getroffen brach das Tier zusammen, ein unkontrolliertes Zucken durchlief noch einmal den ganzen Tierleib, dann war das Pferd verendet.
„Lass Sattel und Zaumzeug hier“, ließ sich wieder Wethman vernehmen. „Die Dinge besorgen wir uns auch auf der Ranch.“
Logan zog sein Gewehr aus dem Scabbard, dann schwang er sich hinter Wetham auf dessen Braunen.
Es wurde heiß. Das Pferd, das zwei Männer tragen musste, röchelte und röhrte. Ein sachter Wind wirbelte den feinen Staub auf und trieb ihn in Spiralen vor sich her. Ringsum buckelten Hügel mit spärlicher Vegetation, hier und dort wuchteten zerklüftete Felsen zum Himmel. Unter den Pferdehufen knisterte rotbraun verbranntes Gras.
Sie brauchten fast drei Stunden, dann lag die Ranch vor ihnen im Sonnenglast. Wes Holliday hatte sie an einem Creek erbaut, dessen Wasser er auch für seine Rinder und die Bewässerung einiger Weizenfelder nutzte. Denn Holliday hatte längst erkannt, dass die Zukunft des Landes nicht in der Rinderzucht lag, sondern im Getreideanbau, in der Landwirtschaft also. Und er war bereit, langsam auf Farmwirtschaft umzustellen. Noch aber verfügte er über eine große Longhornherde, und so waren der Rancher und die Cowboys auf der Weide.
Wetham hatte das Pferd pariert. Er beobachtete die Ranch. Logan blickte über Wethams Schulter hinweg auf die Ansammlung von Gebäuden und Corrals, in denen sich einige Pferde tummelten. Ein Ranchhelp karrte Pferdemist aus einem Stall. Im Ranchhof scharrten einige Hühner oder badeten im Staub.
„Da haben wir ja, was wir brauchen“, tönte Tom Logan und rutschte auf dem Pferderücken herum, um bequemeren Sitz einzunehmen.
„Hüh!“ Mit einem Schenkeldruck trieb Wetham das Pferd wieder an. Mit hängendem Kopf trottete das erschöpfte Tier weiter. Wenig später ritten sie zwischen zwei Schuppen und gelangten in den Ranchhof.
Gerade kam wieder der Help mit einer Karre voll Mist aus dem Stall. Er sah die beiden Fremden absitzen und stellte die Schubkarre ab, wischte sich an der Hose den Schweiß von den Händen und musterte dann die beiden Männer, die auf ihn einen abgerissenen, mitgenommenen und wenig vertrauenserweckenden Eindruck machten.
Sattelsteif näherte sich Dick Wetham dem Ranchhelfer. Sein wacher Blick sprang zwischen Haupthaus und Mannschaftsunterkunft hin und her. Seine Rechte hing locker neben dem Knauf des Sechsschüssers.
Tom Logan war beim Pferd zurückgeblieben. Mit beiden Händen hielt er die Winchester schräg vor der Brust. Die Mündung wies zum Himmel. Logans Finger lagen im Repetierbügel.
„Hallo, Ranch“, grüßte Dick Wetham und grinste tückisch. „Scheint ja wenig los zu sein, hier.“
„Der Boss und die Mannschaft sind auf der Weide“, erklärte der Help, und das Misstrauen, das ihn erfüllte, was aus jedem Zug seines Gesichts zu lesen. „Hatten Sie Pech mit einem Ihrer Pferde?“
„Ja.“ Wetham hielt an. „Wir mussten den Gaul meines Gefährten erschießen. Auch mein Pferd ist ziemlich verausgabt. In den Corrals hier stehen prächtige und ausgeruhte Tiere herum. Was meinst du, mein Freund, wird dein Boss etwas dagegen haben, wenn wir uns zwei seiner Gäule nehmen?“
Das Grinsen des Banditen hatte sich verstärkt, aber es war ein Grinsen, das alles andere als freundlich war. Hinter der verzerrten Maske lauerten Verworfenheit und Erbarmungslosigkeit.
Der Help erwiderte nach kurzer Überlegung: „Ich kann Ihnen keine Pferde verkaufen, Stranger. Dazu bin ich nicht befugt. Entweder warten Sie bis zum Abend, bis der Boss auf die Ranch zurückkehrt, oder Sie und Ihr Gefährte müssen sich weiterhin mit einem Pferd behelfen.“
Wethams Grinsen war erstarrt. „Boyfriend“, murmelte er, indes sich über seiner Nasenwurzel eine steile Falte bildete, und es klang auf besondere Art drohend und unheilvoll. „Ich lebte früher mal in dieser Gegend und dein Boss ist ein alter Bekannter von mir. Er hat sicherlich nichts dagegen, wenn ich mir zwei Pferde mit seinem Brand borge. Er kann sie sich in San Marcial gerne wieder abholen.“
„Das kann jeder sagen“, entgegnete der Help trotzig. „Vielleicht versuchen Sie es bei Mrs. Holliday. Sie ist im Haus. Wenn Sie ein alter Bekannter des Boss sind, dann kennt Sie gewiss auch Mrs. Holliday, und wenn Sie Ihnen zwei Pferde verkauft oder leiht, dann ist das für mich okay. So aber ...“
Aus einem der Fenster des Haupthauses erklang eine weibliche Stimme: „Wer ist da gekommen, Toby? Fremde? Haben Sie Hunger und Durst?“
Wetham drehte den Kopf und sah Jane Holliday, die sich mit beiden Armen auf die Fensterbank stützte. „Wir sind nicht hungrig und durstig, Ma’am“, rief er. „Wir brauchen zwei Pferde und einmal Sattelzeug.“
Jane erkannte den Banditen nicht.
„Ohne meinen Mann kann ich Ihnen keine Pferde geben“, rief die Frau. „Aber Sie können gerne auf ihn warten. Vielleicht machen Sie sich bis zum Abend etwas nützlich hier auf der Ranch und ...“
„Kein Interesse!“, rief Wetham barsch. „Wir nehmen uns jetzt zwei Gäule.“ Er wandte sich dem Help zu. „Und wenn du an deinem Leben hängst, mein Freund, dann versuch nicht, es zu verhindern. Schaff lieber einen Sattel und Zaumzeug herbei. Pronto! Mach schon!“
Wetham gab Logan einen Wink. Dieser nahm das Lasso von Wethams Sattel und stieß sein Gewehr in die Deckenrolle. Steifbeinig stakste er zu einem der Corrals, indes er das Lasso für den Wurf vorbereitete.
„Das ist Diebstahl!“, erboste sich Jane Holliday. „In unserem Land werden Pferdediebe gehängt.“
„Dass man mit dem Strick in diesem Land schnell bei der Hand ist, weiß ich!“, schnarrte Wetham und fuhr den Help an: „Steh nicht herum wie angenagelt! Hol einen Sattel und Zaumzeug.“
Zögernd setzte sich der Bursche in Bewegung. Er fürchtete den Banditen und wagte keinen Widerspruch mehr. Er verschwand in der Düsternis eines Schuppens, in dem Sättel, Zaumzeuge, Campzeug und all die anderen Dinge lagerten, die draußen auf der Weide benötigt wurden.
Tom Logan ließ die Lassoschlinge über seinem Kopf kreisen, dann ließ er sie fliegen. Die Pferde liefen unruhig im Kreis. Hufschlag rumorte. Ab und zu erschallte ein Wiehern. Staub wallte dicht. Die Lassoschlinge schien sekundenlang über dem Kopf eines Rotfuchses zu stehen, dann fiel sie und die Schlinge zog sich zusammen. Logan zerrte das Pferd aus der Fence und nahm ihm das Lasso ab. Währenddessen löste Wetham schon die Sattelgurte und nahm seinem ausgepumpten Pferd erst den Sattel, dann das Kopfgeschirr ab. Der Ranchhelp schleppte einen alten, brüchigen Sattel und Zaumzeug ins Freie.
Mit gemischten Gefühlen beobachtete Jane Holliday, was sich abspielte. Sie hatte die Kerle eingeschätzt und wusste, dass es Banditen waren. Deshalb zog sie es vor, zu schweigen. Sie wollte nichts herausfordern. Plötzlich aber fiel es ihr wie Schuppen von den Augen, in ihre Züge schlich sich der Ausdruck eines namenlosen Erschreckens. „Wetham! Gütiger Gott ...“, entrang es sich ihr und ein Taumel befiel sie.
Der Help legte dem Rotfuchs den Sattel auf.
Logan fing ein zweites Pferd aus der Herde und führte es zu Wetham. Er half diesem, zu satteln. Dann nahm er sein Gewehr aus der Deckenrolle und begab sich zu dem Tier, das er für sich gefangen hatte. Als er sah, dass der Help noch immer nicht fertig war, versetzte er ihm einen brutalen Tritt. „Schlaf nicht ein!“, knurrte er böse.
Schließlich verließen sie die Ranch.
Der Help atmete aus. Die Angst, die sein Herz umkrallt hatte, legte sich. Die beiden Banditen schauten sich nicht mehr um. Als sie weit genug entfernt waren, rief Jane Holliday mit zittriger Stimme: „Reite sofort hinaus und unterrichte meinen Mann, Toby. Reite wie der Wind, und sage ihm, dass Dick Wetham zurückgekehrt ist!“
Nur ganz langsam bekam die Rancherin die Rebellion in ihrem Innersten wieder in den Griff. Mit einem zitternden Atemzug wandte sie sich um und trat vom Fenster weg.
*
Im Imperial Saloon saßen an einem Tisch der Town Major, der Sattler, der Schmied, der Mietstallbesitzer und Dave Carter, der Barbier. Es war kurz nach elf Uhr. Sie steckten die Köpfe zusammen und tuschelten miteinander.
An der Theke lehnte Telly Bradlow, der Stadtsäufer. Soeben hatte er den Besen weggestellt, mit dem er den Saloon fegte. Und nun stand ein doppelter Whisky vor ihm - der Lohn für seine Arbeit.
Ihn interessierten die fünf Männer am Tisch in der hintersten Ecke nicht. Denn er wusste, dass sie von ihm nichts hielten, dass sie ihn verachteten und in der Stadt lediglich duldeten, aber nicht akzeptierten. Er starrte seinen Whisky an, einen gierigen Ausdruck in den geröteten Augen, schob langsam die zitternde Rechte auf das Glas zu, zog sie aber wieder zurück und schloss die Augen, als konnte er den Anblick des gefüllten Glases nicht mehr ertragen. Sucht und Gier fochten in ihm einen heftigen Kampf gegen die Vernunft aus.
Von dem Tisch an der hinteren Stirnwand sickerte verschwommenes Geraune heran.
„Quincannon muss aus San Marcial verschwinden!“, stellte Jim Hopkins, der Town Major, soeben mit leiser, aber eindringlicher Stimme fest. „Wir müssen ihn dazu bewegen, innerhalb der nächsten zwei Stunden der Stadt den Rücken zu kehren. Wethams Hass konzentriert sich in allererster Linie auf ihn. Wir sind nur Randfiguren. Wetham wird die Stadt unverzüglich wieder verlassen, um sich auf Quincannons Fährte zu heften, wenn er erfährt, dass Quincannon fort ist und nur einen knappen Vorsprung hat.“
„Ja, verdammt!“, pflichtete Hank Chapman, der Schmied bei. „Hätte Quincannon uns damals freie Hand gelassen, wäre Wetham längst tot und wir bräuchten heute keinen Gedanken mehr seinetwegen verschwenden. Die Frage ist nur, ob Wetham auch so reagiert, wie wir es erwarten, falls Quincannon tatsächlich verschwindet.“
Sein letzter Satz klang zweifelnd und sorgenvoll.
„Dieses Risiko müssen wir auf uns nehmen“, entgegnete der Town Major.
„Und warum treten wir Wetham nicht geschlossen entgegen?“, fragte Bowden.
„Willst du morgen Abend tot sein?“, herrschte ihn der Town Major an.
Bowden kniff die Lippen zusammen und schwieg.
„Wer übernimmt es, mit dem Marshal zu reden?“, fragte Dave Carter.
„Ich lasse ihn zu mir in die City Hall zitieren“, knurrte Hopkins. „Dort werden wir alle anwesend sein, um ihm unseren Standpunkt zu verdeutlichen. Und da wir in meinem Büro unter uns sind, können wir unserer Forderung auch Nachdruck verleihen.“
Grimmig schaute er von einem zum anderen.
Chapman massierte sich mit Daumen und Zeigefinger den Nasenrücken. Es mutete an, als plagten ihn plötzlich Zweifel. Und er sprach sie auch aus: „Wenn wir Quincannon verjagen, verjagen wir auch Angie. Und das wird ihrem Vater, dem alten Eisenfresser, ganz und gar nicht schmecken. Wenn er nur nicht verrückt spielt und mit seiner Mannschaft in die Stadt kommt, um uns die heilige Mannesfurcht einzujagen.“
„Wes Holliday wird sich raushalten“, grunzte der Town Major. „Vielleicht begeben sich der Marshal und Angie sogar zu ihm. Er kann sie ja beschützen mit seiner Crew. Auf der Bar-H werden sich Wetham und seine Komplizen blutige Nasen holen.“
Der Sattler raunte: „In Hollidays Augen ist Quincannon ein nichtsnutziger Revolverschwinger, und er hat ihn nie als Schwiegersohn akzeptiert. Holliday wollte, dass Angie einen Rindermann heiratet. Ich glaube fast, er hasst Ouincannon. Holliday hat damals sogar mit seiner Tochter gebrochen, als sie Quincannon gegen seinen erklärten Willen heiratete. Wenn Wetham also Angie zur Witwe macht, so wird dies Holliday eher wie eine Fügung des Schicksals denn als Unglück empfinden.“
Er lachte kehlig nach seinen letzten Worten.
Schritte polterten auf dem Vorbau, und dann flog die Schwingtür auf. In diesem Moment trank Telly Bradlow seinen Whisky. Er hatte den Kopf weit in den Nacken gelegt und ließ die scharfe Flüssigkeit wie ein Verdurstender in sich hineinlaufen.
Zwei Männer betraten den Inn. Es waren Ben Smith und Stuart Boddam. Sie schritten zum Tresen. Telly stellte sein Glas ab, nachdem der letzte Tropfen über seine Lippen war.
Am Tisch der Bürger wurde es still.
Sie fühlten sich nicht mehr wohl in ihrer Haut. Ihre Gesichter verkrampften sich maskenhaft und verrieten Unruhe. Sie duckten sich wie unter einer unsichtbaren Knute.
Auf Jim Hopkins Stirn begannen Schweißperlen zu glitzern. Als er sein Bier austrank, zitterte seine Hand. Er wagte nicht, Smith und Boddam anzusehen, denn er fürchtete, sein Blick könnte sie herausfordern.
Smith und Boddam bauten sich am Ende der Theke auf. Der Salooner verzog wenig begeistert den Mund, begab sich aber zu den beiden und nahm ihre Bestellung entgegen.
Der Town Major warf ein Fünfcentstück für sein Bier auf den Tisch und erhob sich. „Seid bis in einer Viertelstunde in meinem Büro in der City Hall“, wies er die anderen flüsternd an, dann schritt er zum Ausgang.
Auch Bowden, Chapman, Wallace und Carter standen auf. Sie legten gleichfalls das Geld für ihre Zeche auf den Tisch. Die beiden Banditen am Schanktisch musterten sie hämisch. Telly bettelte krächzend: „Noch einen, Slim - einen kleinen nur. Als Vorschuss dafür, dass ich morgen wieder den Schankraum kehre.“
Slim, der zwei Biere für die Fremden einschenkte, knurrte: „Nein, Ich will keinen Ärger mit Quincannon.“
Ben Smith kicherte widerlich, als der Name Quincannon fiel. Stuart Boddam grinste herablassend und nuschelte: „Wie kann man Ärger kriegen mit einem, der schon so gut wie tot ist?“
Die Bürger strebten hastig zur Tür und drängten schließlich hinaus. Befreit atmeten sie auf, als sie auf dem Vorbau standen. Aus dem Inn erklang die schnarrende Stimme eines der Banditen: „Gib dem Oldtimer eine Flasche, Keeper. Ich spendiere sie ihm.“
„Bis später“, sagte Jack Bowden, der Sattler, und eilte davon.
Auch die anderen verliefen sich.
Im Saloon sagte Stuart Boddam: „Okay, Alter, diese Flasche gehört dir. Aber ich schenke sie dir nicht. Du wirst uns dafür etwas die Zeit vertreiben. Kannst du irgendein Tier imitieren? Einen Hund vielleicht?“
Telly schluckte, dann bellte er einigemale. Ben Smith lachte schallend. Boddam aber winkte ab und knurrte: „Kein Hund steht auf zwei Beinen, wenn er bellt. Also runter auf alle viere, Oldman, und dann zeig uns, wie gut du einen Hund nachahmen kannst. Der Preis dafür ist ein Schluck aus der Flasche.“
Der Salooner schloss die Augen, um nicht sehen zu müssen, wie sie den Alten demütigten. Und als Telly über den Saloonboden kroch und bellte, versetzte ihm das einen Stich ...
*
Steve verließ die Schreinerei. Er war zutiefst deprimiert. Auch hier hatte er sich eine Abfuhr geholt. Den Schreiner bekam er gar nicht zu Gesicht. Dessen Gattin wimmelte ihn ab, indem sie erklärte, dass ihr Mann krank sei und im Bett liege.
Die Nachricht, dass er Hilfe suchte, war schneller gewesen als er. Und zwischenzeitlich würde sie die letzten Häuser der Stadt erreicht haben. Er hatte es satt, abgewiesen oder angelogen zu werden. Steve gab auf. Bitter sagte er sich, dass sich Angies Prophezeiung zu hundert Prozent erfüllt hatte. Keiner in ganz San Marcial war bereit, ihm gegen eine Horde Banditen beizustehen. Er war enttäuscht. Seine Hoffnung, Hilfe zu finden, war verweht, zurückgeblieben waren nur die Aussicht auf eine finstere Zukunft und ein tiefsitzendes Gefühl von Resignation, Verlorenheit und Sorge, vielleicht sogar Angst.
Unschlüssig stand Steve am Straßenrand. Trügerische Ruhe umgab ihn. Ein ganzes Stück weiter sah er Hopkins, Bowden, Chapman, Wallace und Carter den Imperial Saloon verlassen. Sie gingen auseinander. Carter kam die Straße herunter und musste an Steve vorbei. Als er aber den Marshal bemerkte, wechselte er schnell auf die andere Straßenseite. Steve schluckte trocken. Lahm, als wäre er innerhalb der letzten Stunden um Jahre gealtert, setzte er sich in Bewegung. Es ging auf Mittag zu und Angie würde wie jeden Tag für ihn gekocht haben. Außerdem brauchte er jetzt jemand, einen Menschen, mit dem er sprechen und an dem er sich wieder aufrichten konnte.
Als er den Saloon passierte, vernahm er heiseres Gackern. Als wäre er gegen ein unsichtbares Hindernis gelaufen blieb Steve abrupt stehen. Das Gackern erklang noch einige Male, und dann kam brüllendes Gelächter auf, jemand klatschte sich mit der flachen Hand auf den Oberschenkel, und dann rief ein Mann: „Prächtig, Alter. Du könntest im Zirkus auftreten. Komm her und hol dir deine Belohnung ab. Und dann ahmst du einen Ziegenbock nach. Hahaha ...“
Nichts mehr hielt Steve auf seinem Platz. Er schob all die quälenden Gedanken zur Seite. Mit langen Schritten strebte er dem Inn zu. Unwillkürlich lüftete er etwas den Colt im Halfter. Das Gewehr trug er in der linken Hand. Sein Gesicht mutete an wie aus Granit gemeißelt.
Auf dem Vorbau bewegte Steve sich leise. Die Planken knarrten kaum unter seinem Gewicht. Er blickte über die Batwings der Schwingtür in den Schankraum. Telly trank gerade mit gierigen Zügen von dem Brandy. Am Tresen lehnten die beiden Fremden, deren Bekanntschaft er schon gemacht hatte, und einer von ihnen entwand nun Telly die Flasche. Schnaps rann in Tellys verfilzten Bart und tropfte auf sein verschmutztes Hemd.
„Und nun den Ziegenbock!“, forderte Stuart Boddam.
Da drückte Steve mit seinem Körper die Türflügel auseinander und glitt in den Schankraum. Die Pendel schlugen knarrend hinter ihm. Steve hielt das Gewehr jetzt mit beiden Händen. Smith und Boddam drehten sich ihm zu und nahmen Front zu ihm ein.
„Schluss damit!“, peitschte Steves metallisches Organ. Er ließ die beiden Banditen nicht aus den Augen. Stuart Boddam ließ die halbleere Brandyflasche fallen. Sie rollte über den Boden und der Inhalt ergoss sich glucksend auf die Dielen. Trotz seiner Trunkenheit bewegte sich Telly blitzschnell. Er folgte der Flasche auf allen vieren zwischen Tisch- und Stuhlbeine, um zu retten, was noch zu retten war.
„Du verdirbst uns den Spaß, Marshal“, stieß Ben Smith zwischen den Zähnen hervor. Seine Hand tastete in die Nähe des Revolvergriffs. Leicht geduckt und breitbeinig stand er vor dem Tresen.
„Ihr seid niederträchtige, hundsgemeine Schufte!“, sagte Steve klirrend, aber ruhig - gefährlich ruhig. Langsam ging er weiter, und die Banditen spürten den Anprall von Entschlossenheit und Härte, die von ihm ausgingen. „Na schön. Ihr hattet euren Spaß. Allerdings dulde ich derlei Späße in dieser Stadt nicht. Ihr habt die Würde eines alten Mannes mit Füßen getreten, habt seine Sucht schamlos ausgenutzt und ihn euch gefügig gemacht. Das ist schäbig. Auf Kerle wie euch können wir verzichten in dieser Stadt. Darum verschwindet. Ich gebe euch zwanzig Minuten, in denen ihr eure Siebensachen aus dem Hotel holen und eure Pferde satteln könnt. Treffe ich euch nach Ablauf der Zeit noch innerhalb der Stadtgrenzen an, verhafte ich euch und ihr landet hinter Gittern.“
Die Abscheu vor den beiden stand Steve ins Gesicht geschrieben. Er kochte aber auch vor Zorn und hatte Mühe, die Ruhe zu bewahren und es den beiden Strolchen nicht mit dem Gewehrlauf zu besorgen. Überhaupt war seine Stimmung auf dem Nullpunkt angelangt, nach allem, was er an diesem Tag erlebt hatte. Und das machte ihn unberechenbar und explosiv.
Ben Smith schürzte die Lippen. „Wie lautet die Anklage, Quincannon?“, fragte er hämisch. „Welche gesetzeswidrige Tat wirfst du uns vor? Mit welcher Begründung willst du uns aus der Stadt weisen? Weil der Oldtimer für uns den Kasper mimte? Oder weil dir unsere Nasenspitzen nicht gefallen? Oder weil du langsam durchdrehst vor Angst?“
Steve biss die Zähne zusammen. Er schielte zu Telly hin, der am Boden hockte und die Flasche mit einem Rest Brandy mit beiden Händen umklammerte. Telly trank jedoch nicht. Staunend fixierte er Steve. Und in seinen umnebelten Verstand sickerte nach und nach die Erkenntnis, wie sehr er sich des Brandys wegen erniedrigt hatte und wie sehr er von den beiden Kerlen gedemütigt worden war.
Steve sagte brechend: „Ich bin euch Halunken keine Rechenschaft für mein Handeln schuldig. Ich gab euch zwanzig Minuten Zeit, und davon sind gut und gerne drei Minuten abgelaufen. Ihr müsst euch sputen, wenn ihr nicht gesiebte Luft atmen wollt.“
Von Boddam kam ein höhnisches Lachen, dann versetzte der Bandit: „Deine Absicht ist leicht zu durchschauen, Quincannon. Du willst uns aus der Reserve locken, uns reizen. Du suchst einen Grund, um uns beide aus dem Verkehr ziehen zu können, denn wenn Dick ankommt, müsstest du dich zunächst auf zwei Gegner weniger einstellen, und damit vergrößern sich deine Chancen. Dir geht es gar nicht darum, dass wir die Stadt verlassen. Denn du weißt, dass wir noch heute wieder zurückkämen, und du hättest nichts gewonnen. Doch du bist auf dem Holzweg, Marshal. Wir lassen uns zu nichts Unbedachtem hinreißen, das dir eine Handhabe gegen uns gäbe. Wegen der Sache mit dem Säufer kannst du uns nicht einsperren. Es sieht ganz so aus, als kämpftest du im Moment gegen Windmühlenflügel.“
Da wankte Telly auf die Beine. Er stellte die Flasche auf einen Tisch und lallte mit schwerer Zunge: „Ihr Hundesöhne habt heute den letzten Rest von Stolz in mir zerstört. Dafür soll euch der Himmel strafen. Mein Gott, was bin ich doch für ein charakterloser Haufen Dreck, Marshal. Heute morgen hatte ich noch den Vorsatz gefasst, nie mehr zu trinken. Und nun ...“
Ben Smith lachte zynisch auf.
Bei Steve brannten die Sicherungen durch. Ehe der Bandit sich versah, war er bei ihm. Die Winchester schwang herum, der Kolben krachte seitlich gegen Smith’ Kinn und der Schlag warf den Strolch halb über den Tresen. Blut sickerte aus einer Platzwunde. Stuart Boddam war für den Bruchteil einer Sekunde gebannt, er wurde von Steves blitzartiger Aktion regelrecht überrollt, dann aber schüttelte er die Lähmung ab und stieß sich ab. Er sprang Steve an wie ein Raubtier ...
*
Steve sah Boddam auf sich zufliegen. Instinktiv wich er zur Seite aus, er konnte aber nicht verhindern, dass der Bandit gegen ihn prallte und ihm mit der linken Hand fast die Weste herunterriss. Sie rutschte ihm über den rechten Oberarm und machte ihn mit rechts für die Spanne einiger Lidschläge lang bewegungsunfähig. Diese Zeit reichte für Boddam, Steve zweimal hart zu treffen. Steves Kopf wurde von einer Schulterseite auf die andere gerissen, und Steve entrang sich ein dumpfer, jäh abreißender Ton, vor seinem Blick versank die Welt in wogenden Nebeln.
Doch dann hatte er seinen Arm befreit. Blindlings schlug er mit dem Gewehr nach Boddam, er spürte Widerstand und vernahm einen schmerzhaften Aufschrei, und die Nebelschleier vor seinen Augen lichteten sich. Steve sah Boddam zurücktaumeln, und er nahm wahr, dass der Bandit am Revolver nestelte, um ihn aus dem Futteral zu bekommen.
Steve setzte nach. Da krachte etwas auf seinen Rücken, Arme umschlangen ihn von hinten und er wurde zurückgerissen. Ben Smith hatte den Schlag mit dem Gewehrkolben überwunden und mischte nun mit. Sein Knie knallte in Steves Rücken, Smith’ linker Arm lag jetzt um seinen Hals und würgte ihn, und er wurde über Smith’ Knie mit unwiderstehlicher Gewalt nach hinten gebogen. In seiner Wirbelsäule begann stechender Schmerz zu toben.
Steves Lippen klafften auseinander, er schnappte nach Luft, ein Röcheln kämpfte sich in seiner Brust hoch und brach aus seiner Kehle. Vor ihm tauchte Boddam auf. Die Idee, sich mit dem Colt gegen den Marshal zur Wehr zu setzen, hatte er sausen lassen. Er schickte seine Faust auf die Reise, und sie bohrte sich in Steves Magengrube. Der Aufschrei voll Not erstickte bei Steve im Ansatz. Der Schlag presste ihm die Luft aus den Lungen. In sein Gehirn schlich sich schwindelerregende Benommenheit, und in seinen Gedärmen begann Übelkeit zu wühlen.
Ein Schlag ertönte, es klirrte, Scherben regneten auf die Dielen, im nächsten Moment löste sich der Klammergriff um Steves Hals, der Druck des Knies von seinem Rückgrat verschwand, Steve verlor das Gleichgewicht und stürzte schwer auf den Rücken. Boddams Schwinger pfiff ins Leere, und von der Wucht des Schlages getrieben stolperte Boddam nach vorn, blieb mit dem Fuß an Steve hängen und flog auf den Bauch.
Am Schanktisch stand Telly. Er hielt noch den Rest des Bierglases, das er Ben Smith auf den Kopf geschmettert hatte, in der Hand. Nur noch der Boden und ein paar scharfrandige Zacken waren übrig. Smith war gegen den Tresen getaumelt, hielt sich mit einer Hand den Kopf, mit der anderen klammerte er sich an die Messingstange, die am oberen Thekenrand entlanglief.
Steve und Boddam kamen gleichzeitig hoch. Noch immer hielt Steve das Gewehr fest. Er hatte Benommenheit und Übelkeit überwunden, seine Lungen waren mit frischem Sauerstoff gefüllt, das Kreuz schmerzte ihm zwar noch, aber das war erträglich.
„Du kleine, betrunkene Ratte!“, knischte Ben Smith, als er wieder zu sich gefunden hatte. Er nahm die Hand nach unten und starrte auf seine Fingerkuppen, an denen Blut von einer Schnittwunde klebte. „Dafür schicke ich dich zur Hölle!“
Aus den Augenwinkeln sah Steve, dass Boddam Anstalten machte, sich wieder auf ihn zu werfen. Sein rechter Arm mit dem Gewehr säbelte herum, der stählerne Lauf knallte gegen Boddams Hals und schickte ihn zu Boden. Und in dem Moment, als Smith den Colt auf Telly richtete, schlug Steve auf den Banditen die Winchester an. Mit hartem Schnappen lud er durch. Smith versteifte.
„Fallen lassen“, befahl Steve, und seine Stimme klang wie zerspringendes Eis. „Danke, Telly.“
Smith ließ den Colt einmal um den Zeigefinger rotieren und stieß ihn ins Halfter. Angesichts der schussbereiten Winchester in den Fäusten des Marshals war es das Klügste. Wenn es um sein eigenes Fell ging, war der Bandit - wie fast alle Kerle seines Schlages -, ausgesprochen sensibel.