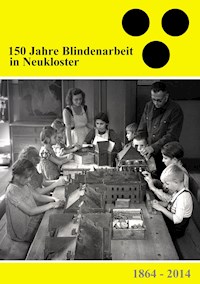
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Von der Landesblindenanstalt Mecklenburgs zum modernen multifunktionalen Rehabilitationszentrum: die Chronik umschreibt nicht nur die Geschichte der Einrichtung von den Anfängen bis zur Gegenwart, sondern liefert auch neue Aspekte zur Orts- und Regionalgeschichte sowie zur Geschichte des Blindenwesens allgemein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 92
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor bedankt sich für die aktive Mithilfe bei der Erstellung dieses Buches insbesondere bei:
Friederike BeyerDeutsches BlindenmuseumBerlin
Natalia KremerLübeck
Susanne SiemsDeutsche Zentralbücherei für BlindeLeipzig
Heinz-Georg SchlömerVerein für BlindenwohlfahrtNeukloster
Simone SchulzStadtgeschichtliches MuseumWismar
Ellen TaubnerDeutsche BlindenstudienanstaltMarburg
„150-Jahre Blindenarbeit in Neukloster“
Der Verein Blindenwohlfahrt Neukloster e.V. kann 2014 auf eine 150jährige Tradition zurückblicken.
Zu diesem Jubiläum möchte ich Ihnen ganz herzlich gratulieren.
Der Verein ist zudem einer der Gründungsmitglieder des Paritätischen Mecklenburg-Vorpommern. Damit verbindet uns seit 1990 auf besondere Weise auch ein Weg in der gemeinsamen Verbandsgeschichte. Von Beginn an orientieren sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrem täglichen Handeln an dem Grundsatz „Die Würde des Menschen ist unantastbar“. Die Leitlinien des Vereins Blindenwohlfahrt verdeutlichen, dass die behinderten Menschen mit Respekt und Wertschätzung auf ihren Lebensweg begleitet werden.
Die aktive Gestaltung der Wohn- und Lebenssituation vor allem älterer Menschen gewinnt zunehmend an Bedeutung. Dabei werden die individuellen Bedürfnisse, Gewohnheiten und Interessen der zu Betreuenden geachtet. Im Vordergrund steht der Erhalt der Fähigkeiten und Fertigkeiten für ein möglichst selbstbestimmtes Leben.
In der Werkstatt für Menschen mit Behinderungen werden anspruchsvolle Tätigkeitsfelder angeboten wie z.B. Korbflechterei. Polsterei und industrielle Fertigungen. Es wird das Ziel verfolgt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu integrieren. Dies ist keine leichte Aufgabe, zumal die Mehrzahl blinde, sehbehinderte oder mehrfach behinderte Menschen sind. Der Verein sorgt zudem dafür, dass die Menschen mit Behinderungen auch im Bereich des Wohnens und der Freizeitgestaltung ein hohes Maß der Selbständigkeit und Selbstbestimmung verwirklichen können.
In allen Arbeits- und Lebensbereichen der Angebote des Vereins Blindenwohlfahrt Neukloster e.V. ist ersichtlich, dass Menschen mit Behinderungen im Arbeitsleben oder im Seniorenalter umfängliche Betreuung, Förderung und Pflege erhalten.
Dafür möchte Ihnen der PARITÄTISCHE Wohlfahrtsverband Mecklenburg-Vorpommern als Ihr Dachverband Dank und Anerkennung aussprechen.
Friedrich Wilhelm BluschkeVorsitzenderParitätischer Mecklenburg-Vorpommern
Inhaltsverzeichnis
Grusswort
Warum Neukloster? Die Vorgeschichte
1860
1858
1863
1864
1870
1874
1879
1881
1882
1884/85
1900/1901
1901
1909/10
1911
1912
1913
1919
1923
1925
1926
1932
1934
1936
1943
1950
1956
1957
1963
1967
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975/76
1978
1983
1988
2005
2006
Nachwort
GRUSSWORT
Der Blinden- und Sehbehinderten-Verein Mecklenburg-Vorpommern (BSVMV) e.V. möchte Ihnen zum 150. Jahrestag Ihres Bestehens die herzlichsten Glückwünsche übermitteln und für die zukünftige Arbeit weiterhin viel Erfolg wünschen.
Trotz aller Wechselfälle der Geschichte hat sich Ihre Einrichtung einen Namen mit gutem Klang auf dem Gebiet der beruflichen Bildung sehbehinderter und blinder Menschen geschaffen. Darauf dürfen Sie mit Recht sehr stolz sein. Das hohe Ansehen Ihrer Institution reicht weit über die Grenzen Mecklenburg-Vorpommerns hinaus und findet dort höchste Anerkennung! Auch unser Verein, der BSVMV e.V. weiß Ihr Engagement zu schätzen. Wir konnten vor acht Jahren das Projekt „Berufliche und gesellschaftliche Integration und Teilhabe” (BGIT) im Rahmen des Europäischen Sozialfonds platzieren. In diesem Rahmen entwickelte sich eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Reha-Zentrum Neukloster und unserem Landesverein. Als Ergebnis dieses gemeinsamen Wirkens können wir auf berufliche Qualifizierung und Vermittlung sehbehinderter und blinder Menschen auf dem Arbeitsmarkt zurückblicken. Dies ist keineswegs selbstverständlich. Nach wie vor gibt es Schwierigkeiten und Widerstände, die gemeinsam bewältigt werden müssen. Um so mehr sind alle Be-Bemühungen, die sich in den Dienst dieser Aufgabe stellen, nicht hoch genug zu bewerten.
Der Blinden- und Sehbehinderten-Verein M-V e.V. wird sich zukünftig um noch engere Kontakte zu Ihnen im Sinne der gemeinsamen Aufgaben und Herausforderungen bemühen, um betroffenen Menschen den Weg in eine erfolgreiche Zukunft zu gewährleisten. Für die Erreichung dieses Zieles sind so starke Partner, wie das Reha-Zentrum Neukloster einfach unerlässlich.
Der BSVMV e.V. wünscht Ihnen daher einen erfolgreichen und beispielgebenden Weg in die weitere Zukunft!
Wolf-Hagen Etter
Landesvorsitzender
Blinden- und Sehbehinderten-Verein
Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Neukloster wäre bestimmt nicht das Neukloster das wir heute kennen, wenn es den Beginn der Blindenarbeit vor 150 Jahren nicht gegeben hätte. Nach der Klostergründung vor ca. 795 Jahren und der Verlegung des Großherzoglichen Lehrerseminars von Ludwigslust nach Neukloster in der 2. Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts, war der Aufbau einer professionellen Blindenwohlfahrt, der dritte kräftige Entwicklungsschub den das Gemeinwesen Neukloster, erhalten hat. In der Folge entwickelte sich aus dem Dorf Neukloster die Ackerbürgerstadt Neukloster. Die Blindenarbeit entwickelte sich stetig. Über den ganzen Zeitraum der 150 Jahre, in allen geschichtlichen Perioden in dieser Zeit, auch in den schwierigsten, war professionelle Blindenarbeit Merkmal dieser Stadt. Und so ist es auch heute und wird es hoffentlich weitere 150 Jahre bleiben.
Wie bei allen gesellschaftlichen Dingen, sind es in erster Linie Menschen, die dafür Verantwortung tragen ob etwas gedeiht oder nicht. Das war so und das ist so. Deshalb zolle ich den Beteiligten dieser Erfolgsgeschichte „Blindenarbeit in Neukloster” für Ihre Leistungen allergrößten Respekt.
Den aktuellen und auch den zukünftigen Akteuren der Blindenarbeit, wünsche ich viel, viel Erfolg in der Weiterführung des Geleisteten.
Warum Neukloster?Die Vorgeschichte
Schauen wir zurück zum Anfang des Jahres 1844. Nach dem Tod von Pastor Haupt 1843 ist die Neuklosteraner Pfarrstelle vakant. Bewerber gibt es einige, doch der Posten wird mit einem Mann besetzt, der diesem Amt wegen seines hohen Alters - er ist 71 - eigentlich gar nicht mehr gewachsen ist. Aber Johann Christoph Kliefoth ist nicht irgendwer, und extra für ihn wird in Neukloster die Stelle eines Hilfspredigers geschaffen.
Kliefoth hat im Leben eigentlich alles erreicht. Er ist der einflussreichste Kirchenmann in Mecklenburg – auf seinen Rat hörten die Großherzöge Friedrich Franz I. und Paul Friedrich. Dabei begann seine Lebensgeschichte in ganz anderen Verhältnissen: 1772 wurde er in Mestlin als Sohn eines Schäfers geboren. Sein Vater stieg bei Junker Otto von Qualen zum Gutsinspektor in Lancken bei Parchim auf. Dies ermöglichte dem Sohn den Besuch der Universität Rostock ab Sommer 1791. Am 14. Dezember 1806 wurde Johann Kliefoth Pastor in Körchow bei Wittenburg. In gefestigter Stellung heiratete er am 3. März 1809 seine Jugendliebe Luise Marie Henriette Hoffmann, welche ihm bereits am 18. Januar 1810 den ersten Sohn Theodor Friedrich Dethlof gebar.
Elf weitere Kinder folgten. In der Regel wurden die Jungen Pastoren, die Mädchen heirateten einen solchen. Die Kinder wurden streng erzogen und mussten beizeiten körperlich arbeiten. Unter anderem waren sie für die Kliefothschen Bienen zuständig. Unterrichtet wurden sie vom Vater, von der Großmutter lernten sie französisch. Nach dem Besuch des Gymnasiums in Schwerin ab 1826 schickte Pastor Kliefoth seinen ältesten Sohn Theodor 1829 zum Studium nach Berlin, im Jahr darauf studiert er wie sein Vater in Rostock Theologie.
Der Vater drängte den Sohn früh, sein eigenes Geld zu verdienen. Eine Hauslehrerstelle bei einer mecklenburgischen Adelsfamilie ist für Theodor das Sprungbrett an den Hof nach Ludwigslust. Dort unterrichtet er 1833 den Prinzen Wilhelm. Der Erfolg des Sohnes hilft auch dem Vater. Am 10. August 1834 wir dieser zum Superintendenten ernannt. Als Großherzog Paul Friedrich seinen Sohn Friedrich Franz II. 1837 nach Dresden zum Studium schickt, stellt er diesem Theodor Kliefoth als Privatlehrer zur Seite. 1840 aus Dresden zurück, heiratet Theodor die Tochter des Oberhofpredigers Walter in Ludwigslust und übernimmt erste Funktionen seines Vaters. Während Johann Kliefoth konventionell eingestellt ist, möchte sein Sohn die Kirche reformieren. Mit Erfolg, Ende 1841 tritt die von ihm initiierte neue Synodalordnung in Kraft. Als 1842 Theodors fürstlicher Freund Friedrich Franz II. in Schwerin die Regierung antritt, stehen den Kliefoths nun gänzlich alle Türen offen. Vater Johann machte den Platz frei für seinen Sohn Theodor als Superintendent von Schwerin. Wer jedoch dachte, der Senior zog sich in Neukloster aufs Altenteil zurück, der hatte sich geirrt.
Weshalb sich Pastor Kliefoth Neukloster aussuchte, darüber können wir nur spekulieren. Er kannte die Pfarre aus seiner Zeit als Superintendent, auch der mit ihm befreundete Friedrich Lisch mag ihm aus Neukloster berichtet haben. Von Bedeutung war das Dorf eher nicht. Die Kirche und die verbliebenem Klostergebäude waren in desolatem Zustand, und die gesellschaftlichen Verhältnisse, die der Pastor Born, ein Schwiegersohn von Johann Kliefoth, als Hilfsprediger hier im Dorf vorfand, waren alles andere als rühmlich. In den vielen* Büdnereien herrschte Armut, „teils weil die Erwerbsquellen fehlen, teils weil durch Vergnügungssucht manches drauf geht, was zu besseren Zwecken verwendet werden könnte. Auch gibt es eine Reihe von Menschen, die durch Trunk und Arbeitsscheu verkommen sind. Manches hat dazu der Umstand beigetragen, dass bis in die letzte Zeit hin das Großherzogliche Amt viele Schlechte, der Armenkasse zur Last fallende auswärtige Leute in Neukloster zusammenlegte. Selbstverständlich können derartige Elemente auf die übrigen auch nur einen nachteiligen Einfluss ausüben.“
Diesen ernüchternden Eintrag machte Kliefoths Nachfolger in der Kirchenchronik. Mit dem Zuzug von Pastor Kliefoth 1844 ändert sich die Lage in Neukloster grundlegend, wenn auch nicht von jetzt auf gleich. Als am 22. April sein Sohn Helmuth in die Matrikel der Universität Rostock eingetragen wird, steht unter Wohnsitz der Eltern bereits Neukloster. Selbstverständlich studiert auch Helmuth Theologie. Am 28. Dezember 1850 wird er am Lehrerseminar in Ludwigslust angestellt. Dort hatte sich nach dem Tod von Friedrich Franz I. am 1. Februar 1837 Ernüchterung eingestellt. Dessen Nachfolger Friedrich Paul verlegte den Regierungssitz nach Schwerin. In der Folge verließen auch viele staatliche Einrichtungen Ludwigslust, obwohl hier ab 1816 quasi alles neu erbaut worden war. Schon 1842 gab es Überlegungen, dass seit 1785 bestehende, 1829/30 neu erbaute Lehrerseminar in eine ländlichere Gegend zu verlegen, denn es wäre besser, wenn „…die Anstalt, welche Menschen vom Lande für ein Leben auf dem Lande bildet, auch besser auf dem Lande ihren Aufenthalt hätte.”
Noch war es nicht soweit, Friedrich Franz II. ließ ab 1843 in Ludwigslust wieder neu bauen. Im Oktober 1846 bekam die Stadt Bahnanschluss und 1848 wagten es die Seminaristen im Zuge der Revolution, eine Liste mit freiheitlichen Forderungen zu übergeben. 1851 wurde dann wiederholt gefordert, das Seminar in Ludwigslust an einen Ort zu verlegen, der frei ist „von städtischer Frivolität und Weltlichkeit“. Im Landeshauptarchiv geben eine Reihe Akten Aufschluss darüber, dass von da an intensiv nach einem Platz „fern ab vom Schuss“ gesucht wurde. So schrieb das Kuratorium für das Seminar am 7. September 1852: „Die Seminaristen gewöhnen sich an andere Lebensweisen und Lebensanschauungen, als zu ihren späteren Verhältnissen stimmen. Sie werden den ländlichen Verhältnissen immer mehr entfremdet. Der Umgang, welchen sie in Bürgerhäusern suchen, ist ihnen selten förderlich und führt oft zur Eingehung von Verlöbnissen, die in mehrfacher Beziehung als eine Kalamität zu betrachten sind. Die Lud-wigsluster Mädchen werden schwerlich gute Dorfschulmeisterfrauen. Nicht weniger übel ist es, wenn die Seminaristen, was auch nicht selten geschieht, die in Ludwigslust angeknüpften Verbindungen später wieder auflösen und dadurch Leichtfertigkeit in der Behandlung von Eheberedungen und überhaupt von geschlechtlichen Verbindungen an den Tag legen.“
Das Darguner Schloss oder gar Pölitz im Regierungsbezirk Stettin waren als neue Standorte im Gespräch. Und durch den Einfluss von Kliefoth auch Neukloster. Am
12. Juni 1855
erhielt Landesbaumeister Voß den Auftrag, einen Situationsplan für den Bau in Neukloster zu entwerfen.





























