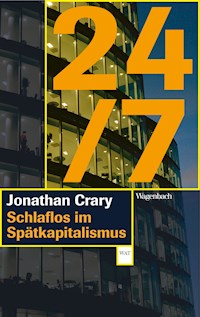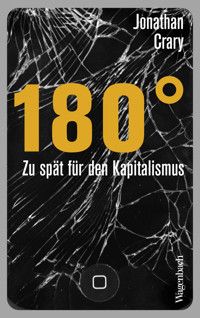
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Klaus Wagenbach
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Welt brennt. So weit, so bekannt – aber: Ist eine Kehrtwende noch möglich? Ja, sagt der renommierte Kunstkritiker und Medientheoretiker Jonathan Crary, doch ein Green New Deal wird nicht reichen. Klimaprotest und Kapitalismuskritik müssen sich international vernetzen – außerhalb der digitalen Sphäre. Denn die Digitalisierung verhindert nicht nur echte Solidarität, sondern ist auch für massive und flächendeckende Ressourcenausbeutung verantwortlich. In seinem engagierten Aufruf zeigt der so gefeierte wie kontrovers diskutierte Autor die Alternativen zu Digitalkomplex und Überwachungskapitalismus auf. Er zeichnet den fundamentalen Gegenentwurf eines Ökosozialismus, der eine lebbare Zukunft verspricht und Mensch und Natur vor ihrem Kollaps bewahren könnte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 191
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der streitbare Denker Jonathan Crary betrachtet die Verwüstungen, die der digitale Kapitalismus verursacht. Es braucht den fundamentalen Gegenentwurf eines Ökosozialismus, der eine lebbare Zukunft verspricht und Mensch und Natur vor ihrem Kollaps bewahrt.
Ein leidenschaftliches Plädoyer für den Aufstand, der bald kommen muss.
»Die Lektüre kann den Leser im positiven Sinne um den Schlaf bringen.«
Der Freitag über 24/7. Schlaflos im Spätkapitalismus
Jonathan Crary
180°
Zu spät für den Kapitalismus
Aus dem Englischen von Max Henninger
Verlag Klaus Wagenbach Berlin
No don’t say doom
Tom Verlaine
Vorwort
Man könnte einen kleinen Berg errichten aus all den Büchern der letzten zehn Jahre, die Aspekte des Internets und der sozialen Medien kritisiert oder angeprangert haben. Ein gemeinsames Merkmal all dieser Bücher ist die unhinterfragte Annahme der Dauerhaftigkeit und Unumgänglichkeit des Internets als bestimmendes Element des sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens. Kurz gesagt beschränkt sich der öffentliche Diskurs über die Netztechnologie darauf, Nachbesserungen und Justierungen an einem System vorzuschlagen, das als alternativlos akzeptiert wird. Ich wollte diesem Korpus inhärent reformistischer Bücher nicht noch einen weiteren Titel hinzufügen. Mir ging es im Gegenteil darum, die Notwendigkeit der Verweigerung zum Ausdruck zu bringen. Außerdem wollte ich die Dringlichkeit aufzeigen, Formen des Lebens und Zusammenseins zu imaginieren und zu verwirklichen, die mit den entmutigenden Routinen brechen, die uns mächtige Konzerne aufzwingen.
Eines meiner Ziele war es, die weitverbreitete Annahme in Frage zu stellen, die vernetzten Technologien, die unser Leben dominieren und deformieren, seien »gekommen, um zu bleiben«. Ich wollte unterstreichen, dass das sogenannte digitale Zeitalter und der Spätkapitalismus synonym sind. Eines ist ohne das andere nicht denkbar. Ein »sozialistisches Internet« ist ebenso unmöglich wie das Oxymoron eines »grünen Kapitalismus«. Es wird häufig vergessen, dass genuiner Sozialismus vom Gedeihen nicht monetarisierter oder instrumentalisierter Zwischenmenschlichkeit abhängt. Er könnte also überhaupt nicht sinnvoll bestehen inmitten der Formen von Trennung, Isolation, Konkurrenz und toxischem Individualismus, die online entstehen und gestärkt werden. Man kann sich nicht zu einem Gegner des Kapitalismus erklären und gleichzeitig seine konstitutiven Apparate gutheißen.
Seit der Fertigstellung des Buches im Jahr 2020 haben außergewöhnliche Entwicklungen die Instabilität jener Institutionen und Systeme potenziert, deren Bestehen als ewig proklamiert wurde. Eine neoliberale Fantasie über das Internet betraf dessen Ausrichtung auf einen von der freien Marktwirtschaft beherrschten Planeten, für den es angeblich eine nahtlose, allumfassende Interkonnektivität bereitstelle. Doch die vorher undenkbare Realität eines verheerenden europäischen Landkriegs hat die Illusion einer unipolaren, von reibungslosen Wohlstands- und Warenströmen angetriebenen Welt zunichte gemacht. Welche weiteren Zäsuren und gewaltsamen Brüche erwarten uns in naher Zukunft?
Gleichzeitig sind Restriktionen, Finanzialisierung, Zensur, Überwachung und Ausschlüsse der Internetnutzung durch dessen Kontrollinstanzen in den letzten Jahren verschärft worden. Nun, da die sozialen Medien zur Vorrichtung einer soziopathischen Milliardärsklasse geworden sind, wäre es pathologisch zu glauben, sie seien »gekommen, um zu bleiben«.
Die historische Flüchtigkeit dessen, was ich als »Internetkomplex« bezeichne, ist untrennbar mit den sozialen und ökologischen Krisen verflochten, die der globale Kapitalismus mit sich bringt. In vielerlei Hinsicht knüpft dieses Buch an meinen früheren Text 24/7. Schlaflos im Kapitalismus an. Darin habe ich die Folgen von Mustern des Konsums sowie der Extraktion, Verbrennung, Produktion und Militarisierung beschrieben, die ohne Unterlass wirken und keine Auszeit zugestehen. Das Ergebnis dieser Muster ist, wie ich auf diesen Seiten zeige, eine verbrannte Erde, in der Zivilgesellschaft und Ökosysteme gleichzeitig erodieren. Wie Rosa Luxemburg und andere bereits vor langer Zeit erkannt haben, zerstört der Kapitalismus alles, was es Gruppen und Gemeinschaften ermöglicht, autark zu existieren und sich gegenseitig zu helfen.
In der Situation der verbrannten Erde stellt sich außerdem eine Verarmung und Zersetzung individueller und kollektiver Erfahrung ein. Die Allgegenwart des Internets verzerrt unaufhörlich unsere Wahrnehmung sowie unsere sinnliche Fähigkeit, andere Menschen zu erkennen und uns mit ihnen zu verbinden. Viele der US-amerikanischen und britischen Rezensionen dieses Buches haben sich, zustimmend oder kritisch, auf die kompromisslosen Aussagen konzentriert, die ich auf den ersten fünfundzwanzig Seiten formuliere. Für mich bilden jedoch die im dritten Teil des Buches entwickelten Themen dessen Herzstück. Dort denke ich über den Schaden nach, der dem Blick, dem Gesicht und der Stimme durch die ständige Vertiefung in Onlinebereiche zugefügt wird. Die Art und Weise, in der wir sprechen und uns anderen zeigen, ist von fundamentaler Bedeutung für eine gerechte und von Zwischenmenschlichkeit geprägte Welt. Sie ist die fragile, aber unverzichtbare Grundlage gesellschaftlicher Solidarität. Heute wird sie zunehmend manipuliert, monetarisiert, in Routinen gezwängt, simuliert und in Form »verwertbarer Daten« abgeschöpft.
Unsere zwanghafte und passive Unterordnung in digitale Netze ist unerlässlich für das neoliberale Projekt, jeden Versuch nicht unterdrückerischer Lebensweisen unsichtbar oder undenkbar zu machen. Dieses Projekt der Herstellung von Konformität und Fügsamkeit ist in den Vereinigten Staaten und Teilen Europas am erfolgreichsten gewesen. Wie die anhaltenden Kämpfe und dauerhaften Widerstands- und Verweigerungsformen Lateinamerikas, Afrikas und anderer Regionen zeigen, sind es Orte im globalen Süden, wo der Geist der Revolte nie besiegt wurde. Hier zeigen sich die konsequentesten Wege in Richtung einer postkapitalistischen Welt.
Januar 2023
Erstes Kapitel
Ja, es ist Nacht und eine andere Welt ist im Aufstieg begriffen. Hart, zynisch, ohne Schriftkundigkeit oder Erinnerung, sich grundlos drehend. … Sie ist ausgedehnt, abgeflacht, als ob Perspektive und Fluchtpunkt abgeschafft worden wären. Und das Seltsame ist, dass die lebenden Toten dieser Welt auf der Welt davor beruhen …
Philippe Sollers
Wenn es eine lebenswerte und gemeinsame Zukunft auf unserem Planeten geben soll, dann wird es eine Offline-Zukunft sein, abgekoppelt von den weltzerstörenden Systemen und Funktionsweisen des 24-Stunden-Kapitalismus. Was auch immer von der Welt übrig bleibt: Das Netz, in dem wir heute leben, wird ein zerbrochener und peripherer Teil der Ruinen sein, auf denen vielleicht neue Gemeinschaften und zwischenmenschliche Projekte entstehen werden. Wenn wir Glück haben, wird das kurzlebige digitale Zeitalter von einer hybriden materiellen Kultur abgelöst werden, die auf alten und neuen Formen des gemeinsamen Lebens und Überlebens basiert. Jetzt, inmitten des sich verschärfenden sozialen und ökologischen Zusammenbruchs, wächst die Erkenntnis, dass das tägliche, auf allen Ebenen vom Internetkomplex überschattete Leben die Schwelle zur Irreparabilität und Toxizität überschritten hat. Immer mehr Menschen wissen oder spüren dies, da sie die schädlichen Folgen erleben und im Stillen erdulden. Die digitalen Werkzeuge und Dienste, die von Menschen aus aller Welt genutzt werden, unterstehen der Macht von transnationalen Unternehmen, Geheimdiensten, kriminellen Kartellen und einer soziopathischen Milliardärselite. Für die Mehrheit der Weltbevölkerung, der er aufgezwungen wurde, ist der Internetkomplex der unerbittliche Motor für Sucht, Einsamkeit, falsche Hoffnungen, Grausamkeit, Psychose, Verschuldung, vergeudete Lebenszeit, Gedächtnisverlust und sozialen Zerfall. Alle angepriesenen Vorteile werden durch seine schädlichen und sozialmörderischen Auswirkungen irrelevant oder zweitrangig.
Der Internetkomplex ist untrennbar verbunden mit dem unermesslichen Ausmaß des 24-Stunden-Kapitalismus und dessen Rausch der Akkumulation, Extraktion, Zirkulation, Produktion, des Transports und Ausbaus im globalen Maßstab. In fast allen Bereichen des Onlinebetriebs werden Verhaltensweisen gefördert, die der Möglichkeit einer lebenswerten und gerechten Welt zuwiderlaufen. Angetrieben von künstlich erzeugten Begierden, maximieren die Geschwindigkeit und Allgegenwart digitaler Netzwerke die Priorität des Aneignens, Besitzens und Begehrens, der Missgunst und des Neids. All dies fördert den Verfall der Welt – einer Welt, die ohne Pause funktioniert, ohne Erneuerung oder Erholung, die an ihrer Hitze und ihrem Abfall erstickt. Der Traum der Technomoderne vom Planeten als riesige Baustelle der Innovation, der Erfindung und des materiellen Fortschritts findet nach wie vor Verteidiger und Fürsprecher. Die meisten der zahlreichen Projekte und Geschäfte im Bereich der »erneuerbaren« Energien dienen der Aufrechterhaltung des business as usual, dem Erhalt zerstörerischer Konsummuster, der Konkurrenz und der zunehmenden Ungleichheit. Marktgesteuerte Programme wie der Green New Deal sind absurd und müßig, weil sie die Ausweitung sinnloser wirtschaftlicher Aktivitäten, die unnötige Nutzung elektrischer Energie und die globalen Industrien der Ressourcengewinnung nicht verhindern, die vom 24-Stunden-Kapitalismus angestachelt werden.
Dieses Buch steht in einer Tradition sozialer Pamphlete, die das artikulieren soll, was gemeinsam erlebt und zumindest teilweise auch erkannt, aber von einer überwältigenden Flut von Botschaften negiert wird, die auf der Unveränderlichkeit unseres verwalteten Lebens beharren. Viele Menschen sind sich tagtäglich der Verelendung ihres Lebens und ihrer Hoffnungen bewusst, haben aber vermutlich nur ein zögerliches Bewusstsein davon, wie sehr ihre Erkenntnisse von anderen geteilt werden. Mein Ziel ist es hier nicht, eine nuancierte theoretische Analyse vorzulegen, sondern in einer Zeit des Notstands die Wahrheit der geteilten Erkenntnisse und Erfahrungen zu bekräftigen und darauf zu bestehen, dass Formen der radikalen Verweigerung, als Alternative zu Anpassung und Resignation, nicht nur möglich, sondern notwendig sind. Der Internetkomplex proklamiert unaufhörlich seine Unentbehrlichkeit sowie die Bedeutungslosigkeit jeglichen Lebens, das nicht an seine Protokolle angepasst werden kann. Seine Allgegenwart und Einbettung in fast alle Bereiche persönlicher und institutioneller Aktivität lässt jede Vorstellung von seiner Unbeständigkeit oder postkapitalistischen Marginalisierung unglaubhaft erscheinen. Dieser Eindruck entsteht durch ein kollektives Versagen der Vorstellungskraft, aufgrund dessen die betäubenden Onlineroutinen als Synonym für das Leben akzeptiert werden. Die Überwindung des Internetkomplexes ist nur so lange undenkbar, wie unsere Wünsche und unsere Bindungen zu anderen Menschen und Arten verletzt und entmündigt werden.
Der Philosoph Alain Badiou hat festgestellt, dass gerade an diesem Punkt scheinbarer Unmöglichkeit die Bedingungen für einen Aufstand entstehen: »Emanzipatorische Politik besteht immer darin, genau das möglich erscheinen zu lassen, was aus der Situation heraus für unmöglich erklärt wird.«1 Die lautesten Stimmen, die diese Unmöglichkeit verkünden, sind diejenigen, die von der Aufrechterhaltung des Bestehenden und vom ununterbrochenen Funktionieren einer kapitalistischen Welt profitieren, also alle, die ein berufliches, finanzielles oder narzisstisches Interesse an Aufstieg und Expansion des Internetkomplexes haben. Wie, so werden sie ungläubig fragen, könnten wir ohne etwas auskommen, von dem jeder Aspekt des finanziellen und wirtschaftlichen Lebens abhängt? Übersetzt heißt diese Frage: Wie könnten wir ohne eines der Kernelemente der techno-konsumistischen Kultur und Wirtschaft auskommen, die das Leben auf der Erde an den Rand des Zusammenbruchs gebracht hat? Würde eine Welt, die nicht vom Internet beherrscht wird, nicht darauf hinauslaufen, alles zu verändern, würden sie fragen. Ja, und genau darum geht es.
Jeder mögliche Weg zu einem überlebensfähigen Planeten wird weitaus mühsamer sein, als die meisten erkennen oder offen zuzugeben bereit sind. Eine entscheidende Aufgabe im Kampf für eine gerechte Gesellschaft wird in den kommenden Jahren darin bestehen, soziale und persönliche Arrangements zu schaffen, die die Dominanz des Marktes und des Geldes über unser Zusammenleben aufheben. Dazu gehört, dass wir unsere digitale Isolation ablehnen, Zeit als gelebte Zeit zurückgewinnen, kollektive Bedürfnisse wiederentdecken und uns gegen die zunehmende Barbarei wehren, einschließlich der Grausamkeit und des Hasses, die vom Internet ausgehen. Ebenso wichtig ist die Aufgabe, sich demütig wieder mit dem zu verbinden, was von einer Welt voller verschiedener Arten und Lebensformen übrig geblieben ist. Es gibt zahllose Möglichkeiten, wie dies geschehen könnte. Tatsächlich haben Gruppen und Gemeinschaften auf dem ganzen Planeten einige dieser Bemühungen bereits in Angriff genommen, auch wenn das nirgends vorgesehen war oder angekündigt wurde.
Viele derer, die die Dringlichkeit des Übergangs zu einer Form von Ökosozialismus oder wachstumslosem Postkapitalismus begreifen, gehen dennoch unvorsichtigerweise davon aus, dass das Internet und seine derzeitigen Anwendungen und Dienste irgendwie weiterbestehen und auch in Zukunft wie gewohnt funktionieren werden, neben den Bemühungen um einen bewohnbaren Planeten und um egalitärere soziale Arrangements. Es besteht der anachronistische Irrglaube, dass das Internet einfach »den Besitzer wechseln« könnte, als ob es ein Telekommunikationsunternehmen aus der Mitte des 20. Jahrhunderts wäre, wie Western Union oder ein Radio- oder Fernsehsender – ein Unternehmen, das in einer veränderten politischen und wirtschaftlichen Situation anders genutzt werden könnte. Die Vorstellung, das Internet könne unabhängig von den katastrophalen Operationen des globalen Kapitalismus funktionieren, ist eine der verblüffenden Illusionen unserer Zeit, denn das eine ist strukturell mit dem anderen verwoben. Sofern sie eintritt, wird die Auflösung des Kapitalismus das Ende einer marktgesteuerten Welt sein, die von den vernetzten Technologien der Gegenwart geprägt ist. Natürlich wird es auch in einer postkapitalistischen Welt Kommunikationsmittel geben, wie es sie in jeder Gesellschaft gegeben hat, doch sie werden wenig Ähnlichkeit mit den finanzialisierten und militarisierten Netzwerken haben, in die wir heute verstrickt sind. Die vielen digitalen Geräte und Dienste, die wir heute nutzen, gibt es nur aufgrund der unendlichen Verschärfung der wirtschaftlichen Ungleichheit und der beschleunigten Zerstörung der Biosphäre zugunsten von Ressourcenabbau und unnötigem Energieverbrauch.
Der Kapitalismus hat schon immer ein abstraktes Wertesystem und dessen physische und menschliche Ausdrucksformen verbunden. Die heutigen digitalen Netzwerke haben jedoch eine vollständigere Integration beider bewirkt. All die miteinander vernetzten Telefone, Laptops, Kabel, Supercomputer, Modems, Serverfarmen und Mobilfunkmasten konkretisieren die quantifizierbaren Prozesse des finanzialisierten Kapitalismus. Die Unterscheidung zwischen festem und zirkulierendem Kapital wird permanent verwischt. Dennoch halten viele an dem trügerischen Bild vom Internet als einer freistehenden technologischen Ansammlung fest, als handele es sich um einen Werkzeugsatz; die weite Verbreitung von tragbaren Geräten verstärkt diese Illusion.2 In den frühen 1970er Jahren entwickelte der Sozialkritiker Ivan Illich eine weitreichende Definition des Werkzeugbegriffs, die rational entworfene Artefakte, produzierende Institutionen und technische Funktionen umfasste. Werkzeuge, so schrieb er, sind von Natur aus gesellschaftlich, und er bewertete sie anhand eines fundamentalen Gegensatzes: »Je nachdem, ob ich es beherrsche oder ob es mich beherrscht, bindet mich das Werkzeug an den Sozialkörper oder verbindet mich mit diesem.«3 Illich betonte, dass Menschen Glück und Zufriedenheit nur durch den Gebrauch von Werkzeugen erlangen, die »durch andere weniger kontrollierbar sind«, und warnte davor, dass »das Wachstum des Apparates über die kritischen Schwellen hinaus immer mehr reglementierte Uniformierung, Abhängigkeit, Ausbeutung und Ohnmacht produziert«.4 In den späten 1990er Jahren, kurz vor seinem Tod, konstatierte er das Verschwinden der Technik als Mittel zum Zweck, als Instrument, mit dem der Einzelne der Welt einen Sinn geben kann, und die Ausbreitung von Technologien, die Menschen in ihre Regeln und Abläufe einbinden. Einst zumindest teilweise autonome Handlungen wurden zu »systemadaptiven« Verhaltensweisen.5 In dieser historisch beispiellosen Realität sind die Ziele, die wir verfolgen, nicht mehr diejenigen, die wir genuin gewählt haben.
Trotz seiner historischen Neuheit stellt der Internetkomplex eine Vergrößerung und Konsolidierung von Arrangements dar, die bereits seit vielen Jahren in Betrieb oder zumindest ansatzweise realisiert sind. Er ist kaum monolithisch, sondern ein Flickenteppich von Elementen aus verschiedenen Epochen, die für eine Vielzahl von Zwecken produziert wurden. Einige von ihnen gehen auf die Konfigurationen zur Finanzierung von Stromflüssen zurück, die in den 1880er Jahren von Edison und Westinghouse entwickelt und dann von J. P. Morgan usurpiert wurden. Gegenwärtig erleben wir den letzten Akt des verrückten, brandgefährlichen Projekts einer vollständig verkabelten Welt, des leichtsinnigen Glaubens, dass eine vierundzwanzigstündige Verfügbarkeit von elektrischer Energie für einen Planeten mit acht Milliarden Menschen ohne die jetzt allerorts eintretenden katastrophalen Folgen erreichbar sei.
Die nahezu unmittelbare Konnektivität des Internets bestätigt die Marx’sche Prognose aus den 1850er Jahren bezüglich der Entstehung eines »Weltmarkts«. Marx erkannte die Unvermeidlichkeit einer kapitalistischen Vereinheitlichung der Welt, in der die Geschwindigkeit von Zirkulation und Tausch stetig weniger beschränkt wird aufgrund der »Vernichtung des Raums durch die Zeit«.6 Marx war sich auch darüber im Klaren, dass die Entwicklung des Weltmarkts notwendigerweise zur »Auflösung des Gemeinwesens« und aller von der »universelle[n] Tendenz des Kapitals« unabhängigen sozialen Verhältnisse führen würde.7 Auch wenn die mit den digitalen Medien verbundene Isolation heute noch umfassender ist, so setzt sie nur jene soziale Fragmentierung fort, die institutionelle und wirtschaftliche Kräfte während des gesamten 20. Jahrhunderts bewirkt haben. Die Materialität der Medien mag sich ändern, doch die sozialen Erfahrungen der Trennung, der Entmachtung und der Schwächung von Gemeinschaftlichkeit bestehen nicht nur fort, sondern verstärken sich. Der Internetkomplex ist rasch zum integralen Bestandteil einer neoliberalen Austerität geworden, durch die die Zivilgesellschaft fortschreitend erodiert und durch monetarisierte Onlinesimulationen sozialer Beziehungen ersetzt wird. Er nährt gleichzeitig die Überzeugung, dass wir nicht mehr voneinander abhängig sind, dass wir unser Leben allein gestalten und unsere Freunde auf die gleiche Weise verwalten können wie unsere Onlinekonten. Er verstärkt zudem das, was die Sozialtheoretikerin Elena Pulcini die »narzisstische Apathie« von Individuen nennt, die kein Verlangen nach Gemeinschaft mehr haben und in passiver Konformität mit der bestehenden sozialen Ordnung leben.8
Die vorherrschende Erzählung, die Weltzivilisation sei ins »digitale Zeitalter« eingetreten, fördert die Illusion einer historischen Epoche, deren materielle Determinanten jenseits jeglicher möglichen Intervention oder Veränderung liegen. Ein Ergebnis ist die scheinbare Naturalisierung des Internets, von dem viele annehmen, es habe sich unabänderlich auf dem Planeten installiert. Die zahlreichen Mystifizierungen der Informationstechnologien verbergen sämtlich ihre Untrennbarkeit von den zunehmend unkoordinierten Strategien eines globalen Systems, das sich in einer tiefen Krise befindet. Es wird kaum darüber gesprochen, dass die Finanzierung des Internets eng mit einem weltwirtschaftlichen Kartenhaus verbunden ist, das bereits ins Wanken geraten ist und durch die vielfältigen Auswirkungen der Klimaerwärmung und des Zusammenbruchs von Infrastrukturen noch weiter bedroht wird.
In den 1990er Jahren fielen Behauptungen bezüglich der Dauerhaftigkeit und Unvermeidbarkeit des Internets mit verschiedenen Jubelrufen zum »Ende der Geschichte« zusammen: Der globale Kapitalismus des freien Marktes wurde als triumphierend, konkurrenzlos und auf ewig vorherrschend bezeichnet. In geopolitischer Hinsicht zerbrach diese Fiktion bereits in den frühen 2000er Jahren, doch das Internet schien das Trugbild der Post-Histoire zu bestätigen. Es schien eine einheitliche, durch Konsum definierte Standardrealität einzuführen, losgelöst von der physischen Welt und ihren zunehmenden sozialen Konflikten und Umweltkatastrophen. Das Aufkommen der sozialen Medien mit all ihren scheinbaren Potenzialen der Selbstdarstellung suggerierte kurzzeitig eine entwertete Verwirklichung der Hegel’schen Perspektive universeller Autonomie und Anerkennung. Als konstitutiver Bestandteil des Kapitalismus des 21. Jahrhunderts zählt das Internet heute jedoch die Ausschaltung des Gedächtnisses und die Absorption gelebter Zeitlichkeit zu seinen Schlüsselfunktionen. Diese Funktionen beenden die Geschichte nicht, sondern lassen sie unwirklich und unverständlich erscheinen. Die Lähmung des Gedächtnisses erfolgt individuell wie kollektiv. Wir sehen dies an der Vergänglichkeit aller »analogen« Artefakte, die digitalisiert werden: Nicht die Bewahrung dieser Artefakte ist das Ergebnis, sondern ihr Vergessenwerden und Verlorengehen, was von niemandem bemerkt wird. In gleicher Weise spiegelt sich unsere eigene Austauschbarkeit in den Geräten wider, die schnell zu nutzlosem digitalen Müll werden. Gerade die Arrangements, die angeblich »gekommen sind, um zu bleiben«, bauen auf die Vergänglichkeit, das Verschwinden und Vergessen von allem dauerhaft Bleibenden, hinsichtlich dessen es gemeinsame Verpflichtungen geben könnte. In den späten 1980er Jahren erkannte Guy Debord die Allgegenwärtigkeit derartiger Zeitlichkeiten: »Wenn das Wichtige sich gesellschaftlich anerkennen läßt als das, was augenblicklich ist und im nächsten Augenblick noch sein wird, anders und gleich und stets ersetzt durch eine weitere augenblickliche Bedeutsamkeit, so kann man genausogut sagen, daß das verwendete Mittel dieser so laut tönenden Unwichtigkeiten so etwas wie Ewigkeit garantiert.«9
Die Transformation des Internets von einem Netzwerk, das jahrzehntelang hauptsächlich von Militär- und Forschungseinrichtungen genutzt wurde, in allgemein zugängliche Onlinedienste Mitte der 1990er Jahre erfolgte nicht einfach aufgrund von Fortschritten in der Systemtechnik. Vielmehr war dieser Wandel wesentlicher Bestandteil der sich bereits vollziehenden massiven Umstrukturierung der Kapitalströme und der Umgestaltung der Individuen zu »Unternehmern ihres Humankapitals«. Die weit verbreitete Einführung informeller, flexibler und dezentralisierter Arbeitsformen wurde zwar von vielen bemerkt, doch in den frühen 1980er Jahren war nur eine Handvoll von Kommentatoren in der Lage zu begreifen, was dabei auf dem Spiel stand. So stellte der französische Wirtschaftswissenschaftler Jean-Paul de Gaudemar eine grundlegende Umgestaltung des Kapitalismus fest, die weit über die Neuorganisation der Arbeit und die globale Streuung der Produktion hinausgeht. »In der Tat leben wir heute in einem Zeitalter, in dem klar geworden ist, dass das Kapital von nun an den gesamten sozialen Raum zurückerobern muss, von dem das vorherige System es tendenziell getrennt hatte. Es muss sich diesen sozialen Körper neu aneignen, um ihn mehr denn je zu beherrschen.«10 Niemand hätte aber 1980 schon vorhersehen können, wie diese Rückeroberung konkret ablaufen und mit welcher Unerbittlichkeit sie noch Jahrzehnte später immer mehr Schichten der Lebenserfahrung erfassen würde. Zahllose Sphären des Sozialen mit ihren ausgeprägten Autonomien und lokalen Strukturen sind verschwunden oder zu Onlinesimulationen vereinheitlicht worden. Der Internetkomplex ist heute der umfassende globale Apparat zur Auflösung der Gesellschaft.
Ab Mitte der 1990er Jahre wurde der Internetkomplex als inhärent demokratisch, dezentralisierend und antihierarchisch gepriesen. Er sollte als nie dagewesenes Mittel des freien Ideenaustauschs, unabhängig von jeglicher Kontrolle, den allgemeinen Zugang zu den Medien erleichtern. Nichts von alledem war der Fall. Es gab nur eine kurzlebige Phase naiver Begeisterung, die den unerfüllten Hoffnungen ähnelte, die mit der breiten Verfügbarkeit des Kabelfernsehens in den 1970er Jahren geweckt wurden. Auch das heute gängige Narrativ einer egalitären Technologie, die nur durch monopolistische Unternehmen, die Aufhebung der Netzneutralität und Eingriffe in die Privatsphäre bedroht sei, ist schlichtweg falsch. Eine »digitale Allmende« hat es nie gegeben und wird es auch nie geben. Von Anfang an ging es beim Internetzugang einer globalen Öffentlichkeit um die Eroberung von Zeit, um Entmachtung und entpersonalisierte Verbundenheit. Der einzige Grund, weshalb das Internet anfangs »freier« oder offener zu sein schien, war, dass die Projekte der Finanzialisierung und Enteignung einige Zeit benötigten und erst in den frühen 2000er Jahren einen bestimmten Beschleunigungsgrad erreichten. Transnationale Konzerne konnten durch die allgemeine Zugänglichkeit des Internets Arbeit und Konsum in eine vierundzwanzigstündige Beschäftigung umgestalten, die nicht mehr an Zeit oder Ort gebunden ist. Dies schuf weitreichende, miteinander verknüpfte Möglichkeiten der Überwachung und der Kontaktaufnahme zu allen, die gerade online sind. Dadurch wurden gesellschaftliche Privatisierungstendenzen intensiviert. Aus der Perspektive des Medienhistorikers Harold Innis kann die unternehmerische Kontrolle digitaler Netzwerke als »Wissensmonopol« verstanden werden, das den Ambitionen eines dominanten Imperiums oder Staates dient.11 Kommunikationssysteme bieten scheinbar einen populären oder demokratischen Zugang zu Informationen, doch Innis sieht ihr übergeordnetes Ziel darin, lokale und regionale Gemeinschaften aufzubrechen. Diese werden dann in umfassendere Zusammenhänge gestellt, über die das Wissensmonopol aufrechterhalten wird, um die kulturelle und wirtschaftliche Vorherrschaft zu sichern. Nur selten, so stellt Innis fest, haben sich unterworfene Gruppen die Kommunikationsmedien wirksam für ihre eigenen politischen Ziele aneignen können.
Mitte der 1990er Jahre erforderten die Prekarisierung der Arbeitswelt, die zunehmende wirtschaftliche Ungleichheit, der Abbau öffentlicher Dienstleistungen, die strukturelle Verschuldung und viele andere Faktoren neue Wege, um die politische Gefügigkeit aufrechtzuerhalten. Die endlosen digitalen Ablenkungsmanöver verhinderten den Aufstieg von Massenbewegungen, die sich gegen das System richten. Teil der optimistischen Erwartungshaltung an das Internet war die Hoffnung, es werde sich als unverzichtbares Organisationsinstrument für politische Bewegungen außerhalb des Mainstreams erweisen und die Wirkung kleinerer oder marginaler Formen der Opposition verstärken. Tatsächlich bietet das Internet eine Reihe von Vorkehrungen, die selbst das zaghafte Entstehen einer nachhaltigen antisystemischen Organisierung und Aktion verhindern oder unterbinden. Sicherlich kann das Internet der Übermittlung von Informationen an eine große Zahl von Empfänger dienen, etwa zur Unterstützung kurzfristiger Mobilisierungen zu einzelnen Themenkomplexen, die oft mit Identitätspolitik, »Farbrevolutionen«, Klimamärschen oder vorübergehenden Empörungsbekundungen verbunden sind. Es sollte aber auch daran erinnert werden, dass breit angelegte radikale Bewegungen und weitaus größere Massenmobilisierungen in den 1960er und frühen 70er Jahren zustande kamen, ohne dass dabei die materiellen Organisationmittel fetischisiert wurden.
Betrachtungen des Internets als egalitäres, horizontales Feld von »Öffentlichkeiten« löschen jegliche klassenbezogene Sprache oder Befürwortung des Klassenkampfes aus, und das in einem historischen Moment, in dem die Klassengegensätze akuter sind als je zuvor. Tatsächlich ist der Internetkomplex noch nie mit nennenswertem Erfolg zur Förderung einer antikapitalistischen oder antimilitaristischen Agenda eingesetzt worden. Er zersplittert vielmehr die Entmachteten in eine Ansammlung separater Identitäten, Sekten und Interessen. Bei der Verfestigung reaktionärer Gruppenformationen erweist er sich wiederum als besonders effektiv; die von ihm erzeugte Engstirnigkeit wird zum Inkubator für Partikularismen, Rassismen und Neofaschismen. Wie Nancy Fraser und andere argumentiert haben, ist Identitätspolitik für die Strategien »progressiver« neoliberaler Eliten von entscheidender Bedeutung: Sie stellt sicher, dass eine potenziell mächtige Mehrheit sich selbst nicht erkennen kann, weil sie in getrennte und konkurrierende Fraktionen aufgespalten wird, aus denen eine Handvoll Vertreter deutlich sichtbar in die Leistungsgesellschaft eintreten darf.12