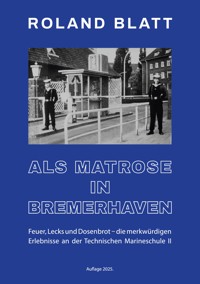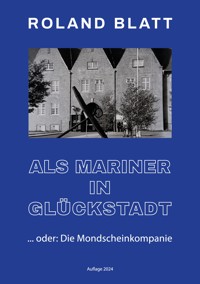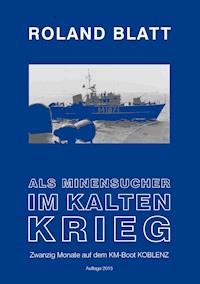Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Deutsche Krieg von 1866, auch bekannt als der Deutsch-österreichische Bruderkrieg oder als der Zweite deutsche Einigungskrieg, ist sicher vielen Menschen in Deutschland nicht oder nicht mehr präsent. Und doch war dieser Deutsche Krieg eine Episode in der deutschen Geschichte von großer Tragweite. Das hier vorliegende Booklet zeichnet die Ereignisse von 1866 anhand von persönlichen Aufzeichnungen eines der Beteiligten nach. Es war der preußische Infanterist und Landwehrmann Johann Georg Blatt aus Saarbrücken, der auf dem westlichen Kriegsschauplatz diesen Krieg vom Anfang bis zum Ende mitgemacht hat und trotz aller Strapazen und Beschwernisse ein Tagebuch geführt hat, das sich, obwohl das Haus im Bombenkrieg des Jahres 1944 verloren ging, in der Familie erhalten hat. Der durchaus bemerkenswerte Text aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde vom Autor kommentiert und in den allgemein- und militärhistorischen Zusammenhang gestellt, sodass bei allen, die dieses Booklet lesen, ein sachgerechter Eindruck vom dramatischen Geschehen dieser Zeit entsteht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 75
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die bisher erschienenen Titel von Roland Blatt:
Auf der GORCH FOCK, gestrandet in Portugal und andere Geschichten... ISBN 978 – 3 – 8448 – 8183 – 7
Auf dem Schulschiff und andere Geschichten ...
ISBN 978 – 3 – 8482 – 0509 – 7
Als Minensucher im Kalten Krieg –
Zwanzig Monate auf dem KM-Boot KOBLENZ
ISBN 978 – 3 – 7347 – 9626 – 5
Zur See und auf den Wellen Gedichtband
ISBN 978 – 3 – 7460 – 7659 – 1
Schleswig-Holstein Geschichte kurz und bündig
ISBN 978 –3 – 8482 – 0930 – 9
Die Erfahrung der Senioren mit Damen und Motoren
ISBN 978 – 3 – 7519 – 5652 – 9
Einhand unterwegs zwischen Ems und Oder
Unterm Rentnerkreuz und andere Geschichten ...
ISBN 978 – 3 – 7568 – 4100 – 4
Inhalt:
Vorwort
Mobilmachung
Der Krieg beginnt
Der Mainfeldzug
Die Heimkehr
Nachbetrachtung
Abschließende Bemerkungen
Daten in der Zusammenfassung
Legende
Weitere Erläuterungen
1866 – ein vergessener Krieg
Vorwort
„Frankreich ist des Deutschen Erbfeind!“ Dieser weithin bekannte, und heute kaum fassbare Satz wird schon seit Jahrzehnten leichthin abgetan als typisch militaristische preußisch-deutsche Einstellung, die noch bis weit ins zwanzigste Jahrhundert galt. Doch wer denkt, dieser Satz sei nur der Borniertheit früherer Zeiten zu verdanken, der hat zu kurz gedacht, denn für die historisch Bewanderten hatte diese Aussage damals durchaus ihre Berechtigung.
Gehen wir zurück in die Geschichte:
Seit 1635, als Frankreich in den fast schon beendeten 30-jährigen Krieg eingriff, um leichte Beute in den Landen des erschöpften Deutschen Reichs zu machen, waren französische Truppen immer wieder ins Land eingefallen. Sogar im Friedensschluss von Münster und Osnabrück war auf Bestreben Frankreichs das Reich so geschwächt worden, dass der Zugriff deutlich erleichtert war. Die einzelnen Landesteile des Reiches, wohl mehr als 300 an der Zahl, waren, darauf hatte Frankreich nachdrücklich bestanden, so in die Lage versetzt worden, Bündnisse mit ausländischen Mächten eingehen zu können oder zu müssen. Frankreich hatte dabei stets und zuvorderst an die eigenen Chancen gedacht, die sich aus dieser Regelung boten. Denn damit war jede Möglichkeit gegeben, dass deutsche Territorien in unterschiedlichen Bündnissen immer wieder gegeneinander kämpften, und zwar oft genug zum Vorteil Frankreichs. Aber auch Dänemark und Schweden nutzten diese Regelung und führten ihre Kriege oft genug mit den im HEILIGEN RÖMISCHEN REICH DEUTSCHER NATION rekrutierten Soldaten, Kriege gegeneinander sowie gegen andere Mächte. Selbst der Kampf zwischen Frankreich und England um die Vorherrschaft in Europa und in der Welt wurden zum Teil auf deutscher Erde ausgetragen. Entscheidungen von größter Tragweite fielen auf dem Boden des Reiches und zu Lasten deren Bewohner.
Allerdings waren durch den im Jahr 1648 geschlossenen Frieden von Münster und Osnabrück die größeren Fürstentümer im Reich nahezu souverän geworden, und deshalb waren es zuletzt nur noch die vielen kleineren Reichsstädte, die Reichsritter und die sog. Duodez-Fürsten mit ihren eng begrenzten Gebieten, die im Kaiser noch die einzige Schutzmacht sahen vor dem Verlangen der größeren Nachbarn, sie zu vereinnahmen. Und nur auf diese konnte sich der Kaiser tatsächlich noch stützen.
Die Kriege, die von Frankreich ausgingen, waren viele, und der Deutsche Kaiser hatte nicht mehr die Macht, ausreichend Truppen dagegen zu stellen. Ganz überwiegend musste sich der Kaiser auf seine eigene Habsburger Hausmacht stützen, die allerdings nicht klein war. Immerhin gehörte nach dem 30-jährigen Krieg neben dem eigentlichen Österreich u.a. auch Böhmen, Mähren und Kroatien dazu. Doch erst in der Folgezeit, als gegen Ende des 17. Jahrhunderts die Türkenkriege zunehmend siegreich verliefen, wurde Habsburg eine Macht aus eigener Größe.
Frankreich war aus dem 30jährigen Krieg als mächtigster Staat im kontinentalen Europa hervorgegangen, und das wussten die französischen Könige zu nutzen, allen voran der Sonnenkönig Ludwig XIV. Bis 1681 ging dem Deutschen Reich Elsass und Lothringen verloren – teilweise unter Ausnutzung der Tatsache, dass die Türken sich anschickten, Wien zu erobern. Ab 1688 und unter dem fadenscheinigen Vorwand von Erbansprüchen fielen die Franzosen erneut ins Reich ein und besetzten das Gebiet des Pfalzgrafen bei Rhein. Als sie, fast 10 Jahre später, endlich wieder abziehen mussten, waren das Heidelberger Schloss, aber auch viele andere Residenzen nachhaltig zerstört. Es war der Krieg, der deutscherseits über Jahrhunderte als der „Pfälzer Raubkrieg“ bezeichnet wurde. Während des Spanischen Erbfolgekrieges von 1700 bis 1714 führten die Franzosen erneut Krieg auf deutschem Boden, ebenso ab 1740 im Österreichischen Erbfolgekrieg sowie im Siebenjährigen Krieg von 1756 bis 1763. Ein erster Höhepunkt dieser Entwicklung war nach dem 1. Koalitionskrieg eingetreten, als Frankreich 1797 im Frieden von Campo Formio das gesamte linke Rheinufer vereinnahmte. Alle Lande westlich des Rheins, inklusive der Städte Köln, Trier und Mainz, seit dem Mittelalter Hauptstädte deutscher Kurfürstentümer, wurden französisches Staatsgebiet.
Doch selbst damit war es noch nicht genug. In einer Nebenabsprache des besagten Friedens war festgelegt worden, dass die Fürsten des linken Rheinufers mit Gebieten rechts des Rheins entschädigt werden sollten, und dies sollte zu Lasten der kleinen Territorien, der Reichsritter, der Reichsgrafen und vieler Reichsstädte geschehen. Vor allem sollte der kirchliche Landbesitz enteignet und neuen Besitzern zugeführt werden.
Unter dem Druck Napoleons wurde 1803 dieser Plan, der als „Reichsdeputationshauptschluss“ in die Geschichte einging, umgesetzt. Bistümer, Stifte und Abteien, aber auch 45 Reichsstädte wurden aufgelöst und neu verteilt. Die kleinen Staaten verschwanden, die großen wurden größer. Besonders gewannen dabei Preußen, Bayern, Württemberg und Baden.
Die Folge dieser Veränderungen war, dass der Kaiser seine Macht verlor. Die vielen kleinen Territorien, deren Schutz er garantiert hatte und auf deren Unterstützung er angewiesen war, waren nicht mehr vorhanden. Die Großen dagegen hatten sich zusehends verselbständigt. Im Jahr 1804 nahm der Kaiser deshalb, vorsorglich und vorausschauend, den Titel „Kaiser von Österreich“ an, und 1806 legte er die deutsche Kaiserkrone, die inhaltslos geworden war, endgültig nieder. Damit war das sog. „Heilige Römische Reich Deutscher Nation“ nach fast 1000 Jahren seines Bestands endgültig beendet.
Bis auf Österreich und Preußen mussten sich alle deutschen Länder, deren Fürsten sich soeben noch über Gebietszuwächse und Titelerhöhungen aus Napoleons Hand freuen konnten, bereits im Jahr 1806 zum sog. „Rheinbund“ zusammenschließen, deren „Sicherheit“ von Frankreich garantiert wurde. Damit war fast das ganze heutige Deutschland bis hin zur Oder ein französisches Protektorat geworden.
Doch auch davor war Frankreich in Deutschland präsent. Schon 1803 und anlässlich seines Krieges mit England hatte Frankreich das in Personalunion mit England stehende, zum Reich gehörende Kurfürstentum Hannover besetzt. Damit standen bereits seit 1803 französische Truppen an Weser und Elbe.
Die Rheinbundstaaten waren jetzt dauerhaft Verbündete Frankreichs, die zu jeder Zeit und auf Befehl Napoleons Truppen für jeden zukünftigen Kriegsschauplatz zu stellen hatten. Nach genauem Plan hatten die Fürsten eine festgelegte Anzahl von Soldaten zu stellen. Wie schon im 2. Koalitionskrieg, so hatten auch in den folgenden Koalitionskriegen Nr. 3, 4 und 5 immer wieder Deutsche auf Deutsche schießen müssen. Auf dem spanischen Kriegsschauplatz waren Soldaten aus deutschen oder den ehemals deutschen Landen ebenso präsent wie im Feldzug Napoleons gegen Russland, der 1812 geführt wurde. Allein hier kamen weit mehr als 100.000 deutsche Soldaten ums Leben, sei es durch Kriegshandlungen, sei es durch die Kälte des Winters. Auch Theodor Körner, der Held im 6. Koalitionskrieg, dem Befreiungskrieg von 1813, und poetischer Protagonist der Befreiung aus dem napoleonischen Joch, starb durch die Kugel eines rheinland-pfälzischen Soldaten im Zwangsdienst der Franzosen. Dieses Bündnissystem war zuletzt sogar noch dadurch optimiert worden, dass am 1. Januar 1811 die gesamte deutsche Nordseeküste nebst Hinterland bis hin nach Bremen, Hamburg und sogar bis nach Lübeck und Eutin französisches Staatsgebiet geworden war. Jetzt war Frankreich in der Lage, die Wirtschaft zu kontrollieren und in weiten Teilen Deutschlands deutsche Rekruten in Massen auszuheben. Weitere Gebiete, wie das von Kaiser Napoleon bereits im Jahre 1807 gebildete Königreich „Westphalen“, dessen König einer seiner Brüder war, waren da schon lange im Sinne Frankreichs regiert und verwaltet worden.
Das Land, das heute Deutschland heißt, hatte damals schwere Zeiten zu überstehen.
Im Frühjahr 1814 war Frankreich im 5. Koalitionskrieg von Preußen, Österreich und Russland endlich besiegt worden. Kaiser Napoleon dankte ab und wurde mit Elba abgefunden. Ab 1814 tagte der Wiener Kongress, um die Veränderungen, die durch Frankreich entstanden waren, soweit es überhaupt möglich war, rückgängig zu machen und Mitteleuropa neu zu ordnen. Doch Napoleon kam 1815 aus dem Exil in Elba zurück und ergriff erneut in Paris die Macht. Erst als er, drei Monate später, im 6. Koalitionskrieg, in Waterloo geschlagen war, da erst war seine Macht gebrochen. Er selbst musste unter englischer Aufsicht seine letzten Lebensjahre auf der einsam im Südatlantik gelegenen Felseninsel St. Helena verbringen, doch seine Kriege hatten mehr als 3,5 Millionen Soldaten das Leben gekostet, die gefallen waren auf den Schlachtfeldern von Lissabon bis Moskau und von Hamburg bis Kairo in Ägypten.
Doch völlig unbeabsichtigt hatte er dem Land, das heute Deutschland heißt, auch Vorteile gebracht. Neben einigen fortschrittlichen Aspekten der franz. Revolution waren durch seine Machtpolitik von den über 300 Einzelstaaten des einstigen Heiligen römischen Reiches jetzt nur noch etwa 40 Staaten übrig geblieben.