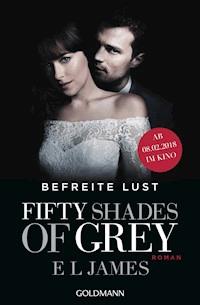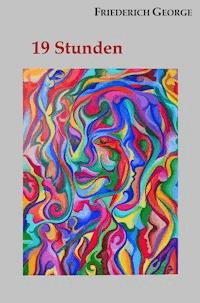
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Die Erzählung beschreibt einen Zeitraum von 19 Stunden. Ihr Beginn ist der frühe Vormittag, ihr Ende einige Stunden nach Mitternacht. Ein Mann und eine Frau begegnen sich auf einem Mittelalterfest. Er, wandernder Schmuckverkäufer mit einem kleinen Verkaufsstand, sieht sie, die Tochter des Bäckers, der bei Festen auch den steinernen Ofen des Festplatzes befeuert, bei der Arbeit und in ihrer Pracht. Er folgt mit seinen Blicken dem Regen, der sie heimlich bloß stellt. In ihm blüht die Kraft auf, die ihn unwiderstehlich zu ihr zieht. Auch ihr geschieht dies. Als sie ganz einander gewahr werden, finden sie gemeinsam wissend einen Ort der Zweisamkeit. Rausch um Rausch nehmen sie in ihrer Weiblichkeit und ihn in seiner Männlichkeit gefangen und tragen sie Stück um Stück, Minute um Minute, über die Stufen und durch die Räume und Farben der unergründlichen Gefilde, die Mann und Frau mit-, gegen- und ineinander durchqueren. Wie Sonne und Mond, doch in sich ständig ändernden Bahnen, kreisen sie umeinander und tauchen ein in das Beherrschen und tauchen ein in das Beherrschtwerden. 19 Stunden. Es ist eine beinah minutiöse Schilderung der Entwicklung der inneren Zustände beider Personen in hoher Erzähldichte und Bildhaftigkeit. Die Erzählung folgt einer ununterbrochenen Zeitlinie, ist ständig anwesend und führt mit der Lupe durch die Landschaften der inneren Bewegungen der Gemüter, der Gefühle, der Leiden und Leidenschaften. Es sind die Berührungen, Gerüche und Verläufe zwischen Mann und Frau, denen Bilder gegeben wurden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Friederich George
19 Stunden
Dieses eBook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Neunzehn Stunden
Impressum
Neunzehn Stunden
Theo, der das erste Mal hier war, stand wie die anderen beim Backhaus und wartete ungeduldig in der Schlange auf die eigens für die Schausteller und Ständebesitzer gebackenen Zwiebelkuchen, in der Hoffnung ein kleines Stück vom ersten Blech zu bekommen. Das Geld hatte nicht genügt, um sich vor Erreichen des Festplatzes neben der alten Burgruine ein Frühstück, und sei es auch nur ein trockenes Brötchen, zu kaufen. Außerdem musste er ohnehin erst seinen wackligen Stand aufbauen. Wäre er noch später eingetroffen, hätte man ihm das Aufstellen verboten. Da er jeden Pfennig brauchte, musste er eben hungern.
Der Auftakt des Festes stand kurz bevor. Die Sonne begann langsam ihre später am Tage allgegenwärtige sommerliche Schwere zu verbreiten. Keiner der Anwesenden war sich der Leiden und der Härte des mittelalterlichen Lebens bewusst. Die hier für das bevorstehende Fest aufgeputzte Mittelalterlichkeit war die Sonnenseite. Die Krankheiten waren ausgemerzt. Die Pest mit ihren Beulen, Flecken und Toten. Der Hunger, die Ratten und der Krieg. Die rauchenden, nach brennendem Menschenfleisch riechenden Scheiterhaufen waren verschwunden. Die Schausteller ebenso wie die Besitzer der Marktstände hatten weiße lückenlose Zähne und eine fast reine und makellose Haut. Keiner war vom Hunger oder von anderen Leiden gezeichnet. Allenfalls der Wohlstand war manchem an seines Körpers Fülle anzusehen.
Die Umgebung erlöste ihn. Sein Blick schweifte über die sanften Hügel die von dem warmen Grün der Nadelwälder überzogen waren. Der Morgendunst stieg zwischen den Wipfeln der talwärts stehenden Tannen auf um sich kurz darüber in der kräftigen vormittäglichen Sonne aufzulösen. Die Burg, die man auf einem kleineren, nicht weit hinauf ragenden Vorsprung am Hang des größten Berges der Umgebung gebaut hatte, lag oberhalb des kleinen zusammengekauerten Dorfes. Dennoch waren das Dorf und die Burg untrennbar miteinander verbunden. Die wulstige Stadtmauer war von drei Toren durchbrochen, von denen sich eines in die Richtung der Burg öffnete. Von dort gelangte man über eine stoppelige Wiese mit allen erdenklichen Kräutern, Unkräutern und Goldruten geradewegs zur Burg. Eine Straße gab es nicht. Nur in einer geraden, von Pferdekutschen ausgeprägten Spur gelangte man schnurgerade zur Burg. Die Wiese war schmal und der Anstieg bis kurz vor die Burg sehr sanft. Keiner war daher je auf den Gedanken gekommen die Anhöhe zur Burg in Schlangenlinien zu überwinden. Rechts und links der langen schmalen Wiese fiel das Gelände steil ab. Gleich dort, wo die Böschung abfiel, waren dichte Brombeerhecken gewachsen. Vor Ewigkeiten ist man eben wegen dieser Dornenbüsche rechts und links der Wiese auf einen Wettstreit verfallen, bei dem je zwei Kontrahenten mit selbstgebauten Wagen oder bei winterlichen Festen mit Schlitten die Wiese herunter fahren mussten. Ziel war es, den jeweils anderen derart aus der Bahn zu werfen, dass er sich in der Dornenhecke verfing. Beide Mitspieler starteten gleichzeitig nebeneinander aus dem Burgtor. So war gewährleistet, dass bereits zu Beginn der Abfahrt eine solche Nähe zwischen den Kontrahenten bestand, die Gewähr für das unverzügliche Drängeln und Schieben bot. Auch die Enge der Wiese ließ es kaum zu, die Abfahrt beider Wagen ohne selbst ungewollte Zusammenstöße zu ermöglichen. Denn wegen der Unebenheit der Wiese war ein gerades Fahren an sich nicht möglich. Die Wagen wurden durch die Gras- und Krautbüschel viel zu heftig hin und her geworfen. Um aber noch über diese Unwägbarkeiten hinaus sicher zustellen, dass der Kampf in jedem Falle mit der erwünschten Leidenschaft geführt wird, gab es die Regel, beide Teilnehmer in hohem Bogen in die Brombeerbüsche zu werfen, sollten beide unversehrt unten ankommen. Diese Regel hatte sich als sehr wirksam herausgestellt. Denn es war deutlich schwieriger sich drei bis vier Meter durch Dornen zu kämpfen – so weit wurde man in die Hecke hinein geworfen – als sich nur einen halben Meter aus dem Gebüsch heraus zu winden, wenn man vom Kontrahenten hinein gestoßen worden war.
Ein Schutz war nicht vorgesehen. Wer in die Hecke zu fahren drohte, tat gut daran, Kopf und Gesicht hinter Händen und Armen zu verbergen, wollte man sich am nächsten Morgen im Spiegel wieder erkennen.
Beinah glaubte sich Theo wirklich im Mittelalter wieder gefunden zu haben, hätte nicht das gleich bleibende Rauschen des Verkehrs auf der Fernstraße hinter dem anderen Ende des Dorfes und der Sendemast auf einem der gegenüberliegenden Hügel Auge und Ohr vom Gegenteil überzeugt.
In seinem Gesicht erzeugte die Sonne des Frühsommers diese über den Winter fast vergessene Wärme. Millimeter für Millimeter drang sie tiefer in seine Haut. Zwar war es schon fast zwei Monate sehr warm, dennoch sog Theo noch immer begierig jeden Sonnenstrahl in sich auf. Der Winter war zu lang und Theo zu lang allein. Seit fast zwei Jahren zog er nun schon mit seinem mickrigen Stand durchs Land und verkaufte selbst gefertigten Schmuck. Ringe, Ketten und Schmuckbänder aus gefärbter Baumwolle und aus Lederriemchen, ebenso wie Edelmetalle mit Steinen und Kristallen.
Er schloss die Augen und nahm nur noch die Sonne auf. Die Stimmen rundum verschwammen im Hintergrund. Die Sonne drang durch sein Augenlid hindurch mit solcher Helligkeit, dass er die Lider fest gegeneinander kniff. Vom Berghang in seinem Rücken floss die kalte Luft der vergangenen Nacht herunter und zog um seinen kräftigen nackten Hals. Ihn fror. Während sich in seinem Nacken die Haut zusammenzog und in einer Gänsehaut aufwarf, durchströmte nichts als Sonnenlicht und tief in ihn hineinreichende Wärme seine Vorderseite. Er verfolgte das Aufeinandertreffen der Gegensätze in seinem Innern und blieb still.
Fast unbemerkt gingen vereinzelte Regentropfen nieder. Theo öffnete neugierig seine Augen und blickte um sich. Wo er auch hin sah konnte er keinen dichter werdenden Regen ausmachen. Plötzlich wurde sein kreisender Blick festgehalten. Lisa. Ihr weites Sommerkleid, gemustert mit großen grünen Blättern und großen roten Klatschmohnblüten auf weißer Baumwolle begleitete sie wie ein Schleier aus sommerlicher Frische. Mit müheloser Leichtigkeit folgte das Kleid jeder Lisas behänden Bewegungen und verlieh ihnen mit dem weiten Schwingen des bis weit über die Knie reichenden Saumes fast den Ausdruck eines Tanzes. Unentwegt sah er zu Lisa. Auch als sie, die Tochter des Bäckermeisters, die Handreichungen bereits erledigt hatte, deren Abfolge sie längst kannte, sah er zu ihr, obwohl sie in diesem Moment vor sich hin blickend erstarrt war. Das Kleid bewegte sich kaum mehr und ihre Hand stützte sich auf einen Schieber, den sie in Gedanken versunken noch in den Händen hielt. Die flimmernde Hitze des schon vor Sonnenaufgang angefeuerten, aus Natursteinen gemauerten Backofens umwarb sie. Die Mauern des Backofens hatten wegen der zahlreich gefeierten Feste die Mauern der Burg überdauert, denn sie waren wieder und wieder erneuert und ausgebessert worden. Bei jedem Fest wurde hier gebacken wie einst.
Nun brachen mehr Tropfen durch die warmen Wogen der Backhitze. Keiner kümmerte sich um den Regen; es schien nur ein Intermezzo von wenigen Minuten zu werden. Wenige, dafür große Tropfen fielen aus dem milchigen Himmel. Doch allmählich wurde der Regen stärker und das helle Rund der Sonne über den Bergen ging allmählich in den konturlosen Wolken auf.
Enttäuscht sah sich Theo in der Hoffnung, von dem ersten Blech ein großes Stück Speckkuchen abzubekommen. Nur langsam ging es in der Schlange vorwärts. Doch wurde er für die Zeit des Wartens mit dem Anblick Lisas reich belohnt. Freilich wuchs sein Hunger mit jedem Lüftchen, das den Geruch des Backwerks entlang der Schlange der Wartenden wehte. Und doch hatte er es nun nicht mehr so eilig, seinen Hunger zu stillen. Ein anderer Appetit erwachte zaghaft.
Jedes Mal, wenn ein Blech mit Speckkuchen fertig und dampfend aus der Gluthitze des Ofens herausgezogen wurde, ging Lisa eilig ihrem Vater zur Hand, stütze hier, hob dort mit an und schnitt schließlich den Speckkuchen in großzügig bemessene Stücke, die so schnell von den Hungrigen ringsum fort getragen wurden, dass sie mit dem Schneiden kaum hinterher kam.
Doch immer wenn ein neues Blech im Ofen verschwunden war und wieder Minuten vergingen, bis alles durch gebacken war, wurde sie still und nach wenigen Momenten richtete sich ihr Blick in ihr Inneres.
Lisa gefiel Theo außerordentlich und um so näher er an den Ofen heran rückte und trotzdem immer häufiger immer dichtere Schwaden von dem appetitlichen Geruch von gebackenem Speck, Zwiebeln und Lauch in seine Nase stiegen, geriet sein Hunger in den Hintergrund. Er konnte seinen Blick nicht mehr von ihr wenden und beobachtete sie unentwegt, egal, ob sie still und in sich gekehrt etwas abseits von dem Ofen wartete, oder ob sie mit geübten Handgriffen und ohne sich zu verbrennen, die noch heiße Quiche zerteilte.
Immer dichter fielen die Regentropfen und Theo, der den sich stetig wiederholenden Wechsel Lisas von der Ruhe hin zu den raschen Bewegungen und wieder in die Ruhe, weiter verfolgt hatte, bemerkte, wie das Kleid unter dem Gewicht des in den Stoff dringenden Regenwassers langsam an Leichtigkeit und Schwung einbüßte und so auch bei schnellen Bewegungen Lisas um ihre eigene Achse nicht mehr wie im Tanz empor schwang.
In der Schlange krümmte sich einer nach dem anderen nach vorn und schob den Kopf tief in den Kragen um sicher zu gehen, dass ihm der Regen nicht kalt und nass in den Nacken fällt. Schließlich wurden die Gespräche ruhiger und bald verstummten die Wartenden ganz; zusammengekauert und den Regen wegen des ersehnten Mahls erduldend.
Theo, anfangs betrübt über den nachlassenden Schwung des Kleides, erkannte schnell, wie Lisa damit zugleich an Reiz gewann. Denn je schwerer das Kleid wurde, um so näher folgte es zugleich den Linien ihrer Figur.
Im Moment dieser Erkenntnis war jede Linie ihres Körpers, die sich deutlicher abzeichnete, von seinen Augen berührt und nachvollzogen. Jeden neuen Zentimeter der seinen Augen sichtbar wurde, hielt er fest, angetrieben von dem wachsenden Appetit seiner Phantasie.
Seine Phantasie war nicht jungfräulich. Neben dem was ihm die Natur an Instinkten gegeben hatte, waren die Jahre eines Mannes mit ihren Erlebnissen mit dem anderen Geschlecht getreten. So ahnte er jeden Zentimeter voraus. Gleichwohl blieb ein Rest Ungewissheit über die sich als nächstes offenbarende Form. In dieser Ungewissheit lag die Spannung, die Theo zu durchdringen begann. Diese Spannung war der Nebel und der Zauber, der seinen Blick nun fesselte.
Der Regen ließ nicht nach. Lisa hatte noch nicht bemerkt wie Theos Blick auf ihr haftete, ihren Körper Maß nahm und jeden Zentimeter ihrer Statur für seine Empfindung und tastende Ahnung kopierte.
Lisa genoss den Regen. Es waren große schwere Tropfen, die Blasen in Pfützen hinterlassen würden, wenn sich solche schon gebildet hätten. Sie empfing jeden einzelnen Tropfen. All ihre Wahrnehmung hatte sich weg von Auge und Ohr allein auf das Empfinden gelenkt. Die großen Tropfen waren ausreichend vereinzelt und sie nahm so jeden Tropfen einzeln wahr, auch wenn nur Bruchteile von Sekunden zwischen ihrem Auftreffen lagen. Zu Beginn des Regens hatte Lisa die ersten Tropfen nur als schwachen gedämpften Schlag bemerkt und hatte noch unbeeindruckt Worte mit den anderen gewechselt. Denn so lange das Kleid noch fast trocken war, lag zwischen dem Stoff und ihrer Haut vielfach ein Luftpolster und die Tropfen trafen sie nicht unmittelbar auf ihrer Haut.
Was Theos Phantasie ihm eröffnete und ausschmückte, wurde aufgesogen von seinem jetzt erwachten Sehnen. Zugleich war es Nahrung des wachsenden Sehnens selbst. Wie eine Sucht sich mit der Dosis der Droge verstärkt, war für Theo der Anblick Lisas wie ein Weckruf für seine Lust einerseits und zugleich deren stetiger Quell andererseits. Denn der Anblick Lisas war es, der Theo als Mann getroffen hatte, so wie es seine Natur ihm auferlegte.
So schien es ihm, als trete ihr Körper durch den Stoff ihres Kleides wie der Keim einer Pflanze aus dem Erdboden treibt. Wie die aufgebrochene Krume des Feldes den Keim frei in das Licht und die Wärme der Sonne entlässt, gab das Kleid in kleinen, kaum merklichen Veränderungen, die nur Theo in jeder Einzelheit verfolgte, ihren Körper in die Leben stiftende Nässe des Regens hinaus. Wie der Keim aus dem Dunkel der Erde mit seinem zarten und zugleich kräftigen Grün sich vom umgebenden Erdreich abhebt, drang ihr Körper durch die sich verlierenden Formen des Kleides. Jeder neue Regentropfen spülte weitere verdeckende Erde hinweg und nährte zugleich den Keim. Der Keim wurde Pflanze und Lisas Körper wurde Leib.
Theo wiederholte es in seinem Innern immer wieder. Leib. Er fürchtete fast, man könne das Wort aus seinem schwer gewordenen Atem heraus hören. Leib. Lisas Körper war für Theo das Gestalt gewordene Wort ‚Leib’. Lisa war wie in der Schwere weiblicher Trägheit und in dem Unterschied zum Manne vergossenes Wachs. Jede Kurve, jede Linie war für ihn ein Geschenk. Eine Botschafterin der Weiblichkeit. Lisas Leib wurde für ihn wie eine Gabe, wie die Fähigkeit eines Sehers, wie die Kunst einer Hexe.
Theo war gebannt. Der Frühling und Lisas Leib hatten sich gegen ihn verbündet, hatten ihn verhext und sich seiner bemächtigt.
Oft schon hatte Theo eine Situation erlebt, in der er Mühe hatte, seinen Blick von einer besonders schönen Frau zu wenden, die in seine Phantasie hatte vordringen können. Indes war es ihm doch stets gelungen, sich wieder zu fassen. Heute gelang es ihm nicht mehr. Er wurde sich selbst noch nicht einmal seines stierenden Blickes bewusst. Theo war hypnotisiert. Kein Pendel hatte ihn seiner Selbstbeherrschung beraubt. Die herab fallenden Regentropfen hatten begonnen, die keimende frühlingshafte Kraft der Weiblichkeit offen zu legen und ihr zu aller Macht über ihn zu verhelfen. Als hätte ein Herrscher mit seinen Legionen und seinen Zauberern die Macht an sich gezogen, so hatte die Urkraft der ewig lockenden Weiblichkeit in Theo die Herrschaft übernommen, ihn zum Untertan gemacht.
Nur haftete dieser Urmacht nichts Schreckliches an, nichts Schwarzes. Keine Furcht durchtrieb Theo, keine Unsicherheit. Stattdessen hatte er die Gewalt über sich verloren. Sein Geist war in diesen Momenten in einer richtungslosen Ferne verschwunden und war ohne jede Beteiligung. Kein Begriff war zu fassen, keine Gedankenfolge zu knüpfen. Theo war gefesselt an der Leine seiner Instinkte. Die süßesten und wunderbarsten Fesseln.
Sollte ihn jedoch die Kraft seiner Arme heute an Lisa fesseln dürfen, würden zugleich die Fesseln der Entbehrungen für die nächsten Stunden, Tage, vielleicht Wochen an Stärke verlieren und würden sich nicht mehr ganz so fest um seine Lenden schnüren. Eine Erlösung würde ihn befreien. In diesem Moment aber hielt sein Hunger nach dem Weib ihn gefangen wie das Netz der Häscher. Wie ein viel zu enger Maßanzug umstrickte ihn die Sucht; durchwirkte ihn. Die Fäden drangen in seine Haut,
durchflochten seine Lenden. Die Muskeln seines Gesäßes spannten sich wieder und wieder an, gehorchten instinktiv seinem Trieb, der sein Ziel gefunden hatte.
Lisa trug nur ihr Kleid und fror dennoch nicht. Sie war keine Mimose. Sie wuchs auf in einem Bauernhaus, in dem es in ihrer Kindheit keine automatische Heizung gegeben hatte. Im Winter musste geheizt werden, so dass es morgens häufig noch kalt war, wenn sie sich wusch. Es gab immer Räume und Flure im Haus, in denen es sehr kalt war. Man sah Lisa frierend fast nur, wenn sie müde oder krank war.
Lisas Gestalt war geprägt von ihren Proportionen, die in einer Weise miteinander übereinstimmten, dass man ihr Gesundheit und Lebenskraft unmittelbar ansah. Sie hatte weder zu dünne Arme, einen zu kleinen Kopf oder einen zu kurzen Hals. Jeder Teil ihres Körpers schien mit den anderen zugleich geschaffen worden zu sein. Alles aus einer Hand, aus einem Guss. Als hätte ein Bildhauer sie erschaffen, der mit seiner Statue die Schönheit der richtigen Proportion beweisen wollte. Ihre Beine, ihre Arme, ihr Busen, ihr Rücken, ihre Taille, ihre Hüften und ihr Schoß waren die Noten eine Melodie. Gleichzeitig zeichnete sich jede ihrer Gliedmaßen durch seine eigene Schönheit, nur übertroffen von der Schönheit der Komposition.
Bewegte sie sich, nahm ihre Schönheit eine weitere Form an. Dank ihrer körperlichen Vorzüge, bedurfte sie keiner Mühe, um in ihrem Gang schön zu sein. Er zeichnete sich aus durch ein Schreiten sicheren Fußes mit einem leichten Wippen, das nicht aufgesetzt war. Kraftvoll doch zugleich gediegen, wie sie ihre Beine vorwärts schob, ebenso kraftvoll drückte sie sich mit dem hinteren Fuß vorwärts. Lisa schlich nicht, sie schlurfte nicht mit den Füßen über den Boden. Auch schien es nicht, wie bei vielen Leuten aus der Stadt, als hingen die Beine wie die einer Marionette irgendwo am Becken angeknüpft und allein der Schwung, der dem hölzernen Bein vom Marionettenspieler versetzt wurde, entschied darüber, wo der Fuß seinen Halt finden würde. Vielmehr war jeder Schritt, den sie tat, wie eine Unterhaltung mit dem Untergrund, auf dem sie sich bewegte und wie ein wieder und wieder einstudierter Tanz. Eine angelernte und wissentlich verinnerlichte Choreographie war in ihrem Gang gleichwohl nicht auszumachen. Es wohnte ihr inne. Ein Talent zu gehen. Sich zu bewegen, zu tanzen und zu schwimmen. Begünstigt durch die natürliche Proportion und veredelt und ganz erheblich geprägt von ihrer Weiblichkeit, die sich ihren Bewegungen wie eine Krone aufgesetzt hatte. Als gäbe man einem Gemälde den richtigen Rahmen, so umschloss und vollendete ihre Weiblichkeit all ihre Bewegungen.
Als der Regen tiefer und tiefer in die Fasern des Kleides zog und damit jeder neue Tropfen schneller an Lisas Haut gelangte, wurde Lisa sich ihrer Haut und ihrer Hülle plötzlich unmittelbar bewusst. Immer weiter entfernte sich ihre Wahrnehmung von der Welt draußen, von der Welt des jahreszeitlichen, sie umgebenden Frühlings hin zu einem Frühling in einem Tagtraum, hin zu der Welt in ihrem Innern, hin zu der Welt, die ihr allein gehörte. Die niedergehenden Tropfen begannen sie verhalten kühl zu umfangen. Mehr und mehr wandelte sich die bloße Feuchtigkeit hin zu Nässe. Gleichwohl war sie noch begrenzt auf die Hautflächen, die dem Regen direkt ausgesetzt waren. Sie begann jeden Tropfen einzeln als zarten Klöppelschlag zu spüren.
Sein Blick lag unverwandt auf ihrer keimenden Weiblichkeit. Eine Aura trat von innen durch den Stoff. Ganz anders war daher Theos Empfinden. Während Lisa sich des Wassers gewahr wurde, wie es sie mehr und mehr benetzte, blieb Theo das Durchnässen seiner eigenen Kleidung verborgen. Er war gefesselt von Lisas Leib. Ein Teil von Lisa, der nie ein Wort sprach, der nie einen Laut oder ein anderes Argument als sich selbst in die Gespräche führte, war das Argument, dem Theo erlegen war. Ein Argument, das eine Sprache sprach, in der es in diesen Momenten der Offenbarung kein Gegenargument gab. Theo konnte nichts anderes tun, als mit seinen Augen diesem Argument zuzuhören. Als der Stoff immer näher den Linien ihrer Haut folgte, war es zuerst ihr Busen, der seine Sinne auf sich zog. Ihre Brüste waren vollkommen. Sie nahmen sich des Stoffes, der sie umgab, ganz und gar an. Für sich betrachtet hätte man meinen können, dass sie ein wenig zu groß wären. Sie überragten in ihrer Üppigkeit rechts und links ein wenig den Brustkorb. Dies lag jedoch allein an dem schmalen Brustkorb, der sich beginnend von Lisas Taille in einer fast geraden Linie bis hin zu ihrer Schulter weitete. Dort wo ihr Busen saß, war dieser breiter als ihr Brustkorb, der darüber aber doch noch an Umfang gewann.
Was das Kleid in seiner anfänglich lockeren Leichtigkeit nur erahnen ließ, gab es jetzt den Augen Theos preis. Jeder neue Tropfen trieb die Enthüllung voran. Das Kleid umspielte den Körper und der Körper trug das Kleid zur Schau. Keines der beiden Dinge hatte zu diesem Zeitpunkt die Oberhand gewonnen. Der Leib ließ sich alle erdenkliche Zeit durch den Stoff an den Tag zu treten. Das Kleid vergab seine lockere Fülle nur nach und nach mit der Vorahnung jeden weiteren Zentimeters verdeckter Haut. Das leichte und luftige Fallen des Stoffes wurde abgelöst von dem Körper in seiner jugendlichen Pracht. So huldigte das Kleid dem Körper, indem es ihn umspielte und ihm Gelegenheit hervorzutreten gab, und der Körper dem Kleid, indem er es sein Schmuck sein ließ.
Bald umschloss der Stoff den Busen ganz. Die Rundungen traten ganz und gar hervor, als sei Lisa nackt.
Der Stoff des Kleides im Muster großer roter Blüten und dem tiefen Grün der Blätter umspielte Lisa. So verloren sich die stärker hervortretenden Konturen ihrer Brüste wieder in den Blüten und Blättern ihres Kleides. Die Atemzüge Lisas wurden schwerer und tiefer. Die Nässe brachte eine unausweichliche Kälte mit sich. Mit jedem Atemzug den Lisa tat, hob und senkte sich ihr Busen.
Minuten später war das Kleid so nass, dass es sich am ganzen Körper immer rascher festsaugte. Bald schon war es so von Wasser durchtränkt, als hätte Lisa bekleidet ein Bad genommen. An ihrem Bauch lag es an und dort, wo die unter dem Stoff liegende Haut ein Abfließen des Wassers verhinderte, war der Schimmer der Nässe beinah silbrig. An ihrem Nabel fehlte der silbrige Schimmer. Jede vom Stoff unberührte Nische ihres Körpers ließ sich dort erahnen, wo der Schimmer fehlte.
Ganz und gar nass hatte ihr Leib das Spiel mit dem Kleid gewonnen. Das Kleid schmiegte sich geschlagen und doch nicht verloren an Lisa und erlaubte ihr, ihren Leib hier unter all den Menschen hervor zu heben.
Theo wusste von mehr als ihm seine Augen zeigten. Theo wusste darum, welche Farbe der Busen von Lisa haben musste. Er wusste, dass ihre Haut von einer sich spannenden Gänsehaut gekrönt war. Er wusste, dass unter der oberflächlich gekühlten Haut eine wundersame Hitze war. Eine Hitze, die er so gut kannte, dass sie ihm auch über die Jahre, in denen er ohne Frau gewesen war, nicht entfallen konnte.
Es gab so verschiedene Arten von Hitze. Da war die anfängliche, brennende Hitze, die entstand wenn sich die Geschlechter ungestüm und entlassen aus allen Fesseln übereinander warfen. Es gab die Hitze, die sich nach dem ersten Sturm ausbreitete, eine alles durchwebende Hitze der gemeinsamen Takte. Und es gab die Hitze des gemeinsamen Schlafes, die wie ein heilender Balsam den Körper vom Kopf bis zu den Zehen durchdrang, die im Schlaf Besitz von den erlösten Punkten des Leibes ergriff, vom ganzen, befriedeten und gesättigten Körper.
Theos Gedanken kreisten um die verborgene Hitze, die wohl auch jetzt an einer Stelle bis an die Oberfläche treten könnte, obwohl Lisas Körper bereits ganz von kühler Nässe umgeben war.
Die Tropfen trafen Lisa jetzt zahlreich und ungebremst. Sie spürte jeden Tropfen, als wäre sie nackt. Jeder Tropfen traf nicht ihr Kleid, sondern sie selbst – ihren Leib, dort wo er seine Grenze zur Außenwelt fand. Je stärker der Regen wurde, umso mehr wurde sich Lisa ihrer Haut und damit der Linien ihres Leibes bewusst. Diese Linie trennte die Orte des Raumes in ihrem Körper, die ihrem Empfinden, ihrem Wahrnehmen und dem Befehl ihres Geistes unterstanden und dem Raum außerhalb dieser Grenze, der niemandem oder anderen gehörte. Plötzlich wurde ihr das Einschlagen der Tropfen ganz vordergründig gegenwärtig. Ihre Haut, die sie zuvor nicht spürte, entstand nun aus der Summe der einzelnen Aufschläge neu. Mit jedem Tropfen ein zarter, in seinen Grenzen verschwimmender Kreis. Alle Stellen, die in kurzer Folge getroffen wurden, ließen hinter ihren geschlossenen Augenlidern die Gänze ihres Körpers neu entstehen, geformt aus dem Gefühl der Empfängnis. Ohne Unterlass griffen weitere Kreise in- und übereinander. Wellenförmig breitete sich ein Kitzel auf ihrer Haut aus. Sie fühlte sich wie die Oberfläche eines Sees im Regen. Durchmischt von der Kälte die sich darunter in ihre Glieder schob. Mit einem zarten Kribbeln zog das Frieren wie ein Hauch aus einer eisigen Tiefe über jede Pore ihrer jugendlich gespannten Haut. Ihre Brüste waren straff, die Brustwarzen standen fest zusammengezogen empor.
Die Spannung der Haut übertrug sich auf ihren ganzen Körper, der nun auch innerlich von einem Zittern ergriffen war und sich alle ihre Muskeln nach und nach spannten, beginnend in den Beinen bis hin zu den Armen und dem Nacken. Ihr rann der Regen über das Gesicht herab, am Hals, über den Kehlkopf, über die Mulde, die sich oberhalb des Brustkorbes am Hals befand, über ihr Dekolleté und ihre Brüste. Sie sah an sich herab und konnte dem Rollen der Tropfen über die kleinen Erhebungen der Gänsehaut folgen, konnte sehen, wie sich das Wasser zwischen ihren Brüsten zu einem Rinnsal sammelte, das sich unter ihren Brüsten im Kleid verlor.
Theo nahm Lisa wieder und wieder Maß. Als wäre es seine Aufgabe, einen weißen Fleck in der Landkarte zu tilgen, musterte er jede Gegebenheit Lisas. Was war das, dieser Leib? So gleich und so verschieden. Hier diese enge, ganz andere Kurve, mit der sich die Taille vom Becken trennte. Er wollte zugreifen. Es folgte die sanfte Wölbung der Lenden hin zur Mitte und die nachfolgende kleine Mulde und die weiche ovale Erhebung rings herum um die Vertiefung des Nabels. Der Nabel der Frau, der höher sitzt als der eines Mannes. Den in der Mitte ihres Bauches einem Thron gleich eine Erhebung umgibt. Der sich darbietet. Der sich in ein Licht stellt. In ein Licht neben den anderen Begehrlichkeiten. Theo konnte Lisas Nabel nicht sehen. Er erahnte ihn nur unter dem Kleid, dessen Nässe es zur zweiten Haut werden ließ. In dem erhabenen Oval Lisas Bauches verlor sich ihr schwerer Atem in seinen letzten Ausläufern in verhaltenen Wellen.
Lisas Leib war vor Theo verhüllt. Gleichwohl bot er sich ihm dar, wie ein Kunstwerk, das es zu betrachten galt. Nicht belanglos und beliebig etwa, wie bloß hingeworfen oder vergessen, stand sie da, sondern sie war eine Darbietung. Ihre Erscheinung war gleich einem Wohlklang. Theo betrachtete sie in einer Weise, als lausche er heimlich hinter verschlossener Tür einer Generalprobe. Ungestüm vor Erwartung der Aufführung, erfasst von der Lust, die Töne nicht leise und gebrochen hervordringend hinter dicken Türen in ihrem Zusammenspiel nur wahrzunehmen, sondern sie laut in all ihrer Klarheit hervorgestoßen von den Musikern in ihrer Leidenschaft als ganze Komposition zu empfinden, frohlockte er über den kommenden Moment, die Tür endlich aufstoßen zu können. So erkannte Theo die unaussprechliche Schönheit dieser Komposition zwar durch die geschlossene Tür, doch wollte er die Aufführung in der ersten Reihe sehen; jeden einzelnen Musiker in der Leidenschaft seines Instrumentenspiels erleben. Die Geige, das Cello, das Klavier und das Becken mit seinem schweren Schlag.
Es dürstete Theo nach dem nackten Leib und dennoch genoss er auch diese verhüllte Vorahnung gepaart mit einer unabänderlichen Nervosität.
Welten trennten Theo und Lisa. So wie Lisa nur sich selbst wahrnahm, weilte Theo allein bei Lisa. Lisas Augen starrten in die Leere. Ihr Blick war nach innen gewandt und gerichtet auf jede einzelne Regung, auf jeden einzelnen Tupfer eines Regentropfens, auf die sie umgebende kribbelnde Fläche der nassen Kälte. Noch nie hatte sie ein Regenschauer so spürbar berührend umhüllt. Noch nie hatte sie sich selbst so unverhofft aus dieser Nähe wahrgenommen. Mehrere Minuten ließ sie die Aufführung dieses fremden Schauspiels in ihrem Innern geschehen, den Reigen der Schauer aus Regen und Kälte, aus Atem und dem Spannen in ihren Brüsten, dem kalt klebenden Anschmiegen des nassen schweren Stoffes und die Wogen der Gänsehaut auf ihr spielen, bis sie erst Minuten später wieder in die Runde sah.
Um sie herum hatte sich eine Situation ergeben, die von Spannung angefüllt war. Die meisten der Händler hatten sich unter Ständen und kleinen überhängenden Dächern zusammendrängend vor dem Regen in Schutz gebracht. Die Schlange derer, die wegen des Lauchkuchens vor dem Backofen anstanden, war auf weniger als die Hälfte zusammengeschmolzen. Die Verbliebenen hatten den Kopf krampfhaft in den Nacken geschoben. Ihre Körper hatten sie nach innen gekrümmt. Lisa betrachtete die Schlange derer. Etwas war anders. Es gab etwas, was die Schlange besonders machte. Sie vermochte nicht sofort zu erkennen was es war. Sie sah sich jeden einzelnen der dort Stehenden an und alle sahen sie an. Wie ein Schlag traf es sie: nur Männer. Einige stierten sie an, andere wagten es nur dann und wann einen verstohlenen Blick unter ihren in die Tiefe gezogenen Augenbrauen auf sie zu werfen. Wieder andere streiften, ohne sich darüber Gedanken zu machen, wie offensichtlich es war, immer aufs neue mit lüsternem Blick an Lisas Leib auf und ab, führten dabei ihren Kopf in seiner Neigung nach. Keine einzige Frau war unter den Wartenden verblieben. Wie ein Rudel zum Sprung bereiter Hyänen, die einen ihren unterdrückten Hunger kaum mehr beherrschend, die anderen devot und auf günstige Gelegenheit wartend, standen die Männer um sie herum, von einem Fuß auf den anderen tretend. Nach und nach hatten sie einen Bogen gebildet, der seinen Mittelpunkt dort hatte, wo Lisa stand. Je nach Rang in der Hackordnung des Rudels – so schien es Lisa – ließen die Männer mehr oder weniger offensichtlich ihre Absichten und ihre Gedanken erkennen.
Theo war einer von ihnen. Theo aber war benommen. Anders als die geifernden Blicke eines Teils der Männer und der schüchtern haschenden Blicke des anderen Teils, haftete Theos Blick Lisa an, wie der eines Gläubigen, der sich einer Erscheinung gegenüber sieht. Alles Übrige in Theo war verstummt. Lisa stand wie angewurzelt, im Schreck über den bevorstehenden Angriff des Rudels erstarrt. Doch war dieses Gefühl im nächsten Moment erloschen. Lisa erkannte, wie viel den Männern dort vor ihr zum Raubtier fehlte. Eine wundersame Leere machte sich in ihr für einen kurzen Moment breit. Nach einem Moment der inneren Unordnung und Orientierungslosigkeit vollzog sich in ihr eine Veränderung. Tief in ihr erwachte etwas.