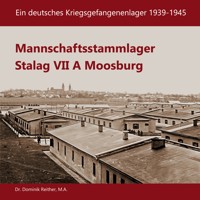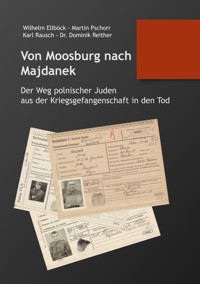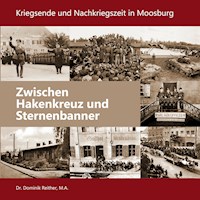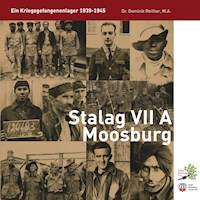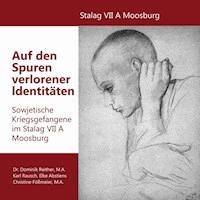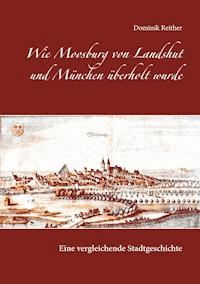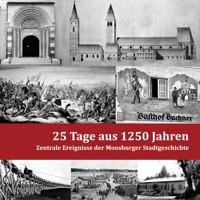
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Besuch Kaiser Arnolfs 890, der Stadtbrand 1865, die Elektrifizierung 1908 oder das Kriegsende 1945 waren wichtige Daten in der Moosburger Stadtgeschichte. Anlässlich des Stadtjubiläums 1250 Jahre Moosburg stellt dieses Buch in 25 kurzen Kapiteln mit zahlreichen Bildern diese Ereignisse vor. Manche von ihnen haben die Stadt und das Leben der Moosburger massiv verändert, manche haben Nachwirkungen bis heute.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 146
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
21.03. 890: Ein Kaiser in Moosburg
28.01.1171: Landtag in Moosburg
02.06.1207: Der Plan entsteht
21.10.1212: Neu-Weihe des Kastulus-Münsters
19.08.1281: Aussterben der Burghartingter
09.11.1313: Die Schlacht bei Gammelsdorf
17.03.1331: Die Stadtrechtsverleihung
09.04.1468: Der Bau des Hochchores von St. Kastulus beginnt
07.07.1595: Die Verlegung des Kollegiatstifts St. Kastulus nach Landshut
05.05.1632: Schwedens König Gustav Adolf in der Stadt
03.05.1803: Aufhebung des Kollegiatstifts St. Kastulus
30.12.1805: Napoleon in Moosburg
03.11.1858: In Moosburg beginnt der Bahnbetrieb
13.06.1865: Der Moosburger Stadtbrand
27.07.1870: König Ludwig II. in Moosburg
24.12.1908: Die Elektrifizierung Moosburgs
17.11.1909: In Moosburg beginnt die Industrialisierung
01.08.1914: Der Erste Weltkrieg beginnt
25.03.1919: Isarkanal und Kraftwerk Pfrombach
26.04.1933: Machtergreifung in Moosburg
01.09.1939: Der Zweite Weltkrieg beginnt
19.10.1939: Stalag VII A - Die ersten Gefangenen treffen ein
29.04.1945: Das Kriegsende in Moosburg
08.06.1945: Das Internment Camp No. 6 entsteht
12.05.1948: Der Anfang der Neustadt
Vorwort
25 Tage in 1250 Jahren –
der Titel ist zugleich Programm des Buches. In 25 Kapiteln werden Ereignisse der Moosburger Geschichte vorgestellt, die prägend für die Stadt waren – wobei prägend viele Facetten hat. So hatten einige Ereignisse große Auswirkungen auf die Entwicklung Moosburgs, so die Verlegung des Kollegiatstifts St. Kastulus nach Landshut 1595 oder die Ansiedlung des ersten Industriebetriebes 1909. Andere haben das Stadtbild bestimmt, so die Anlage des Plans 1207 oder der Stadtbrand 1865. Bei manchen waren die Auswirkungen zunächst noch gar nicht abzusehen, wie bei der Errichtung des Stalag 1939. Manche Ereignisse verbanden Moosburg gewissermaßen mit der überregionalen Geschichte, zum Beispiel die Schlacht bei Gammelsdorf 1313 oder der Aufenthalt des schwedischen Königs Gustav Adolf in der Stadt 1632. Und immer wieder kamen auch Herrscher nach Moosburg, so Kaiser Arnolf 890 oder König Ludwig II. 1870. Andere Ereignisse wiederum veränderten das Alltagsleben der Moosburger wie der Anschluss an das Eisenbahnnetz 1858 oder die Elektrifizierung 1908.
Die Kapitel sind 2022 als Artikel im Rahmen einer Serie zum Stadtjubiläum „1250 Jahre Moosburg“ in der Moosburger Zeitung erstmals erschienen. Daher gilt mein Dank zunächst der Mediengruppe Attenkofer, die großzügigerweise den Abdruck gestattet hat, namentlich Herrn Lehner und Frau Karl-Fischer. Bedanken möchte ich mich auch bei meiner Frau Christine Metterlein-Reither für zahlreiche Anmerkungen, Hinweise und Korrekturen, bei Günther Strehle für das Layout, bei Karl A. Bauer für die vielen Bilder, die er aus seinem Online-Bilderarchiv www.alt-moosburg.de zur Verfügung gestellt hat und bei der Stadt Moosburg für ihre Unterstützung.
21.03.890: Ein Kaiser in Moosburg
St. Michael im höchsten Bereich des Stadtberges: In diesem Bereich dürfte sich der königliche Gutshof befunden haben, Bild aus dem frühen 20. Jhdt. (Archiv Karl A. Bauer).
Am 21.3.890 hielt sich der spätere Kaiser Arnolf (ca. 850-899) in Moosburg auf. Er stellte hier eine Urkunde für das Kloster St. Emmeram aus, daher ist sein Aufenthalt in Moosburg belegt.
Arnolf war von 887-899 König des ostfränkischen Reiches (in etwa die Gebiete des Westteils der heutigen Bundesrepublik, Elsass und Lothringen, Friesland sowie Teile der Schweiz und Österreichs) und von 896-899 Kaiser. 891 konnte er die Wikingerüberfälle auf das Ostfrankenreich beenden und damit Stabilität in Norddeutschland schaffen. Arnolf stützte sich bei der Ausübung seiner Herrschaft besonders auf Bayern, Regensburg wurde zu einem Zentrum seiner Macht.
Auf dem Weg nach Ungarn
Zur Zeit Arnolfs gab es noch keine Hauptstädte, sondern der Herrscher zog durch sein Reich und hielt sich in Städten und Siedlungen, königlichen Gutshöfen, Klöstern, Stiften sowie Bischofssitzen auf, wo er zu Gericht saß, Ämter verlieh und Urkunden ausstellte. Der König musste auf diese Weise seinen Herrschaftsanspruch zeigen. Ließ er sich in einem Gebiet zu lange nicht blicken, lief er Gefahr, dort nicht mehr als Herrscher akzeptiert zu werden. Arnolf war auf dem Weg zu einer Heeresversammlung in Pannonien (Gebiet der Steiermark und Nordwestungarn), als er in Moosburg Station machte.
Arnolfs Beziehungen nach Moosburg
Dass der als Ausstellungsort der Urkunde angegebene Ort „Mosapurc“ tatsächlich Moosburg an der Isar ist, ist zwar nicht unumstritten. Eine systematische Rekonstruktion des Reiseweges Arnolfs hat jedoch ergeben, dass mit „Mosapurc“ nur Moosburg an der Isar gemeint sein kann. Die Bezeichnung „civitas regia“ für Moosburg in dieser Urkunde deutet auf eine weitere Siedlung neben der Klostersiedlung hin und ist damit ein Beleg für eine Siedlung um die Kirche St. Michael. „Civitas regia“ ist nämlich mit „königliche Siedlung“ zu übersetzen, was für eine Klostersiedlung nicht passen würde, jedoch für eine Siedlung um den ehemals herzoglichen, inzwischen königlichen Gutshof bei der Kirche St. Michael. Arnolf hatte zudem Beziehungen in die Umgebung von Moosburg, seine Mutter Liutswinde besaß den Hof Erding als Lehen.
Besitzübertragungen an St. Emmeram
In Moosburg gab Arnolf in einer Urkunde dem Kloster St. Emmeram in Regensburg Besitzungen in Hessen zurück. Zusätzlich beauftragte er Gefolgsleute, die Grenzen dieser Besitzungen des Klosters St. Emmeram festzustellen. Die Güterübertragung an das Kloster St. Emmeram erfolgte zum Gedächtnis an den Vater Arnolfs, König Karlmann.
Der Ort Moosburg
Die Beurkundung in Moosburg liefert wichtige Informationen über den Ort. In der Urkunde sind insgesamt 100 Zeugen aufgeführt. Es handelt sich zunächst um sieben Grafen, darunter die mächtigsten in Bayern und Alemannien (Schwaben). Dann folgen 93 weitere Zeugen. Interessant sind vor allem die sieben Grafen. Sie stammen teilweise aus Gebieten, die weit von Moosburg entfernt sind. Arnolf selbst zog mit einem größeren militärischen Gefolge nach Pannonien. Es ist anzunehmen, dass sich auch die Zeugen mit einer entsprechenden Begleitung in Moosburg eingefunden hatten. Zusammen mit dem Hof Arnolfs muss sich also eine relativ große Zahl an Personen in Moosburg aufgehalten haben. Dies setzt eine gewisse Größe und Leistungsfähigkeit voraus. Ein solcher Aufenthalt des Königs bedeutete nämlich für mittelalterliche Verhältnisse enorme Anforderungen an Ressourcen und Organisation. Für mehrere hundert Menschen – neben König und Adeligen auch deren jeweiliges Gefolge und Dienstpersonal – mussten Nahrung und Schlafgelegenheiten zur Verfügung stehen. Tiere waren zu versorgen. An Waffen, Sätteln, Zaumzeug und Wagen mussten Ausbesserungs- und Instandsetzungsarbeiten vorgenommen werden. Hierzu war eine gewisse Anzahl geschulter und spezialisierter Handwerker nötig. Moosburg muss damals also schon eine gewisse Größe gehabt haben.
28.01.1171: Landtag in Moosburg
Herzog Heinrich der Löwe hält einen Landtag in Moosburg ab
Im Januar 1171 hielt Herzog Heinrich der Löwe (ca. 1130 bis 1195, Herzog von Bayern 1156 bis 1180) einen Landtag für das Herzogtum Bayern in Moosburg ab. Ein Landtag war eine Versammlung der weltlichen und geistlichen Würdenträger des Herzogtums. Je nach Bedarf berief der Herzog in unregelmäßigen Abständen Landtage ein, zu denen die Adeligen, aber auch die bayerischen Bischöfe erscheinen mussten. Schon die Teilnahme an der Versammlung war eine politische Aussage: Wer unentschuldigt fernblieb, zeigte, dass er den Herzog nicht anerkannte.
Die Landtage hatten verschiedene Funktionen: Hier wurden die Wahl oder die feierliche Zustimmung zur Einsetzung eines neuen Herzogs durchgeführt. Der neue Herzog konnte so erkennen, auf wen er sich bei der Ausübung seiner Herrschaft stützen konnte. Hier wurde außerdem die große Politik des Herzogtums gemacht, hier wurden grundlegende Entscheidungen getroffen. Der Herzog konnte nämlich seine Ziele nicht einfach so durchsetzen, er war auf die Unterstützung der Großen des Landes angewiesen. Während der Landtage konnte er auf die führenden Vertreter des Herzogtums einwirken und ihre Zustimmung zu seinem Vorhaben erreichen. Die Würdenträger wiederum konnten im Rahmen der Verhandlungen ihre Interessen geltend machen. Entscheidungen wurden also zwischen dem Herzog einerseits und den Adeligen und Bischöfen andererseits vereinbart. Letztere konnten aktiv auf die Herrschaft Einfluss nehmen.
Auf den Landtagen wurden so wichtige Themen des Herzogtums beraten, wurden Entscheidungen getroffen und Regeln beschlossen sowie Streitigkeiten geschlichtet. Ein wichtiges Thema war die Friedenswahrung durch das Zurückdrängen von Fehde und Selbsthilfe. Außerdem vergab der Herzog Privilegien und Lehen.
Die Entscheidungsträger des Herzogtums in Moosburg
Es war eher selten, dass solche Versammlungen außerhalb Regensburgs, des Hauptortes Bayerns, stattfanden. Warum Moosburg als Tagungsort bestimmt wurde, ist unklar, doch könnte der geplante Neubau des Kastulus-Münsters ein Motiv gewesen sein. Vielleicht nahm der Herzog an der Grundsteinlegung teil oder er hoffte, die Landtagsteilnehmer zu Spenden an das Stift bewegen zu können, um so den Kirchenbau voranzutreiben.
An dem Landtag in Moosburg, der vermutlich mehrere Tage dauerte, nahmen unter anderem Pfalzgraf Otto VI. von Wittelsbach, Pfalzgraf Friedrich II. von Wittelsbach, Burggraf Heinrich von Regensburg, die Grafen von Dachau, Riedenburg, Wasserburg, Valley, Falkenstein, Sulzbach, Andechs und Vohburg sowie mindestens 64 Edelfreie teil.
Die Moosburger Familie der Burghartinger war auf dem Landtag jedoch nicht vertreten. Wahrscheinlich war der spätere Graf Konrad II. (gestorben 1218) noch minderjährig. Sein Vater Burghart V. war mit Kaiser Friedrich Barbarossa nach Italien gezogen und 1162 in den Kämpfen vor Mailand gestorben. Allerdings nahm wahrscheinlich Konrads späterer Schwiegervater Graf Konrad von Roning an der Versammlung teil.
Ein Moosburger war jedoch auf dem Landtag vertreten: Conrad Herscast, ein Dienstmann der Burghartinger. Er wurde offensichtlich als würdig anerkannt, an den Beratungen der Entscheidungsträger des Herzogtums mitzuwirken. Auch die Edlen der Umgebung waren mit von der Partie, so Theodor von Moosen (Vils), Albero von Bruckberg sowie Bertold von Mauern. Da Herzog und Grafen mit Gefolge anreisten, muss Moosburg in dieser Zeit in der Lage gewesen sein, über mehrere Tage hinweg eine große Anzahl von Menschen zu beherbergen und zu verköstigen. Moosburg war also damals bereits eine Siedlung von einer entsprechenden Größe und Leistungsfähigkeit.
Entscheidungen auf dem Landtag
Einige Entscheidungen des Moosburger Landtags sind noch nachvollziehbar: So schlichtete man einen Streit zwischen zwei edelfreien Brüdern aus Abensberg und dem Kloster Admont (Steiermark) wegen der Übergabe eines an das Kloster verkauften Gutes, ebenso eine Auseinandersetzung zwischen dem Kloster Biburg und einem Eberhard wegen mehrerer Güter. Außerdem wurde auf dem Landtag wahrscheinlich die Grafschaft Dornberg (Landkreis Mühldorf am Inn) errichtet. Auch die Moosburger Stiftsherren konnten einen Streit beilegen: Ein Gottschalk von Reichersdorf verzichtete auf ein Gut in Reichersdorf gegen Bezahlung von 3 Talenten durch den Besitzer, den Kanoniker Waltmann.
Der Plan, dass anlässlich des Landtags Stiftungen zugunsten des Neubaus des Kastulus-Münsters erfolgen sollten, ging auf: Pfalzgraf Friedrich II. von Wittelsbach übergab ein Gut in Endorf (Landkreis Ebersberg) zur Fertigstellung des Kirchenneubaus. Ein Priester stiftete ein Gut bei Dorfen. Damit hat der Landtag zumindest indirekt bis heute Spuren in der historischen Altstadt hinterlassen.
Auf dem Plan. Kastulusmünster 1910 (Archiv Karl A. Bauer).
02.06.1207: Der Plan entsteht
Auf dem Plan 1932 (Archiv Karl A. Bauer).
Am 02.06.1207 brannte die Burg der Grafen von Moosburg ab, wobei auch das Münster schwer beschädigt wurde. Graf Konrad II ließ den Platz einebnen und mit einem Bauverbot belegen: Der Plan war entstanden.
Die Burghartinger
Die Familie der Grafen von Moosburg, die Burghartinger, ist wahrscheinlich gegen Ende des 11. Jahrhunderts aus dem Regensburger Gebiet nach Moosburg zugewandert. Zu dieser Zeit gehörten die Burghartinger, vor allem die Brüder Burghart II. und Berthold, zur Spitzenschicht im Reich. Die Familie begann ab 1106 von Moosburg aus einen Herrschaftsbezirk aufzubauen. Auf diese Weise wurde die Siedlung Verwaltungssitz eines kleinen Territoriums. Sie bekam damit eine, wenn auch in geringem Umfang, zentrale Funktion für das nähere Umland. Mit dem Tod des kinderlosen Konrad V. am 19.08.1281 starben die Burghartinger aus.
Eine Burg auf dem Plan
Zunächst hatten die Burghartinger eine Burg auf dem Plan. Ihr genauer Standort ist unbekannt, die bisherigen archäologischen Untersuchungen des Areals haben keine entsprechenden Spuren ergeben. Es dürfte sich um eine für diese Zeit typische einfache Anlage gehandelt haben: Eine Befestigung mit Wall, Graben und Palisaden, in der Mitte ein hölzerner Turm auf einem Hügel und rundherum hölzerne Nebengebäude.
02.06.1207: Die Burg brennt ab
Am 02.06.1207 brannte diese Burg auf dem Plan ab. Die Ursache für das Feuer und der Verlauf des Brandes sind nicht bekannt. Bei dem Brand kam die Frau des Moosburger Grafen, Benedikta, ums Leben. Von dem Brand und seinem genauen Datum wissen wir, weil Konrad eine Messstiftung einrichtete, damit am Todestag seiner Frau für sie Messen gelesen werden konnten.
Das Feuer griff auch auf das 1184 fertiggestellte Kastulus-Münster über und beschädigte es schwer. Die Kirche wurde innerhalb weniger Jahre wieder hergestellt: Am 21.10.1212, dem Ursulatag, wurde sie neu geweiht.
Planierung und Bauverbot: Der Plan entsteht
Graf Konrad entschloss sich, seinen Herrschaftssitz nicht wieder an Ort und Stelle zu errichten. Er baute stattdessen eine neue Burg am Weingraben, auf dem Gebiet, wo heute das Gebäude des ehemaligen Amtsgerichts steht.
Die Ruine am alten Standort ließ er abtragen und das Gelände einebnen, also planieren. Der so entstandene Platz erhielt den Namen „Auf dem Plan“. Konrad übertrug diesen Platz an das Stift St. Kastulus mit der Maßgabe, dass dort in Zukunft keine Gebäude mehr errichtet werden durften, die der Kirche gefährlich werden könnten.
Die Häuser rund um den Plan entstanden spätestens ab dem Ende des 13. Jahrhunderts, weil die Stiftsherren in dieser Zeit das gemeinsame Leben aufgaben und sich nun eigene Haushalte einrichteten.
Auf dem Plan, 30er-Jahre (Archiv Karl A. Bauer).
21.10.1212: Neu-Weihe des Kastulus-Münsters
Luftbild der beiden Stadtkirchen St. Johannes und St. Kastulus, 80er-Jahre (Archiv Karl A. Bauer).
Das prägendste und kunsthistorisch wertvollste Gebäude Moosburgs ist das Kastulus-Münster. Seit 1212 steht die ehemalige Kirche des Chorherrenstiftes St. Kastulus in ihrer Grundform weitgehend unverändert am Plan nördlich der Altstadt. Am 21.10.1212, dem Ursulatag, wurde die Kirche geweiht.
Ein Vorgängerbau des frühen Mittelalters
Das heutige Münster ist der dritte, vielleicht sogar der vierte Kirchenbau an dieser Stelle. Bei der Restaurierung des Münsters wurden 2006 archäologische Untersuchungen vorgenommen. Dabei legten Archäologen Fundamentreste einer Kirche frei, die man auf die Zeit zwischen etwa 668 und 748 datieren konnte. Möglicherweise gab es noch einen (hölzernen) Vorgängerbau.
Die Ausmaße dieser Kirche kann man nur in Ansätzen nachvollziehen. Sie war vermutlich 10 m breit und einschiffig. Im Norden reichte der Bau wohl bis an den Bereich der Pfeilerreihe des heutigen Mittelschiffes, die zum Kastulusplatz zeigt. Nach Westen war die Kirche etwa 10 Meter kürzer, die Länge nach Osten ist derzeit nicht zu ermitteln. Vielleicht war die Kirche im Gegensatz zum heutigen Münster exakt nach Osten ausgerichtet.
Auch zum Aussehen dieser Kirche lassen sich einige Aussagen treffen. Es handelte sich um einen Steinbau, für den Flusskiesel und Tuffstein verwendet wurden. Er war mit Schindeln gedeckt. Bemalte Putz- und Estrichreste lassen auf eine reiche Ausschmückung schließen.
1171-1184 Neubau des Münsters
Im Zeitraum von 1110 - 1120 stürzte die Decke dieses Vorgängerbaus ein und erschlug neben dem Stifts-Dekan auch einige Kirchenbesucher. Das Münster scheint nur notdürftig wiederhergestellt worden zu sein, da man sich wohl schon mit dem Gedanken an einen Neubau trug. Auf dem Landtag 1171 in Moosburg wurden dem Stift umfangreiche Schenkungen für den Kirchenbau gemacht. Wahrscheinlich weihte Bischof Adalbert von Freising die Kirche im Jahr 1184.
Dieser Bau aus dem 12. Jahrhunderts bestand aus Tuffstein. Er war mindestens 40 Meter lang und bereits als dreischiffige Basilika errichtet. Mit einer Breite von 18 Metern war er etwa 6 Meter schmäler als die heutige Kirche. Die Ausrichtung der Kirche entsprach dem heutigen Bau. Seine Wand in Richtung Plan lag exakt unter der Stützenreihe des südlichen Hauptschiffes. Die dem Kastulus-Platz zugewandte Außenmauer hat sich in der heutigen Nordwand des Münsters erhalten. Der Abschluss im Westen ist mit dem heutigen identisch.
Auch das Tympanon-Relief über dem Hauptportal, das Kaiser Heinrich II., Maria, den segnenden Christus, St. Kastulus und Bischof Adalbert von Freising zeigt, stammt aus dieser Zeit: Die Unterschrift unter dem Relief lautet: „Dieses so großartige Gotteshaus bringt Dir, Castulus, der glückliche Bischof dar, dem Du ein mächtiger Schutz sein mögest. Ihm sei auch der König (Heinrich II.) gnädig, der Dir wieder den Glanz verlieh, welcher Dir so lange Zeit hindurch entzogen war.“
1207-1212 Wiederaufbau des Münsters
Am 02.06.1207 brannte die Burg der Grafen von Moosburg auf dem Plan ab. Die Ursache für das Feuer und der Verlauf des Brandes sind nicht bekannt. Das Feuer griff auch auf das Kastulus-Münster über und beschädigte es schwer.
Die Stiftsherren sahen dieses Unglück offensichtlich als Chance und begannen mit dem Wiederaufbau in vergrößerter Form. Das Kirchenschiff wurde nach Süden, Richtung Plan verbreitert. Diesmal verwendete man statt Tuffstein Ziegel. Die unterschiedlichen Bauphasen sind heute noch an der Westwand erkennbar: links vom Portal kann man das Mauerwerk in Tuffstein erkennen, rechts die regelmäßige Ziegelwand.
Das Westportal wurde dabei wahrscheinlich nach Süden versetzt, mitsamt dem Tympanon-Relief über dem Eingang. An den beiden äußeren Säulen des Münsterportals sind Fabelwesen, Symbole und Ornamente angebracht, die heute kaum zu deuten sind.
Das Münster wurde am 21.10.1212, dem Ursula-Tag, von den Bischöfen Otto II. von Freising und Hartwig von Eichstätt neu geweiht. Zu diesem Anlass wurde der Moosburger Ursulamarkt eingeführt.
Vorhalle, Kreuzgang und Kapellen: Das Münster im Späten Mittelalter
Bis zum Ende des Mittelalters kamen weitere Elemente hinzu. Umfangreiche Untersuchungen der Kunsthistorikerin Martina Außermeier haben hier neue Erkenntnisse erbracht. So kann man nachvollziehen, dass der Kastulusturm vermutlich um die Mitte des 13. Jahrhunderts ergänzt wurde. Eine Vorhalle vor dem Hauptportal wurde um 1400 errichtet. Sie könnte zumindest zeitweise als Gerichtshalle gedient haben. 1468 ließen die Stiftsherren den Hochchor anbauen. Es liegen Hinweise auf Planungen vor, nach denen das gesamte Hauptschiff aufgestockt und mit einem gotischen Gewölbe versehen werden sollte. Diese Pläne wurden jedoch nicht umgesetzt. Neben einer gotischen Überarbeitung der Ursulakappelle kam 1490 die Sakristei hinzu. Um diese Zeit wurden auch die Seitenschiffe gotisch überwölbt.
Die Umgebung des Münsters sah deutlich anders aus als heute: Der Vorgängerbau der heutigen Volksbank war eine Kapelle, die dem heiligen Martin geweiht war. Sie diente als Friedhofskirche mit Beinhaus und wurde deswegen auch als Arme-Seelen-Kapelle bezeichnet. Im Bereich des Kastulusplatzes schlossen Kapellen an die Sakristei an. Wahrscheinlich direkt an die Sakristei war eine St. Anna-Kapelle angebaut, im Norden gefolgt von einer Maria-Hilf-Kapelle. Das Portal zum Kastulusplatz war vermutlich der Zugang zum Kreuzgang, der sich im Bereich des Kastulusplatzes und des heutigen Klosters erstreckte und an den die beiden Kapellen angebaut waren.
Dagegen haben sich wesentliche Teile der Innenausstattung, nämlich der Leinberger-Altar und das Chorgestühl, bis heute erhalten.