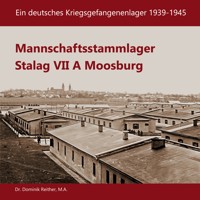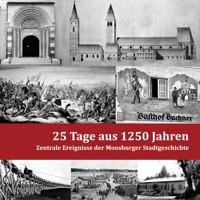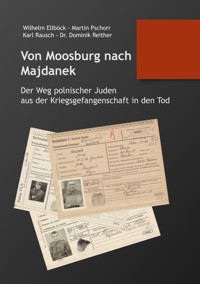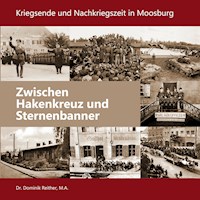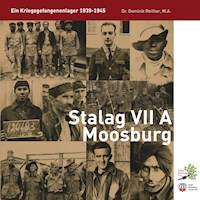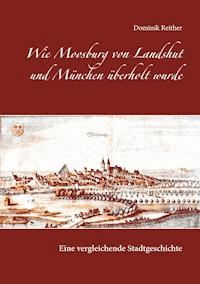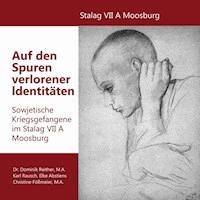
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Sowjetische Kriegsgefangene hatten im 2. Weltkrieg unter deutlich schlechteren Bedingungen zu leiden als die übrigen Gefangenen. Obwohl sie die zweitgrößte Gruppe im Kriegsgefangenenlager Stalag VII A in Moosburg darstellten, sind ihre Schicksale bislang häufig nur in pauschalen Zusammenhängen betrachtet worden. Die vorliegende Publikation -Auf den Spuren verlorener Identitäten- zeigt die ideologische Situation und die prekären Lebensbedingungen der sowjetischen Kriegsgefangenen auf, ebenso aber Besonderheiten im Stalag VII A. Wie stellte sich hier die Lagerleitung gegen die berüchtigten Aussonderungen? Wie entfaltete eine Widerstandsgruppe - die B.S.W. - ausgehend vom Moosburger Lager ihre Wirkung noch über Südbayern hinaus? Neu erschlossene oder erstmals in ihren Inhalten und Aussagen gesichtete Quellen mit tausenden von Registrierungsnummern und penibel geführten Dokumenten öffnen auch den Blick auf die Einzelschicksale. Die Namen der Toten werden zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder genannt, und manches Gesicht ist nun in all seiner Individualität wieder sichtbar. Drei wissenschaftlich fundierte Beiträge von den Historikern Dr. Dominik Reither und Karl Rausch, Elke Abstiens und der Kunsthistorikerin Christine Fößmeier nähern sich dem Thema aus historischen, wie aus menschlichen Blickwinkeln an.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 611
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Danksagung
Vorwort
Teil I Zwischen Vernichtung und Widerstand
Das Leben sowjetischer Gefangener im Stalag VII A Moosburg
Dr. Dominik Reither, M.A.
Teil II Nummern eine Seele geben
Archive erzählen von Schicksalen
Karl, Rausch, Elke Abstiens, Christine Fößmeier, M.A.
Teil III Gelacht, gelitten, gelebt, gestorben
Gesichter sowjetischer Gefangener in Fotografie und Kunst
Christine Fößmeier, M.A.
Über die Autoren
Danksagung
Seit Herbst 2013 widmet sich der Verein Stalag Moosburg e.V. der Recherche und der Dokumentation der Geschichte des ehemaligen Kriegsgefangenenlagers Stalag VII A, das während der Jahre 1939-45 in Moosburg a.d. Isar existierte. Die Stadt Moosburg hat schon während meiner Zeit als Bürgermeister eine Gedenkstätte für die verstorbenen Gefangenen auf dem Gelände des ehemaligen „Russenfriedhofs“ in Oberreit errichtet. Von Anfang an war es mir daher als Gründungsvorstand des Vereins ein besonderes Anliegen, die zum Teil katastrophalen Lebensumstände der sowjetischen Kriegsgefangenen im Stalag VII A einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Aktivitäten mündeten in ein Forschungsprojekt mit Ausstellungen und Vorträgen zur Situation der sowjetischen Gefangenen, die in diesem Buch eindrucksvoll dokumentiert werden.
Die vier Autoren (Dr. Dominik Reither, Karl Rausch, Elke Abstiens, Christine Fößmeier) haben mit unterschiedlichen Beiträgen dabei mitgewirkt. Mein Dank gilt neben ihnen all denen, die das Vorhaben über mehr als ein Jahr begleitet haben: dem Stadtarchivar der Stadt Moosburg, Wilhelm Ellböck, für die wertvollen Informationen zur Recherche und seine engagierte Kooperation, den Mitarbeitern des Bundesarchivs-Militärarchiv und des Staatsarchivs München für ihre Unterstützung, Reinhard Otto für die wertvollen Hinweise zu den historischen Quellen, Margarethe Burger und Bernhard Kerscher für die Überlassung des Manuskripts des Lagerkommandanten Otto Burger, der Stadt Moosburg für finanzielle Unterstützung bei den Ausstellungen, der Volkshochschule Moosburg e.V. für die räumliche und organisatorische Unterstützung bei allen Veranstaltungen, dabei insbesondere Dorothea Band, für das Fotomaterial dem Stadtarchiv Moosburg sowie Karl A. Bauer und Günther Strehle, Rafaèle Antoniucci für die Gestattung, die Bildrechte am Werk des Künstler Alfred Gaspart zu nutzen, Günther Strehle für die Gestaltung und das Layout des Buches, Christiane Strehle für die französischen Übersetzungen, und nicht zuletzt den Familien der Beteiligten für die Geduld und das Verständnis während der Arbeit und für ihre Mitwirkung beim Lektorat.
Herbert Franz
1. Bürgermeister a.D.
Ehrenvorsitzender Stalag Moosburg e.V.
Vorwort
Die sowjetischen Kriegsgefangenen stellen nach den Juden Europas die größte Opfergruppe des Zweiten Weltkrieges. Unterernährung, Krankheiten und Misshandlung, schwerste Arbeit und Mord halbierten nahezu ihre Zahl, die mindestens 5 Millionen betragen haben dürfte. Überall im damaligen deutschen Herrschaftsbereich, von Norwegen und Finnland bis nach Italien und Griechenland, findet man sog. Russenfriedhöfe, auf denen z. T. Tausende von Verstorbenen oft unter unwürdigen Bedingungen ihre letzte Ruhestätte fanden. Bis vor relativ kurzer Zeit galten sie allesamt als unbekannt, doch weiß man heute recht genau, dass ihr Tod in der Regel bürokratisch exakt verbucht wurde und sich daher noch heute in vielen Fällen feststellen lässt, wer an welchem Ort begraben wurde.
Moosburg an der Isar war 1939 ein kleines Städtchen mit etwas mehr als 6100 Einwohnern. Als dort im September 1939 ein Kriegsgefangenenlager eingerichtet wurde, ahnte niemand, dass in den folgenden Jahren bis zur Befreiung Ende April 1945 eine sechsstellige Zahl von Gefangenen vieler Nationalitäten dieses Lager durchlaufen würde, allein die Zahl der dort erstmals in Gefangenschaft Registrierten betrug fast 150000. Hinzu kamen weitere in Zahlen nur schwer zu bestimmender Größenordnung, die aus anderen Lagern nach Moosburg versetzt wurden, d. h., auf einen Einwohner kamen während dieser Zeit wenigstens 30 Gefangene. Das Lager in Moosburg, als Stammlager oder – abgekürzt – Stalag VII A bezeichnet, gehörte damit zu den großen im Deutschen Reich, und kaum ein anderes hat länger existiert. Insofern kann es mit einigem Recht als Beispiel für die deutschen Gefangenenlager des Zweiten Weltkrieges angesehen werden.
Typisch war es auch für die Behandlung der kriegsgefangenen Angehörigen der Roten Armee. Den deutschen Vorschriften lag zwar die Genfer Konvention von 1929 zu Grunde, die eine humane Behandlung sämtlicher Kriegsgefangener forderte, doch wurde das dieser Gruppe von Anfang an nicht zugestanden mit der Begründung, die Sowjetunion habe das Abkommen nicht ratifiziert. Willkür bis hin zum Mord war die Folge. Politisch unerwünschte Gefangene wie Angehörige der sowjetischen Intelligenz, Kommissare oder Juden wurden bis zum Sommer 1942 systematisch herausgesucht und zur Exekution in das Konzentrationslager Dachau gebracht, darin unterscheidet sich das Stalag VII A nicht von den anderen Lagern im Reich. Anders als bei diesen verweigerte sich allerdings die Lagerleitung weiteren Auslieferungen an die Gestapo, als sie von dem Verbrechen erfuhr, und verwies auf das Völkerrecht, das für alle Gefangenen gelte. Sie bewahrte dadurch viele Gefangene zumindest vorläufig von dem Tod. Kann das als ein leuchtendes Beispiel dafür gelten, sich dem nationalsozialistischen Terror widersetzt zu haben, so übergab dieselbe Lagerverwaltung in den Folgejahren immer wieder geflohene und wiederergriffene Angehörige der Roten Armee dem KZ Dachau, oft ausdrücklich zur Exekution. Auch in Moosburg und seinem Zuständigkeitsbereich starb eine mindestens vierstellige Zahl von sowjetischen Kriegsgefangenen an den Folgen der schlechten Behandlung. Von Widerstand über Willfährigkeit bis hin zu aktiver Unterstützung lässt sich am Beispiel von Stalag VII A die gesamte Bandbreite des Verhaltens der Deutschen Wehrmacht gegenüber dem nationalsozialistischen Regime aufzeigen.
Nach dem Krieg gerieten das Lager und seine Geschichte zwar nicht in Vergessenheit, aber in Zeiten von Wiederaufbau und Kaltem Krieg gab es aus der Sicht der Zeitgenossen Wichtigeres, als sich mit der Vergangenheit zu befassen. Der Gedanke, die Geschichte dieses Ortes aufzuarbeiten, stand zwar immer wieder im Raum, doch erst die Gründung des Vereins Stalag Moosburg im Jahr 2013 lieferte den endgültigen Anstoß für eine wissenschaftlich Aufarbeitung der Lagerhistorie und des Schicksals der sowjetischen Kriegsgefangenen in Oberbayern. Ohne ihn und seine beharrliche Arbeit wäre das vorliegende Buch kaum möglich gewesen.
Dieses bleibt aber nicht bei der Darstellung der Vergangenheit stehen, denn ein zweiter Teil zielt darauf ab, die im Umfeld von Moosburg verstorbenen sowjetischen Kriegsgefangenen ihrer Anonymität zu entreißen und ihnen ihre Namen und damit ihre Identität zurückzugeben. Damit steht deren Familien erstmals ein konkreter Ort zur Verfügung, an dem sie ihrer Väter und Großväter gedenken können. Das weist in die Zukunft, denn für eine Versöhnung einst erbitterter Kriegsgegner ist zwar die Klärung der damaligen Lebensumstände die wichtigste Voraussetzung, verwirklichen lässt sie sich jedoch nur, wenn zugleich die erste, die ganz persönliche Frage von Angehörigen endgültig beantwortet wird: Wie ist er gestorben und wo wurde er begraben?
Es liegt im Bestreben der Autoren und insbesondere in der Absicht des dritten Buchteiles, verschiedenste Quellen oft erstmals zu eröffnen und das Gesicht des Krieges wie der sowjetischen Kriegsteilnehmer sichtbar zu machen, auch wenn Namen verloren gegangen sein mögen. Wie eng verknüpft Lachen und Leiden für die Kriegsgefangenen waren, wird augenfällig, wenn man beispielsweise hinter die erhalten gebliebenen Bilder, Fotos wie Kunstwerke, schaut. Abseits vom geschichtlichen Datenwissen tut sich hier eine neue Perspektive auf.
Daher ist diesem Buch nicht nur zu wünschen, dass es über die Region hinaus bekannt wird, sondern ebenso in den Nachfolgestaaten der früheren Sowjetunion.
Dr. Reinhard Otto
Historiker
Teil I
Zwischen Vernichtung und Widerstand
Das Leben sowjetischer Gefangener im Stalag VII A Moosburg
Dr. Dominik Reither, M.A.
Teil I – Zwischen Vernichtung und Widerstand
Das Leben sowjetischer Gefangener im Stalag VII A Moosburg
Inhalt
Einleitung
Stalag VII A
Sowjetische Gefangene im Zweiten Weltkrieg
3.1 Informationslage
3.2 Unterschiedliche Planungen 1941/42
3.2.1 Überlegungen vor dem Angriff auf die Sowjetunion
3.2.2 Die Behandlung sowjetischer Gefangener in den ersten Monaten nach dem Angriff auf die Sowjetunion
3.2.3 Die Verlegung sowjetischer Gefangener ins Reichsgebiet
3.3 Situation der sowjetischen Gefangenen im Reich
3.3.1 Rechtliche Situation
3.3.2 Unterbringung, Ernährung und Versorgung
3.3.3 Arbeitseinsatz
3.3.4 Widerstand, Flucht und Bestrafung
Sowjetische Gefangene im Stalag VII A
4.1 Quellenlage
4.2 Lebens- und Arbeitsbedingungen
4.2.1 Hintergründe
4.2.2 Postwesen
4.2.3 Ernährung und Bekleidung
4.2.4 Arbeitseinsatz
Außenlager
Arbeitsbedingungen
Arbeitseinsätze in Moosburg
4.2.5 Kontakt sowjetischer Gefangener mit der deutschen Zivilbevölkerung
4.2.6 Seelsorge und Freizeitgestaltung
Seelsorge
Kulturelles Leben und Sport
4.2.7 Medizinische Versorgung und Tod
Medizinische Versorgung
Todesfälle sowjetischer Gefangener
Bestattung sowjetischer Gefangener
4.2.8 Flucht und Bestrafung
Fluchten und Fluchtversuche
Bestrafung von Gefangenen
4.2.9 Widerstand und Kollaboration
Widerstand
Kollaboration
4.3 Die Aussonderung sowjetischer Gefangener
4.3.1 Die Aussonderungen in den Kriegsgefangenenlagern 1941/1942
4.3.2 Aussonderungen im Stalag VII A
Phase: Lagerleitung und Wehrkreiskommando verweigern die Zusammenarbeit mit der Gestapo
Phase: Der Konflikt mit der Gestapo
Phase: Sabotage der Aussonderungen durch Lagerleitung und Wehrkreiskommando
Das Ende des Konflikts und die Folgen für die beteiligten Offiziere
Die Motive der Offiziere
4.4 Die Widerstandsbewegung B.S.W.
4.4.1 Überblick
4.4.2 Gründung der B.S.W.
4.4.3 Verbreitung der B.S.W.
4.4.4 Aktivitäten der B.S.W.
4.4.5 Die B.S.W. im Stalag VII A
4.4.6 Aufdeckung der B.S.W.
4.4.7 Bedeutung der B.S.W.
Schlussbemerkung
Anhang
6.1 Liste der Arbeitskommandos
6.2 Quellenverzeichnis
6.2.1 Quellen
Ungedruckte Quellen
Gedruckte Quellen
6.2.2 Literatur
6.2.3 Abbildungsnachweis
6.2.4 Abkürzungen
1 Einleitung
Ausgehend von der Grundannahme Hitlers, dass der Krieg gegen die Sowjetunion ein weltanschaulicher Vernichtungskrieg gegen den Kommunismus und die slawischen „Untermenschen“ sei, wurden auch die sowjetischen Kriegsgefangenen grundsätzlich anders behandelt als diejenigen aus anderen Ländern. Während letztere als Kombattanten und gefangene Soldaten weitgehend unter dem Schutz der Genfer Konvention standen, waren erstere gerade „Keine Kameraden“, wie ein Buchtitel über die Situation sowjetischer Kriegsgefangener deren Lage zutreffend beschreibt.1 Wer von ihnen überhaupt die erste, auf die direkte Gefangennahme folgende Zeit und den Transport zu den Kriegsgefangenenlagern im Reich überlebte, sah sich auch dort einer im Vergleich zu den Gefangenen anderer Nationen deutlich schlechteren Behandlung ausgesetzt.
In den verschiedenen Kategorien des täglichen Lebens, von Ernährung und Bekleidung über Postverkehr und medizinische Versorgung bis hin zur Bestattung, lässt sich die unterschiedliche Behandlung der Gefangenen nachvollziehen. Am besten war die Situation für Briten und US-Amerikaner, wohl vor dem Hintergrund, einen Verständigungsfrieden nicht zu torpedieren und dem Deutschen Reich in der Öffentlichkeit dieser beiden Länder einen guten Ruf zu erhalten. Franzosen und Jugoslawen waren schlechter gestellt. Hier bestand keine Notwendigkeit mehr, einen Verständigungsfrieden zu schließen. An der Behandlung der polnischen Gefangenen lässt sich die Rassenideologie der Nationalsozialisten nachvollziehen und die italienischen Soldaten galten nach dem Bruch Italiens mit dem Deutschen Reich als Verräter. Am schlechtesten war die Situation der sowjetischen Gefangenen.
Insgesamt sind die Zahlen erschreckend. Schätzungen gehen davon aus, dass über fünf Millionen sowjetische Soldaten in deutsche Gefangenschaft gerieten. Knapp eine Million wurden aus der Gefangenschaft entlassen, um entweder als Zivilisten nach Hause zurückzukehren, in Zukunft als Zivilarbeiter tätig zu sein oder in spezielle Wehrmachtseinheiten einzutreten. Mindestens zwei Millionen Sowjetsoldaten starben nachweislich in deutscher Gefangenschaft. Das Schicksal einer weiteren Million Vermisster ist unklar. Die meisten kamen um, flüchteten oder wurden von SS/SD getötet. Bei Kriegsende im Mai 1945 lebten in den deutschen Lagern etwa eine Million Gefangene aus der Sowjetunion.2
Auch in Stalag VII A Moosburg befanden sich seit Sommer 1941 zahlreiche sowjetische Gefangene. Der letzte Lagerkommandant von Stalag VII A räumt unumwunden ein, „dass die russ. Gefangenen schlechter daran waren als jene anderer Nationen“.3
Der Beitrag möchte sich in verschiedenen Kapiteln dem Schicksal dieser Gruppe von Gefangenen annähern. Nach einer kurzen Darstellung der Geschichte von Stalag VII A wird im zweiten Kapitel die Behandlung sowjetischer Gefangener in Deutschland skizziert, bevor das dritte Kapitel die Situation sowjetischer Gefangener speziell in Stalag VII A beleuchtet. Hier geht es neben dem Alltagsleben der sowjetischen Gefangenen auch um zwei Aspekte, die die Situation sowjetischer Gefangener in Stalag VII A von der in anderen Lagern unterscheiden. Es handelt sich um die Aussonderungen tatsächlicher und vermeintlicher kommunistischer Funktionsträger und anderer „untragbarer Elemente“ unter den Gefangenen im Herbst und Winter 1941/1942 und den Widerstand, den die für das Stalag verantwortlichen Offiziere dagegen leisteten, sowie die Organisation der B.S.W., der größten Widerstandsbewegung sowjetischer Gefangener im Reichsgebiet, die im Bereich von Stalag VII A entstand.
1 Streit C., Keine Kameraden, Bonn 2001.
2 Pfahlmann H., Fremdarbeiter und Kriegsgefangene in der deutschen Kriegswirtschaft 1939-1945, Darmstadt 1968, S. 103; in Zukunft abgekürzt: Fremdarbeiter; Mommsen geht von mehr als drei Millionen in deutscher Gefangenschaft verstorbenen sowjetischen Soldaten aus, ders., In deutscher Hand – Der Arbeitseinsatz sowjetischer Kriegsgefangener 1941-1943, in: Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland (Hg.), Kriegsgefangene, Düsseldorf 1995, S. 141-147, S. 141; in Zukunft abgekürzt: In deutscher Hand.
3 Stadtarchiv Moosburg B10004, Burger O., Manuskript, S. 78. Er betont jedoch auch, dass man in Kenntnis dieser Umstände alles getan habe, um die Situation der sowjetischen Gefangenen zu verbessern.
2 Stalag VII A4
Das Stalag VII A war eines der größten deutschen Kriegsgefangenenlager des Zweiten Weltkriegs. Es handelte sich um ein Mannschaftsstammlager (abgekürzt „Stalag“), also ein Lager für Unteroffiziere und Mannschaften, nicht ein Lager für Offiziere (abgekürzt „Oflag“)5. Das Stalag war ein Stammlager, also die Zentrale eines ganzen Komplexes von Nebenlagern, in denen zahlreiche Gefangene für die Zeit ihres Arbeitseinsatzes in der Nähe ihrer Einsatzorte untergebracht waren. Kriegsgefangene in Landwirtschaft, Handwerk und Industrie als Ersatz für einberufene deutsche Arbeitskräfte heranzuziehen war nämlich von Anfang an eines der Ziele der deutschen Kriegswirtschaft. In der Zentrale, dem Stammlager, wurden die von der Front ankommenden Gefangenen registriert und auf die Arbeitskommandos verteilt. Im Stalag betreuten deutsche und kriegsgefangene Ärzte die erkrankten Gefangenen. Hier befanden sich also die Neuankömmlinge, die Kranken und diejenigen, die auf ihren nächsten Einsatz warteten. Außerdem wurden vom Stalag aus die Versorgung und der Postverkehr der Gefangenen organisiert. Die römische Ziffer VII steht für den Wehrkreis VII. Das ganze Reich war in Wehrkreise eingeteilt. Der Wehrkreis VII (München) umfasste Südbayern bis zur Donau, Nordbayern bildete den Wehrkreis XIII (Nürnberg). Der Buchstabe A bedeutet, dass es sich beim Stalag um das erste Lager im Wehrkreis handelte. Daneben existierte seit 1940 noch das kleinere Stalag VII B (Memmingen).6
Oberste Instanz in Sachen Kriegsgefangene war das Oberkommando der Wehrmacht (OKW). Auf der mittleren Ebene, nämlich der der Wehrkreise, war das stellvertretende Generalkommando zuständig, auch als Wehrkreiskommando bezeichnet. (Das Generalkommando kommandierte die Truppen an der Front). Vor Ort leitete die Wehrmachtseinheit „Stalag“, befehligt vom Lagerkommandanten, das Kriegsgefangenenlager.7
Am 21./22.09.1939 entschied das Wehrkreiskommando VII, in Moosburg ein Lager für 10.000 Gefangene aufzubauen. Hintergrund war ein Befehl des OKW von Mitte September 1939, der die Errichtung eines Lagers in der Nähe von Landshut anordnete.8 Dieser Befehl wird verständlich, wenn man bedenkt, dass die Gegend um Landshut relativ zentral im Wehrkreis liegt, außerdem an den Bahnlinien München-Nürnberg und Richtung Passau, sodass Gefangene leicht zu verlegen und zu versorgen waren. Die Tatsache, dass die Entscheidung für den Raum Landshut erst mehrere Wochen nach Kriegsbeginn fiel, lässt sich mit dem Kriegsverlauf erklären. Zunächst waren die Agrargebiete im Norden und Osten des Reiches für Kriegsgefangenenlager vorgesehen gewesen, um die Gefangenen dort in landwirtschaftlichen Großbetrieben als Ersatz für eingezogene Landarbeiter einsetzen zu können. Erst als die Gefangenenzahlen in kurzer Zeit deutlich die Prognosen überstiegen, richtete die Wehrmacht Lager auch im Süden und Westen des Reiches ein.9
Der Grund für die Entscheidung für Moosburg ergibt sich aus der Heeresdienstvorschrift 38/12, die Anordnungen für den Bau eines Gefangenenlagers traf.10 Die dort geforderten Kriterien lagen bei dem Gebiet nördlich der Stadt in Richtung Zusammenfluss von Isar und Amper vor. Das Lager konnte hier gut mit Wasser und Strom versorgt werden. Das Gelände lag etwas abseitig, war wenig einsichtig und trotzdem mit der unmittelbaren Nähe zur Bahnlinie München-Nürnberg verkehrsgünstig angebunden, die Fläche selbst eben und übersichtlich. Außerdem konnten die teilweise stillgelegten Industrieanlagen und Hallen einer Hanfrösterei und einer Düngemittelfabrik als erste Anlaufstation dienen.
Noch am 22.09.1939 begann der Aufbau des Lagers. An diesem Datum wurden die ersten Baumaterialien bestellt, unter anderem 100 Kilometer Stacheldraht. Dieser Posten hatte seinen Hintergrund ebenfalls in der Heeresdienstvorschrift 38/12, wonach ein Lager bereits dann einsatzbereit war, wenn es eine Stacheldrahtumzäunung aufwies. In den ehemaligen Industrieanlagen wurde nun eine Entlausungsstation eingerichtet und der Reichsarbeitsdienst begann mit dem Bau der Baracken. Außerdem stellten Angehörige des Reichsarbeitsdienstes als vorübergehende Unterkunft Zelte auf. Trotzdem war vieles noch provisorisch, als am 19.10.1939 die ersten 1.400 Gefangenen im Lager eintrafen. Diese Situation war typisch für die deutschen Stalags im Herbst und Winter 1939/1940, was auf die große Zahl an polnischen Soldaten zurückzuführen ist, die die Wehrmacht binnen kurzer Zeit gefangen nahm.11
Am 31.12.1939 befanden sich bereits 9.000 Gefangene im Bereich des Stalag.12 Die Ausmaße waren, nicht zuletzt im Vergleich zur Größe der Stadt, beachtlich. 1941 belegte das Lager eine Fläche von 600 Meter auf 550 Meter, die Lagerstraße war 670 Meter lang. Außerhalb des eigentlichen Lagers befand sich der Kommandanturbereich.13 Im Wesentlichen war das Stalag VII A Moosburg nach den Vorgaben der Heeresdienstvorschrift 38/12 strukturiert. Auf einem undatierten Lageplan sind die Einrichtungen des Lagers eingezeichnet. Das Stalag nahm den gesamten Platz zwischen Mühlbach im Westen und Schleiferbach im Osten ein. Die Gebäude von Kommandantur, Arbeitsamt, Verwaltung, Abwehr und Wache befanden sich vor dem eigentlichen Lager direkt am Mühlbach. Leicht nach Norden versetzt, auf der anderen Seite des Mühlbachs, lag eingezäunt der „Stalag-Bahnhof“ mit eigenem Gleisanschluss und den Gebäuden für das Rote Kreuz und die Paketpost. An der nördlichen Seite des Lagers, von diesem durch einen Stacheldrahtzaun getrennt, befand sich ein kleines Durchgangslager. Die exakt gerade und von West nach Ost verlaufende Lagerstraße teilte das Gelände des Hauptlagers in zwei Hälften. Links und rechts der Hauptstraße waren die Wohnbaracken giebelseitig angeordnet, in denen jeweils 400 Mann, nach Nationen getrennt, untergebracht waren. Inder sowie farbige Briten und Amerikaner lebten in eigenen Abschnitten des Lagers, die vom übrigen Lagergelände durch Stacheldrahtzäune abgesondert waren. Auf dem Lagergelände existierten weitere Komplexe, vom Hauptlager durch Stacheldraht getrennt: Ein Frauenlager mit vier Baracken, ein Offiziersdurchgangslager mit drei Baracken, ein eigenes Lager für russische Offiziere mit zwei Baracken und einem eigenen Wachturm mitten auf dem Lagergelände, im Südosten ein großes „Russenlager“ mit 13 Baracken, die mit je 204 Mann belegt werden konnten14, und im Südwesten ein eigener Bereich für Seuchen- und Isolierbaracken. Dort befand sich auch das Lagerlazarett. Links und rechts der Hauptstraße waren zwei Küchen mit je 20 Großkochkesseln und einer Kapazität von drei warmen Mahlzeiten für 18.000 Personen und Kantinen angeordnet. Im Norden gab es einen Wäschetrocken- sowie einen Spiel- und Sportplatz. Ein großes Holz- und Kohlenlager und ein Gelände, das als „Werkhof“ bezeichnet wurde, lagen in der Nord-West-Ecke des Lagers. Abgesehen von einer Baracke für Bekleidung und einer Baracke, die als Theater und Kirche benutzt wurde und die sich am Ostzaun des Lagers befanden, lagen die anderen zentralen Einrichtungen im Westen bei der Kommandantur, so die Baracken für das Rote Kreuz, die Arrest-Baracke und die Lagerräume für Lebensmittel und Geräte sowie Schusterei und Schneiderei nördlich der Lagerstraße, südlich die Baracken der Lagerpost, des Zahnarztes, die Baracke, in der die Aufnahme durchgeführt wurde und das Entlausungsbad. Nördlich, außerhalb des Lagergeländes, gab es Gärtnereianlagen und einen Schweinestall.15
Die Baracken bestanden aus Holz und waren ohne Unterkellerung in Fachwerkbauweise auf Pfahlrosten errichtet. Eine Baracke war durch zwei Waschkabinen in zwei gleich große Wohn- und Schlafräume für je 200 Gefangene unterteilt. Möbliert waren die Räume mit dreistöckigen Betten, Tischen und Bänken. Außerdem gehörten zwei Kachelöfen zur Standardausstattung.16
1941 wurde das Lager nach Süden erweitert17. 1943 und 1944 baute man nördlich des bisherigen Lagers zusätzliche Unterkünfte für weitere 1.200 Mann.
Für Leitung, Verwaltung und Betrieb eines „Standard-Stalags“ mit 10.000 Gefangenen waren nach dem Personalschlüssel der Wehrmacht 98 Soldaten (14 Offiziere, 23 Unteroffiziere und 61 Mannschaften) sowie 33 Militärbeamte und –angestellte vorgesehen, wobei dieses Personal nur Leitungs- und Schlüsselpositionen besetzte, während Gefangene große Teile der täglichen Arbeit erledigten.18 Nach der Heeresdienstvorschrift 38/5 war das Stalag-Personal in sechs so genannte „Gruppen“ eingeteilt, nämlich die Gruppen „Kommandant“, „Arbeitseinsatz“, „Sanitätsoffizier“, „Abwehr und Postüberwachung“, „Verwaltung“ und „Fahrbereitschaft“. Besonders weitgehende Befugnisse hatte der Abwehroffizier, der Leiter der Gruppe „Abwehr und Postüberwachung“. Er war neben der Kontrolle von Briefen und Paketen für die Abwehr von Sabotage und Spionage, für die Vernehmung von Gefangenen und für die Lagersicherung zuständig. Der Abwehroffizier war angewiesen, zur Erfüllung seiner Aufgaben engen Kontakt zur Gestapo zu halten.19
Die Stalag-Kommandanten waren reaktivierte, ehemalige Offiziere. So war der erste Kommandant, Oberst Nepf, bei seiner Bestellung bereits 63 Jahre alt. Die Bewachung der Gefangenen übernahmen Landesschützenbataillone, die jeweils aus rund 450 älteren, nur bedingt kriegsverwendungstauglichen, leicht bewaffneten Soldaten bestanden.20 Zunächst standen dem Stalag fünf Bataillone, bei Kriegsende sieben Bataillone mit 32, später 40-44, Kompanien zur Verfügung. Ein Bataillonskommandeur war dabei für 400-500 Außenkommandos verantwortlich, die er zu bewachen hatte und bei denen er für Unterkunft und Versorgung der Gefangenen und die Einhaltung der Arbeitsbedingungen zuständig war.21
Oberst Hans Nepf wurde am 28. September 1939 zum ersten Kommandanten des Stalag ernannt und blieb dies bis zum 05. Januar 1943. Sein Nachfolger war Oberst Franz Winiwarter. Vom 21.10.1943 bis zur Auflösung des Lagers am 29.04.1945 leitete Oberst Otto Burger das Stalag VII A.22
Viele Gefangene hatten bereits eine kleine Odyssee durch Gefangenensammelplätze an der Front und Durchgangslager in deren Hinterland hinter sich, als sie in Moosburg ankamen. Direkt nach der Gefangennahme im Gefechtsgebiet wurden Offiziere und Mannschaften getrennt und die Soldaten zunächst zu Gefangenensammelstellen in Frontnähe gebracht. Es handelte sich dabei um Provisorien in Lagerhallen, Kasernen oder auf Sportplätzen. Nach einigen Tagen kamen die Gefangenen von dort aus in die Durchgangslager (Dulags), wo sie registriert und so lange untergebracht wurden, bis die Wehrmacht sie auf die Gefangenenlager im Reich verteilen konnte. In den Gefangenensammelstellen und den Dulags gab es oft keine ausreichende Verpflegung und Versorgung. Außerdem herrschten schlechte hygienische Verhältnisse, sodass sich unter den Gefangenen häufig Läuse ausbreiteten. Da von ihnen Krankheiten übertragen werden, stellten bei der engen Belegung der Lager Läuse eine erhebliche Gefahr für das Auftreten von Epidemien dar.23 Daher legte die Wehrmacht großen Wert auf die Entlausung der Gefangenen bei ihrer Ankunft im Stalag. Außerdem wurden die Gefangenen durchsucht und ihnen Geld, Wertsachen, Waffen und andere gefährliche Gegenstände abgenommen. Schließlich wurden die Gefangenen registriert und ihre persönliche Daten genau erfasst und auf vorgefertigten Karteikarten vermerkt. Außerdem erhielt jeder Gefangene eine Nummer und eine Erkennungsmarke, damit er identifiziert werden konnte.24
Die Zahl der Gefangenen, für die Stalag VII A zuständig war, stieg im Kriegsverlauf stark an. Am 10.09.1940 befanden sich 62.768 Gefangenen im Bereich des Stalag VII A, am 10.01.1941 55.130, am 01.01.1942 59.169 Gefangene, am 01.01.1943 65.771, am 01.01.1944 74.096 Gefangene und am 01.12.1944 (letzte verfügbare Aufstellung) 75.400.25
Die letzten Kriegsmonate brachten ein starkes Anwachsen der Belegungszahlen. In der Endphase des Krieges wurden nämlich zahlreiche Kriegsgefangene vor der zusammenbrechenden Front vor allem aus den Lagern im Osten nach Moosburg evakuiert.26 Bei Kriegsende waren im Bereich von Stalag VII A etwa 80.000 Gefangene auf Arbeitseinsatz, im Lager selbst lebten etwa 70.000 Gefangene, davon 12.000 Offiziere.27 Lagerkommandant Oberst Burger hatte im April 1945 den Befehl erhalten, Gefangene in den Süden zu bringen, das Lager zu zerstören und die Wachmannschaften in die Verteidigungslinie Isar-Amper-Glonn einzugliedern. In dieser Situation beschlossen Oberst Burger, der Befehlshaber der Wachmannschaften, Major Koller und der Moosburger Bürgermeister Müller, Stadt und Lager kampflos den amerikanischen Truppen zu übergeben und die Zerstörung der Brücken über Isar und Amper zu verhindern. Zu diesem Zweck hatte Oberst Burger schon am 28.04.1945 mit gefangenen Offizieren die Übergabe des Lagers, vor allem des Lazaretts, der Verpflegung und der Wertgegenstände besprochen. Am 29.04.1945 eroberten Truppen der 3. US-Armee nach kurzen Gefechten mit versprengten SS-Einheiten Moosburg und befreiten Stalag VI A. Die Wachmannschaften gingen in Gefangenschaft.28
4 Zur Geschichte von Stalag VII A vgl. Reither D., Stalag VII A Moosburg, Moosburg 2015.
5 Sowjetische Offiziere wurden nicht in Oflags, sondern gemeinsam mit den Mannschaften in Stalags untergebracht und zwar in eigenen Lagerbereichen, getrennt von den Gefangenen anderer Nationalität.
6 Das Wehrkreiskommando VII befahl am 21.06.1940 die Aufstellung der Einheit Kommandantur Stalag VII B in München, einzusetzen in Memmingen. Die Aufstellung war zum 15.08.1940 abgeschlossen, Kriegstagebuch des Stellvertretenden Generalkommandos VII. A.K., BA-MA 53-7/212, S. 36, 51.
7 Speckner H., In der Gewalt des Feindes, Wien 2003, S. 19ff.; Otto R., Wehrmacht, Gestapo und sowjetische Gefangene im deutschen Reichsgebiet 1941/1942, München 1998, S. 27ff.
8 Bundesarchiv-Militärarchiv, RH 53-7/724 Bl. 12f.; Aktenvermerke des Moosburger Bürgermeisters Dr. Müller „Kriegsgefangenenlager in Moosburg betr.“ vom 19.09.1939 bis zum 21.09.1939, Stadtarchiv Moosburg 06/47.
9 Otto R., Wehrmacht, Gestapo und sowjetische Gefangene im deutschen Reichsgebiet 1941/1942, München 1998, S. 29; Pfahlmann H., Fremdarbeiter, S. 83ff.; Nowak E., Polnische Kriegsgefangene im Dritten Reich, in: Bischof G./Karner S./Stelzl-Marx B. (Hgg.), Kriegsgefangene des Zweiten Weltkriegs, Wien 2005, S. 507-517, S. 508.
10 Bundesarchiv-Militärarchiv RHD 4/ 260 (vormals RHD 4, 138/12).
11 Mitschrift eines Vortrags von Oberst Nepf, gehalten vor Moosburger Bürgern in der Stalag-Kantine im Januar 1941, Stadtarchiv Moosburg 06/45, S. 1; Otto R., Wehrmacht, Gestapo und sowjetische Gefangene im deutschen Reichsgebiet 1941/1942, München 1998, S. 31.
12 Mattiello G., Prisoners of War in Germany 1939-1945, Lodi 2003, S. 76ff.
13 Mitschrift eines Vortrags von Oberst Nepf, gehalten vor Moosburger Bürgern in der Stalag-Kantine im Januar 1941, Stadtarchiv Moosburg 06/45, S. 7.
14 Oberst Burger erklärt diese Trennung von den anderen Gefangenen mit der Seuchengefahr, die von den sowjetischen Gefangenen ausging, Stadtarchiv Moosburg B10004, Burger O., Manuskript, S. 51.
15 Lageplan, Stadtarchiv Moosburg B10004, „Stalag VII A Lagerberichte“; Stadtarchiv Moosburg B10004, Burger O., Manuskript, S. 32.
16 Stadtarchiv Moosburg B10004, Burger O., Manuskript, S. 21.
17 Stadtarchiv Moosburg B10004, Burger O., Manuskript, S. 22.
18 Otto R., Wehrmacht, Gestapo und sowjetische Gefangene im deutschen Reichsgebiet 1941/1942, München 1998, S. 32; Stadtarchiv Moosburg B10004, Burger O., Manuskript, S. 31.
19 BA-MA RH D4/255. Speckner H., In der Gewalt des Feindes, Wien 2003, S. 75.
20 Otto R., Wehrmacht, Gestapo und sowjetische Gefangene im deutschen Reichsgebiet 1941/42, München 1998, S. 28, 32; Speckner H., In der Gewalt des Feindes, Wien 2003, S. 38ff.
Oberst Burger beschreibt ausführlich, wie wenig militärisch leistungsfähig die Wachmannschaften waren, gleichzeitig aber auch, wie sehr sie eigenständig und verantwortungsvoll handeln und, oft auf sich allein gestellt, wichtige Entscheidungen treffen mussten, ja wie sehr das Schicksal der Gefangenen von den Fähigkeiten eines Wachmanns abhing, Stadtarchiv Moosburg B10004, Burger O., Manuskript, S. 28ff.
21 Stadtarchiv Moosburg B10004, Burger O., Manuskript, S. 27.
22 Über Oberst Nepf sind nur vergleichsweise wenige Daten bekannt, seine Personalakte befindet sich nicht im Bundesarchiv-Militärarchiv in Freiburg. Hans Nepf wurde am 18.06.1876 in Meinigen geboren und starb am 27.08.1952 in Garmisch-Partenkirchen, Ermittlungsakte der Staatsanwaltschaft München I Az. 116 Js 13/65 (Staatsarchiv München StA-Nr. 21986), Bl. 18. Oberst Nepf wurde zu Beginn des Zweiten Weltkriegs im Stab des Stellvertretenden Generalkommandos bei der Materialerfassung verwendet, Gruppeneinteilung des Wehrkreiskommandos VII vom 26.08.1939, Wehrkreiskommando VII, Az. 13n/o/Ia Hsh. Nr. 8462/39geh, BA-MA RH 53-7/1349. Er war nach eigenen Angaben von 28.09.1939 bis zum 05.01.1943 Kommandant von Stalag VII A, Verfahren Staatsanwaltschaft München I, Az 1 Js Gen. 119-125/50 (Staatsarchiv München Staatsanw. Nr. 20988), Bl. 264.
Über Oberst Franz Winiwarter liegen derzeit kaum Erkenntnisse vor. Er war am 01.10.1935 Oberstleutnant und am 01.04.1940 Oberst bei den Grenztruppen der Saarpfalz. Mit Wirkung vom 21.10.1943 wurde Oberst Burger zum Kommandanten von Stalag VII A ernannt und löste Oberst Winiwarter ab, der aus dienstlichen Gründen Stalag VII B übernahm (Fernschreiben vom 19.10.1943 in der Personalakte von Oberst Burger, Personal-Nachweis in Heeres-Personalakte 4792, BA-MA Pers 6/11185). Ein Anschreiben an den Moosburger Bürgermeister vom 16.04.1943, gezeichnet von Oberst Winiwarter, hat sich erhalten (Stadtarchiv Moosburg 06/57).
Oberst Otto Burger, geb. am 20.10.1888 in Immenstadt als Sohn eines Obermaschinisten, nahm am Ersten Weltkrieg als Angehöriger der bayerischen Armee teil, zuletzt im Rang eines Leutnants. (Personal-Nachweis in Heeres-Personalakte 4792, BA-MA Pers 6/11185). Am 28.11.1918 aus dem Heeresdienst entlassen war er in der Zwischenkriegszeit als Betriebsleiter des Bezirks Wolfratshausen der Isarwerke, eines Stromerzeugers, tätig. Außerdem beschäftigte er sich mit der Ausarbeitung von Patenten. Von 1937 bis 1938 war er Angestellter beim VII. und XIII. Armeekorps und wurde 1938 Ergänzungsoffizier der Wehrmacht. Von 1939 bis März 1943 war Burger in Tschechien stationiert, zuletzt als Leiter des Wehrmeldeamtes Pilsen im Rang eines Obersts. Nach der Teilnahme an einem vom 22.-31.03.1943 stattfindenden Lehrgang im Kriegsgefangenenwesen in Wien wurde er am 04.06.1943 Kommandant von Stalag VII B (Memmingen). Mit Wirkung vom 21.10.1943 wurde Oberst Burger zum Kommandanten von Stalag VII A ernannt und löste Oberst Winiwarter ab, der aus dienstlichen Gründen Stalag VII B übernahm.
Aufschlussreich sind auch seine dienstlichen Beurteilungen: In seiner Beurteilung zum 15.04.1939 wird er als „groß, kräftig, untersetzt, dienstfähig“ in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen beschrieben. Hinsichtlich seiner Persönlichkeit ist die vorhergehende Beurteilung vom 30.12.1939 aufschlussreich. Hier wurde Burger als „ausgeglichen, gereift, gefestigt, aufrichtig, bescheiden, zuvorkommend und liebenswürdig“ bezeichnet. Er komme seinen dienstlichen Obliegenheiten mit peinlicher Gewissenhaftigkeit und äußerster Pünktlichkeit nach. Er habe ein ausgeprägtes Pflichtgefühl und sei fleißig und unbedingt zuverlässig. Aufgrund seiner reichen Lebenserfahrung und seiner praktischen Veranlagung arbeite er sich rasch in die ihm zugewiesenen Arbeitsgebiete ein. Auch bei starker Beanspruchung verliere er nie den Überblick. Er sei klar und treffend im Urteil, rasch und sicher im Entschluss, energisch und zielbewusst in der Durchführung. Im Umgang mit Behörden sei er gewandt, gegenüber Vorgesetzten taktvoll, zuvorkommend und korrekt. Gegenüber Untergebenen habe er großes Verständnis. Er verstehe es, sie zur Mitarbeit anzuregen und ihre Dienstfreude zu erhalten (aufgrund einer Unterstreichung ist davon auszugehen, dass dieser Teil der Beurteilung als wichtig angesehen wurde), er genieße bei ihnen Ansehen und Vertrauen. Bei den Kameraden sei er beliebt. Seine Stelle fülle er sehr gut aus. Dieser Beschreibung fügte der neue Beurteiler noch Folgendes hinzu: Er verfüge über große Entschluss- und Verantwortungsfreudigkeit [unterstrichen], mit „innerem Schwung und großer Passion“ habe er seine Arbeiten aufgenommen. Er komme für eine Weiterbeförderung und für die Stelle als Wehr-Bezirksoffizier und Stabsoffizier bei einem Wehr-Bezirks-Kommando in Frage (ebd.).
Burger war seit 1931 Parteimitglied (Beurteilung vom 01.03.1944, ebd.). Er wurde von Hauptmann Hörmann als nationalsozialistisch eingestellt beschrieben, der seine Versetzung zum Oflag VII D Tittmoning durchgesetzt habe, Zeugenaussage Hörmanns im Verfahren der Staatsanwaltschaft München I, Az 1 Gen 119-125/50, Staatsarchiv München Staatsanw. Nr. 20988, Bl. 302.
In seiner letzten Beurteilung vom 01.03.1944, die nun nicht mehr vom Wehrbezirkskommando Budweis erstellt wurde, sondern vom Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis VII, Generalmajor Hübner, wird er als bedingt kriegsverwendungsfähig - nicht fronttauglich eingestuft [was angesichts des immer größeren Mangels an Offizieren bemerkenswert ist], und in seiner Persönlichkeit folgendermaßen beschrieben: „Besonders tatkräftige, ideenreiche und energische Persönlichkeit [unterstrichen] soldatischen Gepräges mit aufgeschlossenem Wesen und gesundem Ehrgeiz; praktisch veranlagt mit großer Gründlichkeit und Fleiß; einwandfreie nat.soz. Haltung; keine Gelegenheit zur Feindbewährung im Zweiten Weltkrieg [unterstrichen]; in seinen bisherigen Dienststellungen voll bewährt. Starke Seiten: Tatkraft und Organisationstalent. Schwache Seiten: Kurz angebunden, manchmal schroff“. Insgesamt wird er als „Über Durchschnitt“ beurteilt, eine anderweitige Verwendung war nicht vorgesehen.
Bei der Übergabe des Lagers geriet Oberst Burger in amerikanische Kriegsgefangenschaft, Erlebnisbericht Major Kollers vom 01.04.-01.05.1945, Stadtarchiv Moosburg, Bestand Stalag VII A Berichte Beginn-Ende, Bl. 8f.
Nach dem Krieg lebte Burger bis 1957 in Moosburg. Er starb 1964.
23 Nowak E., Polnische Kriegsgefangene im Dritten Reich, in: Bischof G./Karner S./Stelzl-Marx B. (Hgg.), Kriegsgefangene des Zweiten Weltkriegs, Wien 2005, S. 507-517, S. 515f.; Spoerer M., Zwangsarbeit unter dem Hakenkreuz, München 2001, S. 101.
24 Nowak E., Polnische Kriegsgefangene im Dritten Reich, in: Bischof G./Karner S./Stelzl-Marx B. (Hgg.), Kriegsgefangene des Zweiten Weltkriegs, Wien 2005, S. 507-517, S. 515f.
Die Registrierung der Gefangenen und die Dokumentation des Verlaufs der Gefangenschaft erfolgten sehr genau: Auf der Personalkarte PK I mit ausführlichen Angaben zur Person und Angaben zur Gefangenschaft (Nummer der Erkennungsmarke, Lichtbild, Angaben über Versetzungen, Arbeitskommandos, Strafen, Fluchtversuchen oder Entlassungen), den Personalkarten PK II und PK III mit Angaben zu Arbeitseinsatz und Lohn, auf Lazarettkarten, die bei jedem Lazarettaufenthalt angelegt wurden, sowie in Krankenblättern mit dem Krankheits- und Behandlungsverlauf. Bei Todesfällen kamen noch Sterbefallnachweise und Grabkarten hinzu, Keller R., Das Deutsch-russische Forschungsprojekt „Sowjetische Kriegsgefangene“ in: Bischof G./Karner S./Stelzl-Marx B. (Hgg.), Kriegsgefangene des Zweiten Weltkriegs, Wien 2005, S. 460-475, S. 461.
25 Matiello G., Prisoners of War in Germany 1939-1945, Lodi 2001, S. 78.
26 Erlebnisbericht Major Kollers vom 01.04.-01.05.1945, Stadtarchiv Moosburg, Stalag VII A Berichte Beginn-Ende, S.2.
27 Reither D., Stalag VII A Moosburg, Moosburg 2015, S. 51f., durch Abgleich verschiedener Quellen.
28 Erlebnisbericht Major Kollers vom 01.04.-01.05.1945, Stadtarchiv Moosburg, Stalag VII A Berichte Beginn-Ende, S.2ff.; Bericht Oberst Burgers, Stadtarchiv Moosburg, Stalag VII A Berichte Beginn-Ende, S. 1ff.; Bericht des Stadtpfarrers Alois Schiml in: Pfister P. (Hg.), Das Ende des Zweiten Weltkriegs im Erzbistum München und Freising Teil II, München 2005, S. 842-848, S. 843f.; Alckens A., Ein Tagebuch (29. April -22. Mai 1945), in: Keller M. (Hg.), Was ist geschehen?, Moosburg 1995, S. 87-129, S. 89f.
Interessant ist eine Aussage Oberst Burgers am Ende seines Berichts. Noch bevor er seinen Offizieren und Soldaten bescheinigt, gewissenhaft gehandelt zu haben, spricht er den Gefangenen seine „höchste Achtung“ für ihr Verhalten aus. Dies habe ihm ermöglicht, die SS im Unklaren über seine Pläne zu lassen und das Lager kampflos zu übergeben. Damit hatten sich in den letzten Kriegstagen die Fronten gewandelt, nicht mehr deutsche Truppen und Dienststellen gegen die Kriegsgefangenen, sondern Teile der deutschen Truppen und Kriegsgefangene gegen SS und Gestapo.
3 Sowjetische Gefangene im Zweiten Weltkrieg
Die Behandlung sowjetischer Gefangener richtete sich nicht wie bei den Gefangenen anderer Nationalitäten nach der Genfer Konvention, sondern befand sich in einem steten Spannungsfeld zwischen Ideologie und Nützlichkeitserwägungen, zwischen dem rasseideologischen Ziel der Vernichtung der „slawischen Untermenschen“ und der „Träger des Bolschewismus“ und gleichzeitig der immer dringender werdenden Notwendigkeit, sowjetische Gefangene als Arbeitskräfte zu verwenden, um die zur Wehrmacht eingezogenen Arbeitskräfte zu ersetzen und die Kriegswirtschaft am Laufen zu halten.
Das Kapitel beschäftigt sich zunächst mit den unterschiedlichen Planungen in den verschiedenen Phasen des Krieges und beleuchtet sodann anhand einiger Aspekte die Situation sowjetischer Gefangener im Reich. Dies stellt den Hintergrund für die Behandlung sowjetischer Gefangener im Stalag VII A dar.
3.1 Informationslage
Zunächst stehen mit Erlassen, Denkschriften und Befehlen wichtige Quellen zur Behandlung sowjetischer Gefangener im Allgemeinen zur Verfügung. So lassen sich die verschiedenen Planungen und deren Umsetzung sowie ideologische Hintergründe ebenso nachvollziehen wie die unterschiedlichen Konzepte von Wehrmacht, Wirtschaftsverwaltung und Parteigrößen sowie die Auseinandersetzungen der verschiedenen Akteure. Insbesondere werden aber die katastrophalen Verhältnisse in den besetzten Ostgebieten während der ersten Monate im Krieg gegen die Sowjetunion deutlich.
Entgegen der bisherigen Forschungsmeinung kann man die Einzelschicksale zumindest derjenigen Gefangenen, die ins Reich gebracht wurden, relativ genau nachvollziehen, ebenso das Massensterben und die Aussonderungen. Im Gegensatz zu den Gefangenen in den besetzten Ostgebieten wurden die sowjetischen Gefangenen, die in Lagern im Reichsgebiet ankamen, gemäß den allgemeinen Vorschriften, wie sie auch für die Gefangenen anderer Nationalitäten galten, genau registriert und erhielten eine Erkennungsmarke. Über verschiedene Unterlagen, zum Beispiel Personalkarten, Lazarettkarten und –bücher, Sterbefallnachweise sowie Zu- und Abgangslisten kann man Gefangenentransporte, Versetzungsmechanismen und Arbeitseinsätze nachvollziehen. Es ist jetzt auch möglich, Namenslisten der so genannten „Russenfriedhöfe“ zu erstellen. Von großer Bedeutung für die Rekonstruktion der Schicksale von Gefangenen sind dabei die Karteien der Wehrmachtsauskunftstelle, die 1997 im Zentralen Archiv des Verteidigungsministeriums der Russischen Föderation nahezu vollständig entdeckt wurden.29 Die Sorgfalt, ja Pedanterie der Bürokratie stand dabei in diametralem Gegensatz zur Verachtung der Gefangenen als Menschen, wie folgendes Beispiel zeigt. Immer wieder sandten KZ-Kommandanten Sterbefallanzeigen über die in ihren Lagern exekutierten sowjetischen Gefangenen an die Wehrmacht. Die Wehrmachtsdienststellen gaben diese Sterbefallanzeigen mit dem Hinweis zurück, dass die Gefangenen mit der Überstellung zur Exekution aus der Kriegsgefangenschaft entlassen worden seien. Daher kämen Sterbefallanzeigen nicht in Betracht.30
3.2 Unterschiedliche Planungen 1941/42
Die Planungen und Konzeptionen der verschiedenen Akteure zum Umgang mit sowjetischen Gefangenen waren bis Dezember 1941, als Hitler mit einem Führerbefehl für Klarheit sorgte, höchst gegensätzlich. Auch danach handelten die Akteure noch uneinheitlich. Parteiführung, Wehrmacht aber auch Wirtschaft und Wirtschaftsverwaltung setzten unterschiedliche Prioritäten. Hinzu kam, dass der Kriegsverlauf zu Umplanungen zwang. So lassen sich mehrere Phasen nachvollziehen, in denen die verschiedenen Gruppen in Konkurrenz zueinander standen und in denen zeitweise die eine, zeitweise die andere ihre Position durchsetzen konnte.
Sowjetische Gefangene waren zunächst für die nationalsozialistische Führung Repräsentanten einer Ideologie, die es zu vernichten galt. So notierte der Generalstabschef des Heeres, Franz Halder (1884-1972), stichpunktartig aus einer Rede Hitlers vom 30. März 1941 vor 250 hohen Offizieren: „Kampf zweier Weltanschauungen gegeneinander. Vernichtendes Urteil über Bolschewismus, ist gleich asoziales Verbrechertum. Kommunismus ungeheure Gefahr für die Zukunft. Wir müssen vom Standpunkt des soldatischen Kameradentums abrücken. Der Kommunist ist vorher kein Kamerad und nachher kein Kamerad. Es handelt sich um einen Vernichtungskampf. […] Kampf gegen Russland: Vernichtung der bolschewistischen Kommissare und der kommunistischen Intelligenz. […] Kommissare und GPU-Leute sind Verbrecher und müssen als solche behandelt werden. […] Wir führen nicht Krieg, um den Feind zu konservieren.“ 31
Damit war nach Hitlers Ansicht jeder sowjetische Soldat ein potenzieller Kommunist und damit eine permanente Gefahr. Deswegen mussten sowjetische Gefangene auf alle Fälle vom Reichsgebiet ferngehalten werden. Daher konnte auch die Genfer Konvention auf sowjetische Gefangene keine Anwendung finden. Eine ausreichende Versorgung der Gefangenen war folglich auch nicht vorgesehen.
Demgegenüber planten Pragmatiker in Wehrmacht und Arbeitsverwaltung schon ab Frühjahr 1941, sowjetische Gefangene nach Deutschland zu bringen und sie dort zur Arbeit einzusetzen.32 Sie konnten sich mit ihrer Position im weiteren Kriegsverlauf nach und nach durchsetzen. Auch den Pragmatikern ging es in erster Linie nicht um die menschliche Behandlung der Gefangenen, sie sahen vielmehr in den sowjetischen Soldaten eine wichtige Ressource, die es für das Deutsche Reich einzusetzen galt. Entsprechend richtete sich auch hier die Behandlung der sowjetischen Soldaten nicht nach völkerrechtlichen Normen, sondern nach utilitaristischen Gesichtspunkten vor dem Hintergrund der nationalsozialistischen Ideologie.
Von Anfang an zeigt sich, dass nach den Planungen beider Lager die sowjetischen Gefangenen anders behandelt werden sollten als die Gefangenen westlicher Länder.
3.2.1 Überlegungen vor dem Angriff auf die Sowjetunion
Die Quellenlage hinsichtlich der Planungen für das Gefangenenwesen im Falle des Angriffs auf die Sowjetunion in den Monaten Januar bis Juni 1941 ist dünn.33 Es kann jedoch nachvollzogen werden, dass sich die Wehrmacht bereits im ersten Halbjahr 1941 auf sowjetische Gefangene vorbereitete.
Aufgrund der vom OKW angenommenen Stärke der Roten Armee und der Prognose, dass deren Widerstand schon in den ersten Wochen nach Beginn der Kampfhandlungen zusammenbrechen werde, musste das OKW bei seinen Planungen davon ausgehen, binnen weniger Wochen für die Ernährung und Versorgung von zwei bis drei Millionen sowjetischer Kriegsgefangener verantwortlich zu sein.34
Auf die Fragen, wo und wie die Gefangenen untergebracht werden und ob und inwieweit sie überhaupt ins Reichsgebiet transportiert und zur Arbeit eingesetzt werden sollten, gab es im Rahmen der Überlegungen unterschiedliche Antworten. Vereinfacht dargestellt existierten zwei Planungsphasen.
In der ersten Phase, ab März 1941, sollten nach den Konzepten der Wehrmacht sowjetische Gefangene nur in geringer Zahl ins Reichsgebiet gebracht und in Industrie und Landwirtschaft eingesetzt werden. Die zweite Phase ab 16. Juni 1941 lässt die Absicht erkennen, einen weitaus größeren Teil der Gefangenen ins Reich zu transportieren. Dies kann man unter anderem aus den Planungen zur Unterbringung der Gefangenen ableiten.35
In der zweiten Märzhälfte 1941 erging von Seiten des OKW an die Stalags der Befehl, Personal für 60 Gefangenenlager zu stellen, die bis spätestens Ende April einsatzfähig sein mussten. Während die meisten dieser neu aufgestellten Einheiten Frontstalags führen sollten, war geplant, einen Teil der Stalags im Reichsgebiet zu errichten.36 Stalag VII A stellte die Einheiten für die Frontstalags 307 und 317 auf.37 Dies bedeutete, dass vorgesehen war, die Masse der Gefangenen nicht ins Reich zu bringen. Aus den vorhandenen Quellen kann geschlossen werden, dass nach einem entsprechenden Befehl Ende März ab Mitte April in einigen Wehrkreisen im Reichsgebiet die neuen Stalags errichtet wurden. Der Bau dieser Lager erfolgte auf Truppenübungsplätzen, da man auf diese Weise die Gefangenen von der Zivilbevölkerung besser isolieren konnte. Die strikte Durchführung dieses Konzepts hätte aber den Arbeitseinsatz erheblich erschwert.
Schon zu diesem Zeitpunkt war wohl zumindest auf mittlerer Ebene bereits bekannt, dass die sowjetischen Gefangenen schlechter behandelt werden würden als die Gefangenen anderer Nationen. Zum Beispiel waren vorbereitete Unterkünfte für die Gefangenen nicht geplant, diese mussten die Gefangenen selbst bauen. Sie sollten mit einfachsten Mitteln errichtet werden und sich an den Plänen für Behelfsbauten der Wehrmacht orientieren, die als „Notunterkünfte“ gedacht waren. Langfristig sollten die Lager zwar mit Baracken primitivster Art ausgestattet werden, der Bau von Erdhütten und Lehmgebäuden war jedoch ausdrücklich vorgesehen. Auch Lazarette waren so einfach zu halten, dass sie nach ärztlichem Maßstab gerade noch vertretbar waren. Die Ausstattungsgegenstände sollten sich die Gefangenen aus Abfällen ebenfalls selbst anfertigen, so Kochgeschirr aus Konservenbüchsen oder Löffel aus Holzresten.38 Im Mai 1941 erhielt der für das Generalgouvernement zuständige Kommandeur der Kriegsgefangenen den Befehl, vier Durchgangslager zu errichten, deren Insassen nach und nach, je nach Transportkapazität, ins Reich gebracht werden sollten. Ebenfalls bereits im Mai hatten die zuständigen Stellen außerdem Richtlinien für den Arbeitseinsatz und Bestimmungen für die Behandlung sowjetischer Gefangener sowie die Zuständigkeiten im Kriegsgefangenenwesen im Osten ausgearbeitet.
Mit Befehl vom 16. Juni 1941 ordnete das OKW an, im gesamten Reich (außer im Wehrkreis I, Ostpreußen) 19 Stalags und Oflags (alle auf Truppenübungsplätzen) speziell für sowjetische Gefangene zu errichten, mit Kapazitäten von je 30.000 bis 50.000 Gefangenen und einer Gesamtkapazität von 790.000 Gefangenen. Dies bedeutete eine Erhöhung der Zahl „Russenlager“ im Reichgebiet um 50%. Es war nun geplant, entsprechend mehr sowjetische Gefangene ins Reich zu holen.39
Vor allem die Lager in Ostpreußen und im Generalgouvernement sollten jedoch die sowjetischen Gefangenen aufnehmen und zwar bis an die Grenze ihrer Kapazität. Mit Befehl vom 16. Juni wurde nämlich der Kommandeur der Kriegsgefangenen im Generalgouvernement angewiesen, sechs Lager zu errichten, die bis an die Grenze der Aufnahmefähigkeit zu belegen waren. Am 2 Juli erhielt er dann den Befehl, die Lager zu Winterlagern – also zur dauerhaften Unterbringung – von einer Million Gefangenen auszubauen. Die Gefangenen dürften nur auf besonderen Befehl des OKW überhaupt ins Reichsgebiet gebracht werden. Die Mehrzahl der erwarteten zwei bis drei Millionen Gefangenen sollte im Generalgouvernement und im Operationsgebiet sowie in den Reichskommissariaten im Osten zur Arbeit eingesetzt werden.40
Ungeachtet aller Konzeptionen und Planänderungen blieben die konkreten Vorbereitungen unzureichend und beschränkten sich wohl häufig darauf, lediglich umzäunte Flächen für die sowjetischen Gefangenen zu schaffen, keine Barackenlager wie für die Gefangenen der anderen Nationen.41
3.2.2 Die Behandlung sowjetischer Gefangener in den ersten Monaten nach dem Angriff auf die Sowjetunion
Die grundlegende Haltung gegenüber sowjetischen Gefangenen geht aus einem Erlass des OKW vom 8. September 1941 hervor: „Zum ersten Mal steht dem deutschen Soldaten ein nicht nur soldatisch, sondern auch politisch im Sinne des volkszerstörerischen Bolschewismus geschulter Gegner gegenüber. Der Kampf gegen den Nationalsozialismus ist ihm in Fleisch und Blut übergegangen. Er führt ihn mit jedem zu Gebote stehenden Mittel: Sabotage, Zersetzungspropaganda, Brandstiftung, Mord. Dadurch hat der bolschewistische Soldat jeden Anspruch auf Behandlung als ehrenhafter Soldat und nach dem Genfer Abkommen verloren.“42
Für die nationalsozialistische Führung gab es dabei nicht den sowjetischen Gefangenen an sich, sondern gemäß der NS-Ideologie wurden die Gefangenen in mehrere Gruppen eingeteilt und diese unterschiedlich behandelt.
Besonderes Augenmerk legte man auf die politischen Kommissare der Roten Armee. Ihre Behandlung war im so genannten „Kommissarbefehl“ des OKW vom 06.06.1941 geregelt: …“Sie [politische Kommissare] sind aus den Kriegsgefangenen sofort, d.h. noch auf dem Gefechtsfelde abzusondern. Dies ist notwendig, um ihnen jede Einflussmöglichkeit auf die gefangenen Soldaten zu nehmen. Diese Kommissare werden nicht als Soldaten anerkannt; der für die Kriegsgefangenen völkerrechtliche Schutz findet auf sie keine Anwendung. Sie sind nach durchgeführter Absonderung zu erledigen.“ Damit war von Anfang an auch die Wehrmacht als ausführendes Organ in die NS-Vernichtungspolitik eingebunden.43
Juden unter den sowjetischen Gefangenen, etwa 85.000 Soldaten, wurden meist ebenfalls sofort umgebracht.44 Im Oktober 1941 ordnete das OKW an, die Ukrainer, Weißrussen, Polen, Litauer, Letten, Esten, Georgier, Kosaken und Karelier unter den sowjetischen Gefangenen auszusondern. Besonderen Wert legte das OKW auf die Identifikation deutscher, finnischer oder rumänischer Volkstumsangehöriger. Sie sollten umgehend aus der Kriegsgefangenschaft entlassen werden. Soweit sich die Angehörigen dieser Volksgruppen bereits im Reichsgebiet befanden, sah die Wehrmacht wegen der großen Zahl und der Transportschwierigkeiten von einer Entlassung in die Heimat ab. Das Auswärtige Amt forderte zudem eine bessere Behandlung der Moslems und der Angehörigen der Turkvölker, da diese für die weiteren Operationen im Kriegsverlauf von wichtiger Bedeutung sein würden. Einzelne Gruppen von Gefangenen wurden als Zivilarbeiter aus der Gefangenschaft entlassen. Andere traten speziellen Wehrmachtseinheiten, wie der Wlassow-Armee, bei. In „engen Grenzen“ konnten Ukrainer auch als Hilfswachmannschaften, Hilfspolizisten oder Dolmetscher herangezogen werden.45
Die Wehrmacht hatte sich logistisch nicht auf die große Zahl an Gefangenen (bis Mitte November 1941 2,4 Millionen) vorbereitet und weder ausreichend Nahrung noch Unterkünfte bereitgestellt. Die Vorbereitung der Lager im Osten beschränkte sich wohl tatsächlich darauf, lediglich eine umzäunte Fläche zu schaffen. In improvisierten Lagern waren die Gefangenen daher oft schutzlos Wind und Wetter ausgeliefert.46 Die Ernährung der sowjetischen Gefangenen war, vor allem in den ersten Monaten des Krieges gegen die Sowjetunion, katastrophal. Die Verpflegung war, wenn sie überhaupt erfolgte, äußerst mangelhaft (in den Sammellagern 300-700 Kalorien täglich, also weit unter dem Existenzminimum).
Die Versorgungslage war so schlecht, dass es wohl auch zu Fällen von Kannibalismus gekommen ist. Anders lässt es sich nicht erklären, dass der Wehrkreisarzt des Wehrkreises VII im September 1941 ausdrücklich feststellte, dass solche Fälle unter den russischen Kriegsgefangenen im Korpsbereich nicht bekannt geworden seien.47 Medizinische Versorgung fand nicht statt. In dieser Anfangsphase des Krieges gegen die Sowjetunion starben hunderttausende an Erschöpfung und Entkräftung, Typhus und Fleckfieber.48
Dass das OKW von der Situation vollständig informiert war, zeigt eine Notiz über ein Gespräch des Kommandeurs der Kriegsgefangenen im Generalgouvernement vom 20.10.1941 mit zwei Offizieren des OKW. Danach sollten bis Mitte November 500.000 Gefangene vom Generalgouvernement aufgenommen werden. „Ins Reich sollen 600.000 abgeschoben werden; Ernährung nur für 300.000 vorhanden. OKW hat Kenntnis davon, dass das Massensterben unter den Kgf. nicht aufzuhalten ist, da diese mit ihren Kräften am Ende sind. Es kann weder erhöhte Verpflegung noch können Decken zur Verfügung gestellt werden. Durch Chef des Kommandostabes beim Kdr.d.Kgf. wurde OKW gegenüber die Auffassung vertreten, dass dann auch keine Arbeitsleistung verlangt werden könne.“49
Zur mangelhaften Versorgung kamen Vernichtungsmaßnahmen. Manche Kommandanten verboten der Zivilbevölkerung, Gefangenen Nahrung und Wasser zu geben. Viele Gefangene, die die langen Märsche von der Front in die Lager bei völlig unzureichender Versorgung mit Wasser und Nahrungsmitteln nicht mehr mitmachen konnten, wurden von den Wachmannschaften am Wegesrand erschossen. Einsatzgruppen fuhren von Lager zu Lager und erschossen ganze Gruppen von Gefangenen, vornehmlich Asiaten, mit dem Argument, dass die Menschen, je weiter man nach Osten komme, immer minderwertiger würden.50
In den ersten Monaten des Krieges waren die sowjetischen Gefangenen weitgehend als „unnütze Esser“ oder „bolschewistische Mordbestien“ betrachtet worden, an deren Überleben kein Interesse bestand. Erst als sich der Arbeitskräftebedarf im Reich vergrößerte und man in den sowjetischen Gefangenen ein Arbeitskräftereservoir erkannte, verbesserte sich ihre Versorgung, aber nur soweit, dass ihre Arbeitskraft erhalten blieb. Menschliche oder völkerrechtliche Gesichtspunkte spielten keine Rolle.51 Als sich die Sichtweise auf die sowjetischen Gefangenen ab Herbst 1941 änderte, waren die Folgen der Behandlung der ersten Monate nicht mehr zu beheben. Im Dezember 1941 traten Fleckfieberepidemien auf, sodass auch die Spezialisten des Reichsarbeitsministeriums die Lager nicht zur Erfassung der Gefangenen für den Arbeitseinsatz betreten konnten. Auch von den fleckfieberfreien Gefangenen waren mindestens zwei Drittel wegen der schlechten Ernährung nicht arbeitsfähig. Eine Erhöhung der Verpflegungssätze hatte zunächst keinen durchschlagenden Erfolg. Die Zahl der Gefangenen reduzierte sich aufgrund der Todesfälle zwischen November 1941 und Januar 1942 um 25%. In den Lagern im Osten starben durchschnittlich täglich 2.000 Gefangene an Unterernährung.52
Schon im Sommer 1941 gab es erhebliche Bedenken gegen diese Behandlung der sowjetischen Gefangenen. In einer Denkschrift vom 26.08.1941 wurde darauf hingewiesen, dass ein großer Teil der Sowjetunion dauerhaft an Deutschland angebunden werden sollte. Dies könne nur gelingen, wenn die Bevölkerung mitmache. Daher müsse der Kriegsgefangene als Bewunderer Deutschlands in seine Heimat zurückkehren. Der sowjetische Gefangene erwarte eine angemessene Behandlung und ausreichende Ernährung, was ihm ja in den Flugblättern auch zugesichert worden sei.
„In jedem Kriegsgefangenen noch nachträglich einen Bolschewiken sehen zu wollen und ihn entsprechend zu behandeln, wäre völlig abwegig. Schikanöse Maßnahmen sind auf jeden Fall zu unterlassen.“ Auf die Gefangenen sollte man mittels Propaganda, vor allem Zeitungen und Flugblätter, Vorträge, Erziehung zur Sauberkeit und Gesundheitspflege sowie einer strengen, aber gerechten Behandlung einwirken. Außerdem müsse versucht werden, über die Gefangenen Informationen über die Sowjetunion zu erlangen. Schließlich sollte man unter ihnen geeignete Personen für Aufgaben in der Landesverwaltung oder im Wirtschaftsleben ermitteln.53
Im Entwurf einer Denkschrift an den Chef des OKW beklagte sich das Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete massiv über die Behandlung der Gefangenen. Eine gute Behandlung sei wichtig, da eine solche die Rotarmisten zum Überlaufen bewegen könnte. Bei der dauerhaften Besetzung der Gebiete der Sowjetunion sei das Deutsche Reich auf die einheimische Bevölkerung angewiesen. Die Kriegsgefangenen müssten zu Propagandisten der Sache Deutschlands und des Nationalsozialismus gemacht werden. Dies sei bisher nicht erreicht worden. „Das Schicksal der sowjetischen Kriegsgefangenen in Deutschland ist im Gegenteil eine Tragödie größten Ausmaßes. Von den 3,6 Millionen Kriegsgefangenen sind heute nur noch einige Hunderttausend voll arbeitsfähig.“ Die Bevölkerung in der Sowjetunion habe in den Deutschen Befreier vom Bolschewismus gesehen und sich den Deutschen willig zur Verfügung gestellt. Dieses Geschenk habe man nicht angenommen. Auch Überläufer habe man nicht ausreichend gut behandelt. Entsprechende Zusagen in Flugblättern seien nicht eingehalten worden. Der Verfasser fordert schließlich, dass die Behandlung der Gefangenen „nach den Gesetzen der Menschlichkeit und entsprechend der Würde des Deutschen Reiches zu erfolgen hat“. Es sei für Unterkunft und Verpflegung zu sorgen.54
Aber auch in diesen beiden Denkschriften wird deutlich, dass es den Verfassern nicht um die sowjetischen Gefangenen als Menschen ging, sondern um die Vorteile, die eine bessere Behandlung der Gefangenen dem Deutschen Reich bringen werde. Auch hier beherrschten reine Nützlichkeitserwägungen das Denken. Vor allem in der Denkschrift des Ministeriums für die besetzten Ostgebiete wird über vertane Chancen einer besseren Behandlung und deren negative Auswirkungen auf Kriegsführung und Rüstung geklagt.
Als Nebenaspekt sei angemerkt, dass im Juli 1944 schließlich der Befehl an die Verbände an der Ostfront erging, bei Rückzügen kranke und verwundete sowjetische Gefangene, die dauerhaft dienstunfähig seien, in Lazaretten und geeigneten Unterkünften mit Verpflegung und Medikamenten für fünf Tage sowie mit ausreichend russischem Sanitätspersonal zurückzulassen.55 Im Vergleich zur Behandlung der sowjetischen Gefangenen im Jahr 1941 eine Kehrtwende. Vielleicht war nun, nach der erfolgreichen Landung in der Normandie und dem Vormarsch der Roten Armee an der Ostfront den Verantwortlichen klar, dass der Krieg nicht mehr zu gewinnen war und sie versuchten auf diese Weise, mit einem humanitären Vorgehen die Gegner milde zu stimmen.
Diese Maßnahmen änderten an den Zahlen nichts mehr. Von den insgesamt 3,4 Millionen Gefangenen hatte die Wehrmacht bis zum Frühjahr 1942 bereits etwa 2 Millionen verhungern und erfrieren lassen oder, zusammen mit der SS, ermordet.56 Insgesamt starben während des Krieges von den fünf Millionen gefangenen Sowjetsoldaten in deutschem Gewahrsam mehr als drei Millionen.57
3.2.3 Die Verlegung sowjetischer Gefangener ins Reichsgebiet
Der entscheidende Faktor in der Frage, ob und in welchem Umfang sowjetische Gefangene ins Reichsgebiet gebracht werden sollten, waren die Planungen für den Arbeitseinsatz. Hier trafen besonders in der ersten Kriegsphase 1941/42 gegensätzliche Interessen der NS-Führung, der Wirtschaftsverwaltung und der Wehrmacht aufeinander.58 Daher kam es in diesen Monaten zu gegenläufigen Planungen und Maßnahmen, wobei sich beide Positionen zeitweilig durchsetzten, bis Wirtschaft und Wehrmacht im Dezember 1941 endgültig den Sieg davontrugen.
Was die Verwendung der Kriegsgefangenen anbelangte, gab es bis in den Winter 1941/42 hinein – ausgehend von der Alternative, den Gegner zu vernichten oder seine Arbeitskraft auszunutzen - heftige Spannungen zwischen der deutschen Wirtschaft und der Wehrmacht auf der einen, Hitler und der NSDAP auf der anderen Seite. Die Reichsarbeitsverwaltung, die Zuständigen für den Vierjahresplan und das Wirtschaftsrüstungsamt der Wehrmacht wollten mit den sowjetischen Gefangenen die
Lücke an Arbeitskräften schließen, die die Mobilisierung für den Krieg gegen die Sowjetunion in das Reservoir der deutschen Arbeiter gerissen hatte. Dabei griff diese Gruppe auf die positiven Erfahrungen zurück, die man beim Arbeitseinsatz russischer Gefangener während des Ersten Weltkriegs gemacht hatte. Dagegen lehnten Hitler, Bormann, Goebbels und Himmler den Einsatz von sowjetischen Gefangenen im Reich ab. Sie waren in ihrem selbst erzeugten Untermenschenstereotyp gefangen und von einer gleichsam paranoiden Furcht ergriffen, sowjetische Gefangene würden die deutsche Bevölkerung mit dem Virus des Bolschewismus infizieren und bei jeder Gelegenheit ihrem Hass gegen alles Deutsche freien Lauf lassen.59
Vor diesem Hintergrund kam es in der Frage des Arbeitseinsatzes sowjetischer Gefangener im Reichsgebiet bis in den Winter 1941/42 hinein zu keinem einheitlichen Vorgehen.
In der ersten Phase bis Ende August 1941 hatten die Pragmatiker von Wehrmacht und Reichsarbeitsministerium das Heft in der Hand. Unter Auswertung regionalgeschichtlicher Literatur weist der Historiker Reinhard Otto nach, dass bereits ab Mitte Juli überall im Reich sowjetische Gefangen ankamen, in die Wehrkreise weitergeleitet und unverzüglich zur Arbeit im zivilen Bereich eingesetzt wurden. Er weist außerdem auf den Widerspruch zwischen der offiziellen Linie und der tatsächlichen Handhabung hin, ebenso auf das „Dilemma“, vor dem nicht zuletzt das OKW stand, einerseits den weltanschaulichen Gegner zu vernichten, andererseits möglichst viele sowjetische Gefangene in den Arbeitseinsatz zu bringen, um die Kriegswirtschaft aufrecht zu erhalten.60
Aufgrund eines Befehls des OKW vom 02.08.1941 wurden, abweichend von den bisherigen Planungen, sowjetische Gefangene auch in Wehrkreise ohne „Russenlager“ zum Arbeitseinsatz transportiert und in regulären Stalags untergebracht. Hintergrund dürfte gewesen sein, dass die „Russenlager“ im Reich auf eine größere Zahl von Gefangenen nicht vorbereitet waren. Es herrschten katastrophale hygienische Verhältnisse, die Versorgung mit Nahrungsmitteln und Unterkünften sowie die medizinische Betreuung waren völlig unzureichend. Häufig lebten die Gefangenen in Erdhöhlen, weil es keine Baracken gab. Es standen nur wenige Brunnen und Latrinen zur Verfügung, sodass sich Krankheiten ausbreiteten. Außerdem gab es nur „Hungerrationen“. Die Todesraten in diesen Lagern waren daher sehr hoch. Der Arbeitseinsatz drohte zu scheitern, weil die Wahrscheinlichkeit groß war, dass die Gefangenen in den „Russenlagern“ verstarben61. Abhilfe war, die Gefangenen in die besser ausgestatteten und besser organisierten regulären Stalags zu verbringen, in der Hoffnung, dass dort die Behandlung insoweit gesichert war, dass die Gefangenen überlebten.
Eines der ersten regulären Stalags, in dem sowjetische Gefangene eintrafen, war Stalag VII A, in das bereits am 04.08.1941 40.000 sowjetische Gefangene aus Stalag IV H Zeithain gebracht wurden.62 In Folge dieser Entwicklung verloren die „Russenlager“ im Laufe des Herbstes 1941 rasch an Bedeutung. Ab Frühjahr 1942 wurden sie aufgelöst und die Gefangenen vollständig in das bestehende Lagersystem eingegliedert 63
Vermutlich haben die Pragmatiker und Realisten in Arbeitsverwaltung und Wehrmacht mit den Planungen für den flächendeckenden Arbeitseinsatz sowjetischer Gefangener bereits im Frühjahr 1941 begonnen. Nach einem Befehl des OKW vom 16.06.1941 waren für das Reich 790.000 sowjetische Gefangenen und damit eine erhebliche Anzahl für den Arbeitseinsatz vorgesehen. Mittels Auswertung der Quellen kann nachvollzogen werden, dass bereits Ende Juli/Anfang August 1941 der Arbeitseinsatz sowjetische Gefangener in großem Umfang begann.64
Schon im Juli 1941 betrug die Zahl der offenen Stellen alleine in der Landwirtschaft 430.000. Um 500.000 Gefangene zur Arbeit einsetzten zu können, waren 600.000-700.000 Gefangene nötig. Auf Befehl Hitlers waren zunächst nur 120.000 sowjetische Gefangene ins Reichsgebiet gebracht worden. Offiziell waren sich auch die Verantwortlichen in der Wehrmacht ihrer nationalsozialistischen Verantwortung bewusst. Noch Mitte August 1941 stellte das OKW fest: „Es gibt nur ein Gesetz, das zu beachten ist: Das deutsche Interesse, darauf gerichtet, das deutsche Volk gegen die auf Arbeitskommandos befindlichen sowjetrussischen Gefangenen zu sichern und die Arbeitskraft der Russen auszunutzen. […] Der Schutz des deutschen Volkes beim Russeneinsatz ist das Maßgebliche, der Arbeitseinsatz (dagegen) ist in zweiter Linie zu beachten“.65
Gleichzeitig unterlief die Wehrmacht jedoch schon Hitlers Befehl. Bis Mitte August 1941 waren nämlich bereits rund 200.000 sowjetische Gefangene nach Deutschland gebracht worden und befanden sich im Arbeitseinsatz.66
Nun, in der zweiten Phase, setzten sich kurzzeitig die Ideologen durch. Hitler stoppte jetzt den weiteren Transport und den Einsatz der Gefangenen im Reich, beides sollte als notwendiges Übel auf ein Mindestmaß beschränkt werden.67 Die Wehrmacht ignorierte jedoch diesen Befehl zumindest teilweise. Im September ordnete sie nämlich an, weitere sowjetische Gefangene für wehrmachtseigene Arbeiten ins Reich zu holen. Die Gefangenen mussten jedoch unter der Bewachung der Wehrmacht verbleiben. Nach einem Abkommen zwischen OKW und Reichsarbeitsministerium sollten nur Angehörige bestimmter Mangelberufe wie Metall-, Bau- und Holzarbeiter ins Reich geholt werden. Spezialisten des Reichsarbeitsministeriums erfassten diese bereits in den Lagern im Osten. Diese Gefangenen erhielten eine bessere Verpflegung, um ihre Arbeitsfähigkeit zu erhalten.68
In der nächsten Phase, ab Ende September 1941, wurde der Arbeitseinsatz sowjetischer Gefangener im Reich wieder intensiviert. Aufgrund des Kriegsverlaufs im Osten, der zunehmend in einen Abnutzungskrieg überging, war die Wehrmacht immer stärker gezwungen, deutsche (Fach-)Arbeiter einzuberufen. Gleichzeitig stieg der Bedarf an Arbeitskräften, da die Wehrmacht immer größere Mengen an Waffen, Munition und Ausrüstungsgegenständen benötigte.69 Schon am 23.09.1941 erging daher der Befehl des OKH, nach Aussonderung bestimmter Gruppen von Gefangenen weitere 500.000 sowjetische Soldaten ins Reich zu transportieren und an die Kriegsgefangenenorganisation des OKW zu übergeben. Täglich sollten 30.000 sowjetische Soldaten das Operationsgebiet verlassen, so weit als möglich zu Fuß bei einer maximalen Marschleistung von 30km. Der Marsch sollte in kleinen Kolonnen bei einer Bewachung von 1:50 durchgeführt werden. Die Truppe wurde angewiesen, ausreichend Wasser und Verpflegung zur Verfügung zu stellen (und dabei auch die Bevölkerung heranzuziehen) und für Marschkranke Wagen mitzuführen. Als Wachmannschaften auf dem Transport waren Landesschützenbataillone, nicht die kämpfende Truppe vorgesehen. Die Kommandeure der Kriegsgefangenen waren über die Marschziele zu benachrichtigen.70 Die Wehrmacht handelte hier ohne, ja gegen den Befehl Hitlers, der in dieser Zeit noch die Beschränkung des Einsatzes sowjetischer Gefangener im Reich angeordnet hatte.
Der Meinungsumschwung in der nationalsozialistischen Führung erfolgte erst Ende Oktober 1941. Hintergrund war der Kriegsverlauf im Osten. Ein schneller Sieg über die Sowjetunion zeichnete sich nicht ab und damit auch keine schnelle Entlassung deutscher Arbeiter aus der Wehrmacht. Als Hitler darauf hingewiesen wurde, dass aufgrund des Mangels an Arbeitskräften die Versorgung der deutschen Haushalte mit Kohle im kommenden Winter deutlich gekürzt werden müsste, hob er schließlich am 31.10.1941 das Beschäftigungsverbot für sowjetische Gefangene auf. Jetzt sollten diese ebenfalls in den Arbeitseinsatz kommen, auch im zivilen Bereich, bei Land- und Forstwirtschaft, Rüstung, Bau und Bergbau sowie Bahnunterhaltung und schließlich in der Industrie. Gleichsam im Gegenzug dafür verstärkten Partei und SS die Ressentiments gegenüber den sowjetischen Gefangenen, forderte man strengste Bewachung und härtestes Durchgreifen gegen sie. Hier liegen die Wurzeln der unten geschilderten Aussonderungen.71 Hitler legalisierte mit seinem Befehl vom Herbst 1941 lediglich einen bereits tatsächlich existierenden Zustand. Reichsmarschall Göring reagierte sofort. Am 07.11.1941 gab er Richtlinien für den Einsatz sowjetischer Gefangener in der Kriegswirtschaft heraus. Er propagierte einen starken Einsatz sowjetischer Gefangener im Reich, „weniger leistende und viel essende Arbeiter anderer Staaten“ seien aus dem Reich „abzuschieben“, die deutsche Frau solle zukünftig im Arbeitsprozess nicht mehr so stark in Erscheinung treten. Hier zeigt sich wiederum, wie sehr die sowjetischen Gefangenen als anspruchslose, leistungsfähige Arbeiter gesehen wurden. Dann führte Göring eine Vielzahl von Bereichen auf, in denen die sowjetischen Gefangenen tätig werden könnten und stellte Regeln für ihren Einsatz auf.72
Die Gefangenen, die nun ins Reichsgebiet gebracht wurden, waren jedoch aufgrund der schlechten Behandlung durch die deutschen Truppen in einem so miserablen Zustand, dass sie in der Regel nicht für Arbeiten eingesetzt werden konnten. Arbeitgeber beklagten sich, dass die sowjetischen Soldaten wegen ihres schlechten Zustands nur 20% der Leistung polnischer oder französischer Gefangener erbrächten und sich für sie der Einsatz nicht rechnete. Sie forderten eine bessere Ernährung der Gefangenen – nicht aus menschlichen Erwägungen, sondern aus Renditebestrebungen. Zunächst hatten sie keinen Erfolg, das Reichsernährungsministerium räumte den deutschen Verbrauchern absolute Priorität ein. Insgesamt war damit der Effekt des Arbeitseinsatzes sowjetischer Gefangener zunächst sehr begrenzt. Unter diesen Gefangenen war die Sterberate besonders hoch. Da viele sowjetische Soldaten in den Lagern verblieben, dort katastrophale hygienische und medizinische Zustände herrschten und die Versorgung mit Nahrung sowie die Unterbringung völlig unzureichend war, entwickelten sich die noch bestehenden „Russenlager“ zu Sterbelagern. Verstärkt wurde dies noch durch die Tatsache, dass man häufig die schwerer erkrankten Gefangenen aus den Arbeitskommandos in die Lager einlieferte, die dort verstarben.73
Ab Dezember 1941 weitete die nationalsozialistische Führung den Arbeitseinsatz sowjetischer Gefangener deutlich aus. Im Herbst/Winter 1941 zeigte sich nämlich, dass die Prognose der Wehrmacht, Ende des Jahres 1941 eine Teildemobilisierung durchführen und vor allem Facharbeiter nach Hause entlassen zu können, nicht eintraf. Ganz im Gegenteil, das Militär musste weitere Facharbeiter einziehen, die dann in der Rüstungsindustrie fehlten.74 Ende 1941 stieg der Arbeitskräftebedarf im Reich stark an, 1,4 Millionen Stellen waren unbesetzt. Die Wehrmacht benötigte immer mehr Soldaten, gleichzeitig aber auch Waffen und Munition, sodass der Bedarf an Rüstungsarbeitern weiter stieg.75