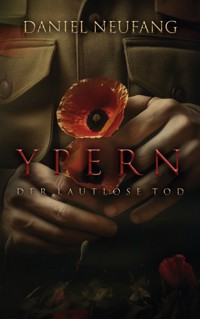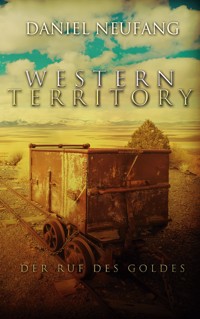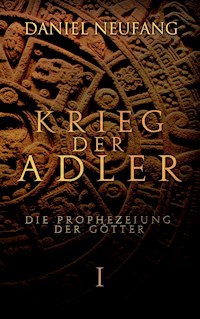Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Überarbeitete Neuauflage Nordfrankreich, Mai 1918. Der Erste Weltkrieg geht in seine entscheidende Phase. Während Amerikaner und Briten die französische Armee in ihrem Kampf unterstützen, bricht in dem kleinen Fischerort Étaples-sur-mer eine seltsame Krankheit aus. Gerüchte über die sogenannte"Spanische Grippe" oder einen Giftangriff der Deutschen heizen die Stimmung auf. Der junge Arzt Marc Nébert versucht mit aller Macht diesen heimtückischen Gegner zu bekämpfen, doch er gerät schnell an seine Grenzen. Monate vergehen nach der ersten Welle, bis das Virus in veränderter Form erneut zuschlägt. Niemand ahnt, dass die Krankheit sich bereits weltweit ausbreitet und die Regierungen einen Mantel des Schweigens darüberlegen. Kann Nébert diese Ketten durchbrechen und somit Leben retten?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 376
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nordfrankreich, Mai 1918. Der Erste Weltkrieg geht in seine entscheidende Phase. Während Amerikaner und Briten die französische Armee in ihrem Kampf unterstützen, bricht in dem kleinen Fischerort Étaples-sur-Mer eine seltsame Krankheit aus. Gerüchte über die sogenannte „Spanische Grippe“ oder einen Giftangriff der Deutschen heizen die Stimmung auf. Der junge Arzt Marc Nébert versucht mit aller Macht diesen heimtückischen Gegner zu bekämpfen, doch er gerät schnell an seine Grenzen.
Monate vergehen seit der ersten Welle, bis das Virus in veränderter Form erneut zuschlägt. Niemand ahnt, dass die Krankheit sich bereits weltweit ausgebreitet hat und die Regierungen einen Mantel des Schweigens darüberlegen. Kann Nébert diese Ketten durchbrechen und Leben retten?
„Wer schleicht durch alle kriegsführenden Länder? Welches Ding schleift die infizierten Gewänder? Wer hat es gesehen? Wer nennt´s? Wer erkennt´s?“von Kurt Tucholsky im Juli 1918 unter dem Pseudonym Theobald Tiger verfasst
Gewidmet all den vielen Menschen, die während der Spanischen Grippe und Covid-19 ihr Leben ließen
Inhaltsverzeichnis
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
1. Kapitel
„Darf ich Ihnen noch etwas zu trinken anbieten, Monsieur?“, fragte die junge Bedienung. Starr und traurig war der Blick des jungen Arztes, Marc Nébert. Hastig griff er nach seiner Geldbörse und suchte seine letzten Sous zusammen.
„Ich nehme noch eine Tasse Kaffee, Mademoiselle. Aber schwarz. Merci.“ Mit einem höflichen Knicks verschwand die in einen schwarzen, knöchellangen Rock und eine schwarze Bluse mit weißem Schleppenkragen gekleidete Frau hinter dem Tresen des gut besuchten Bistros in der Pariser Innenstadt. Abwesend, gar teilnahmslos, schweifte sein Blick durch die mannshohen Fenster über die menschenüberflutete Straße.
Wie sie strahlend umherlaufen. Als hätte es dieses schlimme Jahr nie gegeben. In der Verdrängung sind wir Menschen meisterlich.
Er griff nach einem kleinen Stück Baguette und aß sein Omelette, obwohl es ihm beim Gedanken an die vergangene Zeit speiübel wurde. Sein Antlitz spiegelte sich in der Scheibe.
Was ist bloß aus dir geworden? Ein Schatten deiner Selbst. Nicht mehr ist geblieben als ein grauer, schmaler Kerl. Einfach nur erschütternd.
Seine schmalen Hände verschwanden in den viel zu großen Taschen seines Anzugs. Zitternd nahm er ein silbernes Zigarettenetui hervor. Nervös zündete sich der Mediziner eine Gitane an und schaute erwartungsvoll zur Eingangstür. Er war sich unsicher, ob dies die richtige Entscheidung war.
Hoffentlich kommt er bald. Ich kann das alles nicht mehr länger für mich behalten. Die Welt soll erfahren, was passiert ist… Es ist das Recht jedes Einzelnen.
In diesem Augenblick schellte die Türglocke und ein dreißigjähriger, großer Mann stürmte den Gästeraum. Als wäre er in Zeitnot schaute er sich in dem gefüllten Raum um.
„Monsieur Nébert!“, rief der junge Mann quer durch den Raum und zog dadurch sämtliche Aufmerksamkeit auf sich. Marc hob vorsichtig die Hand. Die Bedienung nahm dem gut gekleideten Herrn die Jacke ab und fragte: „Kann ich Ihnen schon etwas bringen?“
„Ja“, antwortete er kurz angebunden. „Ein Glas Cordier. Merci… Bringen Sie es an diesen Tisch.“ Mit ausgestreckter Hand kam der Fremde auf den Arzt zu.
„Monsieur Nébert. Es freut mich Sie kennenzulernen. Mein Name ist Michel Génève. Journalist bei La Croix.“
„Bonjour, Monsieur Génève. Nehmen Sie doch bitte Platz.“ Der Journalist setzte sich auf die breite, mit dunklem Leder bezogene Bank. Während Marc noch einen tiefen Zug an seiner Zigarette nahm, öffnete Michel seine Tasche. Schneller als Nébert blinzeln konnte, hatte der junge Kolumnist bereits seinen Block auf den hölzernen Tisch gelegt. Der feine Federkiel war schon schreibbereit gemacht. Auch Génève zündete sich eine Zigarette an und schaute sein Gegenüber fragend an.
„Warum wollten Sie mich sprechen?“
„Ich habe eine Geschichte für Sie. Sämtliche Regierungen spielen die Ereignisse des letzten Jahres als Lappalie herunter.“ Der Journalist schaute skeptisch drein, beugte sich vor und flüsterte: „Erzählen Sie mir alles, Monsieur Nébert. Ihre Geschichte ist bei mir in guten Händen.“ Der Dorfarzt nahm tief Luft, drückte seine Zigarette im Aschenbecher aus und schaute sich um, während sein Augenlid zu zucken begann.
„Was ich Ihnen nun erzähle ist tatsächlich geschehen…“
An diesem herrlichen Maimorgen des Jahres 1918 schien die Welt, trotz des verheerenden Krieges, in Ordnung zu sein. Die Sonne bahnte sich langsam ihren Weg durch die schweren Nachtwolken. Dünne Nebelschwaden schwebten wie ein Geisterschleier über die anliegenden Felder vor dem malerischen Strand. Aus der Ferne war der tosende Lärm der Geschütze zu hören, doch in Étaples-sur-Mer fühlten sich die Menschen sicher. Es war ein kleines Örtchen an der Kanalküste, nordöstlich der Hauptstadt Paris. Wie in einem alten Ölgemälde, schien die Zeit stillzustehen. Die Kirchturmglocke läutete zur achten Stunde.
„Vite!“, schallte die laute Stimme Monique Callas durch das gesamte, alte Backsteinhaus.
„Ich bin schon wach!“, rief ihr Ehemann, Arthur. Der gelernte Schreiner arbeitete im kleinen Familienbetrieb und fertigte zusammen mit seinem alten Herrn, Luc Callas, sämtliche Möbelstücke an. Auch Ausbesserungen und Reparaturen waren kein Problem für die beiden. Seit Jahrzehnten hatten sie sich einen guten Namen über die Grenzen des Ortes hinaus gemacht und wenn die sie nicht gerade die Kirchenbänke restaurierten, engagierten sie sich selbstlos für ihre Mitbürger.
„Schon so spät“, murmelte Arthur. Sein Blick galt der Wanduhr, welche das Schlafzimmer zierte. Schnell wusch er sich an der Waschschüssel das Gesicht, kämmte den Oberlippenbart und rannte die schmale Treppe hinunter. „Entschuldige, mein Schatz. Es hat gestern Abend etwas länger gedauert“, erklärte er seine Verspätung, küsste seine Frau auf die Wange und setzte sich an den gedeckten Frühstückstisch.
„Was habt ihr denn so lange getan? Schränke ausgebessert oder Doktor Nébert die Vitrine angepasst auf die er schon wartet?“ Monique schenkte ihrem Gatten Kaffee ein.
„Nein, ma chère“, flüsterte Callas mit trauriger Stimme. „Wir haben Gérards Sarg fertiggestellt. Ich denke, das ist momentan wichtiger als Néberts Vitrine.“ Kurzes Schweigen flutete den Raum, ehe Monique Callas betroffen fortfuhr: „Daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Verzeih mir.“ Ihr Gatte schnitt sich ein Stück Baguette auf und belegte es mit etwas Wurst.
„Gibt es schon was Neues von Sèrge? Er müsste doch unserer Amelie inzwischen geschrieben haben.“
„Sie hat nichts gesagt“, wisperte seine Ehefrau ahnungslos. „Hoffen wir, dass unser Schwiegersohn mit heiler Haut zurückkommt.“ Arthur sah seine Frau besorgt an und streichelte sanft ihre Hand.
„Ich werde nach der Arbeit bei den Lémaux vorbeigehen und mich erkundigen.“ Arthur gab Monique noch einen Kuss, ehe er das Haus verließ. Es war Ende April. Die kühle Luft zwang ihn sich eine dicke Jacke anzuziehen. Ein leichter Wind wehte vom Kanal her durch die Gassen von Étaples und brachte die Leichtigkeit des Frühlings in das Dorf.
Der Schreiner schritt flink zum Familienbetrieb. Pierre, der Zeitungsjunge, stand bereits an seinem festen Stammplatz einige hundert Meter von der Canche entfernt. Mit lauter Stimme rief er die neusten Meldungen aus. Es war der Sohn des Schmieds, der sich so ein paar Sous hinzuverdiente.
„Wollen Sie eine Tageszeitung, Monsieur Callas? Frisch aus der Presse.“ Er nahm ein Geldstück aus der Tasche, lächelte gequält und kaufte ihm eine Ausgabe des Le Matin ab. Ohne einen weiteren Blick auf die Schlagzeilen zu werfen, ging Arthur weiter zur Bäckerei der Villebons. Die großen, einladenden Fensterscheiben brachten normalerweise die Backwaren zur Geltung, welche täglich frisch angefertigt wurden. Doch in den vergangenen Jahren war es weniger geworden. Villebon bekam nicht mehr genug Mehl, um den gesamten Ort mit der wichtigen Nahrung zu versorgen. Als Callas den Laden betrat ertönte das kleine Eingangsglöckchen und der Duft des Brotes stieg ihm in die Nase.
Nanu? Wo ist Roger? Auch von Elise keine Spur. Seltsam.
Mit beiden Händen stützte er sich auf dem schmalen Tresen ab und versuchte einen Blick in die Backstube zu erhaschen.
„Roger? Bist du da?“ Es dauerte einen Moment, bis der Bäcker nach vorne kam. Er wischte sich schnell die Tränen ab, um sich keine Blöße zu geben.
„Salut, mon ami.“
„Bonjour, Roger. Wie geht es euch?“ der Bäcker schaute an seine holzgetäfelte Decke und holte tief Luft.
„Wie soll es uns schon gehen, Arthur. Der Verlust ist ein Stich ins Herz.“
„Er wird heute fertig“, flüsterte der Schreiner betroffen und wagte es nicht seinem Freund ins Antlitz zu schauen. „Wir haben uns beeilt.“
„Merci. Das bedeutet uns viel. So können wir wenigstens von unserem geliebten Gérard Abschied nehmen… Ist mir lieber, als hätten sie ihn nur vermisst gemeldet. So wissen wir immer, wo er ist. Was sind wir euch eigentlich schuldig?“ Callas schüttelte den Kopf und fuchtelte mit den Händen.
„Nein, mein Freund. Es war uns ein Bedürfnis dies für euch zu tun.“ Ein verlegenes, jedoch dankbares Lächeln huschte über Villebons Lippen.
„Der Herr möge euch segnen, Arthur. Ihr nehmt uns eine große Last von den Schultern. Habt ihr eigentlich Nachricht von Sèrge erhalten?“ Bedrückt schaute der Schreiner drein und versuchte seine Sorgen für sich zu behalten.
„Kein Wort. Wenn man den Berichten Glauben schenkt, ist es ein Chaos, welches momentan an der Aisne tobt.“ Der Bäcker griff nach einem noch warmen Baguette und verpackte es in Zeitungspapier.
„Gib die Hoffnung nicht auf. Er ist mit Antoine Barnais zusammen. Sie werden schon aufeinander Acht geben.“ Seine Worte brachten ein Gefühl der Erleichterung.
„Wahrscheinlich hast du Recht. Antoine ist ein besonnener Bursche.“ Im selben Augenblick läutete die Kirchenglocke und ein Tumult der Schulkinder füllte die Straßen. Arthur sah ihnen zu, wie sie in spielerischer Leichtigkeit an den Schaufenstern vorbeiliefen.
„Weißt du, was mir Sorge bereitet, Roger?“
„Du wirst es mir sicher sagen.“ Arthurs Stirn legte sich in Falten.
„Dass der Krieg noch andauert, wenn unser Jean-Luc siebzehn wird… Er ist Feuer und Flamme für sein Land kämpfen zu dürfen. An manchen Tagen haben wir den größten Streit deswegen.“ Der Schreiner schien verzweifelt und erhoffte sich einen Rat.
„Du musst ihn hierhalten, mein Freund. Der Junge muss der Realität ins Auge sehen. Anfangs haben wir alle gedacht, es sei schnell vorüber und nun fressen die blutigen Schlachten unsere Kinder. Mach ihm das klar, mon ami.“
„Ja“, murmelte der Schreiner und schlich zur Tür. „Wann soll nochmal die Beisetzung sein?“
„Sonntag. Sie bringen ihn mit einem Laster heim.“ Callas nickte und verließ mit erhobener Hand das Geschäft. Nachdenklich schritt er durch seine Heimatstraßen. Die Sonne brach durch die Wolken. Ihr warmer Schein ließ fast sämtliche Sorgen verblassen. Callas war dennoch froh, als er endlich die am Dorfrand gelegene Schreinerei erreichte. Aus dem Inneren drangen die lauten Klopfgeräusche des Hammers an ihn heran. Darunter mischte sich hin und wieder das Klacken der Ahle, mit welcher sein Vater die Verzierungen anfertigte. Langsam öffnete er die schwere, quietschende Eisenpforte und betrat die lange Halle. Der alte Kohlenofen sorgte für eine wohlige Wärme. Sein alter Herr bearbeitete kunstvoll die Verschläge an Gérards Sarg. Während die blecherne Kaffeekanne auf dem Ofen klapperte, durchzog der Rauch von Lucs Zigarette den ganzen Raum. Der Schreinermeister war Kettenraucher und bei jedem Arbeitsschritt wippte der glühende Glimmstängel in seinem Mundwinkel. Manchmal wirkte es, als würde sie tanzen. Arthur legte seine Jacke ab.
„Wo warst du, Junge? Ich schufte hier schon seit einer knappen Stunde.“ Beschämt nahm sich sein Sohn die Holzpolitur.
„Tut mir leid, Papa. Ich war noch bei Villebon.“
„Wie geht es ihnen?“ Arthur zuckte mit den Schultern, während er den Deckel einließ.
„Roger trägt es mit Fassung. Aber Elise…“ Luc schenkte sich eine Tasse Kaffee ein.
„Für sie ist es halt noch schwerer den Verlust ihres einzigen Sohnes zu ertragen.“
„Was glaubst du, wie lange es dauert, bis wieder Normalität bei ihnen einkehrt?“, fragte sein Sohn und trug noch eine weitere Schicht Politur auf.
„Das ist schwer zu sagen. Manche verdrängen den Schmerz, andere leiden ihr Leben lang und wieder andere schließen irgendwann damit ab. Ich habe schon zu viel erleben müssen. Hast du eigentlich eine Zeitung mitgebracht?“
„Oui. Da auf dem Tisch.“ Luc drückte seine Zigarette aus und blätterte neugierig darin. Ein zynisches Lächeln stahl sich auf seine Lippen.
„Jetzt drucken sie seit Monaten keine Vermissten-oder Verlustlisten mehr. Als würde es uns dadurch besser gehen.“ Arthur schwieg. „Wenigstens liegen die Deutschen bald am Boden. Mit Hilfe der Amerikaner hat das Sterben ein Ende.“ Skeptisch wischte Arthur weiter. Er hatte nur beschränkte Hoffnungen in die Unterstützung vom anderen Kontinent. So fuhren sie mit ihrer Arbeit fort und in den Abendstunden war es endlich vollbracht. Durch seine Schlichtheit bestechend und dennoch etwas Besonderes, stand ihr Werk inmitten der Schränke, Tische und Stühle, welche den Großteil des Raumes einnahmen. Luc klopfte zufrieden auf die Schulter seines Sohnes.
„Es ist vollbracht. Ich bete dafür, dass Gérard in diesem Sarg seine Ruhe findet.“ Callas wischte sich die Tränen ab. Zu gut kannte er den Burschen. Bereits am nächsten Morgen wurden weitere Truppenteile der Amerikaner durch den Ort in Richtung Aisne transportiert. Unter dem überschwänglichen Jubel der Bevölkerung fuhren dutzende von Lastwagen über die schmale Nebenstraße, die am Ortsrand vorbeiführte. Auch Réne Barnais war dort und beobachtete die Konvois der Lastkraftwagen. Der Schaffner war fünfundvierzig Jahre alt, hatte braunes, kurzgeschnittenes Haar und seine Zurückhaltung stieß nicht bei jedem auf Wohlwollen. Selbst seine sechs Jahre jüngere Frau, Julie, empfand dies stellenweise als störend.
„Réne“, sprach sie ihn vorsichtig an. Julie hegte die Hoffnung ihn von seinem Starren zu lösen. In ihrer Hand hielt sie seine metallene Kassette mit dem Mittagessen. „Hast du nicht etwas vergessen?“
„Excuse- moi“, wisperte der Schaffner verlegen. „Mir blutet das Herz, wenn ich diese Burschen sehe. Wie es bloß unserem Antoine und Sèrge geht?“ Julie versuchte ihren Gatten zu beruhigen und legte sanft ihre Hand auf dessen Wange.
„Es wird ihnen gut gehen, mon chèr. Sie werden Gérards Beerdigung nicht verpassen.“ Doch ihr Mann sah die Lage pragmatischer.
„Wer weiß schon, wie viele Leben wir noch beklagen müssen, bis dieser Wahnsinn endlich ein Ende findet.“ Madame Barnais ging zurück ins Haus. Sie wischte sich die Tränen ab, denn noch nie zuvor war ihr Réne so pessimistisch eingestellt gewesen. Dies bereitete ihr größte Sorgen. Den Blick immer auf die Laster gerichtet, welche die Befreier zur Front transportierten, schlich der Schaffner zum Bahnhof, um seinen Zug zu erreichen. Der lange Fußmarsch bis zum Bahnsteig schien an diesem Morgen nicht zu enden.
Mon Dieu. Wie viele Invaliden und Verwundete werden wohl heute in den Abteilen sitzen? Ihre Gesichter sprechen Bände. Angst, Hoffnungs- und Schlaflosigkeit, schwere Erkältungen. All das ist in ihren geschundenen Mienen zu lesen. Niemand von uns hätte es jemals für möglich gehalten, dass es solch ein schweres Leid für unsere Nation bedeuten würde.
Mit einem unwohlen Gefühl bestieg er den letzten Wagon des Zuges nach Paris. Es blieb nur noch genügend Zeit, um die Uniform zu richten, sich den Scheitel zu glätten und das Mittagessen zu verstauen, als die schrillen Pfiffe von der Bahnsteigkante ihm durch Mark und Bein fuhren. Nichtsdestotrotz ging Réne an seine Arbeit. Und wie er es befürchtet hatte, war jeder Zweite ein Veteran. Voller Respekt vor den Leistungen dieser Männer, nahm er ihre Fahrscheine entgegen.
Die Zeit verging und ehe er sich versah, war es schon sechs Uhr abends. Die Bahn fuhr in den kleinen Bahnhof, einige Kilometer vor Étaples, ein. Erschöpft schwankte Barnais nach Hause. Der kühle Wind und der leichte Regen ließen seine Beschwerden schlimmer werden. Die brennenden Gelenkschmerzen machten seinen Heimweg zur Tortur. Mühsam schleppte sich der Bahnangestellte am nahegelegenen Friedhof vorbei, wo der örtliche Totengräber, Fréderic LaRoche, im Schein seiner Laterne das Grab des jungen Villebon aushob. LaRoche versuchte etwas zu erkennen und sprach: „Bonjour, Réne. Ich habe mich gerade höllisch erschrocken.“
„Wieso, Fréderic?“, brachte Barnais seine Frage mit belegter Stimme hervor.
„Um Gottes Willen, du siehst aus wie der Tod persönlich. Geht es dir nicht gut?“ Der Familienvater schüttelte den Kopf und zog sich seine Kapuze tief ins Gesicht. Der Regen wurde stärker und die Tropfen prasselten ohne Unterlass auf ihn herab.
„Excuse- moi. Ich sehe besser zu, dass ich nach Hause komme.“ Der Totengräber schlug seine Schippe in den schlammigen Boden.
„Kann ich dir helfen?“ Doch Réne verneinte.
„Danke, aber ich glaube die paar Meter schaffe ich noch allein.“
„Geh zu deiner Frau. Julie soll dir einen heißen Tee machen.“ Barnais stimmte wortlos zu und schlich weiter, bis er endlich sein altes Bauernhaus erreichte. Hustend trat der Schaffner ein. Sein gesamter Körper zitterte, bebte, als er an den Küchentisch trat.
„Du liebe Zeit! Was ist mit dir los?“, fragte seine Frau erschrocken, als sie ihrem Mann ins fahle Antlitz schaute. Sie zog ruckartig den Stuhl am Esstisch zurück, so dass er sich sofort setzen konnte.
„Ich fühl mich nicht wohl, Julie“, hauchte er. „Ist noch etwas von der köstlichen Hühnersuppe übrig?“ Sie ließ sich nicht zweimal bitten. Eilig servierte Julie ihrem Gatten einen Teller samt einem Stück Brot.
„Hast du den beiden schon geschrieben, dass ihr Freund Villebon gefallen ist?“, fragte er mit heiserer Stimme.
„Ich habe es erwähnt und würde mich freuen, wenn sie ihrem Kameraden die letzte Ehre erweisen könnten. Außerdem wäre es eine Möglichkeit unseren Jungen wieder in den Arm zu nehmen.“
„Ja, das wäre schön.“
„Du legst dich jetzt erst einmal ins Bett“, flüsterte Julie besorgt und legte ihre flache Hand auf seine Stirn. „Um Himmels Willen. Du glühst ja, Réne.“ Ihr Gatte nickte nur und ging sofort nach dem Essen zu Bett.
Als am nächsten Morgen die Sonne ihre warmen Frühlingsstrahlen auf den französischen Boden warf, weckte der Lärm eines Lastkraftwagens die Einwohner von Étaples-sur-Mer. Sein lautes Knattern wurde von einem starken Dröhnen begleitet. Der Bäcker Villebon und seine Frau Elise waren schon früh auf den Beinen. Das schwarz gekleidete Ehepaar stand schon eine gefühlte Ewigkeit vor der kleinen Dorfkirche und erwartete sehnsüchtig die Rückkehr ihres geliebten Sohnes. Roger stützte seine Liebste, als der Laster vor der Pforte zum Stehen kam. Madame Villebon weinte bitterlich, was auch an Arthur nicht spurlos vorbeiging, während er durch das Küchenfenster alles mit ansah. Schweigend, dennoch voller Stolz, entluden die Soldaten ihren Waffengefährten und betteten ihn in den maßgefertigten Sarg. Die Vier salutierten voller Demut vor dem trauernden Ehepaar, ehe sie so schnell verschwanden, wie sie gekommen waren. Die Eltern traten vorsichtig näher und der Schein der Sonne brach sich wärmend in den rotgelben Mosaikfenstern des Gotteshauses.
„Unser Junge“, schluchzte Elise und presste sich fest an die Seite ihres Mannes. „Er sieht aus, als würde er schlafen. Bitte, Roger. Weck ihn auf.“ Er nahm seine Frau in den Arm und wandte ihren Blick von ihrem geliebten Jungen ab. Sein Unterkiefer bebte. Zu gerne hätte der Bäcker seinen Gefühlen freien Lauf gelassen, doch er wollte sich nicht die Blöße geben. Ungläubig starrte er auf seinen Spross, der in die beste Uniform gekleidet dalag. In diesem Augenblick der übermäßigen Trauer kam Pater Paul hinzu. Der Geistliche hatte in seinen vierzig Jahren des Dienstes an Gott schon so viele seiner Schafe aus dem Dunkel geführt. Doch dieses Schicksal ging ihm nahe. So nahe, wie jedes der Soldaten, welche sich für ihr Land opferten. Nur zu gut kannte er den beliebten Bäckerssohn. Von dessen Taufe, bis hin zu seinem letzten Kirchenbesuch. Langsamen Schrittes näherte sich der Pfarrer dem trauernden Ehepaar.
„Es tut mir entsetzlich leid, Monsieur Villebon. Ein solcher Verlust ist schwer zu ertragen.“
„Danke, Monsieur Paul“, sprach Réne. Er versuchte stark zu sein. Nicht nur für seine Frau, sondern auch für sich selbst. Der Geistliche legte bedauernd die Hand auf Elises Schulter und flüsterte: „Es ist schon alles vorbereitet.“ Erst jetzt fielen Villebon die vielen Kränze auf, welche von den Mitbewohnern da gebracht wurden. Dies zeigte, wie sehr sie alle mit den Villebons fühlten. Sein Blick schweifte umher. An jedem hing ein Trauerflor, versehen mit den Beileidsbekundungen der Dorfbewohner.
„Es wird Zeit“, sprach Monique Callas, die noch einmal ihr schwarzes Kleid richtete. Ihr Mann stand hingegen wie angewurzelt am Küchenfenster.
„Ich bin gleich so weit“, murmelte der Schreiner und schlich mit gesenktem Haupt die Treppenstufen hinauf. Es dauerte fast eine halbe Stunde, da kam Arthur in seinen besten Anzug gekleidet zur Tür.
„Wo sind Amelie und Jean-Luc?“, fragte er, während seine Gattin noch einmal den Sitz der Krawatte prüfte.
„Amelie kommt zur Kirche. Doch, wo sich dein Sohn befindet, kann ich dir nicht sagen.“ Callas versuchte seinen Zorn zu unterdrücken.
„Wo ist der Bengel? War er nicht auf seinem Zimmer?“ Monique schüttelte den Kopf. Sie schaute in den großen Flurspiegel und sprach: „Ich glaube es ist einfach zu viel für ihn.“ Arthur sah sie voller Unverständnis an und sein Gesicht färbte sich feuerrot. Lautstark donnerte daraufhin seine Stimme durch den Flur, so dass auch sein Sohn es in seinem Schlafraum hören konnte.
„Er will doch selbst dienen, Monique! Dann soll er auch sehen, welches Leid und tiefen Schmerz er verursacht.“ Madame Callas ging daraufhin zur Schlafzimmertür ihres Sohnes und pochte wild dagegen.
„Jean-Luc!“
„Was ist denn, Maman?“
„Zieh dich endlich an! Du wirst uns begleiten.“ Jean-Luc dachte nicht daran zu öffnen und rief: „Ihr wollt mich zur Beerdigung schleppen, nicht wahr?“ Seine Mutter geriet in Rage und schlug gegen die stabile Holztür.
„Keine Widerrede! Du machst dich jetzt fertig oder ich schicke dir deinen Vater.“ Es dauerte nicht lange, bis der Junge bestens gekleidet und mit blondem Scheitel dastand. Seine Miene hingegen wirkte missmutig, denn er wusste, was ihm blühte. Während die Kirchturmglocke bereits Neun schlug, hatte sich das ganze Dorf vor dem Gotteshaus versammelt. Schweigend traten sie ein, als Pfarrer Paul die Pforten aufstieß und einen jeden mit Handschlag begrüßte. Die Bewohner nahmen Platz. Der Blick stets auf den geschlossenen Fichtensarg gerichtet.
„Liebe Gemeinde“, begann Paul seine Predigt, nachdem der Jugendchor sein Lied beendet hatte. „Heute haben wir uns erneut versammelt, um nun auch Gérard Villebon die letzte Ehre zu erweisen. Wie so viele jungen Männer, kämpfte er für sein Land und seine Familie, für seine Freunde und die Freiheit. An diesem Tag nimmt unser Herr ihn an seine Seite und schenkt ihm das ewige Leben.“ Er verlas einige, teils lustige Anekdoten, welche ihm zu dem Bäckerssohn einfielen. Stellenweise konnten sich die Anwesenden ein Schmunzeln nicht verkneifen. Dennoch musste der Geistliche mit seinen Tränen kämpfen. Zu viele Burschen, die noch ihr gesamtes Leben vor sich hatten, musste er schon in die Hände Gottes geben. Nachdem die Trauermesse ein Ende gefunden hatte, nahmen die Sargträger zu beiden Seiten Aufstellung. Es waren hauptsächlich gut gekleidete Männer in gesetztem Alter, da die Jungen an der Front kämpften. Gérards letzter Weg führte ihn auf den Schultern der alten Herren, begleitet von seinen Eltern und Angehörigen, über den schmalen Friedhofsweg, hin zu seiner Ruhestätte.
„Wo sind Antoine und Sèrge?“, fragte Barnais verärgert, während er versuchte das Husten zu unterdrücken und auf seine Uhr starrte.
„Ich weiß es nicht. Vielleicht wurden sie aufgehalten oder der Zug hatte Verspätung.“ Doch mehr als die Abwesenheit ihres Sohnes bedrückte Julie der Gesundheitszustand ihres Gatten. Schlotternd stand er da. Mit schmalen Wangen und tiefen, dunklen Gräben unter den Augen. Während der Sarg langsam in die Erde abgesenkt wurde, erschienen plötzlich Sèrge und Antoine. Wortlos schritten sie an ihren Angehörigen vorbei, bekreuzigten sich vor Gérard und warfen eine kleine Schaufel Erde hinab. Die Scharfschützen hatten drastisch an Gewicht verloren. Ihre Gesichter wirkten schmal und die anfangs gutsitzenden Uniformen schienen ihnen nun viel zu groß zu sein. Sie ehrten ihren Freund nicht durch Blumen. Sie gaben ihm ihre Verwundeten Auszeichnungen zum Zeichen des Respekts mit auf seine letzte Reise. Es dauerte nur einen Wimpernschlag, da betraten fünfzehn weitere Soldaten aus Villebons Einheit den Gottesacker. Gekleidet in ihre besten Uniformen, verabschiedeten auch diese jungen Männer ihren Waffenbruder. Doch so sehr sie sich auch bemühten. Die erlittenen Qualen hatten ihre Spuren hinterlassen. Ihre Körperhaltung spiegelte die Ereignisse der letzten vier verdammten Jahre wider. Pater Paul rührten diese Gesten so sehr, dass auch er mit den Tränen zu kämpfen hatte. Allmählich legte sich der kühle Wind und die Sonne erhellte die Gegend. Roger hatte den Eindruck, sein Sohn wollte ihnen ein Zeichen senden.
Trauert nicht um mich. Auf Regen folgt immer ein Sonnenschein.
Dieser Gedanke brachte ihn kurz zum Lächeln. Unterdessen hatten sich Antoine und Sèrge ihren Familien zugewandt. Herzlich küssten und umarmten sie ihre Liebsten.
„Unser Antoine ist zurück“, wisperte Réne gerührt, als Julie ihren geliebten Jungen fest in den Arm nahm. Der Dorfarzt, Marc Nébert, beobachtete diesen emotionalen Augenblick aus der Ferne. Er war erst seit wenigen Monaten in Étaples und versuchte zaghaft eine Beziehung zu den Bürgern aufzubauen. Das Hauptaugenmerk des Mediziners aus Calais galt seiner Integration und Anerkennung in der Gemeinde. Daher gab er acht auf die Gesundheit aller. Erst gingen die Callas an ihm vorüber, danach folgten in einem gewissen Abstand die Barnais. Einem jeden nickte er höflich zu, ohne sein Beileid zurückzuhalten. Erst Réne erregte seine Aufmerksamkeit.
„Bonjour, Monsieur Barnais. Fühlen Sie sich nicht gut?“ Das Kältegefühl ließ den Körper des Bahnangestellten erbeben. Heiser und schwitzend blieb der Schaffner noch einen Moment stehen.
„Salut, Doktor Nébert.“ Er drehte sich zu seiner Familie um und sprach: „Geht ruhig vor. Ich komme gleich nach.“ Nachdem die Angehörigen verschwunden waren, wandte er sich dem Mediziner zu und flüsterte: „Ich fühle mich nicht wohl, Monsieur Nébert. Gestern, nach der Arbeit, überkam mich eine ungewohnte Schwäche. Der starke Husten und das hohe Fieber zwangen mich fast zur Bettruhe. Würden Sie mich untersuchen?“ Marc legte die flache Hand auf seine Stirn und seine Miene sprach Bände.
„Kommen Sie bitte heute Nachmittag in meine Praxis. Ich würde Sie gerne genauer untersuchen. Sonst kann ich keine Aussage treffen.“ Réne schaute ihn überrascht an.
„Es ist Sonntag. Ihre Praxis ist doch geschlossen?“
„Ausnahmsweise. Ihr Zustand bereitet mir Sorgen.“ Réne überlegte kurz, ehe er zustimmte.
„D`accord. Um Zwei?“
„Ja. Das würde mir reichen. Bis dann, Monsieur. Aber erscheinen Sie rechtzeitig.“ So trennten sich vorerst ihre Wege. Während Barnais nach Hause ging, um endlich ein wenig Zeit mit seinem Sohn zu verbringen, saß die Familie Callas bereits mit ihrem Schwiegersohn zusammen. Monique schenkte ihm eine Tasse Kaffee ein. Alle erwarteten von ihm Berichte darüber, wie es momentan an der Front aussah. Arthur war aufgeregt und versuchte ein Gespräch vom Zaun zu brechen.
„Also, Sèrge. Wie ist es euch ergangen?“ Der Soldat schwieg beharrlich. Wie hypnotisiert starrte er in seine Tasse, als würde er in ihr die Antworten auf all die Fragen finden. Sorgevoll nahm Amelie seine Hand und wisperte: „Willst du nicht darüber reden?“ Sèrge schüttelte den Kopf.
„Ihr könnt euch nicht vorstellen, was dort draußen geschieht. Selbst ich hätte es nicht für möglich gehalten… Wir werden wie Vieh zur Schlachtbank geführt.“
„Aber ihr habt doch überlebt“, versuchte Monique ihn zu beschwichtigen. „Dafür sind wir unserem Herrn so dankbar.“
„Wie gerne wäre ich bei euch auf dem Feld.“ Lémaux sah seinen jungen Schwager strafend an, während dieser mit seinen patriotischen Äußerungen fortfuhr. „Ich kann es kaum erwarten die blaue Uniform zu tragen. Die Waffe in der Hand, für unser geliebtes Frankreich.“ Dies war zu viel des Guten. Zornig schlug Sèrge so fest mit der Faust auf den Tisch, dass das Geschirr bebte und schepperte. Voller Unverständnis für diese Ansichten schaute er den Burschen an.
„Du hast überhaupt keine Ahnung, Jean-Luc. Rede gefälligst nicht über Dinge, von denen du keinen blassen Schimmer hast. Antoine und ich haben in dem nassen Schlamm der Marne gelegen, die Gasangriffe vor Verdun durchgemacht und an der Somme unter Blut, Schweiß und Tränen die Deutschen zurückgedrängt. Wir haben unsere Kameraden auf die widerlichste Art sterben sehen… Und haben das Glück gehabt mit Fieber und Schüttelfrost ins Lazarett zu dürfen, ehe sie uns an den Ufern der Aisne verheizt hätten. Also lass die Sprüche!“ Pikiert über diese drastische Schelte sprang Jean-Luc auf, rannte in sein Zimmer und nur noch das Knallen der Tür war zu hören. Arthur, Monique und Amelie schwiegen, doch im Herrn des Hauses brodelte es zusehends. Er konnte seinen Sohn nicht mehr verstehen und entschuldigte sich aufrichtig bei seinem Schwiegersohn.
„Bitte verzeih, Sèrge. Ich glaube er weiß manchmal nicht, was er in seinem jugendlichen Leichtsinn von sich gibt.“
„Ich befürchte, er weiß es genau, Arthur. Aber ihr tragt keine Schuld daran“, flüsterte der Scharfschütze. „Und Jean-Luc erst recht nicht. Seit Kriegsbeginn liegen bei mir die Nerven blank. Ich bete jeden Tag, dass es bald vorüber ist, ehe einem von uns das Gleiche widerfährt, wie unserem Freund Gérard.“ Amelie hätte ihrem Mann gerne neuen Mut gemacht, aber sie wusste nicht, was sie sagen sollte.
„Ihr wart doch an der Aisne? Glaubst du daran, dass die kaiserlichen Armeen bald die weiße Fahne schwenken?“ Sèrge zuckte mit den Schultern und sah seinen Schwiegervater mit einer Hoffnungslosigkeit an, welche ihresgleichen suchte. Sein Körper bebte, als er an die Ereignisse zurückdachte.
„Das glaubten wir noch in den Gräben vor Verdun. Und du weißt, was geschehen ist. Aber jetzt, wo wir die Unterstützung der Amerikaner haben, könnte es möglich werden.“ Lémaux nahm noch einen Schluck Kaffee, als ihn plötzlich ein starker Hustenanfall befiel. Seine Lippen färbten sich binnen Sekunden bläulich und er kämpfte um jeden Atemzug. Erschrocken sprangen alle auf. Jedoch wusste keiner von ihnen, was in einer solchen Situation zu tun war.
„Jean-Luc!“, schrie Monique Callas schallend durch den Flur, bis ihr Sohn erschien. „Geh, Junge! Wir brauchen Doktor Nébert. Vite!“ Aus den Augenwinkeln sah er seinen Schwager an die Wand gelehnt am Boden sitzen. Ein eiskalter Schauer überlief seinen Rücken und der Vierzehnjährige rannte los. Es vergingen quälend lange zehn Minuten, da erreichte der Mediziner abgehetzt das Haus der Callas. Aufgewühlt stürzte er vor Lémaux auf die Knie. Ohne einen weiteren Moment nachzudenken, riss Marc ihm das Hemd auf.
„Madame Callas! Öffnen Sie die Fenster. Er braucht dringend frische Luft.“ Monique tat, was ihr aufgetragen wurde und nahm ihre Tochter fest in den Arm. Nébert horchte Sèrges Brustkorb ab. Das eiskalte Stethoskop ließ seinen Körper zusätzlich erbeben. Danach folgte die Pulskontrolle. Während all den beunruhigenden Vorkommnissen, fand der Arzt immer wieder die Zeit auf seinen Patienten beruhigend einzureden. Es dauerte eine weitere Viertelstunde, bis der Soldat wieder klar bei Verstand war und seine Vitalzeichen sich im Normalbereich einpendelten. Die Atmung wurde flacher und Sèrges Lippen färbten sich rosig rot.
„Sèrge? Fühlst du dich wieder wohl?“, fragte seine Schwiegermutter immer noch unter Schock und reichte ihm ein halbvolles Glas Wasser. Der Scharfschütze nickte erschöpft, während er sich den Angstschweiß von der Stirn wischte.
„Kam dies denn schon des Öfteren vor, Monsieur Lémaux?“
„Nein“, erwiderte der junge Mann und fuhr mit bebender Stimme fort. „Das war das erste Mal. Wahrscheinlich habe ich mich nur am heißen Kaffee verschluckt.“ Nébert glaubte ihm kein Wort. Der Mediziner räumte seine Tasche ein und sah den Soldaten fragend an.
„Waren Sie oder einer Ihrer Kameraden kürzlich in ärztlicher Behandlung?“ Sèrge schaute die Familie seiner Ehefrau verunsichert an, nahm einen Schluck Wasser und antwortete leise: „Antoine und ich lagen an der Aisne in den Gräben. Der Schnee schmolz allmählich und dann der kalte Regen. Soweit das Auge reichte nur noch schlammiger Morast, der die Stiefel zu verschlingen drohte. Wir wussten nicht mehr was schlimmer war. Das feindliche Dauerfeuer oder die Nässe. Schließlich wurden wir von Amerikanern abgelöst. Am selben Tag verspürten wir ein Unwohlsein, bekamen plötzlich hohes Fieber, aber weder Husten noch Schnupfen kamen dazu. Der Feldarzt, bei dem wir vorstellig wurden, sagte, es handle sich um eine leichte Erkältung. Er gab uns Chinin und nach zwei Tagen konnten wir das Lazarett verlassen. Nun sind wir hier.“ Nébert wusste um die Wirkung von Chinin und schüttelte erbost den Kopf und murmelte: „Chinin? Als würde man mit Kanonen auf Spatzen schießen. Sie haben ein leichtes Rasseln auf Ihrer Brust, sind jedoch noch nicht über den Berg, Monsieur Lémaux. Wann müssen Sie zurück zu Ihrer Einheit?“
„In fünf Tagen. So lange haben Antoine und ich Fronturlaub“, wisperte der Zweiundzwanzigjährige. Marc Nébert zückte seinen Block und schrieb etwas auf, während er Amelie aus den Augenwinkeln beobachtete.
„Sie sind in anderen Umständen, nicht wahr?“
„Woher wissen Sie das“, fragte die junge Ehefrau überrascht.
„Sie halten schützend ihre Hand über den Bauch. Ein eindeutiges Zeichen.“ Mit strenger Miene wandte sich der Dorfarzt wieder an seinen Patienten.
„Im Interesse Ihres ungeborenen Kindes, gebe ich Ihnen beiden einen Rat. Halten Sie gebührenden Abstand voneinander.“
„Wie bitte?“
„Sie riskieren eine Ansteckung Ihrer Frau und damit würden Sie Ihrem Nachwuchs erheblichen Schaden zufügen. Ich weiß, dass es schwerfällt, doch nehmen Sie es sich zu Herzen.“ Kein Laut kam mehr über Lémauxs Lippen. Nébert riss schwungvoll den Zettel von seinem Block und gab ihn Monique.
„Hier, Madame Callas. Bitte sorgen Sie dafür, dass er das Medikament regelmäßig einnimmt.“ Sie schaute auf das Rezept und flüsterte: „Acetylsalicylsäure?“
„Oui. Es sollte schnell Linderung bringen. Außerdem kalte Umschläge und viel Ruhe.“ Dankbar flüsterte Sèrge: „Merci, Monsieur.“ Ehe er das Haus verließ, legte er die Hand auf die Schulter des Scharfschützen und fragte: „Ist Antoine zu Hause anzutreffen?“
„Ich denke schon.“
„Dann schaue ich noch bei ihnen vorbei. Monsieur Barnais benötigt eh noch meine Hilfe.“ Kurz angebunden, in der Hoffnung, dass sie seine Ratschläge beherzigten, lief der Hausarzt schnellen Schrittes durch die Gassen. Nicht einmal an der aufblühenden Natur vermochte er sich zu erfreuen, denn zu sehr trieben ihn die bösen Gedanken, dass es sich nicht nur um eine einfache, grippale Infektion handeln könnte. Die Tasche fest in der Hand, stand Marc schneller als gedacht vor dem alten Haus der Barnais. Ein lautes, freudiges Lachen drang durch die einfach verglasten Fenster. Er atmete tief ein und klopfte an.
„J`arrive“, hallte Julies Stimme und im selben Augenblick öffnete sie verwundert die Tür.
„Monsieur Nébert? Mein Mann wollte doch gleich bei Ihnen vorbeischauen?“
„Entschuldigen Sie die Störung. Ich komme gerade von den Callas.“ Erschrocken fasste sich die Dame des Hauses an die Brust.
„Du liebe Zeit. Ist etwas passiert?“ Kopfschüttelnd nahm er ihre Hand und versuchte sie zu beruhigen.
„Es geht ihm wieder gut.“
„Wem? Es ist doch nicht Luc?“
„Sèrge Lémaux. Er hat mir berichtet, dass er zusammen mit ihrem Sohn Antoine in einem Lazarett war.“ Überrascht von dieser Nachricht, bat sie den Mediziner herein. In der Küche war die gesamte Familie anwesend, sogar die achtzehnjährige Tochter, Marie Callas, hatte sich einen freien Tag genommen, um ihren Bruder wiederzusehen.
Sie war gelernte Schneiderin und hatte sich bei Kriegsbeginn freiwillig gemeldet, um als Krankenschwester in einem Hospital nahe Paris Dienst zu tun. Die zierliche junge Frau trug ihr langes, braunes Haar zu einem Dutt gesteckt und kümmerte sich rührend um ihren Vater, welcher in eine dicke Wolldecke gehüllt am Tisch saß. Vorsichtig reichte sie ihm die heiße Gemüsesuppe, die ihre Mutter zubereitet hatte. Marie wollte unter diesen Umständen nicht mehr allzu weit von ihrem Heim Dienst tun.
„Monsieur Nébert“, hauchte das Familienoberhaupt geschwächt. „Ich wäre gleich zu Ihnen in die Praxis gekommen. Sie hätten sich nicht die Mühe machen müssen.“
„Das ist kein Problem“, erwiderte der Hausarzt. „Ich bin nicht nur wegen Ihnen hier.“ Sein Blick galt sofort dem Sohn, welcher versuchte seine Hände an der heißen Tasse zu wärmen.
„Was ist denn los?“, fragte Madame Barnais aufgeregt und sah ihren Filius vorwurfsvoll an.
„Keine Sorge. Ich möchte Ihren Sohn schlicht und einfach untersuchen. Nichts weiter.“ Antoine ahnte, worauf Marc hinauswollte. Er knöpfte bereits sein Hemd auf, doch Nébert wies ihn mit einer Geste zur Langsamkeit an.
„Erst werde ich nach Ihrem Herrn Papa sehen, wenn’s Recht ist.“ Die Beiden verschwanden im Nebenzimmer, wo Marc Réne Barnais untersuchte. Auch hier maß er den Puls, überprüfte die Atmung und kontrollierte zur Vorsicht den Rachenraum.
„Und? Was ist mit ihm?“, fragte Julie, die schon nach kurzer Zeit zu ihnen kam. Nachdenklich hielt er ihr das ausgestellte Rezept entgegen.
„Besorgen Sie dieses Medikament. Es muss noch angemischt werden, aber es wird Ihrem Gatten sicherlich helfen.“ Nun wandte sich der Arzt Antoine zu. „Antoine? Würden Sie bitte Ihr Hemd ausziehen?“ Marie sah alles mit an. Der junge Soldat gehorchte den Anweisungen des Mediziners und legte ab.
„Stimmt etwas nicht mit ihm?“, fragte die Krankenschwester skeptisch. Sie stellte sich demonstrativ mit verschränkten Armen neben Nébert und wartete auf dessen Diagnose.
„Ja. Ich muss Ihren Bruder untersuchen. Laut Aussage von Sèrge Lémaux besteht die Gefahr, dass sie eine Infektion in sich tragen, welche falsch behandelt wurde… Und nun erbitte ich mir kurz Ruhe.“ Auch über Antoines Körper fuhr der Kopf des kalten Stethoskops. Nach der Puls- und Rachenkontrolle setzte sich Marc nachdenklich auf den alten Sessel, der normalerweise der Platz des Familienoberhauptes war. Verzweifelt kratzte er sich an der Stirn, bevor er seinen Block zückte und auch dem jungen Mann Acetylsalicylsäure verschrieb. Noch einmal ließ sich der Hausarzt die Geschichte von Antoine erzählen. Doch nichts schien auffällig zu sein.
„Gehen Sie bitte mit dem Rezept morgenfrüh zu Maurice Prinot. Er weiß schon etwas damit anzufangen.“ Mit dem Gefühl der Sicherheit, dass Marie im Hause war, verabschiedete sich der Arzt und schlich grübelnd zurück zu seiner Praxis. Am Friedhof blieb der Dorfarzt einen Moment stehen. Flink glitt seine Hand in die Brusttasche und er zog ein metallenes Zigarettenetui hervor. Marc zündete sich eine an und blies den Rauch entspannt in den vorabendlichen Himmel.
„Ein Nagel zu Ihrem Sarg, Monsieur Nébert“, ertönte die raue Stimme Fréderic LaRoches. Der Totengräber hatte gerade seine Arbeit beendet, rammt die Schaufel in den feuchten Boden und wischte sich den Schmutz von den Händen.
„Eine Ausnahme, Fréderic. An Tagen wie diesen muss ich einmal sündigen.“ LaRoche zuckte mit den Schultern und flüsterte: „Vor mir brauchen Sie sich nicht zu rechtfertigen. Sie sehen erledigt aus.“ Nébert nahm noch einen kräftigen Zug und trat den Stummel aus. Grübelnd über die Ereignisse dieses Tages, flüsterte er: „Viel Arbeit, mein Guter. Hatten Sie auch schon einmal das Gefühl, dass Sie sich auf dem Holzweg befinden?“
Der Alte strich sich durch sein schulterlanges, graues Haar und lächelte.
„Oui. Bei meiner ersten großen Liebe.“
„So hatte ich das nicht gemeint.“ Während die Kirchturmglocke sechs schlug, zogen allmählich die dunklen Nachtwolken auf.
„Wenn Sie wollen, dürfen Sie mir gerne im Chez-Pierre Gesellschaft leisten.“ Der Arzt wusste dieses Angebot zu schätzen, gab dem Ortsangestellten jedoch einen Korb.
„Das würde ich gerne tun, aber ich habe noch die gesamte Bürokratie vor mir. Danach geht es nur noch ins Bett.“ Fréderic nickte und verabschiedete sich, ehe er an der Ecke in der Dorfkneipe verschwand. An diesem Abend war trotz Ruhe und höllischer Müdigkeit an Schlaf nicht zu denken. Unruhig wälzte sich der junge Mediziner umher. An die Zimmerdecke starrend ließ er die vergangenen Stunden Revue passieren, bis ein frischer Wind seine Aufmerksamkeit erregte. Dieser ließ die Blätter der Eiche tanzen, welche sich im Garten vor seinem Schlafzimmer befand. Die Dunkelheit verhüllte wie ein festgewebter Teppich das helle Licht des Neumondes.
Drei Fälle an einem einzigen Tag. Wann hatte ich das zuletzt? Ich hoffe, dass meine Diagnose richtig war. Ein Fehler wäre fatal. Gerade hier, in solch einem kleinen Ort, wo Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen. Marie Barnais könnte mir eine große Hilfe sein. Eine standhafte, durchsetzungsfähige, junge Frau mit dem Herzen am rechten Fleck. Sie lebt bei ihrer Arbeit auf. Das merkt man. Ich werde sie fragen, ob sie für mich arbeiten möchte. Vielleicht schon morgen…
Gegen Mitternacht waren seine Augenlider so schwer, dass kein weiterer Gedanke ihn mehr wachhalten konnte.
2. Kapitel
Die ersten Junitage waren die heißesten seit Jahren. Kaum ein frischer Windhauch sorgte für die notwendige Abkühlung. Eine Horde Kinder ging wie so oft nach der Schule an den nahegelegenen Strandabschnitt, um Muscheln zu suchen und die wenigen Stunden ohne Hausaufgaben zu genießen. Unterdessen nahmen Antoine und Sèrge von ihren Liebsten Abschied. Der Zug sollte sie zurück zur Front bringen. Entgegen allen Mahnungen seitens des Hausarztes, umarmten, küssten und herzten die beiden ihre Familien, ehe sie den Wagon bestiegen und sich die rauchschnaubende Bestie mit ihren gellenden Pfiffen in Bewegung setzte. Die letzten Tage an der Aisne standen ihnen noch bevor. Währenddessen schaute Jean-Luc Callas nervös auf seine alte Taschenuhr, welche bereits neun Uhr zeigte. Bereits seit einer halben Stunde sollte sein Sohn vor Ort sein und den alten Schreiner bei der Arbeit unterstützen. Doch es gab keine Spur von Arthur. Hektisch griff er nach seinem Zigarettenetui und zündete sich eine an.
Wo steckt der Bursche? Der Zug müsste schon lange unterwegs sein. Wir haben so viel Arbeit. Das schaffe ich nie im Leben allein.
Zunehmend ungehalten starrte er durch das sperrangelweit geöffnete Stahltor hinaus in die frisch erblühende Landschaft. Er atmete die salzige Morgenluft ein. Schließlich erreichte Callas schwer atmend den Familienbetrieb.
„Excuse-moi, Papa. Ich fühlte mich schon den ganzen Morgen nicht sehr wohl.“ Der alte Callas sah seinen Sohn sorgevoll an. Schweißperlen standen auf Arthurs Stirn, er zitterte wie Espenlaub und jegliche Bewegung schien ihm höllische Schmerzen zu bereiten.
„Du siehst wirklich wie ein Häufchen Elend aus“, raunte der alte Schreiner besorgt um die Gesundheit seines Jungen und zündete sich erneut eine Zigarette an. Während sein Sohn sich quälend langsam aus seiner Sommerjacke befreite, nahm sich sein Vater den Stapel Aufträge für die nächsten Tage vor. Der Grund, warum ihr Geschäft so gut lief, war, dass sie keine utopischen Preise verlangten. Für sie stand die Kunst altes Holz zu restaurieren im Vordergrund.
„Was steht heute auf dem Plan?“, krächzte Arthur und versuchte krampfhaft sein fiebriges Zittern zu unterdrücken. Doch sein alter Herr schüttelte den Kopf.
„Du gehst nach Hause, Sohn. Keine Widerrede! Mit den Kleinigkeiten komme ich auch allein zurecht. Geh… Ruhe dich aus und sag Bescheid, wenn du dich besser fühlst.“ Arthur hatte ein schlechtes Gefühl, denn er wollte seinen Herrn Papa nicht im Stich lassen. Doch sein Gesundheitszustand ließ ihm keine andere Wahl. Hustend verabschiedete er sich mit einem Handheben von Jean-Luc und machte sich schwankend auf den Heimweg. Überrascht von der raschen Rückkehr ihres Gatten, ließ Monique den Abwasch stehen und öffnete ihm die Tür. Während sie ihren Ehemann ins Schlafzimmer begleitete, lagen ihre Hausarbeiten still. Arthur fiel wie ein Stein in sein weiches Bett. Seine Atmung war schwer, als hätte er ein riesiges Gewicht auf der Brust. Verzweifelt legte Madame Callas ihre Hand auf seine glühende Stirn und zuckte zurück.
„Ich werde Doktor Nébert informieren“, murmelte sie.
„Monique, es ist halb so schlimm. Belästige nicht den Doktor. Er hat sicherlich Wichtigeres zu tun.“
„Wie du meinst, Arthur. Aber du legst dich jetzt bitte hin.“ Unterdessen standen die Patienten bereits vor Marcs Praxis Schlange.
Zut! Es ist Juni. Warmes Wetter, strahlender Sonnenschein. Nicht die Zeit für eine Grippe, eine Erkältung, was auch immer.
Es waren jedoch nicht die Erwachsenen, welche unter fiebrigen Schmerzen und starkem Husten litten, sondern ihre Kinder.
Nicht älter als sechs. Ich muss etwas tun. Die Kleinen haben noch ein schwaches Immunsystem. All das, seit die Zwei auf Fronturlaub waren.
Die Stirn sorgevoll in Falten gelegt, rief er die Mütter mit ihrem Nachwuchs auf, welcher bitterlich, gar herzzerbrechend weinte. Stunden vergingen wie im Flug und um die Mittagsstunde hatte er bereits fünfzehn Jungen und Mädchen untersucht. Sie alle schickte Nébert nach genauer Begutachtung mit Rezepten zu Maurice Prinot, dessen Apotheke nicht weit entfernt war. Der Hausarzt ahnte nicht, dass sich mittlerweile sein Wartezimmer mit weiteren Patienten jeglichen Alters gefüllt hatte. Erschöpft rieb er die Augen und lehnte sich für einen Augenblick in seinem Polstersessel zurück, als der Blick plötzlich dem Zifferblatt der alten Standuhr galt, welche das Behandlungszimmer schmückte.
Schon ein Uhr. Ich müsste eine Kleinigkeit essen. Der Magen hängt mir schon in den Kniekehlen.
Vorsichtig öffnete er die Tür, um zu sehen, ob eine Pause möglich war. Der Schlag schien ihn zu treffen. Das Wartezimmer, in welchem normalerweise höchstens zwei Patienten saßen, war bis auf den letzten Platz gefüllt. Circa zwanzig Leute, Jung und Alt, drängten sich dort. Hilflos starrte Nébert auf den freien Platz an seiner spartanischen Anmeldung und das dicke Buch, in welchem er die Namen, wie auch die Diagnosen eintrug.
Soll ich das allein stemmen? Wenn sich bloß Marie Barnais gemeldet hätte. Ich könnte eine helfende Hand gebrauchen. Mehr als alles andere.
Marc ergab sich seinem Schicksal und versuchte das Geschrei der Kleinkinder zu übertönen.
„Bonjour. Darf ich erfahren, wer als Nächster an der Reihe war?“ Überfordert mit der Situation stand der junge Arzt da, als sich die Tür öffnete und Marie Barnais den Raum betrat. Ohne ein Wort zu wechseln, trat sie an das Meldebuch, nahm den Schreiber in die Hand und sprach mit energischer Stimme: „Einer nach dem anderen! Bitte hier vorsprechen.“ Ein Gefühl der Erleichterung durchfuhr Nébert.
„Danke, Mademoiselle Barnais. Ich hätte nicht gewusst, wie ich mit dieser Erkältungswelle fertig werden sollte.“ Marie fühlte sich bestätigt, nahm ihm mit einem kurzen Lächeln die Behandlungsmappen ab und versuchte Ordnung in das Chaos zu bringen. Sie führte ein neues System ein, indem sie die Patienten mit Nummern versah.
„Ich werde Sie gleich nacheinander aufrufen. Haben Sie mich verstanden?“ Ein zustimmendes Nicken war der Schwester Zeichen genug, dass sie die Lage im Griff hatte. Weitere sechs Stunden verstrichen, bis sich das Wartezimmer leerte und Marc tief durchatmend aus seinem Behandlungsraum trat.
„Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll, Marie. Wenn Sie nicht für Ordnung gesorgt hätten, wäre ich hier sang- und klanglos untergegangen.“ Die junge Krankenschwester richtete unbeeindruckt von diesem Lob die Akten für den nächsten Tag und flüsterte fordernd: „Sind Sie immer noch auf der Suche nach einer fähigen Hilfskraft?“
„Oui“, lautete seine kurze Antwort.
„Dann nehme ich ab Morgen meine Arbeit offiziell auf, wenn Sie nichts dagegen haben.“ Überglücklich über diese Entscheidung, konnte sich Marc ein freudiges Lächeln nicht verkneifen.
„Also sehen wir uns Morgen. Doch es würde mich interessieren, woher der plötzliche Sinneswandel rührt.“ Marie wurde ernst.
„Ich fühle mich meiner Familie verpflichtet. Mein Herr Papa ist noch nicht über den Berg. Meine Mutter hätte nicht den Schneid ihn in die Schranken zu weisen. So schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe.“ Nébert vermutete, dass mehr dahintersteckte. Er nahm auf einem der Stühle Platz und wies die Schwester an sich neben ihn zu setzen.