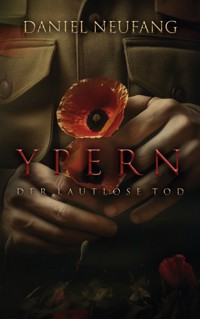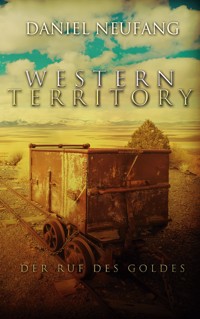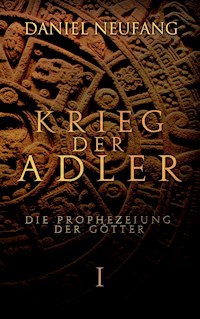Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Rom 1484. Der Dominikanermönch Heinrich Kramer sucht seine Heiligkeit Papst Innozenz auf, um sich von diesem die Erlaubnis einzuholen, den Summis desiderantes affectibus, der sich gegen Hexer- und Ketzerei richtet, in seinem Werk "Der Hexenhammer" zu verwenden. Mit einer List erschleicht er sich das Wohlwollen des Papstes und treibt so, unter dem Namen Henricus Institoris, die Verfolgung derer voran, die in seinen Augen für das Böse stehen. Mit ausschweifenden Reden, die die Angst der Bevölkerung schüren sollen, bereitet er auch den Acker für die, die ihren Mitmenschen schaden wollen. Doch in Verenus, einem papsttreuen Bischof, findet er einen ernsthaften Gegner seiner Anschauungen. Er schickt seine Boten Giovanni Pasci und Walter Kolbe aus, um die Stadträte der Alemannischen Provinz mit Worten und einem Sack voll Goldmünzen gegen den Mönch aufzubringen. Nach einigen Rückschlägen erreichen sie ihr Ziel und das Blatt wendet sich. Wird die von Henricus Institoris angeheizte Inquisition an ein Ende geraten?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieser Roman basiert auf geschichtlichen Überlieferungen.
Dialoge sowie die geschilderten Ereignisse sind so beschrieben, wie es sich der Autor vorstellt.
Ich wünsche Ihnen interessante Lesestunden.
Ihr
Daniel Neufang
Rom 1484. Der Dominikanermönch Heinrich Kramer sucht seine Heiligkeit Papst Innozenz auf, um sich von diesem die Erlaubnis einzuholen, den Summis desiderantes affectibus, der sich gegen Hexer- und Ketzerei richtet, in seinem Werk "Der Hexenhammer" zu verwenden. Mit einer List erschleicht er sich das Wohlwollen des Papstes und treibt so, unter dem Namen Henricus Institoris, die Verfolgung derer voran, die in seinen Augen für das Böse stehen. Mit ausschweifenden Reden, die die Angst der Bevölkerung schüren sollen, bereitet er auch den Acker für die, die ihren Mitmenschen schaden wollen.
Doch in Verenus, einem papsttreuen Bischof, findet er einen ernsthaften Gegner seiner Anschauungen. Er schickt seine Boten Giovanni Pasci und Walter Kolbe aus, um die Stadträte der Alemannischen Provinz mit Worten und einem Sack voll Goldmünzen gegen den Mönch aufzubringen. Nach einigen Rückschlägen erreichen sie ihr Ziel und das Blatt wendet sich. Wird die von Henricus Institoris angeheizte Inquisition an ein Ende geraten?
Inhaltsverzeichnis
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
1. Kapitel
Es war ein klarer, grimmig kalter Dezembermorgen im Jahr 1484. Betend kniete der Prior des Dominikanerordens, Heinrich Kramer, auf dem steinernen Boden der Kapelle des Vatikan. Ein Sonnenstrahl fiel durch die mosaikversehenen, großen, länglichen Fenster und erleuchtete den gesamten Raum. Lächelnd sah der vierundfünfzigjährige, schon grauhaarige, in eine schlichte, graue Kutte gekleidete Geistliche zum Kreuz empor. Die schmalen, faltigen Züge zeugten von Ernsthaftigkeit, die ihresgleichen suchte. Kramer verspürte nicht einmal den kühlen Zug, welcher über seine, in schlichte Sandalen gekleideten, Füße wehte. Demütig, vor dem Antlitz Jesu, strich er vorsichtig über das einfache Holzkreuz, welches an einer Schnur um seinen Hals hing und ihn schon ewig zu begleiten schien. In diesem Augenblick erfüllte den Dominikaner die Kraft des Allmächtigen. Im Beisein des Herrn ließ er das bisherige Leben Revue passieren. Der Mann Gottes erinnerte sich voller Stolz an sein fünfzehntes Lebensjahr und den Beitritt zur Glaubensgemeinschaft in der elsässischen Heimat Schlettstadt, sowie den Aufstieg zu einem der einflussreichsten Männer des Ordens. Stille herrschte im gesamten Raum, als sich plötzlich die schwere, aus Holz gefertigte Eingangspforte quietschend öffnete und sich ein stattlicher, uniformierter, junger Mann demütig näherte. Heinrich Kramer nahm keine Notiz von der Wache. Er widmete sich weiter dem Bildnis seines Herrn. Kurz verharrte der Bursche strammstehend neben dem Prior, ehe er es wagte, ihn anzusprechen.
„Prior Kramer? Seine Heiligkeit Papst Innozenz erwartet Euch.“ Mit pochendem Herzen, sich bekreuzigend, stand der Gottesdiener vorsichtig auf. Er reichte dem Fremden die Hand und flüsterte: „Helft mir bitte auf. Der Zahn der Zeit nagt an meinen Knochen.“ Daraufhin reichte der junge Soldat ihm den Arm und stützte ihn, bis Kramer selbstständig stehen konnte. „Habt vielen Dank.“ Höflich verneigte sich die Wache, während er auf die Pforte wies.
„Darf ich Euch bitten, mir zu folgen?“ Mit einer zuvorkommenden Geste erbat der Dominikaner den jungen Mann, ihm den Weg zu weisen. Obwohl es ein nicht sonderlich großes Areal war, hatte Heinrich ein ungutes Gefühl und befürchtete, sich in den gepresst stehenden Gebäuden schlicht zu verlaufen. Die Wache führte ihn eine breite, marmorne Treppe hinauf, welche zu den päpstlichen Gemächern führte. Kramers Herz schlug wild in seiner Brust, denn er vermochte es nicht zu sagen, was seine Heiligkeit ihm mitteilen würde. Nervös tupfte er sich mit einem Tuch den Schweiß von der hohen Stirn.
„Wartet hier für einen Moment. Ich werde Euren Besuch nun ankündigen.“ Mit einem unsicheren Lächeln nickte der Dominikaner, während die Wache im Inneren des Raumes verschwand. Minuten erschienen ihm wie Stunden, als der junge Wachmann heraustrat, ihm die Tür offenhielt, sich verneigte und ihn höflich hineinbat. Sprachlos schaute sich der betagte Geistliche, angesichts dieser prunkvollen Unterkunft, um. Wie von einer fremden Macht gelenkt, setzte er einen Fuß vor den anderen und schrak auf, nachdem die schwere Pforte hinter ihm in die Angeln fiel. Der riesig wirkende Raum war mit verzierten Kacheln auf dem Boden und einladenden Teppichen versehen. Zu allen Seiten befanden sich hohe Bücherregale, die bis zur Decke reichten und prall gefüllt waren. Vor den mächtigen Fensterscheiben stand ein pompöser, mit Schnitzereien verzierter Schreibtisch sowie zwei Damast gepolsterte Stühle. Einem Thron gleich schien ihm die Sitzgelegenheit des Papstes. Demütig näherte sich der Dominikaner nur langsam. Sein Blick galt dem Diener welcher, trotz seiner schmächtigen Statur, in eine schlichte Kutte gekleidet, drei dicke Holzscheite auf das knisternd, lodernde Feuer im Kamin nachlegte. Vor den einladenden Fensterscheiben stand seine Heiligkeit, Papst Innozenz. Die Hände mächtig vor der Brust verschränkt, stierte das Kirchenoberhaupt in die Dunkelheit hinaus, während der junge Mann die letzten erhellenden Kerzen anzündete.
„Das ist alles. Ihr könnt Euch nun entfernen“, flüsterte Innozenz mit rauer Stimme und wies den Burschen hinaus. Sich verbeugend tat der Diener, wie ihm geheißen wurde und schloss die Tür hinter sich. Ein beunruhigendes Schweigen durchdrang den Saal, welches Kramer das Blut in den Adern gefrieren ließ. Er befürchtete, dass ihm das Herz explodieren würde. So schnell war dessen Schlag. Wie versteinert blieb er stehen. Doch der Papst starrte weiterhin aus dem Fenster. Im flackernden Kerzenlicht war dessen Miene kaum zu erkennen. Respekt und auch Furcht vor Innozenz ließen die Aufregung des Dominikaners ins Unermessliche steigen. „Einen solch eisigen Winter habe ich in diesen Gefilden noch nie zuvor erlebt“, flüsterte das Kirchenoberhaupt. „Sollte es vielleicht ein Omen für uns sein?“ Heinrich Kramer wagte es nicht, auf die Frage zu antworten. Weiterhin durchflutete eine unbehagliche Totenstille den sonst so warmen Raum. Plötzlich drehte sich Papst Innozenz zu ihm um. Voller Ernst musterte er den Mönch und ging langsam auf ihn zu. Als das Oberhaupt der katholischen Kirche vor dem Mönch stand, fiel Kramer auf Knie. Vorsichtig nahm der Dominikaner die Hand von Petrus Nachfahren und küsste leicht den Siegelring, der mit dem Zeichen der Fischer versehen war. „Steht auf, Heinrich Kramer.“ Mit einer einladenden Geste wies ihm der Papst einen der Gästestühle, während sich seine hageren Gesichtszüge keineswegs entspannten. Behutsam schlich der Dominikaner zu seiner Sitzgelegenheit und wartete, bis sein Oberhaupt den Platz eingenommen hatte. Auf dem Schreibtisch befand sich ein verziertes, goldenes Tintenfässchen, neben einer geschwungenen, glänzenden Falkenfeder. Schnell legte Innozenz sämtliche Schreibstücke, die seiner Zustimmung bedurften, zusammen, ehe er sie zur Seite schob. Der aus Genua stammende, Zweiundfünfzigjährige, saß stumm da und starrte sein Gegenüber neugierig an. Erst in diesem Augenblick konnte Kramer im Kerzenschein seine tief dunklen Augen erkennen, welche Wohlwollen, dennoch Durchsetzungsvermögen ausstrahlten. „Ich habe vernommen, welch harten Weg Ihr eingeschlagen habt.“ Überrascht schaute Heinrich drein.
„Heiliger Vater?“
„Ihr habt Euch als Sohn eines ärmlichen Elternhauses aufgrund Gottes Wohlwollen und Güte zu dem entwickelt, was Ihr nun seid. Dafür gebührt Euch Respekt, welchen Ihr auch einfordern solltet.“ Heinrich verneigte sich abermals, doch antwortete er bescheiden: „Darauf bin ich nicht aus, Heiliger Vater. Ich will ausschließlich unserem Heiland dienen und in seinem Namen handeln.“ Lächelnd griff der Papst in seine oberste Schublade und nahm Kramers Bittbrief hervor. Sein Blick war in diesem Augenblick für den Dominikanermönch nicht zu deuten. Zwischen Argwohn, Ablehnung und Zustimmung wirkte alles möglich. Nervös erhob sich Kramer.
„Setzt Euch bitte.“ Wohlwollend bat Innozenz seinen Gast, wieder auf dem gepolsterten Stühle Platz zu nehmen. Der Aufforderung folgte Heinrich umgehend. Der Papst konnte sich ein zynisches Lächeln nicht verkneifen. „Ich glaube, ich weiß, warum Ihr mich aufsucht“, flüsterte der oberste Geistliche, dessen bürgerlicher Name Giovanni Battista Cibo lautete. Fordernd, sich zu erklären, starrte er Heinrich an, bis dieser, nach einem stillen Moment, sein Anliegen erläutern wollte. So ergriff er leise das Wort.
„Eure Heiligkeit. Da draußen tobt ein Krieg“, flüsterte Kramer demütig, während er auf die gesamte Stadt wies. „Der Teufel ist unter uns. Mit jedem Tag, der ins Land geht, versucht er, mehr Seelen auf seine Seite zu ziehen. Dies ist der Grund, warum ich Euch aufsuche. Ich erbitte mir Eure Unterstützung im Kampf gegen Mächte, die dem uns bekannten Bösen weit überlegen sind.“ Neugierig schaute Innozenz sein Gegenüber an, bevor er den untertänigen Mitstreiter weitersprechen ließ. „In meinem Werk beziehe ich mich auf die Verfolgung der Häresie und insbesondere auf die Hexe- und Zauberei, welche eine bislang noch nicht sonderlich beachtete Form des Satanswerks ist. Diese Menschen wollen, vom Bösen getrieben, dem Christentum schaden und sollten ihre gerechte, gottgewollte Strafe erhalten. Daher möchte ich Euch bitten, den Summis desiderantes affectibus als Vorwort für mein Thesenwerk, den Malleus Maleficarum, den Hexenhammer, verwenden zu dürfen.“ Nachdenklich strich der Papst über sein Kinn.
„Ihr wollt also die Summis desiderantes affectibus in euer Werk aufnehmen. Die Bulle richtet sich hauptsächlich gegen den Missbrauch dämonischer Magie. Mich würde nun interessieren, warum Ihr Euch gerade auf diesen Gedankengang beziehen wollt.“
„Wenn ich Eure niedergeschriebenen Gedankengänge verwenden darf, so unterstreicht es die Anwesenheit des Herrn.“ Mit Unverständnis schaute der Papst den treuen Diener Gottes an.
„Ich verstehe. Ihr wollt dem Ganzen Nachdruck verleihen. Doch verfügt Ihr auch über andere Schreiben, die Eure Schrift untermauern würden?“ Selbstsicher zog Kramer ein Schreiben der Theologischen Fakultät zu Köln hervor und antwortete: „Ja. Seht hier, Eure Heiligkeit.“ Innozenz überflog die Zeilen und gab ihm die Zustimmung, seine Bulle als Vorwort zu verwenden. Er ahnte nicht, dass es sich bei dem Brief des Bistums um eine Fälschung handelte. Der Vertreter Gottes auf Erden nahm seine Feder, schrieb einige Zeilen und signierte schließlich die Erlaubnis. So unterhielten sich die beiden weiterhin, während die Holzscheite im Kamin knisterten. Letztendlich stand der Papst auf und bat Kramer ein nächtliches Quartier an, welches er dankend ablehnte.
„Habt vielen Dank für Euer Wohlwollen gegenüber eines einfachen Dominikaners. Aber ich habe bereits eine Unterkunft für die Nacht gefunden.“ Noch bevor er den Fischerring des Heiligen Vaters erneut zum Abschied küssen konnte, sprang die Pforte auf und ein betrunkener, junger Mann stolperte auf sie zu. Abwertend blickte der erst Vierzehnjährige Franceschetto zu dem Geistlichen hinunter. Es war ohne Zweifel, dass der Sohn des Papstes dem Alkohol, aber auch dem Glücksspiel zugetan war. Er trug die feinste Kleidung, kurzgeschnittenes, gepflegtes Haar, aber nicht einmal ein Barthaar schmückte das Antlitz des jungen Burschen. So schwankte Franceschetto unsicher auf seinen Vater zu, der sich empört und zornig von dem Dominikaner abwandte.
„Entschuldigt mich, Prior Kramer“, zischte er aufgebracht, griff nach dem Hemdskragen des Burschen und zog ihn ein Stück zur Seite, sodass der fremde Diener Gottes nur wenig verstand.
„Was tust du?“, lallte der blonde, gutaussehende Mann. „Ich weiß, dass ich nicht erscheinen sollte, wenn du hohen Besuch erwartest. Doch es ist sehr wichtig.“
„Was ist nun schon wieder?“, fragte Innozenz mit grimmiger Miene. „Ich denke, du brauchst wieder Geld.“
„So ist es, Vater. Ich war mit Girolamo Tuttavilla unterwegs. Die Dirnen haben mir das Letzte aus den Taschen gepresst.“
„Es waren nicht nur die Dirnen“, raunte der gutmütige Papst. Dieses Attribut zeugte bei vielen seiner Gegner für ein Zeichen der Schwäche. „Du hast bestimmt auch noch in den Wirtshäusern Schulden.“ Er wollte gerade in die Tischschublade greifen, um seinem Sohn aus der rufschä-digenden Lage herauszuhelfen, da flüsterte der junge Francesco: „Das ist niemals genug.“ In diesem Augenblick wurde sich der Heilige Vater bewusst, dass ihn sein geliebter Sohn immer tiefer in den Abgrund zog. Schließlich hatte er schon wegen seines überheblichen Lebensstils Teile des päpstlichen Kronschatzes, sowie Tiara und seine Mitra verpfändet. Schnell griff Innozenz in eine der obersten Schubladen und nahm ein kleines, ledernes Säckchen hervor, welches mit Dukaten prall gefüllt war.
„Nimm dies. Das sollte deine Schulden decken. Doch wage es nie mehr, mich während einem wichtigen Gespräch zu stören. Nun geh.“ Mit einem Lächeln verneigte sich der Sohn und verließ grinsend das Schreibzimmer. Sein alter Herr blieb wie versteinert stehen, blickte hinaus in die dunkle Nacht und zischte leise: „Dieser Junge kostet mich Nerven und mein letztes Hemd.“ Sein Gast stand schweigend da, denn er hatte erreicht, was er wollte. So nahm Heinrich keine weitere Notiz von dem Geschehen. Als der Papst sich schließlich ihm wieder zuwandte, starrte er seinen Untergebenen ernst an. „Ich denke, dass Ihr das, was Eure Augen gesehen haben, bei Euch bleibt und niemandem gegenüber über die Zunge kommt. Ihr wisst, was ich meine. Ansonsten werde ich leugnen, Euch die Erlaubnis zur Verwendung des Summis desiderantes affectibus gegeben zu haben.“
„Gewiss, Heiliger Vater. Meine Lippen sind auf immer versiegelt.“
„Nun geht und verrichtet Eure Arbeit im Namen unseres geliebten Herrn.“ Innozenz segnete den Mönch, ehe er mit einem Lächeln auf den Lippen die päpstlichen Gemächer verließ. Nachdem Heinrich verschwunden war, öffnete sich eine Seitentür, die dem Besucher der Gemächer vor Aufregung völlig verdeckt blieb. Einer seiner Bischöfe trat langsam vor. Die purpurrote Robe, sowie der mürrische Blick des grauhaarigen Mannes ließen selbst Papst Innozenz erschaudern.
„Schenkt ihm nicht Euer Vertrauen, Heiliger Vater“, sprach Bischof Verenus mit rauer, mahnender Stimme. „Er wird uns in den Abgrund führen, obwohl seine Absichten rechtschaffen zu sein scheinen.“
Diese Aussage trieb Innozenz eine Gänsehaut auf den Körper.
„Woher wollt Ihr das wissen?“
„Eine Ahnung. Nichts weiter. Er war sich seiner Sache zu sicher. Das bereitet mir Unbehagen, Heiliger Vater. Wir sollten eine Gruppe unserer Späher auf ihn ansetzen, die seine Arbeit im Auge behält.“
„Aber er will sich auf meine Abhandlung beziehen…“, wisperte der Papst, während Bischof Verenus vehement den Kopf schüttelte.
„Er benutzt Euch zu seinem eigenen Vorankommen. Wie ich erfuhr, stammt Prior Kramer aus einer armen Familie. Daher versucht er sich einen Platz in der Geschichte zu sichern. Notfalls mit Gewalt. Lasst mich eine Prüfung in die Wege leiten, die ihn in seinen Entscheidungen einschränkt.“
„Gebt Ihm ein wenig Zeit. So wie er über die Stränge schlägt, werden wir ihm einen Riegel vorschieben.“
„Jawohl, Eure Heiligkeit“, antwortete Verenus demütig und zog sich zurück. Aber in ihm regte sich großes Misstrauen angesichts des Vertrauens, welches der Papst in diesen einfachen Gottesdiener steckte. Innozenz beobachtete Kramer, wie er auf den Ausgang zu lief. Seine Befürchtungen stiegen mit jedem Schritt des elsässischen Mönches. Während der Prior das Haupttor des Vatikans verließ und zuvorkommend von den Wachen verabschiedet wurde, wirkte er erleichtert. Zufriedenheit spiegelte sich in seinem Gesichtsausdruck. Denn durch die Unterstützung des Heiligen Vaters war ihm bei seinem Krieg gegen den Leibhaftigen Tür und Tor geöffnet. Selbst der eisige Wind, der durch die Gassen der Hauptstadt fuhr, konnte ihm in diesem Augenblick nichts anhaben. Aber jeder Blick in die vereinzelten Gasthäuser, welche auf seinem Weg lagen, bestärkte ihn in seinem Vorhaben. Überall feierten die einfachen Bürger, tranken, tanzten und versuchten, mit aller Macht, ihrem Alltag zu entgehen. Dies missfiel dem Mönch. Er sah darin die glühenden Pranken des Satans, die die armen Seelen direkt in die Hölle zogen. Nach einem langen Fußmarsch erreichte Kramer endlich sein schlichtes Gasthaus am Rande Roms. Es war ein einstöckiges, aus Backstein gefertigtes Gebäude, dessen Dach mit einfachem Stroh gedeckt war. Die schmalen Fenster wurden vom Kerzenschein erhellt und der Geruch von Pferdemist, der anliegenden Stallungen, drang ihm in die Nase. Doch selbst dies nahm der Dominikaner in Kauf, um den Kampf gegen den Teufel weiterzuführen. Quietschend öffnete Heinrich die Pforte und trat ein. In dem kleinen Raum befanden sich nur drei Tische, auf denen ein schäbiger, verrosteter Kerzenleuchter stand. Niemand saß an den Holztischen, sondern vier Durchreisende hatten am Tresen Platz genommen. Ihnen waren die Strapazen des Tages anzusehen. Schweigend tranken sie einen Becher Bier und schienen fast einzuschlafen. Ungeachtet setzte sich der Prior in einer wenig beleuchteten Ecke hin und wartete darauf, dass der Wirt zu ihm kam. Es dauerte nicht lange, bis Salvatore Gigli an ihn herantrat. Seine hagere Statur, wie auch sein schmächtiger Körper zeugten von den Mühen, die der alleinerziehender Vater dreier Kinder hatte. Ungefragt stellte ihm Gigli einen Becher Wasser vor und verneigte sich vor dem Geistlichen.
„Was wünscht Ihr zu essen, mon Signore.“ Echauffiert sah der Mönch ihn an, schob den Becher zurück und sprach leise: „Ich trinke dieses abgestandene Wasser nicht. Bringt mir einen Becher Bier, wie auch einen Teller Suppe.“ Mit einem missfallenden Lächeln verbeugte sich der Wirt und verschwand. Kramer griff in seine Kutte, aus welcher er ein Blatt Papier hervorzog. Gebannt stierte er auf dieses. Heinrich bemerkte nicht einmal, dass Salvatore bereits mit einer Suppenschale und einem Becher schalem Bier vor ihm stand. Erst ein lautes Räuspern des Inhabers riss ihn aus seinen Gedanken. Wortlos stellte er ihm das Essen vor und drehte sich abwertend um. Ohne ihm weitere Beachtung zu schenken, ließ es sich der Dominikaner schmecken. Noch immer herrschte Stille im Gastraum, als Kramer die Hand hob und den Wirt bei winkte.
„Kann ich noch etwas für Euch tun?“, fragte Salvatore, den allmählich die Müdigkeit befiel.
„Es hat mir sehr gemundet, Signore. Würdet Ihr mir noch einen kleinen Gefallen tun?“ Der Wirt schaute ihn mit dunklen Augenringen an und zuckte mit den Schultern. „Ein Fässchen Tinte und eine Feder.“ Gigli ging wortlos ab und kam wenig später mit einem kleinen Tintenfässchen sowie einer starren Feder zurück.
„Das ist alles, was ich Euch anbieten kann. Nehmt es oder lasst es bleiben, falls Euch dieses Schreibmaterial nicht beliebt.“ Daraufhin drehte er sich um und bat alle Anwesenden, endlich den Raum zu verlassen. Nachdem die vier gegangen waren, wandte sich Salvatore abermals an den Geistlichen. „Löscht bitte das Licht an Eurem Tisch, wenn Ihr fertig seid. Ich wünsche Euch eine gute Nacht.“ Ehe Heinrich eine Antwort geben konnte, löschte Gigli sämtliche Kerzen. Dunkelheit, sowie eine furchterregende Totenstille, machten sich in der kleinen Gaststätte breit. Davon ließ sich der Dominikaner jedoch nicht abbringen.
Ich brauche einen neuen Namen. Einer, der mich über den Pöbel stellt und diesem Demut, Furcht und Schrecken einflößt. Latein…
So machte er einige Übungen, bis seine Signatur perfekt war. Zufrieden und voller Stolz schaute er drein.
Das soll von nun an mein Name sein. Henricus Institoris.
So löschte er auch sein Licht und begab sich zur Ruhe. Aber an Schlaf war in dieser Nacht nicht zu denken. Zusammen mit den Reisenden lag er in einem Zimmer. Acht Betten, die mit Stroh gedeckt und einer schmalen, dünnen Decke versehen waren, befanden sich in dem engen Raum. Das laute Schnarchen und der strenge Körpergeruch der Anwesenden raubten ihm die Luft. Doch er wusste, dass dies das kleinere Übel auf seinem Weg in die Annalen der Geschichte war.
Wenige Tage später begab sich Henricus, wie er sich fortan nannte, zurück zu seinem Orden, wo er bereits durch einige Mönche herzlich empfangen wurde. Er stieg von seinem Esel ab und übergab die Leine einem seiner Brüder. Der junge Mönch verharrte respektvoll neben den Tier und fragte leise: „Warum habt Ihr nicht eines der Pferde genommen?“ Der zukünftige Inquisitor legte ihm lächelnd die Hand auf die schmale Schulter.
„Es ist ein Zeichen des Verzichts, mein Junge. Nicht die Geschwindigkeit führt uns ans Ziel, sondern die Überlegt- und Beharrlichkeit. Nun geh und füttere Antonius, meinen treuen Gefährten.“
Nachdem der Bursche hinter der Ecke im Pferdestall verschwunden war, trat einer seiner besten Freunde an ihn heran. Die beiden umarmten sich freundschaftlich. Der Name des Mannes lautete Jakob Sprenger. Ein mittelgroß gewachsener, kräftiger Dominikaner. Sein schütteres, graues Haar war kurz und zur Tonsur geschnitten, was seinen Glauben in den Augen der meisten Menschen noch unterstrich. Neugierig erkundigte sich Jakob, wie das Gespräch mit seiner Heiligkeit verlaufen war. Heinrich schüttelte den Kopf, ging mit im hinein und wisperte erschöpft: „Lass uns in aller Ruhe verschnaufen, mein Freund. Der Ritt war anstrengender, als ich gedacht habe.“ Während sie an einer der langen Holzbänke Platz genommen hatten, fing Kramer an zu erzählen, was ihm widerfahren war. Jakob lauschte seinen Worten und flüsterte nachdenklich: „Also kannst du dich auf die Unterstützung seiner Heiligkeit verlassen. Das ist die halbe Miete.“
„Der Grundstein für meinen Hexenhammer ist gelegt. Doch ich befürchte den Widerstand vieler Kirchenhäuser, die meine Meinung in Frage stellen.“
„Aber hast du ihm den Brief der Theologischen Fakultät vorgelegt?“
„Ja. Doch du weißt, wie auch ich, dass es sich um eine Fälschung handelt.“ Sie schwiegen einen Moment, bis Heinrich, ohne ein Zeichen der Nervosität, fortfuhr. „Davon darf niemand etwas erfahren. Dafür steht zu viel auf dem Spiel.“ Er nahm Sprengers raue Hände und stierte ihn auffordernd an. „Ich brauche dich mehr denn je. Es ist unsere Chance, in die Geschichte einzugehen und die Welt von Hexerei, Satanismus und all dem Bösen zu befreien.“
„Wie kann ich dir hilfreich sein?“, fragte Jakob verunsichert.
„Du sollst mir helfen, wenn ich mit dem Hexenhammer beginne. Alles ist vorbereitet und selbst die Zustimmung des Papstes ist mir sicher. Aber ich brauche deine Unterstützung, mein alter Freund.“ Jakob überlegte kurz, wägte alle negativen Seiten ab und reichte seinem Bruder die Hand. Dennoch blieb bei dem Mönch ein ungutes Gefühl zurück.
„Ich will nicht namentlich genannt werden. Irgendwo rührt sich dennoch ein schlechtes Gewissen in mir.“
„Was meinst du?“, fragte Henricus, nicht wissend, auf welcher Seite sein alter Freund nun stand.
„Du bist dir im Klaren, dass du nicht nur Fürsprecher haben wirst, die deinen Worten, wie die Mäuse dem Speck folgen. Ich helfe dir bei der Zusammensetzung und der Textstellung. Aber lass mich bitte außen vor.“
„Wie du willst“, raunte der Henricus und wandte sich ab. „Wenn du die Möglichkeit unter deinem Namen, die Welt zu einer besseren zu machen, nicht wahrnehmen willst, dann sei es so.“
„Danke, Heinrich.“
„Es lautet nicht mehr Heinrich, sondern Henricus Institoris.“ Ein lautes Lachen konnte sich Jakob plötzlich nicht mehr verkneifen und schlug sich laut lachend auf die Knie.
„Das kann nicht dein Ernst sein. Immerhin ist es dein gottgegebener Name. Was willst du damit bezwecken?“
„Ich will, dass die Menschheit mich endlich ernst nimmt. Alle Leute sollen sich fürchten, wenn ich in ihre Stadt komme.“ Sein alter Freund wusste, was ihm auf der Seele brannte. Die Kindheit im Kampf gegen die Armut und der Mangel an Nahrungsmitteln hatten seine Eltern dazu getrieben, ihn schon früh in den Orden zu integrieren. Es schien Jakob, als wollte er sich für die Schmach an der Gesellschaft rächen. Dies versuchte Sprenger tunlichst nicht anzusprechen, da er den Zorn seines Freundes mehr fürchtete als alles andere. So fügte er sich Heinrichs Willen und arbeitete mit ihm zusammen an dessen Lebenswerk. Malleus Maleficarum. Tag und Nacht saßen die beiden zusammen in der Bibliothek und bezogen sich immer wieder auf die Bibel. Nebenbei verfolgte Henricus weiter sein Ziel und ließ sich zunächst zum Inquisitor der Ordensprovinz Alemannia bestellen. Nachdem dieses Schreiben ihn erreichte, strotzte der Dominikaner vor Selbstbewusstsein. Am selben Abend kniete er in der kleinen Kapelle vor dem Kreuz und betete um Stärke. Regen prasselte gegen die mosaikversehenen Fenster. Plötzlich öffnete sich die Pforte und im Schein des Kerzenlichts näherte sich ein sechzehnjähriger, in Kutte gekleideter Novize. Seine Schritte hallten durch den nackten Raum, bis er neben dem Prior auf die Knie sank. Unbeeindruckt, ohne den Burschen eines Blickes zu würdigen, flüsterte er leise: „Was ist euer Begehr?“
„Dieser Brief ist heute angekommen“, wisperte er angespannt und übergab den Letter an seinen Obersten.
„Wisst Ihr, was dort geschrieben steht?“
„Ja, Herr. Der Stadtrat von Ravensburg hat um Eure Mithilfe gebeten. Es handelt sich um die Urteilsfindung gegen zwei, als Hexen denunzierte Frauen.“ Der Prior bekreuzigte sich und stand entschlossen auf, ehe er sich dem Novizen zuwandte.
„Dann will ich den Stadtrat nicht enttäuschen. Geht und bereitet alles für meine Abreise vor. Schon morgen, bei Sonnenaufgang will ich mich auf den Weg machen.“ Der Bursche verneigte sich und rannte los, um den Wünschen seines Obersten Folge zu leisten. Als Heinrich das Gebäude verlassen hatte, zuckten auf einmal grelle Blitze durch den wolkenverhangenen Nachthimmel. Wie versteinert blieb er stehen und sah diesem Naturschauspiel zu.
„Oh, Herr. Sendest du mir ein Zeichen?“ Ein lautes Donnergrollen, gefolgt von einem Blitzeinschlag in einen nahegelegenen Baum, schien seine Frage zu beantworten. „Ich werde nach Ravensburg gehen und in deinem Namen die Seelen der vermeintlichen Hexen vor dem Höllenschlund bewahren. Das gelobe ich vor unserem geliebten Herrn.“ Während das Unwetter seine geballte Gewalt auf den Landstrich niedergehen ließ, stürmte Institoris in die anliegende Dominikanerbücherei, wo sein Freund weiterhin Bücher wälzte, die ihre Thesen untermauerten. Völlig durchnässt und schwer atmend stand er vor Sprenger, der aufschrak, nachdem er das Funkeln in Heinrichs Augen sah.
„Was ist geschehen? Du wirkst, als hättest du einen Geist gesehen.“
„Kein Geist. Es war ein Zeichen Gottes.“ Die durchnässten, dünnen Strähnen hingen über seinem Gesicht. „Ravensburg fordert meine Hilfe an. Zwei Frauen werden der Hexerei beschuldigt. Ich werde morgen aufbrechen, um den Anschuldigungen nachzugehen.“ Jakob war sprachlos. Kopfschüttelnd antwortete er in ruhigem Ton: „Ich hoffe, dass du dich nicht verrennst, Bruder. Übereifer schadet nur. Lass dich nicht nur von deinem Verstand, sondern auch dem Herzen führen. So, wie es unser Herr getan hätte.“ Henricus gab keinen Deut auf dessen Worte, ließ es aber Sprenger nicht spüren.
„Das werde ich. Doch es ist meine Aufgabe, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Notfalls mit aller Härte.“
„Ich wünsche dir viel Glück und bete, dass du das Richtige tust.“
„Mach dir keine Gedanken.“ Er wollte gerade den Saal verlassen, um seine Tasche zu packen, als er sich noch einmal seinem Freund zuwandte. „Arbeite weiter. Ich will so schnell wie möglich die Thesensammlung in Umlauf bringen.“
„Natürlich, ich habe ja nichts anderes zu tun“, antwortete Sprenger in sarkastischem Ton, tauchte die Feder in sein Tintenfässchen und schrieb noch einige Zeilen. Da schlug ihm Heinrich das Schreibwerkzeug aus der Hand und stierte ihn strafend an.
„Es wird unser auf ewig wirkendes Vermächtnis sein. Also zweifle nicht an mir oder dem Hexenhammer.“ Schließlich wandte er sich ab. „Ich muss meine Vorbereitungen treffen.“ Wütend über diese herrische Art, die sein Bruder an den Tag legte, wandte sich Jakob wieder seinen Studien zu, während Kramer aufgebracht den Saal verließ.
Als die Morgendämmerung anbrach, machte sich der Mönch mit seinem Esel auf den beschwerlichen Weg. Die Hitze dieser Sommertage ließ ihn nur langsam vorankommen. Immer wieder sah sich Henricus Institoris gezwungen, eine Pause einzulegen, sodass sein Reittier Erfrischung finden konnte. Doch ihm war es ein Gräuel, denn dadurch verlor er kostbare Zeit. Endlich, nach einigen kurzen Nächten, in denen der Dominikaner sich Gedanken machte, was ihn erwarten würde, erschienen die Stadtmauern Ravensburgs in der Ferne. Die Sonne brannte auf die umliegenden Felder, auf denen die Bauernfamilien ihrer Tätigkeit nachgingen. Mit ernster Miene ritt er an ihnen vorüber und würdigte die hart arbeitenden Menschen keines Blickes. Die ängstlichen Augen verfolgten den Geistlichen, der, um ein weiteres Zeichen zu setzen, das Kreuz von seiner Kette nahm und dieses demonstrativ in die Höhe reckte. Die Geste verlieh dem Inquisitor zusätzlichen Respekt der tiefgläubigen Bevölkerung. Seine Ankunft war bereits in aller Munde. Während die alten Bauern, wie versteinert stehen blieben, rannten die Kinder aufgeregt zu dem staubigen Weg hin, um den Mönch auf ihre Art willkommen zu heißen. Nachdem sich Heinrich auf hundert Meter, der den Ort umgebenden Mauer genähert hatte, ertönten laute Fanfaren, die ihn ankündigten. Nie zuvor hatte der Prior einen solch pompösen Empfang erleben dürfen. Umso mehr genoss er den heroischen Einzug. Weiterhin hob er grimmig das Kreuz in die Höhe und die Hufschläge seines Esels hallten durch die engen Gassen. Als er sich dem Ortskern von Ravensburg näherte, mehrten sich die neugierigen Mienen der ansässigen Händler, welche den Fremden skeptisch beobachteten. Wenn Institoris den Menschen ins Gesicht schaute, hielten nur wenige dem starren Blick stand. Die Männer bekreuzigten sich und erwiderten die Ernsthaftigkeit seines Daseins, während viele Mägde und Bäuerinnen verlegen zu Boden schauten. Dies war für ihn ein Zeichen, dass in Ravensburg nicht nur die beiden angeklagten Frauen einen Pakt mit dem Leibhaftigen geschlossen hatten. Er war sich jedoch ebenso im Klaren, dass er für die Inhaftierung sowie die Befragungen weiterer Stadtbewohner Beweise brauchte, was den Kämpfer des Glaubens immer mehr in Rage trieb. Nichtsdestotrotz hielt er an seinem Entschluss fest, die Frauen, von denen die Rede war, auf den Pfad der Tugend und Rechtschaffenheit zurückzuführen. Doch dafür gab es seiner Ansicht nach nur eine Möglichkeit. Ein Geständnis, welches den sicheren Tod bedeutete. Schließlich schlugen die Kirchenglocken zur fünften Nachmittagsstunde, als Heinrich das Gotteshaus erreichte. Vor der einladenden Pforte stand schon der Stadtrat zusammen mit dem Pfarrer, um ihn in Empfang zu nehmen. Ernst Böhmer war sechzig Jahre alt und schon seit die meisten der Einwohner denken konnten, ihr geistlicher Beistand. Der schmale, grauhaarige, mitfühlende und gerechte Mann hatte immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Belange seiner Gemeinde, was ihm einen guten Stand einbrachte.
Friedrich Georgus war das Oberhaupt des ansässigen Stadtrats. In eine feine, schwarzgraue Robe gekleidet empfing der achtundfünfzigjährige, wohlgenährte Mann, den Inquisitor. Zuvorkommend half der Sohn eines Bankiers dem Mönch aus dem Sattel.
„Henricus Institoris, seid uns aufs Herzlichste Willkommen in unserem schönen, beschaulichen Ravensburg. Darf ich Euch unseren Pfarrer Ernst Böhmer vorstellen?“ Zuvorkommend verneigte sich Pfarrer Böhmer vor dem Mann, über den so viele Gerüchte im Umlauf waren. Auch in ihm regte sich ein gehöriges Misstrauen gegenüber dem angeblichen Heilsbringer. Ungeachtet dessen, voller Glück, den Geistlichen endlich in seiner geliebten Stadt zu wissen, verneigte sich auch der Ortsvorsteher, bevor er höflich fortfuhr. „Sagt, wie war Eure Reise?“ Henricus Blick schweifte mürrisch über all die Häupter derer, die ihn schweigend, teils ängstlich musterten.
„Anstrengend, Herr Georgus. Mein Esel ist fast verdurstet.“ Auf einen Fingerzeig hin brachte ein Stallknecht das Maultier in den Schatten und gab ihm Wasser. „Man könnte den Eindruck bekommen, der Teufel habe sich schon der ganzen Umgebung bemächtigt, angesichts dieser sengenden Hitze“, zischte der Dominikaner abwertend. Geschockt von seinen harschen Worten, sahen sich der Stadtrat und der Pfarrer an. Doch Georgus wollte einen schnellen Themenwechsel herbeiführen.
„Ihr seid sicher hungrig, werter Inquisitor. Darf ich Euch einladen, mit uns zu speisen?“ Unbeeindruckt schritt Heinrich an ihnen vorbei, öffnete die Kirchenpforte, lächelte und sprach: „Ich möchte erst nach meiner langen Reise dem Herrn huldigen. Danach komme ich gern auf Euer Angebot zurück. Dann könnt Ihr mir auch den Sachverhalt schildern, wegen dem Ihr mich zur Hilfe riefet.“ Während die Bevölkerung zusah, wie der Fremde in ihrem Gotteshaus verschwand, machten sich Ernst Böhmer und Friedrich Georgus auf, um das Bankett zu Ehren ihres Gastes auf die Schnelle vorzubereiten. Aber dem alten, schwarzgekleideten Diener Gottes brannten seine Befürchtungen auf der Seele. So flüsterte er dem Ortsvorsteher leise zu: „Glaubt Ihr, wir können ihm vertrauen? Immerhin geht es um das Leben von Käthe Albrecht und Lisa Burg. Zwei angesehene Frauen, die sich nie etwas zu Schulden kommen ließen.“
„Sie wurden der Hexerei beschuldigt und inhaftiert. Wie wir nun weiter verfahren, liegt in der Hand Gottes und Henricus Institoris. Er ist ein Meister des Verhörs. Ich vertraue auf seine Meinung.“
„Mein Gewissen ist schlecht. Wir kennen den Herrn nicht und wissen nichts von seinen Methoden.“
„Macht Euch keine Sorgen“, versuchte der Stadtrat seinen Pfarrer zu beruhigen. Während die beiden den prunkvollen Bürgersaal Ravensburgs betraten, schritt der Inquisitor mit gefalteten Händen auf den herrlich geschmückten Altar zu. Jeder Schritt hallte in dem leeren Gotteshaus. Auf den breiten, steinernen Stufen sank er zum Gebet auf die Knie. Als Henricus den Allmächtigen bat, ihm bei den bevorstehenden Entscheidungen beizustehen, fiel der Schein der allmählich untergehenden Sonne durch eines der Kirchenfenster und tauchte das Innere in ein warmes Licht. Dies bestätigte ihn in seinem Handeln.
„Danke, oh gütiger Herr im Himmel“, flüsterte der Dominikaner, bekreuzigte sich und stand unter altersbedingten Schmerzen, aber in dem Wissen, dass Gott in jeglicher Hinsicht an seiner Seite war, auf.
Plötzlich schlug die Glocke im Turm bereits zur siebten Abendstunde.
Ist es schon so spät? Ich muss los. Immerhin warten die Herrschaften Ravensburgs auf mich.
Mit schmerzverzerrtem Gesicht hinkte Heinrich zur Tür hinaus. Erst in der Wärme der untergehenden Sonne linderten sich seine Gelenkschmerzen. Nicht wissend, wohin er gehen sollte, schaute sich der Dominikaner um. Ein sechsjähriger Bursche schlich an ihn heran. Niemand verlor auch nur eine Silbe, bis der Junge leise flüsterte.
„Kann ich Euch helfen, Herr?“ Gerührt von dieser Höflichkeit konnte sich der Inquisitor ein Lächeln nicht verkneifen. Er beugte sich ein Stück zu dem kleinen Mann hinunter und sprach mit väterlicher Stimme: „Ich suche den Bürgersaal.“ Kramer stockte der Atem, als ihn der Winzling auf einmal an die Hand nahm.
„Folgt mir. Ich zeige Euch den Weg.“ Zusammen schritten sie durch zwei Gässchen, die schließlich zum Marktplatz führten. „Seht, dort hinten müsst Ihr hin.“ Ruckartig blieb Institoris stehen. Sein Griff um die Hand des Burschen wurde fester. So sehr ihn die jugendliche Leichtigkeit des Kleinen erfreute, umso stärker rief ihm der Anblick der aufgeschichteten Scheiterhaufen den Ernst seines Daseins wieder in den Sinn. Inmitten der Holzscheite hob sich ein dicker Holzpfahl empor, an dem dicke Taue befestigt waren. „Los. Ihr wollt doch nicht zu spät kommen.“ Nachdem der Geistliche vor den grauen Stufen zur Halle stand, sah er dem Kind in die ehrlichen, weltoffenen Augen.
„Ich danke dir“, flüsterte Heinrich, griff in seine Tasche und nahm eine Münze hervor. „Hier, das ist für dich und deine Familie. Bewahre dir diesen Großmut, denn es ist nicht mehr selbstverständlich.“
Sprachlos verneigte sich der Jüngling, ehe er freudig, die Münze in die Höhe reckend, nach Hause lief. Schon vor den massiven Pforten des Bürgerhauses erwarteten Institoris die städtischen Wachen, die ihm mit ihren Hellebarden ein Spalier bildeten. Ein Tusch der Trompeten ertönte und der Stadtrat nahm den vermeintlichen Heilsbringer in Empfang.
„Verzeiht mir, Henricus Institoris. Wir haben getan, was in dieser kurzen Zeit möglich war. Ich hoffe, Ihr fühlt Euch in unserer Mitte wie zu Hause.“
„Ihr schmeichelt mir“, antwortete der Geistliche, während er die letzte Stufe nahm. Voller Stolz führte Friedrich Georgus seinen Gast durch den breiten, hellen Gang, bis hin zu einem großen, lichtdurchfluteten Saal, dessen schwere Holztüren mit Eisenbeschlägen einladend offenstanden. Je näher die beiden kamen, umso lauter wurden die Gespräche und das Gelächter der anwesenden Gäste. Ihm verschlug es die Sprache, denn bei seinem Eintreten fingen die Musikanten an aufzuspielen, die feingekleideten Adligen erhoben und verneigten sich respektvoll.
„Hier entlang“, sprach Georgus und geleitete den Mönch zu einem der noblen Plätze am Kopfende des aus Tischen gestellten, riesigen Vierecks. Das Wasser lief dem Inquisitor im Mund zusammen, angesichts der exzellenten Speisen, die schon rauchend dastanden und ihren herrlichen Duft verbreiteten. Neben gebratenem Fleisch, Suppen und Gemüsen, befand sich sogar frischer Fisch auf den Platten, da der Bodensee nicht weit entfernt war. Während die Musiker den Abend gesellig gestalteten und sämtliche Kerzen angezündet wurden, füllte der Mundschenk die Becher mit Wein. Obwohl es nicht Heinrichs Art war, lobte er den Koch in höchsten Tönen und trank aus Höflichkeit mit, obwohl ihm jeder Schluck zuwider war. Nach zwei weiteren Stunden, in denen noch viele weitere Becher geleert wurden, wollte der Inquisitor mehr über die Frauen erfahren, die er am nächsten Tag verhören sollte.
„Wir sind im Umgang mit Hexerei völlig überfordert“, sprach Georgus. „So etwas gab es in unserer schönen Stadt noch nie zuvor. Daher sind wir froh, Euch als Experten bei uns zu wissen.“ Kramer nahm noch einen kräftigen Schluck und starrte seinen Gastgeber fordernd an.
„Das war keine Antwort auf meine Frage. Ich brauche Details.“ Nun wollte sich auch Pfarrer Böhmer einmischen, doch der Stadtrat fuhr dazwischen und heizte die Gerüchteküche noch weiter an.
„Es handelt sich um Käthe Albrecht. Sie ist vierzig Jahre alt und die Witwe des Bauern Herbert Albrecht. Die Ehe blieb, trotz seiner stetigen Bemühungen, kinderlos, was Frau Albrecht bis heute nichts auszumachen scheint. Seit dem Tod ihres Gatten hat sie sich der Kräuterheilkunde verschrieben. Auf dem außerhalb gelegenen Hof mischte sie rätselhafte Tinkturen an, welche sie an kranke Bürger unserer Stadt verkauft hat. Laut deren Aussage wurden die Beschwerden nach Einnahme der Medizin noch schlimmer, so dass einige Patienten bereits verstarben. Ihr wird von mehreren vorgeworfen, sich auf Kosten des Lebens der Kranken bereichert und diese vergiftet zu haben.“ Kramer lauschte den Ausführungen des Stadtrats. „Des Weiteren ist da die fünfundzwanzigjährige Wäscherin Lisa Burg. Eine wunderschöne Frau, mit langem, blondem Haar. Sie hat schon so manchem jungen Burschen den Kopf verdreht und auch stets die finanziellen Vorteile genossen, indem sie sich für ihre Dienste bezahlen ließ. Dies finden wir moralisch verwerflich.“
„Ist dies das Einzige, was Ihr der jungen Dame vorwerft?“, fragte Institoris, der das Verhalten nicht guthieß, aber wusste, dass sich schon seit Ewigkeiten Frauen für klingende Münze feilboten.
„Viele ihrer Freier erkrankten schwer. Sie klagten bei unserem Arzt über starken Juckreiz im Genitalbereich, Schmerzen beim Urinieren und auch eitrige Absonderungen. Diese Frauen haben sich, meiner Meinung nach, mit dem Teufel verbündet, um den größtmöglichen Schaden über unsere Stadt zu bringen. Ihr müsst dem ausschweifenden Treiben Einhalt gebieten.“ Nachdenklich nahm Henricus noch einen Schluck zu sich, ehe er die Hand auf Georgus Schulter legte und ihm voller Zuversicht zu verstehen gab, dass er sich den gefallenen Frauen annehmen würde. Erleichtert nahm Georgus noch einen kräftigen Schluck zu sich.
„Dann werde ich den zuständigen Richter informieren.“ Doch er erntete nur ein Kopfschütteln.
„Das braucht Ihr nicht. Meine Befragung sollte ausreichen, sodass wir kein weltliches Gericht benötigen werden.“ Georgus wirkte skeptisch, vertraute jedoch den Ausführungen des Geistlichen.
Niemand von den Anwesenden bemerkte die beiden, in lange, schwarze Gewänder gekleideten Männer, welche sich samt einem Becher Wein, nicht weit von ihnen entfernt, im Halbdunkeln des Saales aufhielten. Mit ernster Miene, die Kapuzen über die schulterlangen Haare gezogen, lauschten sie dem Gespräch. Auf Pfarrer Böhmers Kopfnicken hin verließen sie, wie Geister, leisen Schrittes den Saal.
2. Kapitel
Geschwind rannten die Fremden zum Ort hinaus, wo ihre Pferde auf sie warteten. Behände sprang einer der beiden auf, zündete eine Fackel an und galoppierte in ihrem Schein los. Während noch niemand ihn bemerkt hatte, kehrte der andere zurück.
Zu später Stunde verabschiedete sich der Inquisitor von seinen Gastgebern. Jedoch nicht, ohne ihnen abermals das Versprechen zu geben, dem Treiben der Hexerei ein Ende zu setzen. Als er am Tisch in seinem noblen Gästezimmer saß, regte sich erstmals sein Gewissen gegenüber denen, die er durch sein mächtiges Wort verurteilen konnte. Das schmale Gesicht in den Händen vergraben, betete Heinrich zu seinem Gott, ihm den rechten Pfad zu weisen und standhaft zu bleiben. Durch die offenen, hölzernen Fensterläden wehte plötzlich ein eisiger Windzug und löschte das Kerzenlicht. Er war sich nicht sicher, ob dies ein Omen war oder ihn der Herr nur zur Ruhe schicken wollte. Unruhig wälzte sich der Mönch von einer Seite zur anderen. Schließlich schlug die Kirchenglocke fünf und die Morgendämmerung brach herein. Schlaflosigkeit und Aufregung zollten ihren Tribut, was jedermann an seiner mürrischen Miene ablesen konnte. Nachdem er sich der Pflege unterzogen hatte, nahm Henricus seine Aufzeichnungen und begab sich zur Kerkeranlage, in der die beiden Frauen einsaßen. Ein mulmiges Gefühl machte sich in seiner Magengrube breit, während er die kalten, steinernen Stufen hinabschritt. Der Weg