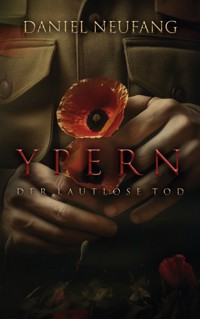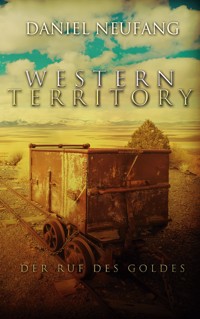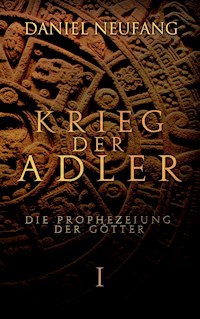Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach ihrer Ausbildung im Franziskanerinnen-Kloster von Waldbreitbach, kehrt die junge Ordensschwester Gabriele Meschenbier in ihre Heimat Saarlouis zurück, um fortan in dem hiesigen Hospital zu arbeiten. Gefestigt in ihrem Glauben, kümmert sie sich mit voller Hingabe und gemeinsam mit Pfarrer Krüger, der Mutter Oberin Viktoria und ihrer Freundin Maria um ihre Patienten. Doch der Ausbruch des Ersten Weltkrieges im Sommer 1914 sollte alles verändern. Unter dem strengen Major von Böklewitz wird das Hospital von einem auf den anderen Tag zu einem Militärkrankenhaus umfunktioniert. Während blutige Schlachten die Westfront beherrschen, geraten Gabriele und ihre Vertrauten an ihre körperlichen und seelischen Grenzen. Nur die Briefe ihres Freundes Walter Schilling, der als Sanitäter an der Front dient, und die Hoffnung ihn bald wiederzusehen, halten Gabriele mehr aufrecht. Konfrontiert mit den Schrecken des Krieges und Gefühlen, die sie bislang niemals empfunden hatte, beginnt Gabriele ihren Glauben in Frage zu stellen. Wird sie die ewige Profess ablegen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 515
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nach ihrer Ausbildung im Franziskanerinnen-Kloster von Waldbreitbach, kehrt die junge Ordensschwester Gabriele Meschenbier in ihre Heimat Saarlouis zurück, um fortan in dem hiesigen Hospital zu arbeiten. Gefestigt in ihrem Glauben, kümmert sie sich mit voller Hingabe und gemeinsam mit Pfarrer Krüger, der Mutter Oberin Viktoria und ihrer Freundin Maria um ihre Patienten. Doch der Ausbruch des Ersten Weltkrieges im Sommer 1914 sollte alles verändern.
Unter dem strengen Major von Böklewitz wird das Hospital von einem auf den anderen Tag zu einem Militärkrankenhaus umfunktioniert. Während blutige Schlachten die Westfront beherrschen, geraten Gabriele und ihre Vertrauten an ihre körperlichen und seelischen Grenzen. Nur die Briefe ihres Freundes Walter Schilling, der als Sanitäter an der Front dient, und die Hoffnung ihn bald wiederzusehen, halten Gabriele mehr aufrecht. Konfrontiert mit den Schrecken des Krieges und Gefühlen, die sie bislang niemals empfunden hatte, beginnt Gabriele ihren Glauben in Frage zu stellen. Wird sie die ewige Profess ablegen?
„Lass es genug, Herr. Muss es noch sein?
In Millionen Augen lischt das Licht.
In Millionen Herzen friert das Blut.
Verheert sind viele Städte, Flur und Feld.
Ströme von Tränen quellen bitterschwer.
Doch dem Gesetz, dem deinen, spricht es Hohn.“
Anton Wildgans
„Stimme zu Gott im Kriege“
Inhaltsverzeichnis
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
I
Wärmende Strahlen der Novembersonne verdrängten die Dunkelheit der Nacht und erweckten das saarländische Saarlouis zum Leben. Abgelegen vom städtischen Treiben erhob sich inmitten einer gepflegten Parkanlage das im 19. Jahrhundert von Mutter Rosa Flesch errichtete Franziskanerinnen-Hospital, welches seit 1902 als Krankenpflegeeinrichtung diente. Es war ein stattliches, quadratisch angeordnetes, dreistöckiges Gebäude. Die großen, einladenden Fenster waren von schwarzem Basalt umrahmt und boten einen wunderschönen Kontrast zu den, aus gelblich, weißem Stein gefertigten Wänden. An der Süd- und Ostseite befanden sich höhere Ausbauten, welche aus den Mauern herausragten und mit Mosaiken versehen waren. Graue Schindeln verhüllten die Dächer und ein metallenes Kreuz zierte den Giebel oberhalb des Haupteingangs. Ebenso verfügte das alte Klostergebäude über einen Innenhof, auf dem sich eine kleine Kirche befand.
Diese bot den Ordensschwestern Raum für ihre täglichen Gebete, aber auch für die Angehörigen der Kranken, welche um die baldige Genesung ihrer Lieben flehten. An der Rückseite, versteckt vor den Augen jeglicher Besucher, erstreckte sich ein schmaler Anbau, in welchem die Ordensschwestern ihre Ruheräume hatten. Die kleinen Zimmer waren spartanisch ausgestattet und verfügten über je zwei stählerne Betten, Nachttische, zwei kleine Kleiderschränke und eine Nische samt Kommode und Waschschüssel. Nichts außer einem Kreuz zierte die grauen Wände. Es sollte die Schwestern stets an den Sinn ihres Lebens erinnern, das sie Gott und ihren Mitmenschen verschrieben hatten und somit auf irdische Besonderheiten verzichteten.
Durch das Wohnheim führte ein schmaler Gang mit einer schweren Holztür, hinter welcher sich der große Speisesaal befand. Ebenso kühl wie die Schwesternunterkünfte, war auch dieser eingerichtet. In langen Reihen standen zu beiden Seiten Holztische, Bänke und nur die schmalen Fensterscheiben brachten neben den Öllampen Licht ins Dunkel. Dreimal täglich wurden sie hier von der Klosterköchin, die sich in ihrer winzigen Küche kaum drehen konnte, verköstigt. In dieser Nacht hatte es in Strömen geregnet und das Nass kühlte den Erdboden aus, so dass sich ein sanfter, kniehoher Nebelschleier durch die Büsche der Gartenanlage zog. Es war Sieben, als Pfarrer Krüger die Kirchenglocke läutete. Mit aller Kraft riss der fünfundsechzig Jahre alte Geistliche an dem dicken Tau und Schweißperlen liefen über seine angegraute Halbglatze. Da der Pfarrer einen stämmigen Körperbau hatte und kein Kostverächter war, stand er erschöpft da und atmete tief durch, während sich seine tiefblauen, gütigen Augen in seiner runden Nickelbrille spiegelten. Als der letzte dumpfe Ton verhallte, vernahm er leise Stimmen vor der Kirchenpforte. Pfarrer Krüger reckte den Kopf in die Höhe, lächelte und bekreuzigte sich, ehe er das Kirchentor öffnete und die Schwestern des Ordens zum Morgengebet eintreten ließ. Krüger war vom Bistum Trier nach Saarlouis geschickt worden, um die Einrichtung der Franziskanerinnen zu unterstützen. Er war Ansprechpartner für jene, die mit dem Leid und Schmerz ihrer Mitmenschen nicht mehr zurechtkamen. Auch außerhalb der Sprechzeiten, welche er mit Mutter Oberin Viktoria vereinbart hatte, war er immer zur Stelle, wenn einer der Ordensschwestern der Schuh drückte. Nacheinander schritten sie demütig an ihm vorbei und unter den weißen Hauben drang ein leises „Guten Morgen, Pfarrer Krüger“ an ihn heran. Er kannte jede der Schwestern persönlich und nachdem die Letzte in den Bänken Platz genommen hatte, begrüßte er voller Respekt Mutter Oberin Viktoria. Die fünfzigjährige Frau war schon in früher Jugend dem Orden beigetreten und hatte die Leitung des Stifts übernommen. Sie hatte mysteriöse, braune Augen, welche nichts über sie verrieten und ihr dunkles Haar wies silbrig graue Strähnen auf, die sich dezent unter der groß gefächerten, weißen Haube verbargen.
„Pfarrer Krüger“, flüsterte sie leise und verbeugte sich mit einem schwerfälligen Knicks. Er nahm sie bei den Schultern, richtete sie auf und sein Blick schweifte durch die Reihen. Ein jeder hätte nur weiße, glatte Hauben und den Habit, eine Ordenstracht, die die Franziskanerinnen auszeichnete, gesehen. Doch er vermisste zwei seiner Schafe und nahm die Oberin Viktoria dezent zur Seite. Leise flüsterte er ihr zu: „Wo sind Schwester Maria und Gabriele?“ Sie wandten sich dem Kreuz zu, gingen auf die Knie und ehe der Organist den ersten Psalm anspielte flüsterte sie zurück: „Sie hatten die Nachtbereitschaft. Ich bitte Euch um Vergebung, Pfarrer Krüger. Sie werden den Gottesdienst nachholen, wenn sie ein wenig geschlafen haben.“ Krüger nickte und ließ es auf sich beruhen, denn er wusste, welche Entbehrungen diese jungen Mädchen erbrachten, ohne jegliche Klage und Äußerung des Missmutes. Abermals sahen sich die beiden an und ein gütiges Lächeln stahl sich auf ihre Gesichter. So stimmten sie den Psalm des Jona an und ihre Stimmen drangen durch die dicken Mauern, bis hin zu Gabrieles Ohren. Sie war gerade zwanzig und stammte aus einer großen Saarlouiser Arbeiterfamilie. Ihre Brüder und Schwestern waren schon verheiratet, hatten bereits Kinder und führten zwar ein bescheidenes, aber glückliches Leben. Ihr langes, braunblondes, lockiges Haar legte sich wie ein warmer, goldener Fluss über Notizbücher, in die sie alle Vorkommnisse der Nacht einzutragen hatte. Gabriele schrak auf. Sie rieb sich den Schlaf aus ihren grünblauen Augen, befestigte hastig ihre Schwesternhaube an ihrem Haar und schaute abermals über die Aufzeichnungen, bevor sie losstürmte und die Pforte zum östlichen Flügel des Gebäudes aufstieß. Der Saal, welchen sie betrat, glich einer königlichen Unterkunft und jeden Morgen, wenn Gabriele Meschenbier eintrat, war sie überwältigt von der Schönheit dieses architektonischen Bauwerks. Es war der größte aller Behandlungsräume und bot Platz für dreißig Betten, die durch graue Laken voneinander getrennt waren, um den kranken Menschen ein wenig Privatsphäre zu spenden. Schweigend, flach atmend schritt sie über den gefliesten Fußboden und versuchte so leise wie möglich zu sein. Vergebens. Denn das Klacken ihrer Schuhe erzeugte einen Hall, der sich an der hohen Decke brach und den gesamten Raum erfüllte. Hoffentlich habe ich niemanden unsanft geweckt. Gott lob, dass sich nur fünf Patienten in diesem Saal befinden, dachte sie und zog vorsichtig die schweren, dunklen Vorhänge zur Seite. Der Ausblick auf die Gartenanlage und ihre Heimatstadt ließen ihr den Atem stocken. Strahlen der aufgehenden Sonne färbten den Himmel in ein warmes, gelbliches Rot. Nur wenige schwarze Wolken unterbrachen das Licht und mischten sich mit dem düsteren Rauch, welcher aus den dünnen Schornsteinen der Hütte am Horizont emporstieg. Sie wirken so klein, wie Streichhölzer, die man mit einem Ruck durchbrechen könnte.
„Schwester?“, ertönte eine raue Stimme gefolgt von einem rasselnden Geräusch. Hektisch wandte sich Gabriele dem ersten Vorhang zu und zerrte ihn zur Seite. Wie angewurzelt stand die junge Ordensschwester vor Herrn Zauner, einem älteren Mann, der aufgrund seiner ständigen Atemnot eingeliefert worden war. Todesangst spiegelte sich in seinen feuchten, braunen Augen und seine Lippen bebten vor Panik, als er Gabriele, flehend um Beistand seine dürre Hand entgegenstreckte.
„Helfen… Sie… mir… Schwester“, hauchte er und rang um einen kleinen Zug frischer Luft.
„Herr Zauner, bleiben Sie ganz ruhig. Ich bin bei Ihnen“, versuchte die junge Schwester den alten Zimmermann zu ermutigen, während ihr Herz vor Aufregung in ihrer Brust hämmerte. Vorsichtig umfasste sie sein Handgelenk, legte ihren Zeigefinger auf seine Schlagader und stierte stumm die Sekunden zählend auf die Uhr. Tick, tack, tick, tack.
„Hundertvierzig“, flüsterte sie und legte seinen Arm sachte auf das weiße Laken. Geistesgegenwärtig stützte sie mit ihrer Hand seinen Nacken, setzte ihn aufrecht hin und polsterte seinen Rücken mit sämtlichen Kissen aus, welche sie finden konnte.
„Tief durchatmen, Herr Zauner. Keine Panik. Ich werde sofort dem Arzt Bescheid geben.“ Heinz Zauner nickte erschöpft und hob seine zittrige Hand. Gabriele lächelte ihn an und rannte los. Adrenalingepeitscht stieß sie die große Tür auf, stürmte den langen Flur entlang und schrie aus voller Brust: „Professor Gross! Professor Gross! Ich brauche Hilfe.“ Am Ende des Korridors öffnete sich eine Tür und ein hagerer Mann mit weißem Bart trat aus dem Zimmer heraus. Er rieb sich die Augen und setzte seine Brille auf.
„Schwester Gabriele, was ist denn geschehen?“, fragte der Mediziner und nahm sie bei den Schultern.
„Herr Zauner. Er bekommt keine Luft.“
„Ich komme sofort. Einen Augenblick.“ Professor Gross eilte zurück und kam mit seinem Stethoskop zurück. Er legte beruhigend die Hand auf ihre Schulter und versuchte durch seine Art Ruhe auszustrahlen. „Lassen sie uns gehen, Gabriele.“ Nachdem sie den Saal betreten hatten, sah der Arzt, wie der Zimmermann aufzustehen versuchte.
„Heinz, legen Sie sich wieder hin. Sie dürfen sich nicht überanstrengen“, befahl Gross seinem Patienten barsch, während Gabriele ihm geruhsam half sich zurückzulehnen. „Ziehen sie ihm das Oberteil aus.“ Er legte das Stethoskop an seine Brust und horchte. Von rechts nach links, von oben nach unten, untersuchte er den aufgedunsenen Brustkorb und übte leichten Druck auf seinen Bauch aus. Der Professor stand auf, schob Schwester Gabriele zur Seite und schloss den Vorhang hinter sich.
„Gut, dass Sie mich so schnell gerufen haben. Seine Lungen haben sich mit Wasser gefüllt und das Herz schlägt unregelmäßig.“
„Aber es ging ihm doch gestern noch gut“, stotterte sie geschockt und fuhr sich immer wieder nervös über den Arm.
„Wie lange arbeiten Sie schon?“, fragte Gross besorgt.
„Seit achtzehn Stunden, Herr Professor.“
Dieser atmete tief durch und schaute kopfschüttelnd nach oben.
„Gehen Sie. Frühstücken Sie eine Kleinigkeit und schlafen sich aus.“
„Aber ich habe noch keine Übergabe gemacht und…“ Der Mediziner unterbrach sie und zog seine Brille ab.
„Schwester Gabriele, tun Sie, was ich Ihnen sage.“ Die Glocken läuteten das Ende der Morgenmesse ein und während die Ordensschwester sich demütig verneigte, fuhr Gross fort: „Sagen Sie Mutter Oberin, dass ich eine Absaugkanüle, ein Skalpell und eine große Auffangschale benötige.“
„Gewiss, Herr Professor.“ Nachdem sie die Tür hinter sich geschlossen hatte und auf das Büro zuging, erschien Mutter Viktoria in Begleitung von Schwester Margarete und der Novizin Laura. Margarete war Mittedreißig und hatte durch ihre offene, warmherzige Art einen guten Ruf in der Einrichtung.
Sie sprach nicht viel, hatte jedoch immer ein offenes Ohr für die Sorgen ihrer Mitmenschen. Laura hingegen war erst seit einem Jahr im Orden und es war ihr deutlich anzumerken, dass dieses Leben nicht ihren Vorstellungen entsprach. Gabriele zeigte Verständnis für ihr Verhalten, welches bisweilen aufbrausend und ablehnend war. Viktoria umfasste ihren Rosenkranz und ließ Perle um Perle durch ihre schmalen Finger gleiten.
„Schwester Gabriele. Ich gehe davon aus, dass es den uns anvertrauten Patienten gut geht“, sprach sie und ihre strenge Miene spiegelte ihre hohen Erwartungen wieder. Die junge Ordensschwester wusste nicht, wie sie auf diese indirekte Frage antworten sollte. Völlig übermüdet senkte sie ihr Haupt und flüsterte: „Herr Zauner…“
„Was ist mit ihm?“, fiel die Oberin ihr ins Wort.
„Er bekam plötzliche Atemnot und hatte einen Pulsschlag von hundertvierzig. Ich habe daraufhin seinen Körper hochgelagert und den Herrn Professor informiert.“ Mutter Viktoria nahm die Worte zur Kenntnis und strafte, obwohl es ihrem Charakter widerstrebte, ihre Untergebene mit Verachtung.
„Ist er bereits bei ihm?“
„Ja. Ich soll Ihnen mitteilen, dass der Professor ein Skalpell, eine Absaugkanüle und ein Auffanggefäß benötigt.“
„Schwester Margarete“, raunte die Oberin und ihre Finger beteten den Rosenkranz schneller als zuvor. „Sie haben gehört, was unser Professor Gross benötigt. Nehmen Sie die Utensilien und gehen Sie ihm beim Absaugen der Lungenflüssigkeit zur Hand. Wenn Sie eine weitere Kraft benötigen, geben Sie mir unverzüglich Bescheid.“
Margarete verneigte sich kurz und verschwand in der kleinen Kammer, in welcher sich die Utensilien befanden.
„Sie werden sich ausruhen, Schwester Gabriele. In diesem Zustand sind Sie niemandem Nutze.“
„Habt Dank, Mutter Oberin.“ Während sie sich auf den Ausgang zu bewegte, nahm sie das zynische Grinsen von Novizin Laura wahr und zerrissen zwischen Zorn, Abscheu, Mitleid und Liebe nahm sie auf einer der Flurbänke Platz. Sie versteckte das Gesicht hinter ihren weichen Händen und ließ ihren Gedanken freien Lauf. Wie kann man nur so schmutzig im Gedankengut sein? Sie tut unserem Orden nicht gut. Doch ich muss es für mich behalten. Schweigen. Irgendwann wird auch Laura die Last, die Bürde, aber auch die Freude und Selbstlosigkeit dieser Arbeit erkennen. Schwester Gabriele schaute ihrer Oberin hinterher. Nach einem weiteren, schweren Wimpernschlag war sie zusammen mit Laura verschwunden und Gabriele war in ihren Gedanken wieder das junge Mädchen von einst.
„Sie sind also Gabriele Meschenbier?“, sprach Mutter Oberin die Sechzehnjährige an. Ängstlich, ohne ein Wort zu erwidern, nickte Gabriele und wagte es nicht sie anzusehen. „Und sie sind die Eltern?“
„Jawohl, Mutter Oberin Viktoria. Mein Name ist Fritz Meschenbier und dies ist meine Frau Anna.“ Argwöhnisch beäugte Viktoria die Familie und ihre Miene verriet, dass sie Skrupel hatte das junge Mädchen in ihren Orden aufzunehmen. Doch als sie ihr sagte, dass sie sich nun von ihren Eltern verabschieden müsse und sah, wie schwer ihnen der Abschied fiel, zeigte auch Viktoria einen Hauch von Mitgefühl. Gabriele fing bitterlich an zu weinen und umarmte ihre Mutter so stark, als würde sie Anna nie mehr loslassen.
„Meine liebe Kleine. Du wirst sehen, dass es das Beste für dich ist. Hab Vertrauen und denk immer daran, wie sehr wir dich lieben“, flüsterte Anna und streichelte unter Tränen das lange, lockige Haar ihrer Tochter. Auch ihr Vater trat näher, strich ihr sanft über die Wange und versuchte seine Empfindungen zu unterdrücken, um seinem kleinen Mädchen den Abschied nicht noch schwerer zu machen. Fritz Meschenbier war ein Grubenarbeiter. Tag für Tag nahm er den beschwerlichen, kilometerlangen Weg auf sich, um im Bergwerk zu schuften und so seiner Familie ein angenehmes Leben zu ermöglichen. Ein Jahr zuvor war er noch ein kräftiger Mann, welcher Zentner mit bloßer Hand bewegen konnte. Dies hatte sich Anfang des Jahres 1909 geändert. Es war ein kalter Morgen im Januar. Fritz war mit seinen Kameraden der Frühschicht gerade die Loren am Beladen, als plötzlich ein donnerndes Krachen zu hören war. Wie versteinert standen sie da und starrten im Schein ihrer Lampen auf die rabenschwarze Rauchwolke, welche sich mit immenser Geschwindigkeit näherte. Die Wände des Stollens bebten, zitterten und ein ohrenbetäubendes Raunen erfüllte den Gang. Meschenbier riss seinen Kollegen nach vorne und stieß ihn in Richtung des Ausgangs, während sich Brocken von der Decke lösten und krachend zu Boden stürzten. Fritz konnte noch verhindern, dass jemand verletzt wurde, als ein dicker Gesteinsbrocken auf sein Bein fiel und es zertrümmerte. Es dauerte ein halbes Jahr, bis seine Wunden verheilten und dennoch waren die Folgen so gravierend, dass er berentet wurde. Vorsichtig legte er seine rauen Hände auf Gabrieles Schultern und flüsterte: „Ich wünschte, es wäre anders gekommen. Ich wollte nie, dass du uns verlässt, aber meine Rente reicht kaum aus, um die anfallenden Rechnungen zu begleichen.“
„Mach dir keine Vorwürfe, Papa. Vielleicht ist es mein Schicksal. Bitte schreibt mir. Ich will wissen, wie es euch geht und sagt dem Rest der Familie, dass ich sie immer in meinem Herzen trage.“ Während sich Anna weinend abwandte, nahm er seine Tochter noch einmal fest in den Arm und versprach ihr sie zu besuchen, wann immer er die Zeit fand, den langen Weg zum Franziskanerinnen-Kloster von Waldbreitbach in Rheinland-Pfalz auf sich zu nehmen, wo Gabriele die ersten Jahre ihrer Ausbildung zur Novizin absolvieren würde, bevor sie als Krankenschwester nach Saarlouis zurückkehren konnte. Doch all ihre Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen wurde zerstört, als die Oberin ihnen klarmachte, dass jeglicher Besuch in dieser Zeit untersagt war.
„Es wird Zeit für uns zu gehen“, sprach Mutter Viktoria und zog sie sachte zu sich heran. Das Ehepaar machte einige Schritte zurück, ehe sie sich umdrehten und Fritz den Kopf seiner Anna behutsam an seine Schulter drückte. Gabriele fügte sich schweren Mutes und schaute sich ein letztes Mal um. Ihre geliebten Eltern waren auf einen Schlag nur noch Schatten, die zwischen den Büschen und Bäumen der Gartenanlage verschwanden. Die junge Novizin spürte die feinen Kieselsteine die den Gehweg auslegten unter ihren Schuhen und wischte sich die Tränen ab. Nun beginnt ein neuer Abschnitt. Ein neues Leben. Die Oberin öffnete die schwere Eingangspforte und Gabriele stockte der Atem. Mit weit aufgerissenen Augen bewunderte sie die riesige Eingangshalle, in der sie so klein wirkte. Die gewaltigen Mosaike boten einen warmen Kontrast zu den kühlen, steinernen Wänden und die hohen, gotischen Bögen, welche die Halle zierten, machten ihr bewusst, wie klein der Mensch doch war.
„Folge mir, Gabriele“, sprach die Mutter Oberin und wies ihr den Weg durch die Halle, hin zu einer schweren Tür, welche sich im Westflügel befand. Gellend hallten ihre Schritte und aus dem Augenwinkel beobachtete Gabriele, wie sich das Licht mit jedem Meter auf neue Art in den bunten Fensterbildern brach.
„Hier sind die Schwesternzimmer“, erklärte Viktoria und wies mit einer einladenden Geste den Gang entlang. Im schummrigen Schein der Kerzen liefen sie weiter und das junge Mädchen fragte sich, wie es wohl hinter den schlichten, weißgestrichenen Türen aussah. Unter einem lauten Quietschen öffnete sich die Letzte und eine junge Frau betrat den schmalen Flur. Erschrocken und demütig neigte sie ihr Haupt und umschloss die Hände vor ihrem Schoß.
„Mutter Oberin, ich wollte gerade…“ Sie hob die Hand, hielt sie wie einen Schild vor sich und sprach: „Du brauchst dich nicht zu rechtfertigen, Maria“ und wandte sich ihrer neuen Novizin zu. „Dies ist Gabriele. Sie hat sich für unser Leben im Glauben an unseren Herrn, entschieden. Du wirst sie weiter herumführen. Erkläre ihr die Gepflogenheiten unseres Klosters, Regeln des Ordens und hilf ihr sich in den Räumlichkeiten zurechtzufinden.“
„Gewiss, Mutter Oberin.“
„Ich lasse euch nun allein, denn ich muss die Tagesberichte überprüfen.“ Sie drehte sich noch einmal um und hob sachte Gabrieles Kinn in die Höhe. „Sei offen und ehrlich. Verstecke nicht dein Gesicht, denn jede junge Frau, die hier ihrem besten Gewissen nachgeht, hat Respekt verdient. So auch du, Gabriele.“ Mit diesen aufmunternden Worten ging sie fort. Maria hob ihren Kopf und lächelte.
„Du wirst mir also Gesellschaft leisten“, flüsterte sie und um ihren schmalen Mund bildeten sich tiefe Grübchen. Maria war Novizin im zweiten Jahr, hatte schon viel Erfahrung gesammelt und war froh ihr Wissen über den Orden weiterzugeben. Ihre Augen waren blau und voller Güte, doch es war nicht zu erkennen, ob sie von femininer Statur war, denn der schwarze Habit verdeckte ihren gesamten Körper. Sie nahm Gabriele bei der Schulter und führte sie in das Schlafgemach.
„Ich weiß, es wirkt kühl, aber die Liebe zu Gott wird deine Seele wärmen.“
„Welches ist mein Bett?“, fragte Gabriele zurückhaltend und stellte vorsichtig ihren Koffer auf den kalten Boden.
„Du schläfst rechts. Ich habe gehört, dass ich endlich eine Mitbewohnerin bekomme. Deshalb habe ich schon alles vorbereitet.“
„Danke. Ich heiße Gabriele Meschenbier“, sagte sie und streckte Maria freundschaftlich die Hand entgegen.
„Maria Schleier.“ Sie wollte gerade ihren Koffer auspacken, als Maria sie zurückhielt. „Das hat Zeit. Wir kümmern uns erst um deinen Habit.“
„Habit?“, fragte Gabriele mit ungläubigem Blick. Maria lachte und fuhr mit den Händen über ihre schwarze Tracht.
„In Gottes Augen sind wir alle gleich. Es ist ein Zeichen unserer Gemeinschaft und des einfachen Lebens, welches wir hier führen.“ Die junge Frau schaute auf ihr grünes Kleid, welches mit weißen Blumen versehen war und erkannte den Unterschied zu ihrem bisherigen Leben.
„Folge mir“, sprach Maria mit leiser Stimme und öffnete die Tür.
Sie zeigte ihr den Speisesaal, die Küche, in welcher die Schwestern nacheinander Hilfestellungen bei der Zubereitung der Mahlzeiten leisteten und zu guter Letzt die hauseigene Wäscherei. Maria klopfte an, doch es tat sich nichts, bis sich plötzlich mit einem heftigen Ruck die Pforte öffnete und eine alte Frau ihnen mit ernster Miene entgegenschaute.
„Was ist denn nun schon wieder los?“, grummelte die wohlbeleibte Dame und musterte das junge Mädchen. Sie umfasste Gabrieles Arme und nickte zuversichtlich. „Ist das unsere neue Novizin?“
„Ja, Schwester Grimhild“, antwortete Maria und schaute die Neue besorgt an. Sie wusste, dass Grimhild kein Blatt vor den Mund nahm und man erst lernen musste mit ihrer ruppigen Art zurechtzukommen.
„Gabriele benötigt ihren Habit.“
„So kann sie bestimmt nicht in den Orden aufgenommen werden“, kam das schnippische Kontra der Schneiderin und Wäschefrau und beherzt zog sie Gabriele an sich heran. „Wir kommen schon zurecht, Schwester Maria“, zischte sie und winkte sie hinaus. Nachdem sich die Tür geschlossen hatte, fühlte sich die junge Novizin verlassen und abermals galt ihr Augenmerk unsicher dem steinernen Fußboden.
„Keine Angst, meine Kleine“, versuchte die Wäscherin sie zu beruhigen. „Ich beiße dich nicht.“ Unter lauten Gelächter schlich sie zur Seite, öffnete eine Schublade und nahm ein Metermaß hervor. Ehe Gabriele sich äußern konnte, fiel Grimhild vor ihr auf die Knie und grummelte hoch konzentriert: „Hm, ja…das könnte passen.“ Währenddessen sah sich die Novizin interessiert um. Drei große hölzerne Waschschüsseln standen da und heißes Wasser stieß seinen Dampf in die Höhe. An der linken Seite befand sich eine lange Stande, an der die frisch gewaschenen, gebügelten Roben der Nonnen hingen. Schwester Grimhild stand auf und verschwand in einer dunklen Ecke.
„Hier!“, rief sie und ihre grelle Stimme hallte in Gabrieles Ohren. „Das dürfte bis morgen ausreichen.“ Sie gab ihr einen schwarzen Habit und zwei weiße Hauben. „Komm morgen um die Mittagsstunde noch einmal vorbei. Bis dahin sind deine Roben fertig.“
„Haben Sie nichts in meiner Größe?“, fragte sie kleinlaut, hielt sich die Arbeitskleidung vor und befürchtete einen emotionalen Ausbruch der alten Ordensschwester.
„Nein. So etwas Dürres, wie dich habe ich seit Ewigkeiten nicht gesehen. Du musst schon damit auskommen.“ Behutsam faltete sie den Habit zusammen und wisperte: „Vielen Dank, Schwester Grimhild.“ Mitleidsvoll strich ihr die Wäscherin über die Wange, lächelte und sprach ihr gut zu: „Ich weiß, wie schlimm es für dich sein muss, dein gewohntes Umfeld zu verlassen, fern der Heimat. Doch glaube mir, wenn du dich in die fürsorglichen Hände unseres Herrn begibst, wirst du wahres Glück erfahren.“
„Wahres Glück?“, fragte Gabriele.
„Natürlich. Merke dir unser Kredo. Wer willkommen sein will unter euch, verlasse alles, und was er hat, gebe er den Armen.“ Gabriele schüttelte den Kopf, denn sie wusste nichts mit diesen Worten anzufangen.
„Was meinen Sie damit?“
„Lasse dein altes Leben hinter dir und sei immer für deine Mitmenschen da. Leihe ihnen ein offenes Ohr und gib ihnen ein gutes Wort. Du wirst sehen, dass es dich befreit.“ Gabriele verneigte sich vor der Schwester und schlich zurück auf ihr Zimmer. Umgezogen und die Haare unter der schmalen, weißen Haube versteckt, nahm sie auf ihrer kargen Liege Platz. Von Heimweh geplagt, versteckte sie ihr Gesicht hinter ihren weichen Händen und weinte bitterlich. Sie vermisste schon nach dieser kurzen Zeit ihre Eltern, Schwestern und Brüder. Papa, wer wird sich um dein Bein kümmern? Liebste Mama, ich wünsche mir, dass du mit dieser schweren Bürde allein zurechtkommst. Ich bin erst wenige Stunden hier und vermisse euch schon jetzt. Bitte, behaltet im Gedächtnis wer ich war, denn ich werde schon bald eine Andere sein.
„Gabriele? Gabi?“, ertönte eine altbekannte Stimme und auf einen kräftigen Ruck an ihrer Schulter hin, erwachte die Ordensschwester Gabriele aus ihrem Tagtraum. Sie rieb sich die Augen und geplagt von der Erschöpfung dieser Nacht, sah sie in Marias engelsgleiches Antlitz.
„Du schienst tief und fest am Schlafen zu sein.“
„Alles ist gut, Maria. Ich dachte bloß über Laura und ihre abweisende Art nach.“
„Mach dir keine unnötigen Sorgen. Mutter Viktoria wird die neue Novizin schon bald auf die Probe stellen, nachdem sie das Kloster verlassen hat.“ Gabriele nickte und strich ihr lockiges Haar zurück.
„Wahrscheinlich hast du Recht. Entschuldige, ich muss aussehen, als wäre ich gerade aus dem Bett gekrochen.“ Maria nahm ihre Hände und richtete sie auf.
„Wir sind schon lange auf den Beinen. Lass uns frühstücken. Danach werden wir beten und uns in unsere Gemächer begeben. Ein wenig Schlaf wird dir guttun.“
„Haben wir morgen wieder Nachtschicht?“ Maria schüttelte den Kopf und flüsterte: „Morgen haben wir frei.“ Erleichtert erhob sich Gabriele von der Bank und die beiden machten sich auf ihre grummelnden Mägen zu füllen.
II
Eine Woche war vergangen und der November 1913 neigte sich dem Ende zu. Das warme, bunte Laub war von den Ästen verschwunden und der Duft verblühender Pflanzen mischte sich mit beißenden Geruch der Hütten, denn, je nachdem wie der Wind stand, wehte der mit Ruß gefüllte Schwall der Bergwerke zu ihnen herüber.
Gabriele stand vor dem Haupteingang, gehüllt in eine dunkle Strickweste, welche ein Geschenk ihrer Eltern war und umfasste ihre Arme. Eine kühle Brise rauschte über den großen Garten hinweg, als würde sie versuchen, Bäume und Büsche hinweg zu wehen. Die junge Schwester dachte an Herr Zauner, um den sie sich so hinreißend gekümmert hatte.
„Schwester Gabriele, fühlen Sie sich nicht wohl?“ Es war Pfarrer Krüger. Er trat an sie heran und seine Finger legten sich um den ledernen Band seiner Bibel. „Sehen Sie nur, wie sich meine Hände blass färben. Es wird wohl an der Kälte liegen.“ Gabriele schwieg und starrte weiter auf die nackten Baumkronen, welche im Rausch des Windes tanzten.
„Wenn ich Ihnen helfen kann, geben Sie mir Bescheid“, fügte er hinzu. Sie atmete tief durch, die frische Luft erfüllte ihre Seele und während sie den Kopf schüttelte, stahl sich ein Lächeln auf ihr Gesicht.
„Danke, Pfarrer Krüger. Ich weiß es zu schätzen, aber es geht mir gut.“ Der alte Pfarrer konnte sich in ihre Lage hineinversetzen und legte seine Hand tröstend auf ihre Schulter.
„Unser barmherziger Gott bestimmt, welche Bürden uns auferlegt werden. Es ist nun an uns, diese zu ertragen und weiterzuleben.“ Gabriele nickte und vergrub ihren zitternden Körper in der baumwollenen Weste. „Vielleicht sollten Sie Ihren Eltern schreiben. Ich denke, dass es Ihre Gedanken befreien würden“, fuhr Krüger fort und wollte gerade das Gebäude betreten, als ein ohrenbetäubendes Rattern ihn aufschrecken ließen. „Ich vermisse die Zeit, als die benötigten Materialien noch mit Pferdefuhrwerken geliefert wurden“, raunte der Geistliche und zog seine Brille ab.
„Ich finde es interessant, Pfarrer Krüger. Ich schaue den Arbeitern schon seit langem zu und bewundere die technischen Errungenschaften.“
„Sie werden sehen, was die sogenannte Technik noch bringen wird. Denken Sie an meine Worte. Es wird nicht immer nur Gutes sein, was der Fortschritt mit sich bringt.“ Seit dem Sommer dieses Jahres waren die Arbeiten am Anbau des Krankenhauses in vollem Gange.
Die ersten Monate waren leise vonstattengegangen, doch als die Grundsteine gelegt wurden, litten nicht nur die Patienten sondern auch die Schwestern unter dem anhaltenden Lärm. Nacheinander hielten die, von Benz gebauten, Lastwagen vor der Baustelle und nachdem die Maurer die Ladeflächen verlassen hatten, gingen sie an ihr Werk. Sie entluden die quadratischen Steine und Gabriele konnte sehen, wie sich die Achsen der dunkelgrün lackierten Vierräder hoben.
„Es sind zu wenige Steine! Wir brauchen mehr!“, schrie der Vorarbeiter den Fahrer an und schlug sich seine französische Mütze über das Bein.
„Was soll ich tun, Herr Sommer?“, rief der Lenker und zuckte mit den Schultern. „Die Karre ist nur für fünf Tonnen ausgelegt.“
„Dann fahr endlich los. Ladet nur vier, Herr Gott nochmal!“ Der junge Mann startete und fuhr langsam mit einem verbissenen Gesichtsausdruck an Gabriele vorüber. Durch den Motorenlärm war es ihr nicht möglich ein Wort zu verstehen. Gabriele musste sich anstrengen, um das Läuten der Kirchenglocke zu hören und stürmte los. Auf ihrem Weg zur Messe konnte sie den rauen Umgangston des Vorarbeiters nicht fassen.
„Wie kann man so schroff zu seinen Mitmenschen sein?“, fragte sie sich und rannte über den Innenhof. Vor der Kirchenpforte hatten sich die Schwestern bereits versammelt und warteten auf Einlass. Ihre Mienen waren verzerrt und einige hielten sich die Ohren zu. Maria trat an ihre Mitbewohnerin heran und auch in ihrem Ausdruck spiegelte sich der Stress der letzten Tage.
„Dieser Krach. Man wünschte, diese ganzen Maschinen wären nie erfunden worden.“
„Du sieht blass aus, Maria“, flüsterte Gabriele und hakte sich bei ihrer Freundin ein.
In diesem Augenblick verstummten die Glocken und knarrend öffnete Pfarrer Krüger die Pforte. Er nahm tief Luft und wies die Franziskanerinnen in das Gotteshaus. Plötzlich verspürten die Beiden einen kräftigen Ruck von der Seite und ein weißer Schatten zischte an ihnen vorüber. Mutter Viktoria blieb stehen und niemand wagte es sie anzusprechen. Entnervt sah sie sich um und auch ihr waren die Spuren dieses Getöses in ihr Antlitz geschrieben. Ihre Augen waren von grauen Gräben umrandet und es schien, als hätte sie seit Wochen nicht geschlafen.
„Mutter Viktoria, Sie sehen müde aus“, sagte der Pfarrer und obwohl er ahnte, warum sie sich nicht wohl fühlte, versuchte er ein Gespräch zu führen. Doch Viktoria blieb stehen, starrte ihn mit eisigem Blick an und zischte: „Seit Tagen dieser Krach. Ich wünsche dieser Anbau würde schon stehen.“
„Haben Sie noch Geduld, Mutter Viktoria. Es ist nun mal nicht Waldbreitbach. Unser Herr stellt uns manchmal auf eine harte Probe.“ Es bedurfte keiner Antwort. Die hängenden Mundwinkel und die faltige Stirn der Oberin sprachen für sich.
„Halten Sie die Messe, Pfarrer Krüger, damit wir wieder an unsere gottgewollte Arbeit gehen können.“
Die Schwestern hofften auf ein wenig Ruhe und sehnten sich nach einem leisen Gebet. Selbst in der Kirche blieben sie von dem anhaltenden Lärm nicht verschont. Der Organist spielte auf und selbst der Klang der Orgel, gepaart mit dem Gesang „Morgenglanz der Ewigkeit“ vermochte es nicht die knirschenden, grellen Geräusche der Maschinen zu übertrumpfen. Minuten schienen wie Stunden und als sie nach der Hostie das Gotteshaus verließen, war den Franziskanerinnen die Erleichterung anzusehen. So ging es weiter, bis endlich die Mittagspause der Männer anbrach und die ratternden Höllenapparate für eine Weile schwiegen. Für die Schwestern war es eine Wohltat und während der Frühdienst seine letzte Stunde vor sich hatte, nahm der Rest das Mittagessen zu sich. Nacheinander füllten sich die hölzernen Bänke und als die letzte der Frauen Platz genommen hatte, erhob sich Mutter Viktoria zum Gebet. Schweigen machte sich breit, die Häupter neigten sich und während sich die Oberin abermals mit strengem Blick umschaute, falteten sich die Hände aller.
„Herr, wir danken dir für die Speisen, welche du uns bereitest. Dass wir frische Kraft schöpfen, um dein Werk zu tun. Amen.“ Die Teller waren reich gefüllt und neben Fleisch, Soße und Kartoffeln befand sich auch frisches Gemüse darauf.
„Womit haben wir heute so ein reiches Essen verdient?“, fragte Gabriele leise, dass sie nicht gehört werden konnte. Maria schüttelte den Kopf, zuckte skeptisch mit den Schultern und schaute zur Oberin hinüber. Während den Mahlzeiten wurde kein Wort gesprochen und nur das Schallen des Bestecks auf dem Porzellan durchbrach die Stille, welche für Außenstehende beklemmend schien.
Um halb eins standen die Schwestern nacheinander auf, nahmen ihre Teller und stellten diese beim Hinausgehen in die Durchreiche, welche zur Küche führte. Maria und Gabriele gingen zusammen in den Haupttrakt. Maria spürte, dass mit ihrer Freundin etwas nicht stimmte. Am Fuße der breiten Treppe stoppte sie Gabriele und sah ihr tief in die Augen.
„Ist alles in Ordnung, Gabi?“, fragte sie besorgt und wartete auf eine plausible Antwort.
„Mach dir keine Sorgen.“
„Bist du dir sicher?“, hakte Maria nach und führte sie zur Seite, wo sich der Schall nicht durch den gesamten Flur ausbreitete. Fragend schaute sie sie an und ihre dunklen Augenbrauen zogen sich in die Höhe. Gabriele fühlte sich bedrängt und ihre Reaktion war völlig ungewohnt. Ihre Stimme bebte und ihre Miene schien wütend, gar zornig.
„Könnt ihr mich nicht in Ruhe lassen? Ich komme zurecht. Mir bleibt ja nichts anderes übrig“, fuhr sie Maria an und rannte forsch die Stufen hinauf.
Was hat sie bloß? Sie hat doch immer mit mir über ihre Probleme gesprochen. Hoffentlich mache ich mir umsonst Sorgen, dachte ihre beste Freundin und folgte ihr in den zweiten Stock. Die junge Ordensschwester Gabriele lief forsch auf das Büro zu, blieb vor der Tür stehen und versuchte sich zu beruhigen.
Bleibe ruhig. Keiner will dir Schlecht. Aber es ist meine Sache. Ich muss damit zurechtkommen und dabei kann mir niemand helfen. Sie atmete tief durch, drückte die Türklinke nach unten und betrat das Büro. Mutter Viktoria befand sich bereits hinter ihrem Schreibtisch und studierte die Aufzeichnungen, während Margarete und Laura auf den harten Stühlen an der kahlen Wand saßen.
„Mutter Oberin, ich melde mich zur Spätschicht“, wisperte Gabriele und ihr Blick schweifte zu Margarete. Diese lächelte ihr zu und nickte.
„Schwester Margarete, Laura, ihr könnt gehen. Und schließt bitte die Tür hinter euch“, sprach Mutter Viktoria bestimmend. Sie standen auf und verließen das Schwesternbüro.
Viktoria wandte sich um, zog ihre Lesebrille ab und schaute Gabriele an. Obwohl ihre Miene ernst erschien, war ihre Stimme klar und freundlich. „Nehmen Sie Platz.“ Die erfahrene Nonne legte die Hände auf den Schoß und fuhr fort, während Gabriele sich hinsetzte. „Ich weiß, wie Sie sich fühlen. Es war eine harte Woche. Wahrscheinlich die härteste in ihrem bisherigen Leben. Doch lassen sie sich nicht verunsichern. Es war alles korrekt und wie die Dinge sich entwickelten, war nicht Ihr Verschulden.“
„Haben sie Dank, Mutter Viktoria.“ Diese stand langsam auf, griff sich mit schmerzverzerrtem Gesicht an die Hüfte und hinkte zur großen Fensterscheibe, welche einen herrlichen Blick auf den Hofgarten bot. Sie betrachtete die blattlosen Bäume, welche das Anwesen umfassten und die angrenzenden, abgeernteten Felder.
„Schreiben Sie Ihrer Familie. Es wird Ihnen eine immense Stütze sein, um die Erlebnisse zu verarbeiten.“ Gabriele lauschte ihren Weisheiten und gleich sah die Welt nicht mehr so düster aus.
„Pfarrer Krüger empfiehl mir alles niederzuschreiben. Doch ich bin bereit für den Dienst. Sagen Sie mir, was ich bei den Patienten be…“ Plötzlich öffnete sich die Eingangstür und Professor Gross trat ein. Er warf seine Kladde in die Ecke, ließ sich auf den Stuhl sinken und versteckte seine rot unterlaufenen Augen hinter seinen Händen.
„Was suchen Sie hier, Professor?“, fragte Viktoria mit scharfer Zunge und war sichtlich erbost darüber, dass der Mediziner einfach in ihr Gespräch geplatzt war. „Ich brauche einen Moment Ruhe, Mutter Oberin.“
„Ihnen schlägt wohl die Arbeit über dem Kopf zusammen, Professor Gross.“ Gabriele saß regungslos, wie zur Salzsäule erstarrt da und lauschte dem Gespräch.
„Es ist nicht nur die Arbeit“, wimmerte der Arzt, nahm seine Brille ab und rieb sich die Augen. „Dieser ständige Lärm, klagende Patienten und nun auch noch die vielen Bewerbungen, welche tagtäglich eingehen.“
„Bewerbungen?“, fragte Viktoria überrascht, setzte sich wieder hin und starrte Herrn Gross erwartungsvoll an, der antwortete: „Ich bin nicht mehr der Jüngste. Außerdem werden wir Ärzte benötigen, welche die neuen Fachbereiche abdecken. Chirurgen, Ärzte für innere Medizin, Gynäkologen. Ich muss die Gespräche führen und bestimmen, wer in Frage kommt.“
„Denken Sie an den hippokratischen Eid, welchen Sie geleistet haben. Sie sind Mediziner aus Passion, ebenso wie wir alle uns unserem Herrn verschrieben haben. Sie dürfen keine Zweifel haben. Weder an Ihren Fähigkeiten, noch an Ihrem Willen.“ Ein Lächeln der Dankbarkeit für diese aufmunternde Predigt stahl sich auf seine schmalen Lippen und geladen von neuer Akribie sprang er auf, hob sein Schreibbrett vom Boden auf und sagte: „Haben Sie Dank, Mutter Viktoria. Sie haben die löbliche Eigenschaft, jedem Gefallenen neuen Mut zu geben. Ich gehe und schaue mir die jungen Ärzte an. Vielleicht ist einer unter ihnen, der unseren hohen Maßstäben entspricht.“ Die Oberin fühlte sich geschmeichelt. Plötzlich verschwanden ihre Gebrechen und ihr Haupt reckte sich zufrieden in die Höhe, während der Professor die Türe hinter sich schloss. Nun konnte sie sich wieder Gabriele widmen, welche von ihrer aufmunternden Art überrascht war.
„Sind auch Sie bereit, Ihre Aufgaben gewissenvoll zu erfüllen, Schwester Gabriele?“
„Gewiss, Mutter Oberin. Ich bin soweit. Doch gestatten Sie mir noch eine Frage.“
„Was bedrückt Sie?“
„Ich weiß, es ist vermessen, aber ich möchte Sie bitten, mich am Weihnachtsabend für einige Stunden freizustellen.“ Viktoria wischte mit ihrer flachen Hand über den rauen Schreibtisch und flüsterte: „Wie lange waren Sie nicht mehr zu Hause?“
„Seit über zwei Jahren, Mutter Oberin. Ich möchte wissen, wie es meinen Eltern, Geschwistern und deren Kindern geht.“
Die Mutter Oberin sah sich um, nahm Gabriele bei der Hand und zog sie an sich heran.
„Nach der Weihnachtsandacht ist es Ihnen gestattet zu gehen. Aber sehen Sie zu, dass es nicht nach Mitternacht wird.“
„Vielen Dank. Sie wissen nicht, welches Geschenk Sie mir damit machen.“
„Diese Vereinbarung bleibt unter uns, Schwester Gabriele. Nun kommen Sie zu mir und ich berichte Ihnen vor der Spätschicht über die gesundheitlichen Zustände der Patienten.“ Viktoria schlug das Buch auf und fuhr mit ihrem schmalen Finger über die einzelnen Namen.
„Heute Nacht wurde Frau Mia Fichtner mit starkem Husten und Schmerzen in der Brust eingeliefert. Professor Gross ist der Meinung, es handle sich um eine Lungenentzündung. Gestern Abend kam Gustav Klein. Er hatte einen Arbeitsunfall im Stahlwerk. Sein rechter Arm ist stark verbrannt. Er erhält Schmerzmittel und kalte Umschläge.“ Der Blick der Oberin wurde ernst und Sorgenfalten bildeten sich auf ihrer Stirn.
„Unsere neueste Patientin ist die kleine Gudrun Moorbacher. Neun Jahre alt. Sie wurde von ihrer Mutter gebracht. Ihr starkes Fieber bereitet uns Kopfzerbrechen. Über Nacht stieg ihre Temperatur von achtunddreißig auf knapp vierzig Grad. Ihr gilt unser Augenmerk ganz besonders. Sie müssen das Mädchen abkühlen. Neben ihrem Bett steht kaltes Wasser, das permanent gewechselt werden muss. Dokumentieren Sie Puls und Temperatur. Falls diese über vierzig steigt, rufen Sie Professor Gross.“
„Jawohl, Mutter Oberin. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht.“
„Davon bin ich überzeugt. Und denken Sie an den Brief. Ihre Eltern werden sich sorgen“, sprach Viktoria, stand auf und verschwand durch die Zimmertür des Schwesternbüros. Gabriele nahm die Waschschüssel, füllte sie mit kaltem Wasser und begab sich in den großen Saal. Als sie diesen betrat, war ein schmerzhaftes Stöhnen zu hören, welches durch Mark und Bein ging. Die Ordensschwester schob den grauen Vorhang zur Seite und sah Herrn Klein erschrocken an. Er schien die Zähne zu fletschen und zitterte am ganzen Körper. Seine dunklen Augen spiegelten den erfolglosen Kampf gegen die Pein wider und verzweifelt zischte der Stahlarbeiter Gabriele an: „Machen Sie etwas, dass diese brennenden Schmerzen aufhören.“
„Herr Klein. Ich bin nun da. Ich tue, was ich kann, um Ihnen zu helfen“, versuchte sie auf den dreißigjährigen Mann einzugehen und reichte ihm seine Pillen, welche er hastig hinunterschluckte. Gabriele nahm unter den Schreien des Patienten die Verbände ab und rang um Fassung. Die Haut war aufgedunsen und zwischen den rotschwarzen Blasen schimmerte das rohe Fleisch. Sie tauchte das Tuch in kaltes Wasser und legte es auf den verbrannten Arm. Gustavs Stöhnen wurde leiser und er sank erschöpft in die Kissen zurück, während Schweißperlen über sein Gesicht liefen.
„Es tut mir leid, Schwester. Ich habe Angst. Angst meinen Arm zu verlieren.“
„Sind Sie ein gläubiger Mensch, Herr Klein?“, fragte Gabriele und maß seinen Puls.
„Jeden Sonntag besuche ich die Messe.“
„Dann brauchen Sie sich vor nichts zu fürchten, denn unser Herr legt seine schützende Hand über die Häupter seiner Schafe.“ Diese Sätze spendeten ihm Trost, wenn auch nur für wenige Sekunden.
„Glauben Sie, dass ich meinen Arm behalten werde?“ Ratlos wandte sie ihren Blick ab und schwieg einen kurzen Moment. Gerne hätte sie dem Arbeiter Mut gemacht, jedoch ließ die Schwere der Verbrennungen nur einen Schluss zu.
„Verlieren Sie nicht den Mut. Ich komme in einer halben Stunde wieder und sehe nach Ihnen.“ Gustav nickte und als die Schmerzmittel zu wirken begannen, lächelte er sie erleichtert an.
„Ich glaube, dass Sie noch andere zu versorgen haben.“
„Ein kleines Mädchen mit hohem Fieber.“ Entschlossen antwortete er: „Was machen Sie dann noch hier? Kümmern Sie sich um die Kleine. Ihr junges Leben ist wichtiger, als mein Arm.“ Beeindruckt von der Nächstenliebe und Selbstlosigkeit nahm Gabi das Stück Kreide und schrieb die Puls- und Temperaturwerte auf die große Schiefertafel, welche über dem Kopfende des Bettes hing. Kaum hatte sie sich von ihrem Patienten abgewandt, schrie eine grelle Frauenstimme durch den Saal.
„Hilfe!“, tönte es donnernd und der Schrei brach sich an den hohen Decken. Gabriele ließ alles stehen und liegen. Sie stürmte los und riss den Vorhang des ersten Bettes zur Seite.
Dort saß Frau Moorbacher auf einem schlichten Holzstuhl und umfasste die zarte Hand ihrer kleinen Tochter. Tränen liefen über ihre Wangen und tränkten ihr geblümtes Kleid. Sie war nicht älter als vierzig, doch ihre grauen Schläfen zeugten von der Schwere ihres alltäglichen Lebens.
„Sie atmet so schwer“, sprach sie aufgeregt und sah Gabriele flehend an. Die Schwester öffnete die schweren Lider der kleinen Gudrun und fühlte gleichzeitig ihren Puls. Die Augen der Neunjährigen wirkten leer, als könnte man tief in ihre Seele blicken. Plötzlich schallten die hämmernden, dumpfen Schläge der Rüttelmaschinen durch den Saal und brachten selbst die Scheiben zum Vibrieren. Die junge Schwester biss auf die Zähne und legte ihre kühle Hand auf Gudruns glühende Stirn. Frau Moorbacher schrak zurück, die Hände fest zum Gebet gefaltet. Unter Tränen flehte sie: „Helfen Sie meiner Kleinen. Sie ist das einzige Kind, welches mir noch geblieben ist.“ Gabriele versuchte Ruhe zu bewahren, legte ein kaltes Tuch auf Gudruns Stirn und versorgte sie mit Wadenwickeln. Wie im Rausch, ging sie ihrer Arbeit nach, bis sie die Stimme von Professor Gross vernahm.
„Nun betreten Sie unseren Hauptbereich, Doktor Trautmann. Hier werden hauptsächlich Patienten betreut, welche über Fieber, Bauchschmerzen und andere Beschwerden klagen.“
„Professor Gross!“, brüllte die Schwester geistesgegenwärtig und bat die Mutter ihn an Gudruns Bett zu bringen. Trautmann hatte das Gefühl sich beweisen zu müssen und riss den Vorhang zur Seite.
„Um Gottes Willen“, flüsterte Gross erschrocken und blieb einen Augenblick wie gelähmt stehen. Sein junger Kollege hingegen machte unerschrocken ein paar Schritte nach vorn, nahm sein Stethoskop und horchte das Mädchen ab.
„Wie hoch ist ihre Temperatur?“, fragte der junge Mediziner und schaute sie ernst, dennoch wohlwollend an.
„Einundvierzig Grad.“ Professor Gross beobachtete das Vorgehen des Arztes und gleichwohl er sich Sorgen um das Leben Gudruns machte, stand er mit verschränkten Armen in der Ecke.
„Kühlen Sie sie weiter, Schwester. Wir müssen das Fieber senken.“ Trautmann wandte sich der Mutter zu und seine Miene wurde ernst. „Wie lange leidet sie schon unter diesem hohen Fieber?“ Sie verschränkte die Arme vor ihrem Oberkörper und flüsterte angsterfüllt: „Seit fast einer Woche. Wir dachten, es würde schon vorrübergehen. Doch als es über Nacht schlimmer wurde, brachten wir sie sofort zu Ihnen.“ Der junge Doktor strich sich nachdenklich über seinen braunen Dreitagebart und fuhr seelenruhig fort: „Sind Sie zu Hause für die Zubereitung der Speisen verantwortlich?“
„Natürlich. Mein Mann arbeitet den ganzen Tag und ohne Gudruns Hilfe, käme ich mit der Haushaltsführung nicht mehr zurecht.“
„Waschen Sie sich nicht regelmäßig die Hände, Frau Moorbacher?“
Die Mutter fühlte sich angegriffen und gab sich größte Mühe es zu leugnen. Franz Trautmann durchschaute sie und konterte mit den ihm ersichtlichen Tatsachen: „Ihre Tochter leidet unter Typhus im fortgeschrittenen Stadium. Es kann durch ungewaschene Hände und verunreinigtes Wasser ausbrechen.“ Weinend hielt sich Frau Moorbacher die Hände vor den Mund und Tränen der Verzweiflung liefen über ihr geschocktes Gesicht.
„Was können wir tun?“, fragte sie.
„Wir müssen das Fieber senken und ihr Antibiotika verabreichen.“ Gross war außer sich und mischte sich voller Entrüstung ein.
„Wollen Sie etwa das Leben der Kleinen gefährden, indem sie auf einen solchen Hokuspokus vertrauen?“
„Das will ich! Ich habe die Schriften von Bartolomeo Gosio studiert und kenne die Zusammensetzung seines Medikaments.“
„Ich werde nicht dulden, dass sie fadenscheinige Experimente durchführen, Doktor Trautmann. Ich werde es außerdem in ihren Unterlagen vermerken.“ Unbeirrt trat der junge Mediziner an ihn heran und wies entschlossen auf das Mädchen, dessen Zustand sich drastisch verschlechterte.
„Geben Sie mir eine Chance, Professor Gross. Ich weiß, dass ich ihr Leben retten kann. Wenn wir weiterhin nur abwarten, wird sie den morgigen Tag nicht überleben.“ Bettelnd um ihre Zustimmung, schaute er Frau Moorbacher an.
„Ich bin einverstanden. Retten Sie das Leben meiner geliebten Tochter.“ Gabriele erneuerte die Wickel, während der Professor skeptisch zusah, wie sein junger Kollege hastig den Raum verließ.
„Trotz des Engagements von Doktor Trautmann würde ich Ihnen raten, den Priester aufzusuchen.“ Fassungslos stand die Mutter da und konnte nicht glauben, was er ihr unterbreitete.
„Ich habe Vertrauen in Gott und diesen jungen Mann, der alles dafür tut, dass meine Gudrun überlebt. Wenn es keine Möglichkeit mehr gibt, habe ich noch genügend Zeit mich an unseren Heiland zu wenden.“
„Es ist Ihre Entscheidung. Wir werden die nächste Nacht abwarten.“ In seiner Ehre gekränkt, ging er aus dem Saal und schloss die Tür leise hinter sich.
„Glauben Sie, dass ich das Richtige getan habe?“, fragte die besorgte Mutter und strich sich nervös über den Arm. Gabriele empfand Mitleid für sie und versuchte der Frau neue Hoffnung zu schenken.
„Haben Sie Vertrauen in unseren Heiland. Er wird seine schützende Hand über Ihre Tochter halten. Der Glaube ist alles was uns aufrechthält. Gehen Sie in die Kapelle und beten Sie. Ich bleibe bei ihr, bis meine Schicht zu Ende ist.“
„Ich danke Ihnen, Schwester Gabriele. Sie sind ein wahrer Engel.“ Frau Moorbacher wischte sich die Tränen mit einem weißen Taschentuch ab und machte sich auf den Weg zu Pfarrer Krüger. Gross stand indessen vor der Tür und lauschte.
Trautmann ist einfach zu unerfahren. Ich hoffe nur, dass er das Mädchen nicht umbringt. Wie kann er sich nur über meine Anweisungen hinwegsetzen? Eine Unverschämtheit. Aus dem Schwesternbüro drang ein lautes Scheppern an ihn heran und Gross machte die Pforte voller Neugier einen Spalt auf. Der junge Mediziner hatte sich den Holztisch zurechtgestellt und schloss unter einem lauten Klacken des Schlüssels den mit milchglasversehenen Medikamentenschrank auf. Sein Blick wanderte aufgeregt über die einzelnen, dunkelbraunen Glasbehälter. Der Dreißigjährige starrte auf die Gefäße und erinnerte sich an die Zusammensetzung. Dies benötige ich, das und das auch. Trautmann griff zu Mörser und Stößel und vermischte verschiedene Elemente. Währenddessen schaute Gabriele im großen Saal permanent auf die Uhr und wechselte alle zehn Minuten die Wickel. Lieber Gott, steh der Kleinen bei. Sie hat noch ihr gesamtes Leben vor sich. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name…
Ihre ganze Aufmerksamkeit galt der Neunjährigen und sie blendete den Radau, welcher von der Baustelle zu ihnen drang, komplett aus. Stunden vergingen und als die Sonne sich allmählich hinter den dunklen Nachtwolken versteckte, kam Doktor Trautmann endlich zurück. In seiner Hand hielt er ein Gefäß, welches mit weißem Pulver gefüllt war. Er schaute die Schwester erschöpft an und lächelte zuversichtlich.
„Hier. Es hat länger gedauert, als ich dachte.“ Gabriele nahm den Becher und fragte: „Wie sollen wir es verabreichen?“
„Dreimal täglich einen Löffel. Geben Sie ihr viel zu trinken.“ Sie nickte und verabreichte Gudrun die Medizin.
„Erwähnen Sie die Medikation unbedingt bei der Übergabe. Das Antibiotika muss zu festen Zeiten verabreicht werden.“
„Gewiss, Herr Doktor Trautmann.“
„Sie dürfen mich Manfred nennen.“
Die Glocke schlug Zehn, als Gabriele die Nachtschwestern endlich eingewiesen hatte und erschlagen von den Ereignissen die breite Treppe hinunterschritt. Zum ersten Mal in ihrem Leben dachte sie über ihre Zukunft nach. Ohne etwas zu essen, betrat die junge Frau das Schlafzimmer.
Maria schlief bereits und lag, eingerollt in ihre Decke, mit dem Gesicht zur nackten Wand. Gabriele setzte sich auf ihr Bett, nahm einen Bogen Papier aus dem kleinen Schreibtisch, welcher zwischen den Betten stand, und ignorierte ihren knurrenden Magen. Vorsichtig zündete sie die Kerze an und versuchte ihre Gedanken verständlich niederzuschreiben.
Liebste Mama, liebster Papa,
es tut mir in der Seele weh, dass ich mich jetzt erst bei euch melde. Ich bin nun im Krankenhaus von Saarlouis tätig. Wie geht es euch? Und wie geht es meinen Geschwistern? Ich vermisse euch und seit mehr als zwei Jahren ist Weihnachten ohne meine Familie wie ein Stich ins Herz. Doch ich werde zum Fest bei euch sein. Ich habe mit der Mutter Oberin gesprochen und sie ist einverstanden. Mein Leben hier ist bescheiden, aber ich möchte nicht klagen. Ich habe ein gutes Verhältnis zu den Patienten und ich kann an ihren Gesichtern sehen, wie gern sie von mir versorgt werden. Doch es gibt auch Tiefschläge. Vor wenigen Wochen hatte ich einen Patienten, der mir sehr ans Herz gewachsen war. Obwohl er nicht wie Papa aussah, erinnerte er mich an ihn. Er wurde wegen Atemnot zu uns gebracht und erholte sich schnell. Doch Anfang November verschlechterte sich sein Zustand und er verstarb einen Tag später. Ich konnte mich nicht einmal von ihm verabschieden. Immer, wenn ich die Augen schließe, sehe ich sein Gesicht und er scheint mir Trost spenden zu wollen. Jeden Abend, wenn ich zu Bett gehe, bete ich für ihn und bin mir sicher, dass er nun an einem besseren Ort ist. Nun betreue ich ein junges Mädchen. Ihr Name ist Gudrun und sie ist wirklich süß. Auch sie kämpft um ihr Leben und ich gebe mein Bestes, dass sie bald wieder herumtollen kann. Ich weiß, ich sollte einen professionellen Abstand zu den Menschen haben. Aber wenn ich in die traurigen Mienen der Angehörigen schaue und mit welcher Freundlichkeit, Dankbarkeit und Liebe mir die Patienten entgegentreten, sehe ich mich in meiner Arbeit bestätigt. Schreibt mir bitte, denn ich möchte trotz der Entfernung weiterhin ein Teil der Familie sein. Ich liebe und küsse Euch,
Gabriele
Sie faltete den Brief, steckte ihn in einen Umschlag und versah ihn mit einer Briefmarke.
„Was machst du noch so spät?“, fragte Maria schlaftrunken und rieb sich die Augen.
„Nichts. Ich werde nun auch schlafen gehen.“
„Hast du noch eine Kleinigkeit gegessen?“, erkundigte sich Maria sorgenvoll und vernahm das laute Knurren von Gabrielles Magen.
„Bis zum Frühstück ist es nicht mehr lang.“ Maria drehte sich zur Seite und schlief weiter, während Gabriele das Licht losch und endlich zur Ruhe kam. Als der nächste Morgen anbrach, schraken die beiden in die Höhe. Ihre Herzen pochten und erneut hielten sie sich die Ohren zu. Die Bauarbeiten waren wieder in vollem Gange und zwischen den nervenzerreißenden Lauten der Maschinen, war das Gebrüll des Vorarbeiters zu vernehmen. Erschöpft standen sie auf und machten sich bereit diesem neuen Tag wohlwollend zu begegnen. An diesem Morgen hatten sie Küchendienst, halfen der Köchin beim Abspülen und der Zubereitung des Mittagsgerichts. Als sie die prunkvollen Stufen zu ihrem Arbeitsplatz hinaufschritten, kam ihnen Schwester Margarete aufgeregt entgegen. Sie hatte Tränen der Freude in den Augen und ein breites Lächeln zierte ihr Gesicht. Schwer atmend nahm sie ihre Kolleginnen bei den Händen und sagte: „Sie hat es geschafft.“
„Wer hat was geschafft?“, fragte Gabriele irritiert.
„Gudrun. Sie ist aufgewacht und hat schon ein wenig Suppe zu sich genommen.“ Gabriele faltete die Hände und betete vor Glück: „Dank sei dir, oh Herr, denn du hast mich erhört.“ Sie bekreuzigte sich und betrat zusammen mit Margarete den großen Saal. Mutter Viktoria beobachtete Gudrun voller Freude und Erleichterung, doch Professor Gross vermochte es nicht ihre Gefühle zu teilen. Er verschränkte die Arme schützend vor seiner Brust und murmelte: „Anfängerglück, wenn ich es Ihnen sage.“
„Die Hauptsache ist, dass Doktor Trautmanns Therapie erfolgreich war, Professor Gross“, antwortete die Oberin mit tiefer, doch zufriedener Stimme.
„Was geschieht nur, wenn die althergebrachte Medizin nichts mehr wert ist?“
„Wir befinden uns in einer Zeit des Wandels. Geben Sie den jungen Ärzten eine Chance. Sie haben neue Ideen und Verfahren, die zum Wohle unserer Mitmenschen beitragen. Dies sollten wir nicht verteufeln, sondern zusammen mit ihnen wachsen und die Erfahrungen und Fähigkeiten teilen. Wir tun es nicht für uns, sondern für die Kranken, welche den Beistand Gottes und unsere Hilfe benötigen.“ Ernst beäugte Gross den jungen Arzt, der euphorisch und voller Elan, nach einem kurzen Gruß, in einem der Behandlungsräume verschwand.
„Wenn Sie meinen, dass ich mich öffnen soll, so werde ich dies tun.“
Die beiden Oberen verabschiedeten sich wortlos voneinander, respektvoll und wissend, dass sie an einem Strang zogen. Eine weitere Woche verging und der Garten vor dem Anwesen verbarg sich unter einer dünnen, weißen Schicht. Das warme Rot des Himmels war einem tiefen Grau gewichen. Der Wind wehte stark vom Osten her und starke Böen machten es schwer einen tiefen Atemzug zu nehmen, ohne den Eindruck zu bekommen, dass einem die Lungen vereisten. Die Arbeiten wurden über die Wintermonate eingestellt, da man befürchtete, die frisch gemörtelten Steine könnten Schaden nehmen. Endlich machte sich wieder Ruhe und Frieden breit und das Weihnachtsfest stand bevor. Pfarrer Krüger versuchte Blumengebinde, frische Tannenzweige und einen voluminösen Baum zu erwerben. Gross verpflichtete weitere Fachärzte und bereitete diese auf ihre schwierigen Fälle vor. Das Leben im Hospital glich einem Ameisenbau. Von außen gesehen schien es ein heilloses Durcheinander zu sein, doch unter Viktorias Leitung machte sich das Haus im gesamten Umkreis einen guten Namen.
So brach der Morgen des 23. Dezember 1913 an. Gabriele half der noch schwachen, aber genesenen Gudrun in ihre Kleidung und überzog das Bett mit frischen Laken. Es begann zu schneien und erste dicke Flocken setzten sich auf die riesige Scheibe.
„Es sieht aus, als würden kleine Geister umherirren“, sprach die Kleine und umarmte Gabrieles Taille. Überrascht über ihre Offenheit und kindliche Fantasie strich sie ihr über das Haar und flüsterte: „Es sind gefrorene Tränen, welche für die Menschen gedacht sind, die von uns gegangen sind.“ Gudruns Umarmung wurde fester und sie presste ihren Körper an Gudruns Schoss.
„Wenn du nicht gewesen wärst, würden solche Tränen als Schneeflocken für mich zu Boden sinken.“ Der Schwester stockte der Atem. Gerührt von diesen Worten erwiderte sie: „Du solltest Doktor Trautmann in den Arm nehmen. Er ist dein wahrer Lebensretter.“ Das Mädchen lächelte sie an und nickte, während ihre Mutter den Vorhang zur Seite zog.
„Frau Moorbacher, ihre süße Tochter ist wohl auf.“
„Mama!“, rief Gudrun überglücklich und fiel ihr um den Hals.
„Ich möchte Ihnen danken, Schwester. Sie haben sich Tag und Nacht um meine Kleine gekümmert.“ Sie griff in ihre selbstgenähte Handtasche und zog ein paar Münzen heraus.
„Hier. Das ist für ihre Mühen.“ Gabriele war peinlich berührt.
„Frau Moorbacher, Sie brauchen uns keinen Obolus zu geben. Jeder war um die Gesundheit des Mädchens stets bemüht und den Erfolg zu sehen, ist uns mehr wert, als alles Geld der Welt.“ Die beiden Frauen verabschiedeten sich in aller Stille und gemeinsam mit ihrer Mutter, machte Gudrun sich auf den Heimweg. Als Gabriele die schmutzige Wäsche hinausbrachte, beobachtete sie, wie Doktor Trautmann auf den Knien lag und Gudrun liebevoll in den Arm nahm.
Ich wünsche dir ein frohes Weihnachtsfest, meine kleine Gudrun, dachte Gabriele und machte sich wieder an ihre Arbeit. Am folgenden Abend hüllte sich die Landschaft in eine sanfte, weiße Schneedecke und es wirkte, als hätte ein Bäcker sie mit Puderzucker bestäubt.
Die Glocken der Kirche läuteten in monotonem Takt und die Ordensschwestern, Ärzte, das Küchenpersonal und ein jeder der Belegschaft nahm auf den Bänken Platz. Der gesamte Innenraum war geschmückt. Vor dem steinernen Altar stand ein kleiner, hölzerner Stall mit einer Krippe und Tannenzweige zierten seine Umgebung. Im flackernden Kerzenschein erschien Pfarrer Krüger, reckte seine Hände in die Höhe und hielt seine Ansprache, während seine Messdiener mit dem schwingenden Weihrauchfass die Reihen abgingen. Im ganzen Gotteshaus herrschte eine friedliche Stille.
„Meine lieben Schwestern und Brüder. Heute ist der Tag, an welchem wir die Geburt unseres Erlösers feiern. Jesus Christus, der du bist im Himmel. Lasst uns ihm huldigen und seinen Ehrentag begehen.“ Er bekreuzigte sich voller Demut und der Klang der Orgel verlieh der Messe eine warme Stimmung. Nach einigen Psalmen, Gesängen und Predigten, verteilte Pfarrer Krüger den „Leib Christi“. Gabriele konnte das Ende der Zeremonie nicht erwarten. Sie freute sich auf ihre Familie und nach so langer Zeit endlich ihre Nichten und Neffen in die Arme zu schließen.
„Gehet hin in Frieden. Der Herr sei mit euch.“ Gabriele sprang auf, kniete im breiten Gang nieder und nahm ihren Wintermantel vom Haken nahe dem Ausgang, während sich die anderen Gäste den Weg hinaus in die kalte Winternacht bahnten.
„Was hast du vor?“ Es war Maria, welche plötzlich hinter ihr stand. Gabriele packte sie am Ärmel und nahm sie zur Seite.
„Ich bin auf dem Weg zu meiner Familie.“
„Wenn die Mutter Oberin das erfährt, wirst du nicht ohne eine Strafe davonkommen.“
„Sie weiß Bescheid. Sie hat mir die Erlaubnis erteilt.“
„Das ist eine feine Geste. Du hast es verdient.“ Maria sah sich um und schob Gabriele unbemerkt aus der Pforte.
„Lauf. Ich gebe Acht, dass unsere Kolleginnen keinen Verdacht schöpfen.“ Die junge Schwester rannte los und die Dunkelheit schien sie zu verschlingen.
„Ich glaube nicht, dass sie noch kommt“, wisperte Fritz Meschenbier leise und schaute in das helle Licht, welches der Vollmond durch das Fenster warf. Seine Frau Anna legte tröstend ihre feine Hand auf seine Schulter und sprach: „Sie kommt, mein Lieber. Sie hat es uns versprochen.“
„Wir hätten ihr diese Bürde nicht auferlegen dürfen. Es war nicht recht.“
„Großvater, wann ist endlich Bescherung?“, fragte der kleine Harald und sprang Fritz mit einem herzhaften Lachen auf den Schoß.
„Nach dem Essen. Geh noch etwas spielen.“
Während der Kleine im Wohnzimmer verschwand, versank Fritz in Gedanken. Nacheinander stellte seine Frau die Schüsseln gefüllt mit Fleisch, Soße, Gemüse und selbstgeernteten Kartoffeln auf den Tisch. Anna schaute bedrückt auf die Uhr und sah jegliche Hoffnung, ihre Tochter wiederzusehen, schwinden. Sie trug es mit Fassung und ging in das Wohnzimmer, wo all ihre Kinder, Enkel und Enkelinnen um den Weihnachtsbaum saßen.
„Kommt. Das Essen ist fertig“, rief sie um den Lärm der Kinder zu übertönen. Gabrieles Geschwister waren nicht in Feierlaune. Ihr Bruder Emil sah seine Mutter fragend an. Auch seine Augen waren blau und blondes Haar bedeckte seine Stirn. Er stellte sein Weinglas auf einen kleinen Beistelltisch.
„Wo ist Gabriele? Ich will nicht mehr ohne sie feiern“, raunte er enttäuscht und starrte auf die Standuhr. Es war bereits halb neun. Plötzlich schellte es unerwartet an der Tür und die Familie tauschte hoffnungsvolle Blicke aus. Anna öffnete vorsichtig die Pforte und erkannte die Silhouette ihrer geliebten Tochter, welche sie liebevoll begrüßte: „Mama.“
Anna konnte ihre Freudentränen kaum zurückhalten und drehte sich zu den anderen um.
„Gabriele. Sie ist da!“, rief ihre Mutter durch das gesamte Haus und nacheinander stürmten alle Geschwister auf sie zu. Jeder wollte der Erste sein und nachdem sie ihren Vater liebevoll in die Arme geschlossen hatte, ließ sie jegliche Bedenken hinter sich. Dieser Abend gehört nur mir und meiner Familie. Gabriele genoss das Zusammensein mit ihren Angehörigen, die sie so lange vermisst hatte. Sie lachte, hatte größte Freude, spielte mit ihren Nichten und Neffen und war, wenigstens für einen Abend, nicht mehr Ordensschwester, sondern eine einfache junge Frau, die sich in den Schoss ihrer Familie flüchtete.
III
„Gabriele?“, flüsterte Maria und weckte sie durch ein leichtes Rütteln aus ihren Träumen.
Die ersten Sonnenstrahlen des 30. Mai 1914 brachen sich in der kleinen Fensterscheibe des gemeinsamen Schlafzimmers und wärmten die kahlen Wände. Gabriele lauschte dem Gesang der Schwalben und Amseln, die aus dem Süden zurückgekehrt waren und versteckt in dem frischen Grün der Laubbäume ihre Nester bauten.
„Willst du mich heute in die Stadt begleiten?“ Gabriele rieb sich den Schlaf aus den Augen und fragte: „Wie spät ist es denn?“
„Kurz vor Sechs.“
„Wie kommst du darauf nach Saarlouis zu gehen?“, wollte die Zwanzigjährige erfahren, während sie ihre Decke zur Seite warf und sich auf die Bettkante setzte.
„Heute ist unser freier Tag und ich möchte mich mal wieder unter die Bevölkerung mischen, das wahre Leben genießen, Düfte wahrnehmen und Gesprächen der Leute lauschen.“
„Hast du es mit der Mutter Oberin besprochen?“
„Sie erlaubt es nur, wenn du mich begleitest.“ Flehend schaute Maria ihre Freundin an, kniete vor ihr nieder und umfasste ihre Hände.
„Also schön. Ich komme mit.“ Gabriele stand auf, wusch sich und zog ihre schwarze Nonnentracht an. Nach dem Frühstück läutete Pfarrer Krüger zur Morgenmesse