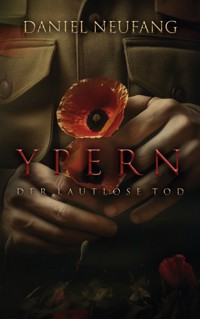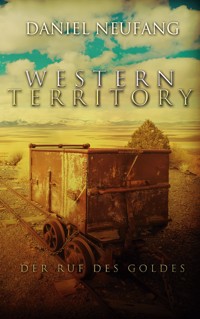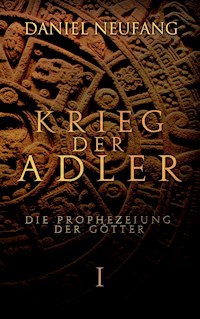Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1873. Die Benoits besitzen einen Bauernhof in Fleury-devant-Douaumont, einem idyllischen Dorf in den Hügeln vor Verdun, Frankreich. Ihr Leben ist geprägt von harter Arbeit und unvorhersehbaren Schicksalsschlägen. Als der Bauer Paul Benoit bei einem tragischen Unfall stirbt, tritt dessen Sohn Gilbert in seine Fußstapfen. Gemeinsam mit seinen Söhnen Romain und Charles versucht er mit aller Kraft, den Hof in Zeiten der industriellen Revolution auszubauen. Doch alle Zeichen stehen zur Jahrhundertwende auf Sturm. 1914 ziehen Charles und Romain, angetrieben von dem Patriotismus der jungen Männer ihrer Zeit und geleitet von falschen Versprechungen, in den Krieg. Für ihre Familien und sie selbst beginnt die härteste Prüfung ihres Lebens. Die Schlacht um die Stadt von Verdun breitet sich rasend schnell aus, wie ein Lauffeuer, welches keiner aufzuhalten vermag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 864
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1873. Die Benoits besitzen einen Bauernhof in Fleurydevant-Douaumont, einem idyllischen Dorf in den Hügeln vor Verdun, Frankreich. Ihr Leben ist geprägt von harter Arbeit und unvorhersehbaren Schicksalsschlägen. Als der Bauer Paul Benoit bei einem tragischen Unfall stirbt, tritt dessen Sohn Gilbert in seine Fußstapfen. Gemeinsam mit seinen Söhnen Romain und Charles versucht er mit aller Kraft den Hof in Zeiten der industriellen Revolution auszubauen. Doch alle Zeichen stehen zur Jahrhundertwende auf Sturm.
1914 ziehen Charles und Romain, angetrieben von dem Patriotismus der jungen Männer ihrer Zeit und geleitet von falschen Versprechungen in den Krieg. Für ihre Familien und sie selbst beginnt die härteste Prüfung ihres Lebens. Die Schlacht um die Stadt von Verdun breitet sich rasend schnell aus, wie ein Lauffeuer, welches keiner aufzuhalten vermag.
In Gedenken an die Opfer
des Ersten Weltkrieges
1914 - 1918
Wider das Vergessen
Inhaltsverzeichnis
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
1. Kapitel
Es war der Spätsommer im Jahre 1916. Die Hügel vor der Bischhofsstadt Verdun standen in Flammen. Wo sich einst blühende Felder und tiefe Wälder erstreckten, war nur noch Ödnis zu erblicken. Die Krater der Granateneinschläge durchzogen die Gegend und kein grünes Pflänzchen durchdrang den nackten, toten Boden. Es schien, als hätte Gott seine schützende Hand von diesem Flecken Erde genommen. Die französische Armee hatte den Gegenangriff begonnen und zwischen den Stacheldrähten und den beißenden Rauchschwaden bezogen sie erneut ihre Positionen.
„Hast du genügend Stabgranaten bei dir?“, fragte Bauer Romain Benoit seinen Waffenbruder Dominique Carras, der an seine Umhängetasche griff.
„Ich habe zwölf.“
„Ich hoffe, dass sie reichen werden. Bete, dass wir den heutigen Tag überstehen!“ Der Schuster Carras bekreuzigte sich und betete das Vater Unser.
Der Zug der Marschkolonne setzte sich in Bewegung. Romain sah nochmals nach Westen, in die Richtung seines Heimatortes Fleury und ein Gefühl durchzog seinen Körper, als würde ihm jemand die Kehle zuschnüren. Im Stechschritt durchquerten sie die Ebene des Schlachtfeldes, bis sie die Gräben am Ravin des Fontaines erreichten. Hastig stürzten die französischen Soldaten in die Stellungen und gingen in Kampfformation. Romain Benoit warf einen kurzen Blick über den Grabenrand. Die einst so saftig grüne Landschaft war zu einem riesigen kargen Friedhof geworden. Die Leichen deutscher wie auch französischer Soldaten lagen neben- und übereinander. Hier und dort gestapelt wie Vieh, um die Gräben von ihrem grässlichen Gestank zu befreien. Verbunden in demselben Schicksal, welches sie erleiden mussten. Ein bedauerndes Lächeln stahl sich auf Benoits Gesicht, während er den Kopf senkte.
Im Tod sind wir doch alle gleich. Die Schmerzen, die Angst. Die Gedanken an die Familien und ein letztes Mal um Vergebung der Sünden bettelnd, finden wir zu guter Letzt alle unseren Frieden. Unter anderen Umständen wären wahrscheinlich einige tapfere deutsche Soldaten unsere Freunde geworden. Wie kann es im Sinne unseres Heilands sein, ein solches Schlachtfest zu vollziehen, aus dem keiner einen Gewinn trägt?
Fest schloss Romain Benoit seine Augen für einen kurzen Moment und lud seinen Karabiner durch. Er verdrängte die Gedanken des Mitgefühls und nahm das Schlachtfeld ins Visier.
„Bist du bereit, Dominique?“
„Oui, Romain.“ Schwer atmend und von Angst getrieben, hielt er die erste Stabhandgranate im Anschlag und begann leise zu zählen. Doch der Angriff ließ auf sich warten. Stunde um Stunde verging und die Anspannung unter den Soldaten wuchs. Romain drückte Carras sein Fernglas in die Hand und sagte in bestimmendem Ton: „Sag mir, wenn sich was tut. Ich ruhe mich einen Moment aus.“ So übernahm der einhändige Dominique die Wache und Benoit setzte sich in eine stille Ecke des Grabens. Das Licht der Abendsonne reichte noch, um einen weiteren Brief an seine Liebsten zu schreiben.
Meine geliebte Jacqueline,
ich hoffe, dass es euch allen gut geht und ihr keinen Groll gegen mich hegt. Im Lazarett habe ich von der Evakuierung erfahren. Ob unser Haus noch steht, vermag ich nicht zu sagen. Ich sah nur Rauch aufsteigen. Welche Torheit trieb uns an? Welche Blauäugigkeit ließ uns blindlinks ins Verderben stürzen? Meine liebe Frau, ich bin nicht mehr der, den du einst geheiratet hast. Dieser Krieg hat meine Seele vergiftet. Obwohl ich mir wünsche wieder bei euch zu sein, regt sich ein schlechtes Gefühl in meiner Magengrube. Ich denke, dass dies der letzte Brief ist, den ich euch schreiben werde. Ich hoffe du kannst mir vergeben. Sag Papa, dass ich auch ihn um seine Vergebung bitte. Denn nichts wäre schlimmer, als mit dem Wissen von dieser Welt zu gehen, dass ihr nicht zu mir steht. Ich bete zu Gott, dass euch dieser Brief eines Tages erreicht und ihr die Stärke habt euer Leben ohne mich weiterzuleben. Ich umarme dich und unsere liebe Tochter Cécile. Ich werde immer bei euch sein. Adieu, euer Romain
Als er diesen Brief geschrieben hatte, senkte sich die Sonne langsam in der Ferne, hinter den kalten Mauern von Verdun. Er sah die Rue Bar-le–Duc, auf welcher immer noch der Nachschub rollte. Wie ein schwarzer Faden zogen die Wagen und Truppen über die Straße. Er atmete tief durch und begann zu weinen. Noch nicht einmal ein Zug der klaren Luft ist mir vergönnt. Nur dieser ekelerregende Geruch. Merde! Wehmütig begab er sich wieder zu seinem Kameraden Dominique und hielt ihn am Arm fest. Sein Lächeln wirkte gequält und seine Augen strahlten Hoffnungslosigkeit aus.
„Lass mich nach deiner Wunde sehen.“ Er griff in seine Tasche, zog Desinfektionsmittel und einen frischen Verband hervor und tat seine Arbeit.
„Das musst du nicht tun, Romain“, flüsterte der Schuster leise und sah ihn dennoch dankbar an. Weitere Minuten vergingen, und als Benoit die Binde straff zog, sah er Carras flehend an.
„Kann ich dich um einen Gefallen bitten?“
„Was soll ich tun?“ Regungslos drückte Romain ihm die letzten Briefe in die Hand und starrte ins Leere.
„Gib diese Briefe meiner Frau oder gib sie in der Poststelle von Verdun ab. Ich spüre, dass dies meine letzten Tage sind.“ Dominique standen die Tränen in den Augen und wild schüttelte er den Kopf.
„Sprich nicht so, Romain! Ich will das nicht hören! Nicht noch ein Freund, den ich verliere!“ Benoit nahm ihn bei den Schultern und sagte: „Du bist der letzte Freund, den ich auf dieser Welt habe. Bitte enttäusche mich nicht.“
Er küsste den jungen Schuster aus dem Ort Limoges auf die Wange, nahm sein Gewehr und kroch auf seine Position, während Carras die Briefe in seine Brusttasche steckte. Um vier Uhr morgens wurden sie von einem höllischen Trommelfeuer überrascht, dass sich über Stunden hinzog. Bei jedem Augenzwinkern schlugen die Mörsergranaten in den Stellungen ein und in diesem Inferno sah sich Romain im Recht, dass sich sein Leben dem Ende näherte.
„Lauf! Dominique! Lauf!“, schrie er seinen Freund an und stieß ihn von sich fort. „Ich lass dich nicht alleine!“
„Geh! Hau ab! Rette dein Leben!“ Romain feuerte weiter auf die Deutschen, die wie eine biblische Heuschreckenplage über das verwüstete Land herfielen und trotzdem fand er die Zeit sich ein letztes Mal umzudrehen. „Lauf! Dominique! Um Himmels willen! Lauf!“ Panisch griff dieser an seine Brust, wo er die Briefe aufbewahrte, und schrie ihm zu: „Romain, Bruder! Ich gebe die Briefe deiner Familie! Versprochen!“ Er rannte los und der Boden vibrierte unter seinen schweren Stiefeln. Er lief einige hundert Meter, bis er aus der Reichweite der Geschütze war und atmete erschöpft durch. Der Himmel über den Stellungen stand in einem gleißenden Rot und einem weißlichen Gelb.
Gott möge bei dir sein, Romain Benoit. Hastig bekreuzigte er sich noch einmal und rannte mit geducktem Kopf weiter. Carras hörte ein lautes Pfeifen und während er sich umdrehte, riss ihn schon die Druckwelle einer explodierenden Mörsergranate nieder und ein heißes Brennen durchfuhr seinen Körper.
Es war ein herrlicher Sommertag im Jahr 1873. Die Landwirte im Gebiet Elsass-Lothringen strahlten, denn in diesem Jahr standen die Felder in solcher Blühte und keiner der ansässigen Bauern machte sich Gedanken über die politische Lage.
Der deutsch-französische Krieg war vorüber und man sehnte sich nach Frieden.
„Gilbert!“, hallte die laute, aufgeregte Stimme des Bauern Paul Benoit über die Weiten der Kornfelder. Hastig hob er die Hand, legte sie an seine Stirn, um sich im grellen Schein der Sommersonne Schatten zu spenden. Die Stirn lag in Falten und seine Augen waren zugekniffen. Nervosität durchfuhr seinen Körper und er schrie erneut: „Gilbert. Komm her!“
Wie ein Donnergrollen brüllte er über die Ebenen vor der Bischhofsstadt Verdun. Doch der junge Gilbert nahm die Worte seines Vaters nicht wahr. Fasziniert von dem Anblick der Wolken, die an ihm vorbeizogen, lag er im mannshohen Korn. Die weißen Figuren, die den hellblauen Himmel durchzogen, waren interessanter. Sie hatten die Formen von kleinen Schafen, großen Wagenrädern und Blättern, die von Bäumen rieselten. Hypnotisiert von diesem Anblick, überhörte er die besorgten Schreie seines Vaters und versank in seinen Gedanken. Die Ähren wehten sanft im Wind dieses schönen Julitages.
„Gilbert!“ Er öffnete seine Augen und sah in das besorgte Gesicht seines Vaters. Paul Benoit war ein einfacher Bauer aus Fleury, einem kleinen Ort nahe Verdun. Nichts war ihm so heilig wie seine Familie. Umso zorniger wurde er, als sich sein einziger Sohn nicht meldete.
„Warum gibst du mir keine Antwort, Gilbert?“ Ruckartig packte er ihn bei den Schultern und riss ihn mit der Kraft eines Bullen in die Höhe. Gilbert schaute ihn überrascht an.
Sein Atem war hastig, da er um die Strafe fürchtete, die ihn erwartete. Er blinzelte seinen Vater an und machte sich auf eine Tracht Prügel gefasst, obwohl Gilbert noch nie die Hiebe eines Gürtels spüren musste. Doch nichts geschah. Zwischen den im Wind wehenden Ähren ließ sich sein Vater auf die Knie sinken, packte ihn kräftig an den Armen und schaute ihn streng mit seinen strahlend blauen Augen an.
„Wenn ich dich rufe, hast du dich zu zeigen!“ Seine raue Stimme gellte über die Felder hinweg. Gilbert erschrak, denn noch nie war der Tonfall seines Vaters so besorgt gewesen.
Trotz der Sorge, die der junge Gilbert ihm bereitet hatte, drückte er ihn fest an seine Brust.
„Excuse-moi. Papa, excuse-moi.“
„Das will ich hoffen!“, flüsterte er seinem Sohn zu. „Du weißt was passieren kann, wenn du dich in den hohen Feldern versteckst.“
„Ja, Papa. Die Sense könnte mich treffen.“ Als Paul aufstand, wischte er sich schnell die Träne ab, die ihm über die kräftige Wange lief. Sein Sohn sollte ihn nicht weinen sehen. Jegliche Besorgnis und Angst wich aus seinem Blick und rasch nahm er seinen Sohn auf seine starken Schultern. Die Kinder, welche auf dem nahe gelegenen Grashügel spielten, lachten laut, als sie sahen wie Gilbert über die Kornwipfel zu schweben schien.
„Hast du Lust auf einen Schluck Wasser aus dem Brunnen bei dieser Hitze?“
„Oui, Papa.“ Bevor sie das Dorf betraten, wandte sich der Bauer noch einmal um. Mit dem Sprössling auf den Schultern bewunderte er die Schönheit der weiten Felder, hügeligen Landschaft und versetzt wachsenden Bäumen. Es war ein idyllischer Fleck auf dieser Erde, den er für nichts in der Welt verlassen würde. Sie taten noch ein paar Schritte, bis sie die kleine Seitenstraße erreichten, die an der Kirche vorüber in den Ortskern führte. Ein jeder Bürger von Fleury schien beschäftigt und es herrschte reges Treiben. Auf der linken Seite der Hauptstraße befand sich die Schmiede von Jean Sissez, durch dessen geöffnete Fenster man das laute Aufschlagen des Hammers auf den Amboss hören konnte. Gegenüber des kleinen Gemischtwarenhandels von Monsieur Hebert befand sich der kleine Brunnen, dessen kühles Wasser direkt aus dem Grund sprudelte. Es war eines der Wahrzeichen des Dorfes und daher hatten die Einwohner vor langer Zeit eine kleine Mauer darum errichtet. Daneben gab es einen Ablaufgraben, welcher zur Wäscherei führte, die nur wenige Meter davon entfernt lag. So hatte jeder etwas von der Quelle. An diesem Platz trafen sich die Kinder in den Sommermonaten zum Spielen.
„Geh nur Gilbert, während ich ein paar Kleinigkeiten für deine Mutter einkaufe.“ Paul wies mit dem Zeigefinger auf Heberts Laden. Gilbert nickte seinem Vater zu und überquerte mit kindlicher Leichtigkeit die Hauptstraße. Seine hochgekrempelte Hose wurde von den weiten abgetragenen Hosenträgern seines Vaters gehalten. Paul Benoit beobachtete, wie sein Sohn sich auf die Mauer setzte und verlegen zu der kleinen Josephine herübersah.
Mein Junge. Ein kleiner Schürzenjäger, dachte Paul und betrat den Gemischtwarenladen. Knarrend öffnete sich die alte, hölzerne Tür und schlug gegen eine kleine aus Guss gefertigte Glocke, die so grell läutete, dass man sie bis in den letzten Winkel des Hauses hören konnte. Neben dem Eingang stand eine alte Waage mit einer großen Schale aus Emaille. Hebert hatte alles was das Herz begehrte und bot es täglich frisch in großen Körben an. Salat, Tomaten, Kartoffeln, Getreide, Säcke mit Mehl und Obst befanden sich auf den großen Tischen, die inmitten des Ladens standen. In einer der hinteren Ecken, die selbst an diesen Sommertagen im Schatten lag, hingen gepökelte Schweinehälften und Räucherwurst. Am Ende des Raumes befand sich eine schmale Holztür, welche halb offen stand.
„J`arrive!“, hallte die laute, rauchige Stimme aus der Kühlkammer im hinteren Bereich und ein Kopf lugte hervor.
Heberts fragender Blick schweifte durch den Raum.
„Ah, Paul. Warte einen Augenblick.“ Er verschwand wieder hinter der Tür. Nur wenige Sekunden vergingen, ehe Hebert aus dem Raum und zu seiner Kasse stürmte. Hebert zog seine Brille auf, die er an einem Stück Schnur befestigt um den Hals trug.
„Lass dir Zeit, Hebert. Nicht, dass du deine Waren ruinierst. Außerdem solltest du die Gläser auf der Nase tragen und nicht um deinen Hals“, hielt Paul ihn an und konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen.
„Bonjour, Paul. Ja, ja. Ich weiß. So ein Kauz wie ich sollte sich nicht schämen eine Brille zu tragen“, antwortete der Gemischtwarenhändler und schaute lächelnd über den Rand seiner Sehhilfe.
„Aber die Damen mögen solche Dinge nicht.“ Beide begannen amüsiert zu lachen.
„Hebert, meine Frau braucht fünfzehn Eier, vier Tomaten und einen Salat.“
„Bist du zum Einkauf abkommandiert worden?“
„Ich habe heute früher mit der Feldarbeit aufgehört und...“ Hebert unterbrach ihn, während er grinsend die Eier in eine Papiertüte einwickelte.
„Brauchst mir nichts zu erzählen, Paul. Wenn sich jemand eine Verschnaufpause verdient hat, dann du.“ Paul beugte sich nah an seinen Freund heran und roch an dessen Kleidung.
„Rauchst du immer noch heimlich Zigarren in deiner Stube?“ Wie vom Blitz getroffen starrte Hebert ihn an. „Psssst! Nicht so laut! Stell dir vor was passiert, wenn Valerie dich hört.“
„Dann hast du wohl heute Abend nichts auf dem Teller?“
„Wenn du wüsstest, mein Freund. Dann könnte ich mich eine Woche aus meinem Laden verpflegen und auf dem Sofa schlafen.“ Plötzlich waren die Geräusche von Hufschlägen zu hören, doch nicht nur von einem, sondern von dutzenden Pferden. Neugierig schauten die beiden durch das große Schaufenster auf die Straße. Sämtliche Bürger kamen herbeigestürmt und bejubelten die Männer, die mit französischen Chansons auf den Lippen vorbeifuhren und ihre Mützen zum Gruß schwenkten. Die meisten Arbeiter mussten aufrecht auf den Pferdekarren stehen, da diese mittig mit Schaufeln, Spitzhacken und Rollen von Schnur beladen waren. Paul sah beunruhigt zu seinem Sohn hinüber und beobachtete dessen Bewunderung für diese Männer. Ein solcher Anblick war dem Jungen gänzlich fremd und seine braunen Augen strahlten vor Begeisterung.
„Jetzt bauen sie also doch dicht an Fleury vorbei“, flüsterte er leise und voller Skepsis.
„Du weißt genau, dass sie uns nicht fragen, Paul.“
„Diese Schmalspurbahn wird uns irgendwann Verderben bringen.“
„Es kann aber auch zu unserem Besten sein. Denk nur mal an die Möglichkeiten. Sie verbindet Verdun direkt mit Douaumont.“ Paul hatte sich jedoch seine Meinung schon gebildet. Nachdenklich nahm er seine Einkäufe in die schwieligen Hände und wollte gerade die Tür öffnen, als Pierre Simon den Laden betrat. Er war einer von Pauls Nachbarn und die beiden verstanden sich blendend.
„Bonjour, Paul. Salut, Hebert.“ Abwesend sah ihm Benoit ins Gesicht.
„Ich glaube du fragst besser Simon. Er hat mehr Ahnung von den Entscheidungen der Ortsregierung“, flüsterte Hebert. Interessiert schaute Pierre Simon seinen Freund an und sagte: „Oui, wenn ich helfen kann. Worum geht es denn?“ Soll ich Gilbert diesen Menschen weiter seine Bewunderung schenken lassen? Sie erinnern mich an die Soldaten, die vor einigen Jahren im Kampf gegen die Deutschen durch den Ort zogen.
Ehe er diese Gedankengänge beenden konnte, legte der hagere Simon seinen Arm um seine Schultern und zog ihn dezent in den Laden zurück. Die Türklingel ertönte erneut und sie schauten sich an.
„Simon, Paul macht sich Sorgen.“
„Um was denn?“, fragte Pierre Simon irritiert.
„Um die Bahntrasse.“
„Ja. Die Bahn. Sie wird jetzt doch gebaut. Die Gerätschaften und die Männer werden bereits dorthin gebracht“, antwortete Simon und wies mit seinem Zeigefinger den Arbeitskonvois hinterher, von denen die ersten langsam aus ihrer Sicht verschwanden. „Morgen erhalten wir deswegen Besuch aus Verdun.“ Paul drehte sich um und sah ihn ahnungslos an.
„Aus Verdun? Weswegen?“
„Soweit ich weiß, nimmt auch unser Bauwesenkontrolleur an der Besprechung teil. Sie wollen Land von uns erwerben, um ihre Bahn zu bauen.“
Der Schock saß tief bei dem einfachen Bauern und er legte die Tüten mit seinen Lebensmitteln wieder auf die Theke. Das Entsetzen wich schnell dem Zorn und der Wut darüber, dass er nicht gefragt wurde. Immerhin war er ein wichtiger Bürger dieses Ortes.
Seine Augen waren weit aufgerissen, während sein Körper zitterte.
„Land von dem Bisschen, was ich besitze? In diesem Jahr ist zwar die Ernte gut, aber was mache ich nächstes Jahr, wenn die Arbeiter mit Schaufeln und Picken über meine Felder ziehen und alles zerstören? Ich...“
Pierre unterbrach ihn und versuchte seinen Freund zu beruhigen. Er verstand dessen Ängste, wollte aber dem Fortschritt der Ortsvernetzung nicht im Wege stehen. Mit beiden Händen packte er Paul Benoit bei den Schultern und redete ihm zu: „Paul, wir alle müssen zum Wohle Frankreichs und unserer Region Opfer bringen.“
„Erklär das meiner Marie und meinem Sohn, wenn sie hungernd am Tisch sitzen!“, zischte Benoit ihn an und seine Enttäuschung über den Standpunkt seiner besten Freunde konnte er nicht länger verbergen. Hebert verstand die Meinung von Pierre Simon, aber auch die von Paul. Hin- und hergerissen begann selbst der wortgewandte Geschäftsmann zu stottern.
„Ich, ich denke, du wirst nichts dagegen tun können, Paul, wie wir alle. Denn sonst zwingt dich der Staat Land abzutreten.“ Pauls Atem beschleunigte sich. Nichts sollte ihn in seinem Leben um sein Land bringen. Diesen schönen Flecken Erde, auf welchem der beste Weizen der Region wuchs. Seine Handflächen schwitzten und wieder schweifte sein Blick aus dem großen Fenster auf die Wagen, die immer noch vorbeifuhren. „Außerdem haben wir so die Möglichkeit in Verdun Dinge zu kaufen, die wir hier nicht bekommen.“
„Das konnten wir bislang auch mit dem Pferdegespann.“
„Ach, Paul. Wie willst du im Winter bei Eis und Schnee nach Verdun kommen, ohne das Fuhrwerk zu beschädigen?“ Paul ergriff den letzten Strohhalm, der sich ihm in seiner Verzweiflung bot und konterte mit dem einzigen, was ihm noch einfiel: „Es ist bislang immer gut gegangen, auch ohne Bahn. Denkt an unsere Vorfahren.“ Hebert legte sachte seine Hand auf Benoits Schulter und schüttelte bedenklich den Kopf.
„Paul, lass Sie die Bahn bauen. Es wird nicht zu unserem Schaden sein. Die Zeiten, von denen du sprichst, sind lange vorbei.“ Noch einmal sah er seinen Freunden in die Augen, die keine Hoffnung versprachen. Pierre Simon äußerte, was jeder von ihnen dachte, aber nicht aussprechen wollte.
„Es brechen neue Zeiten an. Irgendwann werden unsere Feldarbeiten von Maschinen verrichtet. Auch dagegen kannst du dich nicht wehren, mon ami.“ Paul Benoit resignierte angesichts der schlagenden Argumente.
„Wenn Ihr meint, dass es richtig ist. Ich muss erst darüber nachdenken.“ Er griff neben Hebert in das Regal und nahm eine gute Flasche Rotwein heraus. „Schreibst du mir die Flasche auf, Hebert?“
„Naturellement.“ In aller Ruhe zog er seine Brille auf die Nase und schrieb die Schulden für seinen Freund mit einem abgewetzten Bleistift auf. Der Bauer nahm seine Tüten und verließ den Laden.
„À demain, Paul!“, rief Pierre Simon ihm nach, doch Benoit hörte die Worte nicht mehr. In Gedanken versunken stand er vor der Tür und starrte ins Leere, als die letzten Wagen an ihm vorbeifuhren.
„Gilbert!“, rief er laut zur anderen Straßenseite hinüber. Er wartete nicht auf seinen Sohn, sondern ging mit schweren Schritten auf die kleine Kreuzung zu, deren Straßenverlauf an der Dorfkirche einen leichten Hang hinunterführte. Gilbert griff nach der Hand seines Vaters.
„Papa, was ist mit dir?“, fragte der Junge in dessen Gesicht Besorgnis stand. Noch nie hatte er seinen Vater so deprimiert und niedergeschlagen erlebt.
„Es ist nichts. Lauf schon nach Hause und bring deiner Mutter die Einkäufe, mein Junge.“ Behutsam gab er seinem Spross die Papiertüten mit den Eiern und den restlichen Lebensmitteln in den Arm.
„Geh langsam, Gilbert. Nicht, dass dir etwas herunterfällt.“ Die Sonne verschwand allmählich hinter den großen Baumwipfeln und legte einen weiten Schatten über den Großteil des Ortes. Ein leichter Wind wehte durch die Gassen und begann die Temperaturen dieses heißen Tages erträglich zu machen. Paul beobachtete den Jungen noch eine Weile, bis dieser an der Kreuzung verschwand. Gedankenversunken ging er weiter. Mit der rechten Hand versuchte er die Weinflasche unter seinem Hemd zu verstecken und blieb an dem weißen Zaun, der den Dorffriedhof umgab und die Kirche einfriedete, stehen. Warum, konnte er selbst nicht sagen. Irgendetwas schien ihn dort zuhalten. Bedrückt schaute er über die Gräber hinweg und zur hölzernen Pforte. Paul war kein gläubiger Kirchgänger. Er besuchte den Gottesdienst von Pater Frederic zwar regelmäßig, jedoch hauptsächlich seiner Frau zu liebe. Seine Auffassung war, dass jeder seines Glückes Schmied war. Langsam öffnete er das knarrende Törchen und betrat den Weg zur Kirche, der mit weißen Kieseln ausgelegt war.
Was tue ich hier?, fragte sich der fleißige Bauer und setzte wie von einer fremden Macht gelenkt einen Fuß vor den anderen. Sein Blick wanderte über die Grabsteine, die im Schatten der Bäume lagen. Einige von ihnen waren schon sehr alt und verwittert. Er kannte die Menschen, die hier ihre letzte Ruhe gefunden hatten, und auch deren Kinder, die den Ort verließen, um ein neues Leben zu beginnen. Vor der Kirche befanden sich drei breite Stufen aus hellem Stein, die einladend zur hölzernen Tür führten. Seine Hand drückte die gusseiserne Klinke herunter und plötzlich sprang die Pforte auf. Die dicken, steinernen Wände spendeten angenehme Kühle. Seine schweren Lederstiefel hallten bei jedem Schritt, den er auf den prächtig geschmückten Altar zuging. Vor dem großen, hölzernen Kreuz sank er demütig auf ein Knie, bekreuzigte sich und nahm in einer der ersten Bänke Platz. Im milchig, bunten Schein der Mosaikfenster saß er da. Immer noch plagten ihn mehr Fragen als er Antworten hatte und so bemerkte Paul nicht, wie sich ein Schatten von hinten über ihm aufbäumte.
„Paul?“, hallte es durch das Gotteshaus. „Warum bist du hier, an einem Dienstag?“ Es war Pater Frederic.
„Pater, Excusez-moi. Ich habe Euch nicht gehört“, antwortete Benoit verlegen und stand demütig, mit gesenktem Kopf von der Bank auf. Pater Frederic war einst vom Erzbischof von Verdun berufen worden die einzelnen kleinen Gemeinden im Umkreis zu übernehmen. Dies tat er mit vollster Hingabe und auch wenn er sich nur zwei Tage pro Woche in Fleury aufhielt, so war seine Kirche immer für jedermann offen. Er erkannte die Unsicherheit des Bauern und nahm neben ihm auf der Bank Platz. Sein warmherziges Lächeln und die weit hochgezogenen Augenbrauen weckten Pauls Vertrauen. Die Falten auf seiner hohen Stirn zeigten, dass er sich um die Lösung eines jeden Problems kümmerte.
„Was treibt dich zu mir?“ Zögernd, fast voller Scham, begann Paul zu erzählen: „Pater. Ich weiß nicht, ob Ihr mir helfen könnt.“
„Manchmal genügt ein offenes Ohr, um die Lösung zu finden, mein Sohn.“
„Ich mache mir Sorgen um die Existenz meiner Familie.“
„Und warum?“
„Sie beginnen mit dem Bau der Schmalspurbahn. Und dazu kaufen sie Land von uns Bauern.“
„Sprich nur weiter.“
„Wenn mein größtes Feld dem Bahnhof weichen muss, geht mir so viel Anbaufläche verloren, dass ich in einem schlechten Jahr gerade so viel ernten kann, dass es kaum für meine Familie reicht.“ Pater Frederic verstand die Sorgen und nickte zustimmend.
„Wann wirst du Nachricht über deinen Besitz erhalten?“
„Schon morgen.“
„Es ist der Fortschritt, der uns alles abverlangt, Paul. Doch verschließe nicht die Augen davor. Hab Vertrauen und du wirst sehen, wenn sich eine Türe schließt, sich eine andere öffnet. Hab Vertrauen zum Allmächtigen, denn er ist für seine Schafe da, wenn die Wölfe nahen.“
„Habt Dank, Pater Frederic.“ Paul stand auf, verneigte sich und wendete sich von ihm ab. Wie viele Türen soll denn dieses Leben haben?, fragte er sich und bemerkte nicht, dass er noch die Flasche Wein bei sich trug.
„Mein Sohn“, schallte es hinter ihm durch die gesamte Kirche. „Ich glaube nicht, dass deine Frau sehr glücklich sein wird, wenn du dir heute Abend Mut antrinkst.“ Paul starrte einen Moment die Flasche an und dann übergab er sie an den Pater.
„Wahrscheinlich haben Sie recht.“
„Ich werde diesen Tropfen zur Messe verwenden. Geh nach Hause und umarme deine Familie, denn sie ist unser größtes Glück.“ Sie verabschiedeten sich voneinander und der Bauer verließ das Gotteshaus.
Was bildet er sich ein, mir zu erzählen, worum ich mir Sorgen machen soll? Er unterliegt dem Zölibat. Er hat niemanden, um den er sich Sorgen machen müsste. Andererseits hat er recht. Ich muss stark sein. Für Marie und besonders für Gilbert. Mit diesen Gedanken trat er aus der Kirche. Die Furcht davor, was der nächste Tag bringen würde, war im deutlich anzusehen. Seine Augenbrauen waren tief nach unten gezogen und er biss sich nervös auf die Unterlippe. Seit einer gefühlten Ewigkeit hatte er dies nicht mehr getan und er spürte, dass die Veränderungen in seinem Leben gerade erst begonnen hatten. Wehmütig musterte er sein Anwesen, für welches er so hart geschuftet hatte. Ein großes Haus aus hellen Backsteinen. Ein geschindeltes Dach, das im Sonnenlicht hellrot schimmerte und vor den großen Fenstern standen aus Stein gehauene Blumenkübel, die mit den schönsten bunten Blumen gefüllt waren. Gleich neben dem Haus führte ein breiter einladender Weg zum Innenhof, wo sich die Stallungen befanden. Er vernahm das Wiehern der vier Pferde und das laute Muhen seiner vier Kühe und zweier Ochsen. Seine Tiere brachten ihm Frieden und wenn sein Tag stressig war, fand er dort zur Ruhe. Behutsam näherte sich Paul dem Stall und streichelte einem seiner Pferde, welches den Kopf durch die geöffnete Luke streckte, über die dichte Mähne. Sanft fuhr seine raue Hand über dessen Haupt. Es legte sachte seinen Kopf an Benoits Schulter und rieb sich an ihm. Aus dem großen Küchenfenster beobachtete ihn seine Frau, Marie Benoit. Sie war dreißig Jahre alt, doch ihr Äußeres ließ sie älter erscheinen. Ihr langes rotes Haar umrahmte ihr schmales Gesicht. Voller Zorn wischte sie sich hektisch die Hände an ihrer Schürze ab. Ihre Lippen waren zu schmalen Strichen zusammengepresst und man konnte nur erahnen, was dem armen Paul an diesem Abend bevorstand.
„Paul, das Essen ist fertig!“, donnerte ihre grelle Stimme über den Hof.
„J`arrive.“ Mehr kam nicht über die Lippen des Bauern und noch einmal strich er dem Pferd sanft über die wallende, fast schneeweiße, Mähne. Gilbert saß bereits an dem großen Esstisch, der aus kräftigem Eichenholz gefertigt war. Es war ein Erbstück seines Opas, der handwerklich sehr begabt gewesen war.
Auch die Holzstühle waren von ihm gebaut. Hinter dem Platz des Familienoberhauptes stand ein ausladender Schrank mit Schnitzereien versehen und Glaseinlagen. In ihm standen Gläser und das feine Porzellan, welches nur zu besonderen Anlässen hervorgeholt wurde. Paul zog sich seine Stiefel aus, nahm am Esstisch Platz und lächelte seinen elfjährigen Sohn an. Er wollte ihm das Gefühl geben, dass alles gut sei. Der Tisch war reichlich gedeckt. Es gab Fleisch, Soße, Bohnengemüse und Kartoffeln. Der Geruch war betörend und ließ einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. Gilbert, der trotz seines Alters noch relativ klein war, saß rechts von seinem Vater, von wo aus er freien Blick aus dem großen Fenster und auf die Felder hatte. Seine Beine baumelten von dem viel zu hohen Stuhl und schwangen gleichmäßig hin und her. Ernst schlug Marie ihre Schürze über die Stuhllehne und setzte sich. Die Wut war ihr anzusehen, denn es bildete sich eine tiefe Falte auf ihrer Stirn, die senkrecht zur Nase verlief. Paul bemerkte ihren Gesichtsausdruck und um jeglicher Streiterei aus dem Weg zu gehen, faltete er seine Hände, schloss die Augen und sagte: „Lasst uns beten.“ Gilbert tat es seinem Vater gleich. Demütig schaute auch er auf seinen leeren Teller, faltete ebenfalls die kleinen Hände und seine Beine kamen zur Ruhe. Marie hingegen war voller Unruhe. Sie faltete verbissen die Hände. Gilbert hingegen wirkte abwesend, denn die gefüllten Schüsseln auf dem Tisch, welche ihren köstlichen Duft entfalteten, lenkten ihn von dem Gebet ab und sein Magen grummelte so laut, dass jeder es hören konnte.
„Herr, wir danken dir für die Speisen, die du uns an diesem Tage so reich beschert hast. Wir danken dir für unsere Familie und den Zusammenhalt, den du uns geschenkt hast. Wir beten um eine reiche Ernte, und dass es uns auch die nächsten Jahre so gut gehen wird.“ Unsicher öffnete er ein Auge, um zu sehen wie seine Frau reagierte. Marie stierte ihn an. Hart, als wollte sie ihm im nächsten Moment mit den Krallen einer Katze ins Gesicht springen.
„Amen. Lasst uns essen.“ Ohne Worte wurden die Schüsseln herumgereicht. Die Löffel, die auf das Porzellan schlugen gaben einen grellen Hall wieder. Dem Grollen eines Gewitters gleich. Stille durchfuhr den Raum und als Gilbert seinen Teller gefüllt hatte, kam nur ein strenges „Iss!“ über die Lippen seiner Mutter. Paul schaute sie entsetzt an. Es war nicht das Verhalten, welches er von der Mutter seines Sohnes erwartete. Niemand sprach ein Wort. Paul legte sein Besteck auf dem Tellerrand ab und ballte zu beiden Seiten eine Faust.
„Was ist los mit dir?“, fragte er seine Frau, obwohl er die Antwort bereits kannte. Marie war unzufrieden mit der Lebensart, die ihr hier auf dem Land geboten wurde. Daraus machte sie keinen Hehl. Auch sie legte das Besteck auf den Rand des Tellers, nahm fest ihr Glas in die Hand und starrte ihren Mann an.
„Nicht vor dem Jungen!“, zischte sie ihm zu und nahm einen Schluck. Marie erweckte den Eindruck, dass ihr vor Zorn das Essen fast im Halse stecken blieb. Permanent schweiften Gilberts besorgte Blicke zwischen seinen Eltern hin und her, bis er plötzlich die Gabel ablegte und leise fragte: „Darf ich zu Bett gehen?“
„Natürlich. Immerhin hast du morgen wieder Schule“, sprach Paul liebevoll.
Also stand er von dem großen Stuhl auf, ging zu seiner Mutter und gab ihr einen Kuss auf die Wange. Auch seinen Vater küsste Gilbert, bevor er die lange, knarrende Holztreppe nach oben rannte. Als Gilbert die Türe hinter sich schloss und das Klacken seiner Tür zu hören war, brach ein heftiger Streit zwischen seinen Eltern aus. Paul setzte sein Weinglas an und leerte es in einem Zug.
„Was ist mit dir, verdammt nochmal?“, fragte er vorwurfsvoll und schaute Marie an.
„Ich habe gehört, wie du dich im Ort aufgeführt hast!“
„Aufgeführt?“, schrie der Bauer seine Frau entrüstet an. „Wenn Sie mir mein Land nehmen, um eine Bahn zu bauen, wovon sollen wir dann leben? Denkst du sie nehmen sich nur ein Stück vom Feld? Nein! Sie wollen alles!“
„Ich finde es ist eine gute Idee“, flüsterte Marie abfällig, während sie die Reste des Abendessens auf einen Teller zusammenschob. „Ich könnte öfter meine Eltern besuchen.“
„Und wovon leben wir, wenn wir eine schlechte Ernte haben? Willst du anschreiben lassen oder noch besser, wir fragen deine Eltern? Vielleicht geben sie uns genug Geld, um über den Winter zu kommen!“ Abweisend stapelte sie die schmutzigen Teller.
„Du bist ein sturer Kerl, Paul Benoit. Wir leben im Jahr 1873 und nicht mehr im Mittelalter. Du bist ein typischer Bauer. Verschlossen gegenüber allem Neuen.“ Ehe Marie sich versah, sauste Pauls Faust krachend auf den Tisch und das schmutzige Geschirr klirrte, als wolle es jeden Moment zerspringen.
„Willst du mich nicht verstehen?“, brüllte er seine Frau an und eine pochende Ader erschien auf seiner feuerroten Stirn. „Ich glaube, wenn du es nochmal zu tun hättest, würdest du mich nicht heiraten.“
„So wie du dich aufführst, wäre es wahrscheinlich das Beste gewesen!“ Das Geschrei hielt an und während Gilbert sein Nachthemd überzog, drangen die dröhnenden Stimmen seiner Eltern durch die geschlossene Tür. Es gab für ihn nichts Schlimmeres, als die ewigen Streitereien seiner Eltern. Ablenkung und Abwechslung war das, wonach er suchte. Und obwohl es tausend Dinge gab, die er lieber tat, zündete er seine kleine Öllampe an, die auf seinem Nachttisch stand und las in einem Schulbuch. An Konzentration auf das Geschriebene war jedoch keine Sekunde zu denken. Der grelle Mond dieser Nacht und die dunklen Wolken, die wie kleine Fetzen an seinem Fenster vorbeizogen, lenkten ihn zu sehr ab. All diese Dinge faszinierten ihn. Doch selbst der Versuch sich in seine eigene Welt zu retten war ihm nicht vergönnt. Ständig die dumpfe Stimme seines Vaters, welche wie ein lauter Donner durch die geschlossene Tür seines Zimmers drang, gefolgt von der grellen und lauten Stimme seiner Mutter, die sich anhörte, als würden Nägel über eine große Schiefertafel kratzen.
Warum streiten sie nur so oft?, fragte er sich, ehe er sein Buch zur Seite legte und das Licht löschte. Im einfallenden Mondlicht lief ihm eine Träne die Wange hinunter und er versuchte den Krach von sich fernzuhalten, indem er sich die Hände fest auf die Ohren presste. Tief vergrub Gilbert den Kopf in seinem Kissen und weinte sich in den Schlaf.
2. Kapitel
Am nächsten Morgen saß Gilbert in seinem Klassenraum. Die Strapazen der letzten Nacht hatten ihre Spuren hinterlassen. Lehrerin Mademoiselle Dubois konnte er kaum folgen, obwohl er begeistert von ihr war. Sie war vierundzwanzig, hatte lange blonde Haare, die meist zu einem dicken Zopf geflochten waren und sie trug eine Brille auf ihrer kleinen Stupsnase. Ständig senkten sich Gilberts Lider und versteckten seine braunen Augen. Nur der Krach seiner Mitschüler hielt ihn wach. In dem Tumult der durcheinander redenden Schüler, fiel es der Lehrerin schwer den Überblick zu behalten. Die harten Holzbänke, welche die Schüler zum Geradesitzen anhielten, bereiteten dem jungen Benoit große Rückenschmerzen. Als ob das alles noch nicht genug gewesen wäre, begannen die Mädchen neben ihm mit ihren Kreidestiften auf ihren Schiefertafeln zu schreiben. Das schrille Geräusch erinnerte ihn so sehr an das Geschrei seiner Mutter, dass sich ihm die Nackenhaare aufstellten.
„Psst! Gilbert!“, flüsterte eine leise Stimme von hinten in sein rechtes Ohr. Der Name des Jungen lautete Theo Légas. Er war im selben Alter wie Gilbert und sein bester Freund. Langsam drehte sich Gilbert um und schaute dem blonden Jungen entnervt durch die dicken Gläser seiner Brille, hinter welcher sich stahlblaue Augen verbargen.
„Was ist los?“, zischte er Theo an.
„Kommst du nach der Schule mit uns?“
„Wohin?“
„Zur Eisenbahnbaustelle.“ Gilbert zögerte. Er wollte zu Hause nicht noch mehr Unheil anrichten. Wenn seine Eltern davon erfahren würden, wäre ein noch viel größerer Streit absehbar. Er schüttelte hastig den Kopf.
„Nein.“ Doch schnell kamen ihm Zweifel, denn er wollte schon gerne wissen was dort hinter dem Ort geschah. „Mein Vater ist auf der Sitzung mit dem Stadtrat und den Vertretern aus Verdun. Wenn er davon erfährt, bekomme ich Ärger.“ Theo starrte ihn an und lächelte.
„Feigling!“, flüsterte er.
„Ich bin kein Feigling!“, entgegnete Gilbert zornig und in einer solchen Lautstärke, dass es plötzlich in dem Klassenzimmer mäuschenstill wurde.
„Theo! Gilbert! Ihr werdet heute eine Stunde nachsitzen“, ertönte die laute, helle Stimme von Mademoiselle Dubois. Die Mädchen kicherten leise. Die beiden Jungen hingegen verdrehten nur die Augen. Theo wollte gerade zu einem feurigen Plädoyer für ihre Unschuld ansetzen und nahm schon tief Luft, als die Lehrerin mit ihrer Begründung fortfuhr.
„Danach habt Ihr Zeit Euch weiter zu unterhalten. Und nun kommt an die Tafel und rechnet die Aufgaben aus. Vite!“ Erschöpft stand Gilbert auf und ging neben Theo an die Tafel. Sie empfanden die Strafe als ungerecht und nur widerwillig nahmen sie die weiße Kreide, welche ihnen die Mademoiselle reichte. Mit einem Gefühl der Zufriedenheit und dem Wissen nun endlich für Ruhe gesorgt zu haben, setzte sie sich hinter ihr Lehrerpult und konnte sich ein verschmitztes Lächeln nicht verkneifen. Das Nachsitzen hatte begonnen und die Sonne brannte auf das Dach der Schule. Schweißtropfen liefen über die Gesichter der Jungen und Gilbert wischte sich mit seinem Taschentuch über die Stirn. Gefesselt galt ihr Augenmerk der großen Standuhr, die in der Ecke des Klassenzimmers stand. Tick, tack, tick, tack. Es schien, als würde die Uhr stehenbleiben und rückwärts laufen. Mademoiselle Dubois saß an ihrem Schreibtisch und konnte die Unruhe der beiden spüren. Sie hatte Mitleid mit ihnen und wusste wie es war den Nachmittag im stickigen Klassenraum zu verbringen, während ihre Kameraden draußen spielten und tollten. Behutsam zog sie ihre Brille von der kleinen Nase und beobachtete die rastlosen Buben, deren Beine vor Nervosität hin und her wippten. Ihr Blick ging auf die hölzerne Standuhr, sie zeigte fünf nach zwei.
„Ich glaube ihr habt lange genug geschwitzt.“ Überglücklich sahen sie zu ihrer Lehrerin auf.
„Danke, Madmoiselle Dubois.“ Ehe sie sich versah, waren die Jungen schon zur Türe hinaus.
„Diese Jungen“, sprach sie zu sich selbst und lächelte kopfschüttelnd. Theo und Gilbert rannten eilig die Stufen hinunter und schauten sich um. Keiner ihrer Freunde, die auf sie warten wollten, war weit und breit zu sehen. Sie hielten ihre Bücher fest umklammert und schauten sich fragend um.
„Wo sind die anderen, Theo?“
„Ich weiß nicht. Sie wollten hier warten.“ Die Lehrerin warf einen Blick durch das große Klassenfenster hinaus auf die Straße und wunderte sich über die Hilflosigkeit ihrer Schüler. Sie wollte sich gerade umdrehen und den Jungen nachgehen, als diese plötzlich davonliefen. Wie vom Blitz getroffen, stürmten Theo und Gilbert die Straße entlang. Ein alter Mann, der mit seinem Stock in der Hand auf einer Bank unter der hohen Lärche saß, schrie ihnen laut hinterher: „Langsam!“ Das Gebrüll des Alten nahmen die Jungen schon nicht mehr wahr. Zu stark war ihre Neugier auf die Baustelle, die sich wenige hundert Meter vor ihrem Heimatort befand. Flink liefen die beiden durch die hohen Kornfelder außerhalb von Fleury. Die gelben Ähren waren so hoch gewachsen, dass es ihnen schwer fiel sich zu orientieren.
„Wo müssen wir lang?“, schrie Gilbert über das weite Feld.
„Hier lang!“, hallte es durch die im Wind raschelnden Ähren. Gilbert orientierte sich nur noch an diesem Geräusch. Sie liefen den langen Hang hinab, bis sie einen kleinen Wald erreichten. Plötzlich war sein Freund verschwunden, wie vom Erdboden verschluckt. Gilbert schaute sich um und suchte nach Theo. Nach rechts und links wanderte sein Blick und er begann sich Sorgen um seinen Kameraden zu machen.
„Theo? Theo!“, rief er über das weite Feld, doch niemand antwortete. Sein Atem wurde schneller und schneller und Panik erfüllte ihn. Was, wenn Theo gestürzt ist? Wenn er sich am Kopf verletzt hat?
„Haha, du Memme!“ Mit diesen Worten stürzte Theo aus dem Feld und riss den jungen Bauernsohn zu Boden.
„Was soll der Unsinn?“
„Wieso? Immerhin hab ich dich voll erwischt.“
„Weißt du wo die Baustelle ist?“, fragte Gilbert ihn skeptisch, während er sich den Schmutz von den Kleidern klopfte.
„Natürlich! Es geht dort lang.“ Theo wies mit seinem schmalen Zeigefinger zwischen den alten Bäumen hindurch. Der Anblick dieses düsteren, schmalen Wäldchens sorgte bei den beiden Jungen für Unbehagen. Ihre Eltern hatten ihnen verboten sich so weit vom Dorf zu entfernen. Wenn das Verbotene nicht einen solchen Reiz gehabt hätte, wären sie direkt nach Hause gegangen. Schritt für Schritt gingen sie weiter. Die morschen Äste knackten unter ihren Schuhen und der Griff um die Bücher wurde fester. Je tiefer sie zwischen die dichten Bäume ins Dickicht eindrangen, umso modriger wurde der Geruch. Nur wenige Sonnenstrahlen drangen durch die starken Kronen bis auf den Boden und die Feuchtigkeit des Regens der vorherigen Woche tat ihr Übriges.
„Oh, Gott! Es stinkt erbärmlich!“ Theo war jedoch voller Neugier, dass er trotzdem weiterging. Der junge Benoit schluckte tief und atmete nur noch durch den Mund. Die dicken Äste beugten sich weit hinunter, als wollten sie ihnen den Weg versperren und nach wenigen Metern war kein Weiterkommen mehr. Zu dicht waren das Moos, die Schlinggewächse und Äste.
„Hier ist kein Durchkommen, Theo. Lass uns zurückgehen.“
„Was ist mit dir? Wir sind Entdecker. Wie in den Büchern, die wir in der Schule gelesen haben.“
„Das war Darwin, du Idiot“, antwortete Gilbert genervt. „Er ist mit einem Schiff gefahren und hat fremde Tiere und Pflanzen gesammelt.“
„Oh! Verzeiht mir mein Unwissen, Monsieur. Ich gehe jetzt weiter. Geh zurück, wenn du willst. Doch ich werde allen erzählen was für ein Feigling du bist!“ Die Schmach wäre zu groß gewesen, also sammelte er all seinen Mut und folgte seinem Freund durch das Gebüsch.
„Siehst du? Es wird schon heller.“ Mit einem kräftigen Ruck riss Theo die Hecke ein Stück weit auseinander. Plötzlich ging er erschrocken in die Hocke und schaute auf die lehmige Erde.
„Was siehst du?“
„Pssst!“ Behutsam zogen sie die dünnen Äste weiter auseinander und riskierten einen Blick. Auf der freien Ebene, die sich jenseits des Waldes befand, herrschte reges Treiben. Zahlreiche Arbeiter schufteten in der prallen Sonne. Der Schweiß lief ihnen über die schmutzigen Gesichter und hinterließ schmale saubere Linien auf ihren Wangen. Eine Spitzhacke nach der anderen sauste in den trockenen Boden hinunter und die Schaufeln warfen den Dreck zur Seite. Auf dem bereits geglätteten Boden der zukünftigen Bahntrasse brachten weitere Arbeiter die stählernen Gleisstücke herbei. Mit schweren Hämmern und Eisenstiften, die so dick wie zwei Finger eines erwachsenen Mannes waren, befestigten sie die Schienen miteinander. Das Geräusch von Stahl, der auf Stahl schlug war so grell, dass sich die Jungen die Ohren zuhalten mussten. Sämtliche Sorgen, die sich Gilbert machte, waren vergessen und fasziniert streckte er seinen Kopf weiter aus dem Busch hervor. An der linken Seite befand sich ein hölzerner Verschlag, welcher schnell wieder abgebaut und mitgenommen werden konnte.
„Schau mal dort. Ich wette, dass sie dort ihre Werkzeuge und vielleicht auch Dynamit lagern.“ Ein breites Grinsen stahl sich auf ihre Gesichter und entschlossen flüsterte Theo: „Komm mit!“ Behutsam schlichen sie weiter. Der Vorarbeiter schrie mit solch kräftiger Stimme über die Baustelle, dass niemand die Jungen bemerkte.
„Ebnet den Weg!“, brüllte er die Männer an und diese gehorchten ihm aufs Wort. Es war beeindruckend, welche Macht er ausübte und mit offenen Mündern starrten die Freunde um die Ecke des Verschlags. In diesem Moment gefror ihnen das Blut in den Adern. Ein fester Handgriff umschloss ihre Hemdkragen und in Windeseile verloren sie den Boden unter den Füßen.
„Was sucht ihr hier?“, ertönte eine dröhnende Stimme aus dem Hintergrund. Gilbert dachte ihm würde das Herz stehenbleiben und er drehte den Kopf leicht zurück. Es war der Vorarbeiter Monsieur Moureaux. Er trug einen schwarzen Hut mit breiter Krempe, die sein Gesicht halb verdeckte. Nur sein langer Bart ragte aus dem Schatten hervor. Seine Arme schienen aus Eisen zu sein, sehnig, hart und braun gebrannt. Sein Hemd war bis zu den Ellenbogen hochgekrempelt und eine Tätowierung prangte auf seinem Unterarm. Es war ein verblichener Anker mit einer großen Kette. Daneben standen die Initialen RM.
„Remond!“, ertönte die Stimme des Bauleiters und mit großen Schritten stampfte Moureaux los. Theo war panisch. Er schrie laut und strampelte mit den Beinen umher.
„Wir wollten nur schauen!“ Gilbert war indessen starr vor Angst. Er konnte nicht weinen, geschweige denn einen Ton hervorbringen. Ein wild gestikulierender Mann kam auf sie zugestürmt. Er war von geringer Körpergröße, sein Gesicht feuerrot und seine Halsschlagadern pochten. Jeder auf der Baustelle hatte Respekt vor ihm. Mit heftigen Bewegungen strich er sich die dünnen Haare aus dem Gesicht.
„Was machen diese Jungen hier? Ich habe Ihnen gesagt, sie sollen die Baustelle freihalten, Remond!“ Moureaux starrte ihm unter seinem bedrohlichen Hut in die Augen. Er war fast zwei Köpfe größer und Gilbert hatte den Eindruck er könnte den schreienden Kerl mit bloßer Hand zerquetschen, wenn er wöllte. Auf einmal öffneten sich seine großen, rauen Hände und die beiden Buben fielen in den Staub.
„Ich werde Sie entlassen, falls so etwas noch einmal passiert!“, bellte der kleine Mann den Hünen an. Als er energisch den Platz verließ, schrie er ihm noch einmal zu: „Sorgen Sie dafür, dass sie abgeholt werden. Merde!“
„Jawohl, Monsieur Gerad!“ Remond beugte sich zu den zwei Jungen hinunter.
„Wisst ihr in welche Gefahr ihr euch hier begeben habt?“ Seine Stimme war ruhig und entspannt. „In diesem Verschlag lagert Sprengstoff und hier wird auch damit gearbeitet. Wenn wir gesprengt hätten, wäre nichts mehr von euch übrig geblieben!“ Theo und Gilbert schauten ihn fassungslos an. Nun wurde ihnen erst bewusst, in welche tödliche Gefahr sie sich begeben hatten. Der junge Benoit verstand, worum es dem Mann ging. Er wollte ihnen nichts Böses, sondern sie nur beschützen. Theo begann aufgeregt zu stottern: „Aber wir wollten nur...“
„Kommt mit mir!“ Langsam und nicht wissend, was sie erwartete, folgten sie dem Riesen. Er öffnete die Tür zum Verschlag und ließ die beiden einen Blick riskieren. Es war keine abschreckende Lüge. Der Innenraum war gespickt mit Sprengstoff. Zur Linken standen Schaufeln, Spitzhacken und Schubkarren und in der Mitte befand sich ein kleiner Tisch.
„Warum brennt hier kein Licht?“, fragte Gilbert und voller Neugier. „Eine Lampe könnte alles in die Luft sprengen, Junge.“ Sie hielten einen Moment inne, ehe Gilbert erschrocken fragte: „Dürfen wir gehen?“ Der Vorarbeiter schüttelte den Kopf und verschränkte seine kräftigen Arme vor der Brust. „Nein. Ich werde einen meiner Arbeiter schicken, damit eure Eltern euch abholen.“ Gilbert schaute zu Theo hinüber. Der sonst so selbstbewusste Junge stand wie ein Häufchen Elend da. Theo wusste was ihm blühte, falls seine Eltern erfuhren, dass er sich zur Baustelle geschlichen hatte. Seine Unterlippe zitterte und Tränen, die er zu unterdrücken versuchte, spiegelten sich in seinen dicken Brillengläsern. Nun war es an Gilbert die Kohlen aus dem Feuer zu holen.
„Er ist mein Bruder“, sagte er mit selbstsicherer Stimme. „Wenn sie jemandem Bescheid geben müssen, dann unserem Vater Monsieur Benoit. Er ist ein Bauer aus Fleury.“ Stolz schob er seine Brust nach vorne, obwohl er bereits an die Strafe, die ihn zu Hause erwartete, dachte. Remond war beeindruckt von der Kühnheit und Selbstlosigkeit, mit welcher der junge Mann vor ihm stand.
„Bon! Dann werde ich nach eurem Vater schicken.“ Das Gebrüll auf der Baustelle ging weiter. Gilbert schaute nur auf die Höhe der Sonne. An ihr konnte er erkennen, wie lange es noch dauerte, bis sein Vater die Baustelle erreichen würde. Sie senkte sich weiter und weiter und ihre Farbe wurde greller und greller. Von einem gleißenden Gelb, bis hin zu einem tiefen Rot reichte das Farbenspiel und je länger es dauerte bis sie abgeholt wurden, umso mehr stieg ihre Anspannung. Plötzlich erhoben sich Staubwolken in den Abendhimmel. In dem aufgewirbelten Dreck waren die Räder eines Wagens zu erkennen und als er sich näherte erschienen auch die Pferde der Familie Benoit.
„Ihr werdet großen Ärger bekommen, doch lasst euch nicht unterkriegen“, flüsterte Remond und er legte die Hände auf ihre Schultern. Der Wagen bremste und die Pferde wieherten.
„Hohhhh!“, raunte die tiefe Stimme von Paul Benoit. Dann folgten die schweren Stiefel, die von dem Karren auf den Boden aufschlugen. Paul war außer sich. Seine Augen waren voller Zorn und beide Augenbrauen zogen sich tief in sein Gesicht, während sein Atem dem Schnauben eines wilden Stieres glich. Er ballte die starken Fäuste. Zögernd trat Gilbert vor seinen Vater und sah ihm tief in die Augen. Paul war von seinem Sohn enttäuscht.
„Du solltest nach Hause kommen!“, waren seine vorwurfsvollen Worte, welche für Gilbert schlimmer als eine Tracht Prügel waren.
„Sie waren nur neugierig!“, wandte sich Remond gegen den Vater. Diese Äußerung brachte Paul jedoch nur weiter in Rage. Wütend wandte er sich dem Arbeiter zu und sein gesamter Körper bebte.
„Warum zur Hölle mischen Sie sich ein?“, schrie er Remond an. „Er ist mein Sohn! Denken Sie ich wüsste nicht was ihm hier alles hätte passieren können?“
„Beruhigen Sie sich, Monsieur. Immerhin sind Ihre Jungen wohl auf.“ Wie in Zeitlupe drehte sich Paul zu den Buben um, die langsam zu dem Wagen schlichen. Vorwurfsvoll starrte er Gilbert an.
„Theo ist nicht mein Sohn.“ Remond lachte herzhaft und sprach: „Da habt ihr Buben mich ganz schön hinters Licht geführt.“
„Steigt auf den Wagen!“
Dies waren die letzten Worte, welche über die Lippen des enttäuschten Bauern kamen. Während die Freunde gehorchten, trat Benoit nahe an Remond heran. Er hätte lieber seine Wut an diesem Arbeiter ausgelassen, statt an seinem Sohn.
„Sie haben Glück, dass ihm nichts geschehen ist!“
„Soll das eine Drohung sein?“
„Moureaux! Geh an deine Arbeit, verflucht nochmal!“, schallte es erneut aus dem Mund des Bauleiters. Remond Moureaux nickte, legte seine Hand an seinen Hut und grüßte Paul zuvorkommend, ehe er sich wieder an seine Arbeit begab. Paul verstand die Reaktion seines Gegenübers nicht. In diesem Augenblick suchte er die Konfrontation mit ihm. Doch dieser Mann ließ ihn einfach stehen. Nun hatte er die Gelegenheit sich den beiden Buben zu widmen, die verängstigt und zusammengekauert auf der Pritsche des Wagens saßen.
„Hüah!“ Mit einem straffen Zug an den Zügeln wendete Paul und fuhr gemächlich den staubigen Weg neben den Gleisen her. Als sie aus der Sichtweite der Arbeiter waren, stoppte er abrupt das Fuhrwerk und die Pferde wieherten laut. Es war an der Zeit ein klärendes Gespräch zu führen. In aller Ruhe nahm Benoit seine Taschenuhr hervor. Inzwischen war es schon halb sechs und in einer Stunde sollte das Treffen mit den Vertretern aus Verdun stattfinden. Er lehnte den Arm über die hölzerne Rückwand des Wagens, welche die Ladefläche vom Führerstand des Anhängers trennte. Seine Gedanken schweiften zurück in seine Kindheit und er verstand, warum sein Sohn so gehandelt hatte. Es war das Neue, das Unerlaubte, was den Reiz ausmachte. Ruhig, aber dennoch mit dem nötigen Ernst, nahm er den Jungen ins Gebet.
„Es tut mir leid, dass ich dich so angeschrien habe. Aber deine Mutter und ich haben uns die größten Sorgen gemacht.“ Leise kamen Gilbert die Worte über die Lippen, auf die sein Vater gewartet hatte.
„Es tut mir leid und es wird nicht wieder vorkommen. Versprochen, Papa.“
„Das will ich hoffen. Und ich verlasse mich auf dein Wort, Gilbert. Doch deine Mutter ist außer sich.“ Gilbert schämte sich. Er nickte nur und spielte nervös an seinen Fingern herum. Theo saß eingeschüchtert neben seinem Freund, die Knie an den Körper gepresst.
„Mach dir keine Sorgen, Theo“, versuchte Benoit den verängstigten Jungen zu beruhigen und gab dem Pferd einen leichten Schlag mit den Zügeln. Während der Wagen über die Abzweigung in Richtung ihres Heimatortes rollte, konnte sich Gilbert jedoch die Frage nicht verkneifen, die ihm so tief unter den Nägeln brannte.
„Wie wütend ist Maman?“, flüsterte er leise und schaute auf die weite Ebene, die im goldgelben Licht des Weizens strahlte. Der friedliche Gesang der Lerchen begleitete ihre Fahrt.
„Ich würde heute Abend gleich auf mein Zimmer gehen, bevor deine Mutter dich ausschimpft.“
„Ja, Papa“, kam die zögernde Antwort. Aber Gilbert wusste, dass er die Strafe verdient hatte. So konnte er sich leichter mit den Konsequenzen abfinden. Theo saß unterdessen weiterhin zusammen gekauert wie ein Häufchen Elend neben ihm.
Seine Arme umklammerten fest seine angezogenen Beine und man konnte ihm die Angst vor seinen Eltern ansehen.
„Papa?“, ertönte noch einmal Gilberts besorgte Stimme, welche diesmal entschlossener wirkte. „Wenn du bei Theo anhältst, sag bitte nicht, was wir getan haben.“ Paul bewunderte, wie sich sein Sohn für den Freund stark machte. Sie näherten sich dem Ort und die Angst von Theo wurde immer stärker. Gilberts Vater drehte sich nochmals zu den Jungen um.
„Ihr musstet länger Nachsitzen. Deshalb seid ihr so spät. Kein Wort über das, was ihr Zwei angestellt habt.“ Ein Stein fiel Theo vom Herzen und er kämpfte mit den Tränen.
„Danke, Monsieur Benoit.“
„Bedanke dich bei Gilbert, Theo.“ Die Jungen fielen sich in die Arme und drückten sich so fest, dass es ihnen schwer fiel loszulassen. Paul bog in die kleine Seitenstraße ab, die direkt nach der Ortseinfahrt nach rechts führte. Am Ende befand sich der Hof von Theos Familie. Die Buben hielten den Atem an. Ihre Hoffnung beschränkte sich nur darauf, dass Monsieur und Madame Légas ihre Notlüge glaubten. Hastig kam Jean Légas auf den Wagen zu und nahm mit einem Ruck seinen Sohn in die Arme. Strafend schaute er Paul in die Augen, doch dieser lächelte nur.
„Wo waren die zwei Bengel?“, fragte Jean voller Besorgnis.
„Keine Sorge, Jean. Sie mussten länger nachsitzen. Ich hatte noch einige Besorgungen zu machen und habe sie von der Schule abgeholt.“
„Danke, Paul. Das nächste Mal bin ich dran“, lächelte Jean, nicht ahnend, dass er ihnen auf den Leim gegangen war. Paul zwinkerte Theo zu und gab dem Pferd die Sporen.
„Bis gleich, Jean.“
„Ja, bis gleich. Und danke nochmal.“
„De rien!“, rief Benoit seinem Freund Légas zu, während er die schmale Straße entlang fuhr. „Du wirst die Strafe Deiner Mutter akzeptieren, mon fils!“
„Natürlich, Papa!“ Paul wusste jedoch, dass es besser wäre, wenn Marie sich erst einmal beruhigen würde und so wandte er sich seinem Sohn zu.
„Hast du Lust mich zu der Sitzung zu begleiten?“ Gilbert lächelte seinen Vater an und nickte. In der Hoffnung den Familienfrieden zu wahren, lenkte der Bauer den Wagen statt geradeaus die weitere Seitenstraße hinauf und so erreichten sie das Rathaus von Fleury. Im Beisein seines Sohnes, fühlte sich Paul sicher.
Er wusste, dass es um die Existenz seiner Familie ging, und wenn er den Kleinen dabei hatte, war er sich bewusst, wofür und für wen er kämpfte. Zuversichtlich befestigte er das Pferd am starken Querpfosten vor dem prächtigen Bürgermeisterbüro. Nach und nach erreichten die Kutschen der Herren aus Verdun den Platz. Paul hegte nur Verachtung für diese Männer, die ihm sein Land wegnehmen wollten. Die Benoits würdigten sie keines Blickes und so gingen Vater und Sohn, Hand in Hand, auf den Eingang zu. Die Mairie war quadratisch gebaut und bestand aus dem feinsten Stein, der in dieser Region zu finden war. Die Fenster waren zu beiden Seiten eckig, aber an der Front groß, hoch und hatten nach oben eine Rundung. Vor dem Eingang befand sich ein schmaler Garten, in dem die herrlichsten Blumen blühten und ihren Duft über die beiden Nebenstraßen verbreiteten. Zusehends mischten sich die einfachen Bürger Fleurys unter die adrett gekleideten Herren von Verdun. Paul sah jedoch keinen Grund sich zu schämen. Sein Geruch war der eines einfachen Mannes, der hart arbeitete und dafür einstand. Der Geruch der feinen Parfüms und Eau de Toilette der höheren Schicht übertönten alles. Schnell füllte sich der Saal und die einfachen, unbequemen Stühle schienen den Vertretern der Bischhofsstadt Unbehagen zu bereiten. Nervös rutschten sie hin und her und sahen sich abfällig an, als ob sie sagen wollten: „Was tun wir hier auf dem Land, bei dem Pöbel?“ Paul nahm zusammen mit Gilbert in einer der letzten Reihen Platz. Die Stühle um ihn herum blieben leer.
„Paul. Schön dich zu sehen“, flüsterte eine Stimme. Es war Jean Légas. Zusammen mit seiner Frau setzte er sich neben Paul und schaute die Vertreter aus Verdun voller Verachtung an, die sich mit verzerrten Mienen zu ihnen umdrehten.
„Siehst du, Paul? Wir sind ihnen egal. Diese Kapitalisten! Sie wollen nur unser Land. Und wenn sie sich ein Tuch vor Mund und Nase halten müssen. Sie widern mich an!“ Paul nickte nur, denn in diesem Moment erschien ihr Bürgermeister, Serge de Pois. Sein Haar war schüttern und weiß. Man wusste nicht, ob die Falten auf seiner hohen Stirn für Besorgnis standen oder einfach nur seinem Alter zu zuschreiben waren. Trotz seiner geringen Körpergröße, stellte er sich entschlossen an das Rednerpult, welches mittig vor den Zuhörern stand.
Nervös wippten die Beine der Bauern auf und nieder und Paul merkte, wie sich seine verschränkten Arme zunehmend verkrampften. Stille machte sich breit und jeder von ihnen wusste, um was es hier ging. Nämlich um den Fortbestand dieses Ortes. De Pois stand vor einer großen Tafel, auf welcher der gesamte Umkreis des Dorfes aufgezeichnet war und mit zittriger Hand wies er ganz genau den Weg der zukünftigen Bahn nach. Paul atmete tief durch.
Sein Land blieb von den Vorhaben verschont. Fest faltete er seine Hände zum Gebet und Gott schien ihn erhört zu haben. Jeans Verlust jedoch war immens. Die Bahn sollte genau über sein größtes Feld führen und unter Tränen der Wut stand er auf.
„Was wollt ihr denn noch?“, schrie Légas durch den Saal und er ballte seine Fäuste. Teils erschrocken, teils fassungslos über den Gefühlsausbruch des Bauern, saßen die feinen Herren in dem Raum. Alle starrten auf Jean Légas, der um all das kämpfte, was ihm geblieben war. „Es ist mein Land! Wie soll ich meine Familie ernähren, wenn Ihr mir mein größtes Feld nehmt?“ De Pois versuchte die Situation zu beruhigen.
„Monsieur Légas! Darf ich um Ruhe bitten. Lassen Sie uns doch wie normale Menschen darüber reden.“ Aber seine Worte verpufften im selben Moment.
„Nein! Ich werde mich nicht beruhigen! Ich...“ Plötzlich stand einer der feinen Herren auf, strich sich über den schwarzen Schnauzbart und fiel dem Bürger ins Wort.
„Monsieur. Wenn Sie Sich das Feld nicht zu einem guten Preis abkaufen lassen, werden Sie zwangsenteignet!“ Sämtliche anwesenden Bauern und Geschäftsleute aus Fleury saßen stumm auf ihren Stühlen. Einerseits hätten sie gerne ihre Stimme erhoben, um ihrem Freund zu helfen. Andererseits befürchtete jeder, dass sein Eigentum das Nächste sein könnte, welches unter die Kontrolle der Bauunternehmen fallen könnte.
„Ich werde es Ihnen zeigen! Niemand vertreibt mich von meinem Land!“, schrie Légas hysterisch. Seine Faust wirbelte wild durch die Luft.
„Légas!“, schrie De Pois ihn aus voller Brust an. „Reißen Sie sich zusammen. Sonst werde ich Sie entfernen lassen.“ Als Jean Légas einige hastige Schritte auf den Bürgermeister zuging, sah Paul ihm in die Augen. Die rasende Wut ließ sie aufblitzen und bevor alles eskalierte, sprangen Paul und Pierre Simon von ihren Stühlen hoch und packten ihren Freund beherzt an den Armen.
„Lasst mich los!“
„Jean, bleib ruhig!“
„Nein! Ich mach Euch alle fertig!“
„Komm mit, Jean!“, redete Paul auf seinen Freund ein, während sie ihn langsam rückwärts zur Tür zogen.
„Schafft ihn raus! Er hat hier nichts mehr zu suchen!“, schrie der noble Herr ihnen nach und machte mit den Händen eine abfällige Geste. Jeans Frau folgte ihnen nach draußen. Auch sie machte sich Sorgen um die Zukunft ihrer Familie. Gilbert hob den Hut auf, den Jean in seinem Ungestüm fallen gelassen hatte und auch er folgte den Männern aus dem Gebäude. Der aufgeregte Bauer war mit den Nerven am Ende. Paul nahm ihn in den Arm und Légas` Verzweiflungstränen durchnässten Benoits Hemd. Simon stand daneben. Auch ihm konnte man den Zorn über diese Ungerechtigkeit ansehen. Plötzlich öffnete sich mit einem lauten Ruck die Tür und binnen weniger Minuten standen sie inmitten der restlichen Dorfbewohner. Sie alle zeigten an diesem Abend ihre Solidarität und ihr Mitgefühl. Hebert kam zu ihnen. Besorgt legte er seine Hand auf Jeans Schulter und sagte: „Bis du neues Land hast, kannst du bei mir umsonst Lebensmittel bekommen.“
„Wenn du Werkzeug brauchst, kannst du immer zu mir kommen“, versuchte Simon seinem Freund die Existenzangst zu nehmen. Jean war glücklich über den Rückhalt, den er im Dorf hatte und während Paul ihn fest an sich drückte, wischte er sich die letzten, salzigen Tränen aus den Augen. Paul flüsterte ihm zu: „Jean. Wenn du nicht bald einen neuen Acker findest, bekommst du ein Feld aus meinem Besitz. Ich helfe dir etwas Neues zu finden.“ Die untergehende Sonne tauchte den Platz vor dem Bürgermeisteramt in ein feuriges Rot und dünne, schwarze Wolken zogen vorüber. Légas war überwältigt von dem Wohlwollen seiner Freunde und nachdem er sich beruhigt hatte, nahm er jeden feste in den Arm.