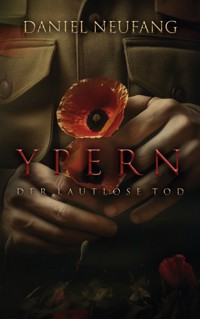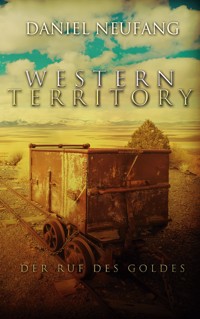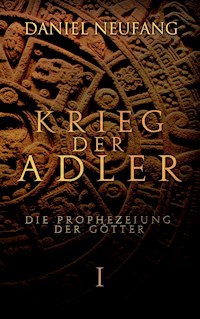Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ende Juli 1914. Die jungen Franzosen Philippe Grouché und Gilbert Sinclair melden sich freiwillig zu den Pionieren, um dem Schlachtfeld zu entgehen. Aus Freundschaft zu dem Offizierssohn Kurt Faber, meldet sich auf deutscher Seite der Stallbursche Friedrich Preuß zum 30. Pionierbataillon. Kurz nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges kommt der deutsche Vorstoß zum Erliegen und beide Pioniereinheiten werden nach Vauquois, einem strategisch wichtigen Bergdorf im Argonner Wald, verlegt. Als es den Armeen nicht gelingt den Ort auf konventionelle Weise einzunehmen, beginnt die Minenschlacht von Verdun, welche die deutschen wie auch die französischen Freunde an ihre psychischen und körperlichen Grenzen bringt. Werden sie den Tunnelkrieg überstehen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 404
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ende Juli 1914.
Die jungen Franzosen Philippe Grouché und Gilbert Sinclair melden sich freiwillig zu den Pionieren, um dem Schlachtfeld zu entgehen. Aus Freundschaft zu dem Offizierssohn Kurt Faber, meldet sich auf deutscher Seite der Stallbursche Friedrich Preuß zum 30. Pionierbataillon. Kurz nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges kommt der deutsche Vorstoß zum Erliegen und beide Pioniereinheiten werden nach Vauquois, einem strategisch wichtigen Bergdorf im Argonner Wald, verlegt.
Als es den Armeen nicht gelingt den Ort auf konventionelle Weise einzunehmen, beginnt die Minenschlacht von Verdun, welche die deutschen wie auch die französischen Freunde an ihre psychischen und körperlichen Grenzen bringt. Werden sie den Tunnelkrieg überstehen?
„Der Unwissende hat Mut,
der Wissende hat Angst“
Alberto Moravia
Inhaltsverzeichnis
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
1. Kapitel
Es war ein heißer Sommerabend Ende Juli 1914. Von der Kaserne auf dem Asterstein bei Koblenz war das Deutsche Eck und der schimmernde Rhein zu sehen, welcher sich mit der Mosel verband. Obwohl ganz Europa in diesen Monaten einem politischen Pulverfass glich, lag eine trügerische Stille über der Stadt. Kurt Faber hatte gerade sein achtzehntes Lebensjahr vollendet und war auf die Anweisungen seines Vaters, Major Ludwig Faber, dem 30. Pionierbataillon beigetreten. Trotz der Kameradschaft fehlten ihm feste Freunde, die dem unsicheren, zurückhaltenden Burschen einen gewissen Halt gaben. Diese tiefe Freundschaft fand er nur bei einem einzigen Menschen, seinem besten Freund Friedrich Preuß. Einem starken, jungen Mann, der ebenfalls kurz vor seinem achtzehnten Geburtstag stand und dessen alter Herr, Konrad Preuß, schon ewig als Stallmeister bei den Fabers arbeitete. Doch Kurts größtes Problem lag nicht darin ein Einzelgänger zu sein, sondern in dem angespannten Verhältnis zwischen ihm, seinem Bruder Albert und dem Vater. Einem neunundvierzigjährigen Mann, der sich seinen Rang als Major hart erkämpft hatte. Wie auch bei seinem Erstgeborenen Albert, war er außer sich vor Freude, als Kurt das Licht der Welt erblickte. Voller Stolz hielt Ludwig seine Jungen im Arm und schwor sich ihnen niemals die psychischen Grausamkeiten anzutun, welche er in seiner Jungend durchmachen musste. Der Major wuchs in einer Militärfamilie auf. Da sein Vater Ferdinand Faber im Deutsch-Französischen Krieg diente, zierten all die Auszeichnungen seine Brust, die dem Jungen Respekt einflößten. Bis 1872 stieg der alte Faber aufgrund seiner Tapferkeit, Führungsstärke sowie seiner Organisations-fähigkeit zum Oberst auf. Im Alter von sieben Jahren ließ der Offizier seinen viertgeborenen Sohn schon spüren, dass er nichts für ihn übrighatte. Weder an Ludwigs Erziehung noch an seinem Werdegang zeigte der Oberst Interesse. Für ihn stand sein erstgeborener Sohn im Vordergrund, was auch zu Reibereien zwischen den Geschwistern führte. Zu oft bekam der stramme Bursche zu hören, dass er ein Versager sei und eh nichts aus ihm würde. Doch dies weckte in Ludwig den Ehrgeiz es seinem alten Herrn zu zeigen. Verbissen versuchte er die an ihn gerichteten Anforderungen zu erfüllen. Aber egal, was der junge Faber erreichte, es war nie gut genug. Nach seiner Hochzeit und der Geburt seiner beiden Söhne, nahm diese Verachtung noch schlimmere Züge an. Selbst an seinen Enkeln ließ Ferdinand kein gutes Haar. Umso erleichterter schien Ludwig, als sein alter Herr 1902 das Zeitliche segnete. Ein Stein schien ihm vom Herz zu fallen. Nun konnte er seine Burschen im militärischen Sinne erziehen, jedoch bemerkte er nicht, wie sehr er in die Verhaltensweisen seines Vaters abrutschte. Das Einzige, was seinem Glück noch fehlte, war sich im Krieg zu profilieren, um den mitschwingenden Erwartungen gerecht zu werden. Doch dieser Wunsch fand nicht nur aufgrund der ruhigen, politischen Lage, sondern auch wegen eines schweren Reitunfalls ein jähes Ende. Seit diesem Ereignis konnte er sein rechtes Bein nicht mehr bewegen und litt unter starken Schmerzen. Von einem auf den anderen Tag erkannte ihn seine Familie nicht wieder. Ludwig redete nicht über seine Pein, wie es ihm vorgelebt wurde. Immer wieder kamen ihm die Worte seines Vaters Ferdinand in den Sinn, der sagte, dass Schmerzen ein Zeichen von Schwäche seien. Sämtliche Schmerzmittel, die der Militärarzt verschrieb, vermochten es nicht seine Qualen zu lindern. Schließlich bekam die gesamte Familie seine Launen zu spüren. Je reifer Albert und Kurt wurden, umso mehr fanden sie sich mit dieser Tatsache ab. Die Söhne, welche zu Gehorsam, Respekt, Ordnung und Höflichkeit erzogen wurden schwiegen meist, wenn sie von der Militärakademie auf Wochenendurlaub waren. Major Faber sah den Krieg 1914 kommen. Daher ließ er seine die beiden Burschen, in das 30. Pionierbataillon versetzen, während er die Ausbildung der Infanteristen auf dem Asterstein leitete. Albert, der im Gegensatz zu seinem jüngeren Bruder ein aufbrausendes Temperament besaß, wollte sich mit dieser Entscheidung, welche über seinen Kopf hinweg gefällt wurde, nicht so einfach abfinden. Der Haussegen hing schief, als sich der Älteste gegen Ludwig auflehnte und seine Versetzung in eines der anliegenden Infanteriebataillone beantragte. An jedem Wochenende, an dem sie aufeinandertrafen, kam es zu derben Streitereien. Niemand wollte von seinem Standpunkt abweichen. Während Kurt dies schweigend ertrug, saß seine Mutter, Maritta Faber, stets zwischen den Stühlen. Die sechsundvierzigjährige Hausfrau wuchs in einer liebevollen, norddeutschen Handwerkerfamilie auf und kam mit diesen verbalen Auseinandersetzungen kaum zurecht. So auch an diesem Freitag, dem 24. Juli 1914. Wie immer machte sich der junge Faber zu den Offiziers-unterkünften auf, welche nur wenige Querstraßen entfernt lagen. Sein Weg führte ihn an den Stallungen vorbei, wo auch das Ross seines Vaters Unterkunft fand. Die Sonne schien noch lange nicht dem Neumond weichen zu wollen und tauchte den Rhein in ein feuriges Rot. Gebannt, fasziniert von diesem Anblick, blieb Kurt noch einen Moment stehen. Die Hände in den großen Uniformtaschen vergraben. Nicht wissend, was ihn an diesem Abend zu Hause erwartete, atmete der Rekrut noch einmal tief durch. In einem der Reitställe sah er seinen alten Freund, Friedrich Preuß, doch keine Spur von dem Major. Fritz arbeitete seit vier Jahren neben seinem Vater als Stallknecht bei Ludwig Faber. Konrad hatte seinem Sohn alles beigebracht, was er für den richtigen Umgang mit den Pferden wissen musste. Zu gerne hätte Konrad gesehen, dass Fritz den Veterenärdienst der Armee abgeleistet hätte. Mit dieser Ausbildung wäre ihm eine erfolgreiche Zukunft sicher gewesen. Er zog es vor seinem geliebten Vater hilfreich zur Hand zu gehen. Seine Eltern gaben sich mit dieser Entscheidung widerwillig zufrieden, dennoch hegten sie die Hoffnung, dass ihr vier Jahre jüngerer Sohn Wilhelm diesen Weg einschlüge. Fritz hingegen sah seinen Platz im Kreis der Familie. Nie im Leben wollte er von ihnen getrennt sein. Das Schicksal hatte jedoch andere Pläne.
Erleichtert, nicht schon jetzt auf den Major zu treffen, ging Kurt in den Stall.
„Hallo, Friedrich“, flüsterte der junge Soldat, um die Pferde nicht aufzuschrecken.
„Ach, Kurt“, sprach der Stallbursche und wischte sich verlegen den Schmutz aus dem Gesicht. „Ich habe dich nicht gehört. Entschuldige.“ Langsam näherte sich sein bester Freund dem Pferdegatter. Er wirkte in diesem Moment nervös.
„Kein Problem.“ Vorsichtig ging er zu dem pechschwarzen Hengst seines Vaters, den dieser liebevoll Zeus nannte und strich ihm behutsam über die weiße, dichte Mähne. Die Hufe pressten sich unruhig in den trockenen Boden. Der aufgewirbelte Staub drang durch jede Ritze des Holzverschlags und erschwerte das Atmen.
„Was suchst du hier?“, wollte sein alter Freund erfahren. „Es ist gleich schon sieben. Zu dieser Uhrzeit sollte sich der Sohn eines Offiziers nicht mehr auf der Straße befinden.“ Kurt strich Zeus weiterhin gedankenversunken über den Kopf.
„Wie macht sich Zeus?“
„Gut. Aber warum fragst du? Der Hengst hat dich doch noch nie interessiert.“
„Er kann ja nichts für die Launen meines Vaters.“ Der Stallbursche wusch sich eilig die Hände im nebenstehenden Wasserfass.
„Hast du dein freies Wochenende?“ Kurt nickte und starrte nachdenklich zu den Offiziersunterkünften hinüber. „Was ist los, mein Freund? Du weißt, dass du mit mir über alles sprechen kannst.“
„Hast du die letzten Meldungen aus Berlin gehört?“
„Ja. Die Spatzen pfeifen es schon von den Dächern“, antwortete Friedrich mit besorgter Miene. „Wie zu hören ist, stehen die Zeichen auf Krieg.“
„Das Gleiche habe ich auch vernommen. Wenn es so kommt, wird meine Ausbildung beschleunigt. Die Pioniere sind dann die Ersten, die in Gang gesetzt werden.“ Preuß trocknete sich die Hände ab und klopfte ihm zuversichtlich auf die Schulter.
„Keine Sorge, mein Bester. Ich lasse dich nicht im Stich. Wenn es hart auf hart kommt, melde ich mich freiwillig zu den Pionieren. Dann bist du nicht allein.“ Kurt wirkte sprachlos, gar überrascht, dass sich sein Freund in diese Gefahr begeben wollte, nur um an seiner Seite zu stehen. Gerührt von dieser Selbstlosigkeit, sprach Faber: „Ich nehme dich beim Wort. Doch ich bete zu Gott, dass es nicht so weit kommen wird.“
„Natürlich. Aber wenn alle Stricke reißen, kannst du dir meiner Unterstützung sicher sein.“ Von Weitem drang das Läuten der Koblenzer Kirchenglocken zu ihnen und der junge Faber wurde unruhig. Er schaute noch einmal in Zeus tiefschwarze Augen und wisperte: „Ich muss los, Friedrich. Mein werter Vater hasst nichts so sehr wie Unpünktlichkeit.“
„Lass dich nicht unterkriegen, Kurt.“ Der Pionierkadett verabschiedete sich und ging mit einem mulmigen Gefühl in der Magengrube die Straße entlang. Schon wenige Meter weiter sah er sein Elternhaus. Ein quadratisches, kaltes Gebäude aus Basaltstein, ohne Blumenbeete oder sonstige Grünstreifen, welche von Leben zeugten, geschweige denn diesen kalten Steinhaufen zu einem Zuhause machten. Wenn die Hausnummer nicht zu erkennen gewesen wäre, hätte er es von all den anderen Wohnungen nicht unterscheiden können. Da die Burschen keinen Schlüssel besaßen, mussten sie klopfen, um eingelassen zu werden. Ludwig befand sich noch bei seiner Infanterieausbildungseinheit und kontrollierte die Stuben der Rekruten. Maritta öffnete und nahm ihren Sohn freudig in den Arm. Sie war sich bewusst, dass ihre Buben momentan kein einfaches Leben führten. Deshalb konnte die Hausfrau, wenn ihr Gatte nicht da war, ihre ganze Liebe zeigen. In eine Kochschürze gehüllt stand die sechsundvierzigjährige Frau da. Mit bleichen Wangen und einem freudigen Lächeln, welches über den Zwist ihrer Männer hinwegtäuschen sollte.
„Mein lieber Junge“, flüsterte sie ergriffen. „Dein Bruder und dein Vater werden auch gleichkommen.“ Ehe er sich versah, zog ihn seine Mutter in den schmalen Flur und verschwand in der Küche. „Nimm schon einmal Platz. Ich komme sofort zu dir.“ Kurt zog seine Uniformjacke aus, hängte sie über einen der Stühle, welche an dem einladenden, bereits gedeckten Esstisch standen. Die alte, viktorianische Standuhr schlug acht Uhr, als sein Vater Ludwig, gefolgt von seinem Albert den Korridor betrat. Mit zorniger Miene streifte sich der Major die Handschuhe ab und warf sie auf die Anrichte. Allein der Anblick seines ältesten Sohnes versetzte ihn in Rage.
„Ist das Essen fertig?“, knurrte der Schleifer und ging wortlos an seinen Söhnen vorbei. Alles war für ein üppiges Mahl bereit. Vor jedem Familienmitglied stand ein flacher Teller, darauf eine kleine Suppenschale sowie das Besteck für ein Dreigängemenü. Ehe Ludwig am Kopfende Platz nahm, schenkte er sich noch einen Cognac ein, welchen er in dem noblen Eichenholzschrank neben dem Fenster aufbewahrte. Nach einem kräftigen Schluck zischte der Offizier abwertend: „Das Beste, was Frankreich je zu Stande gebracht hat.“ Genussvoll strich der Major über seinen angegrauten, kaiserlichen Oberlippenbart. Fordernd legte er sich die aufgefaltete Stoffserviette über den Schoß. Erneut rief er nach seiner Frau. Während Maritta beladen mit Brot, Gemüse und Fleisch aus der Küche kam, sprangen die Jungen auf. Sie wollten ihrer Mutter helfend zur Hand gehen und stellten vorsichtig die Porzellanschüsseln auf die Tischdeckenschoner. Albert nahm ihr die letzte Schale ab und Kurt ging in die Küche, um die Vorsuppe zu holen.
„Dafür sind deine Jungen gut“, murmelte Ludwig zynisch. „Sie hätten Diener werden sollen.“ Schweigend füllte jeder seinen Teller und der Herr des Hauses sprach das obligatorische Tischgebet. Während dem Essen war es so leise, dass eine fallende Stecknadel einen Heidenlärm verursacht hätte. Bis Kurt es nicht mehr ertrug. Krampfhaft versuchte er ein Gespräch vom Zaun zu brechen.
„Gibt es schon Neuigkeiten von der Obersten Heeresleitung, Herr Major?“ Dieser schüttelte desinteressiert den Kopf und schnitt sein Fleisch. „Was glaubst du, Albert? Wird es zum Krieg kommen?“ Sein zwei Jahre älterer Bruder legte sein Besteck zur Seite und faltete die Hände, als ob er ein Stoßgebet senden würde. Er wollte gerade antworten, da unterbrach Ludwig die Konversation.
„Ich habe deine Versetzung veranlasst, Albert.“ Es traf seinen Sohn wie ein Donnerschlag. Er wusste nicht, was er sagen sollte. Dies übernahm jedoch sein Vater. „Du wirst deinen Dienst, wie dein Bruder, bei den Pionieren fortsetzen.“
„Aber, Vater… Ich…“ Ludwig aß unbeirrt weiter und fuhr ihm strikt dazwischen.
„Die Würfel sind gefallen, wie Cäsar zu sagen pflegte. Ich will nicht, dass deine kümmerlichen Leistungen als Infanterist auf mich zurückfallen. Immerhin untersteht mir die Ausbildung dieser Einheit.“ Albert stand geschockt auf, was den Offizier nur noch mehr in Rage versetzte. Er duldete keinen Ungehorsam seiner Söhne Energisch, mit entschlossenem Blick, schlug er auf den Tisch und rief seinen Sohn zur Ordnung.
„Setz dich gefälligst wieder hin, Albert! Ich bin noch nicht fertig.“
„Jawohl, Herr Major.“ Maritta und Kurt hielten den Atem an. Schon lange hatten sie das Familienoberhaupt nicht mehr so verärgert erlebt. Seine schwarzen Augen funkelten. Franzi, der geliebte Schäferhund, ging angespannt in Sitzposition und beobachtete genau, was geschah. Immer noch gingen Ludwig die Worte seines Vaters durch den Kopf. Er solle gefälligst schweigen, da er noch nie im Krieg gedient habe. Nun standen seine Söhne kurz vor der Einberufung, die ihm verwehrt blieb.
„Ich sollte Stolz auf meine Söhne sein, verdammt nochmal. Stattdessen empfinde ich bloß noch Scham für euch. Wir haben uns bei eurer Erziehung alle Mühe gegeben und Zeit genommen. Anscheinend umsonst.“ Ohne seinen Jungen eines Blickes zu würdigen, genehmigte sich der Major noch einen Schluck feinsten Moselweins, ehe er seinem treuen Hund ein Stück des zähen Bratenendes reichte. Maritta versuchte die Contenance zu bewahren, obwohl ihr zum Heulen zumute war. Bis Albert genug von den Schikanen seines Vaters hatte. Er erhob erst sich und dann seine Stimme.
„Vater. Ich werde deine Entscheidung mit Freuden akzeptieren und nie wieder einen Fuß in dieses Haus setzen. Du bist der kaltherzigste Mensch, den ich je getroffen habe und es tut mir leid, dass Mama dich weiterhin ertragen muss.“
„Bist du fertig?“, fragte der alte Faber emotionslos. Sein ältester Spross salutierte demonstrativ, küsste Maritta auf die Wange und verließ die Familie. Mit dem Zufallen der Haustür wurde der liebenden Mutter bewusst, dass sie eines ihrer Kinder für immer verloren hatte. Dieser Schmerz schien wie ein glühendes Messer, das in ihre Brust getrieben wurde. Auch Kurt folgte ohne weitere Worte zu verlieren seinem Bruder. Seine Gefühle waren in diesem Moment, in dem sich die Familie für immer entzweite, kaum zu beschreiben. Entsetzt stand Maritta auf und zischte: „Bist du nun stolz auf dich? Warum hast du das getan, Ludwig? Es war Alberts Wille zur Infanterie zu gehen.“
„Dies ist meine Entscheidung, Maritta“, zischte der Major. „Es wird Krieg geben. Ich hätte an ihrer Stelle losziehen müssen, um mir ein Eisernes Kreuz zu verdienen. Ich will nicht, dass meine Söhne einen besseren Stand in der Gesellschaft haben, als ich es je hatte.“
„Ich gehe ihnen nach.“
„Tu, was du nicht lassen kannst. Die beiden haben ihre Entscheidung bereits gefällt.“ Er gab seiner Franzi ein weiteres Stück Fleisch, während seine Ehefrau den Kindern folgte. Lautstark schrie sie die Namen ihrer Jungen in die dunkle Nacht hinaus. Plötzlich ertöte Kurts Stimme.
„Mama“, rief er lautstark in die Finsternis und schaute sich nervös um. In der Ferne, im Lichtkegel einer Straßenlaterne erblickte er sie. Weinend auf dem groben Randstein sitzend. Sie hatten beide noch vergeblich versucht, den Ältesten einzuholen, aber vergebens. Albert hatte seine Wahl getroffen.
„Mama“, flüsterte Kurt und nahm sie tröstend in den Arm. „Mach dir keine Sorgen. Wir kommen schon zurecht.“
„Das heißt, dass du auch gehst?“
„Ja. Ich kann und will nicht mehr mitansehen, wie sich die beiden anschreien. Verzeih mir.“ Maritta wischte sich die Tränen ab und antwortete mit bebender Stimme: „Ich habe den Eindruck, es wird von Jahr zu Jahr schlimmer. Dein Vater will doch nur euer Bestes, auch wenn er es nicht immer zu eurer Zufriedenheit zeigt.“
„Das wir auf solche Art auseinandergehen, habe ich nie gewollt. Ich liebe dich, Mama.“
„Du bist ein guter Junge“, flüsterte sie und strich sanft über seine Wange. „Ich bin glücklich und stolz zwei so tolle Burschen großgezogen zu haben. Keiner kann mir dieses Gefühl nehmen.“ Sie blieben noch ein wenig dort sitzen. „Ich mache mir Sorgen um euch. Jetzt, da der Krieg so nahe ist.“
„Glaubst du, dass es wirklich so weit kommt?“ Maritta Faber atmete tief durch. Nervös und mit bebender Stimme antwortete sie auf diese Frage.
„Alle Zeichen stehen auf Sturm. Ich will euch nicht verlieren.“
„Wir werden dir regelmäßig schreiben. Auch Albert. Das verspreche ich dir.“ Sie umarmten sich ein letztes Mal zum Abschied. Doch, ehe er sich aufmachte, griff Maritta in die Tasche und übergab ihm einen Kettenanhänger.
„Hier. Der ist für dich.“ Vorsichtig öffnete Kurt das Amulett. „Es soll dich daran erinnern, dass ich immer an deiner Seite bin. Egal, wohin du gehst.“ In der vergoldeten Klappe befand sich ein kleines Foto von ihr. Es musste schon älter sein, denn auf diesem Bild lächelte sie. „Trag es an deinem Herzen, Kurt.“ Betrübt übergab sie ihm ein Zweites. „Gib es deinem Bruder. Sag ihm, was ich dir gesagt habe. Nun geh.“
„Ja, Mama. Das tue ich. Hab keine Angst. Falls es so kommt, wie alle sagen, werden wir schneller wieder hier sein als du denkst. Du wirst sehen, dass wir an Weihnachten zu Hause sind.“
„Hoffentlich hast du Recht.“ Kurt küsste seine Mutter auf die Wange und verschwand in Richtung der Kasernenanlage.
An dem gleichen Abend saß auch die Familie Preuß zusammen. Im Vergleich zu den Fabers war ihre Stimmung ausgelassen, gar fröhlich. Es wurde viel gelacht. Der fünfundfünfzigjährige Stallmeister Konrad Preuß war sehr stolz auf seine Söhne. Er stammte aus einfachen Verhältnissen und wusste, als Sohn eines Tagelöhners, welches Glück seine Familie hatte unter diesen Umständen zu leben. Wohlwollend reichte er die Gemüsesuppe herum. Erst seiner Frau Gabi, dann seinen Söhnen Friedrich und Wilhelm. Der Sechzehnjährige war, wie sein älterer Bruder, kräftig gebaut, jedoch nicht sonderlich groß. Aber seine tiefblauen Augen hatten etwas Faszinierendes. Friedrichs Freundin, Karla Braun, saß ebenfalls am Tisch. Sie war nur ein Jahr jünger als Fritz, doch für die Schreinertochter schien er der Richtige zu sein. Trotz der guten Stimmung, schwang auch in ihrer Familie die Angst vor einer politischen Eskalation in Europa mit. Nachdem die Schüsseln geleert waren, ergriff Friedrich das Wort.
„Ich habe heute mit Kurt gesprochen“, sprach der Siebzehnjährige voller Ernst.
„Wie geht es ihm?“, wollte sein Vater erfahren.
„Er macht sich Sorgen. Der bevorstehende Krieg bereitet ihm Kopfzerbrechen.“ Konrad schaute seine Gabi an und hielt ihre Hand. „Es kann sich nur noch um Tage handeln, bis unser Kaiser zu den Waffen ruft.“ Sein Bruder Wilhelm reagierte euphorisch.
„Ich wünschte, ich wäre schon alt genug. Sofort würde ich mich freiwillig melden.“ Entsetzt starrte Gabi ihren Jüngsten an.
„Gott sei Dank, dass du es noch nicht selbst entscheiden kannst“, raunte seine Mutter und rang um Fassung. Karla saß still neben Fritz. Sie schien zu ahnen, was ihr Freund im Schilde führte.
„Wenn Kurt an die Front geschickt wird, werde ich mit ihm gehen.“
Diese Ankündigung ließ die Eltern tief schlucken. Konrad wusste um die feste Freundschaft der Burschen. Während seine Gattin wie vom Blitz getroffen dreinschaute, nickte der alte Stallmeister bedrückt.
„Du bist dir deiner Sache sicher, mein Junge? Als Pionier bist du einer der ersten in der Schusslinie.“
„Mag sein, Papa. Aber ich bin vorsichtig, kräftig genug und kann anpacken. Wenn ich meinen Beitrag leisten vermag, dass der Krieg schnell zu einem Ende kommt, dann sei es so.“ Seine Mutter war zutiefst schockiert.
„Karla“, flehte Frau Preuß ihre zukünftige Schwiegertochter förmlich an. „Rede ihm doch ins Gewissen. Du kannst diesen Wahnsinn nicht gutheißen.“ Aber die junge Frau kannte ihren Fritz und war sich sicher, ihn nicht von einem Verzicht überzeugen zu können. So blieb der schmalen Schreinertochter nichts anderes übrig, als mit den Schultern zu zucken.
„Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du hättest auch bei den Ulanen sein können. Dann wärst du wenigstens im Hinterland stationiert… In Sicherheit.“
„Papa, ich hätte eine Ausbildung in Veterinärmedizin benötigt, welche in Frankfurt durchgeführt wird. Außerdem hast du immer gesagt, dass man für sein Glück Opfer bringen muss. Ich bin dazu bereit. Macht euch bitte keine Sorgen. Kurt und ich werden schon aufpassen.“ Schließlich brach die Nacht herein. Der Himmel war sternenklar und kein dunkler Schleier verhüllte ihr helles Licht. Karla machte sich auf den Heimweg. Sie musste in die Innenstadt, wo ihr Vater eine kleine Schreinerei unterhielt. Konrad ging vor die Tür. Er stand einfach nur da, zündete sich eine Pfeife an und blies den weißen Rauch in die frische Nachtluft.
Wilhelm half seiner Mutter beim Abwasch, während sein Bruder dem alten Stallmeister Gesellschaft leistete. Zusammen schauten sie hinauf. Die Stille und der majestätische, friedliche Anblick beeindruckten die beiden. Eine Sternschnuppe sauste vorüber.
„Hast du dir etwas gewünscht?“
„Ja, Papa. Ich befürchte nur, dass mein Wunsch nicht in Erfüllung geht.“ Konrad schwieg für einen Moment. Er wusste, dass die Entscheidung seines Sohnes unwiderruflich war.
„Noch zwei Tage, dann wirst du achtzehn. Ich denke, dir ist unter den gegebenen Umständen nicht zum Feiern zumute.“ Sein Sohn schüttelte den Kopf.
„Aber ich will den Tag trotz allem mit meinen liebsten Menschen verbringen. Es wird wahrscheinlich für lange Zeit das letzte Mal sein.“ Der Stallmeister nahm seinen Jungen in den Arm. Er grübelte über die Zukunft, bis ihm eine Idee kam.
„Du triffst doch morgen auf Major Faber?“
„Wie immer. Warum?“
„Frag ihn, ob die Möglichkeit besteht, dass er dir ein Empfehlungsschreiben für die Pioniereinheit ausstellt. Das würde vieles erleichtern und du wärst sicher in der gleichen Truppe wie Kurt.“ Friedrich war von diesem Vorschlag nicht besonders überzeugt. Wohl wissend um Fabers Gefühlsausbrüche, vor welchen der Stallknecht den größten Respekt hatte. Dies bereitete ihm größte Bauchschmerzen.
„Meinst du wirklich, er stellt mir diese Empfehlung aus?“, äußerte der stämmige Fritz seine Bedenken.
„Sei einfach nett und höflich, wie immer. Das wird schon gut gehen, glaube mir. Ich bin davon überzeugt.“
„Ich werde mein Bestes geben. Hauptsache ich komme in diese Einheit, um an Kurts Seite zu dienen.“ Nach diesem Gespräch begaben sich auch die Preuß zur Nachtruhe. Als am folgenden Morgen die Sonne aufging, war Friedrich schon lange auf den Beinen. Mit zittriger Hand trank er seinen Kaffee und legte sich schon die Sätze zurecht, um die Zustimmung des Offiziers zu erhalten. Seine Mutter packte ihm sein deftiges Pausenbrot ein. Schließlich verließ Fritz das kleine, abseitsgelegene Haus. Aus der Ferne drangen die Geräusche der einfahrenden Züge den Berg hinauf. Auf jeden gellenden Pfiff fuhr der Nächste in den Bahnhof ein. Noch nie waren so viele Uniformierte unterwegs, wie an diesem Julitag. Eine bedrohliche Stimmung lag in der Luft. Sein Blick vom Asterstein hinunter ließ die Befürchtungen wahr werden. Wie Ameisen schlängelten sich die Horden der Soldaten durch die Straßen.
Die Zeit verging. Fritz hatte Zeus schon gestriegelt, gefüttert und gesattelt, als er das laute Klacken von Fabers Gehstock auf dem gepflasterten Boden vernahm. Hastig band der Junge die Zügel an der Stallpforte fest. Sein Körper bebte vor Aufregung und die Schweißperlen sammelten sich auf der Stirn. Plötzlich schaute er in die grimmige Miene des alten Majors.
„Na, Friedrich? Ist mein Zeus bereit zum Ausritt?“
„Jawohl, Herr Major Faber.“ Prüfend strich der Offizier um seinen stolzen Hengst. Peinlichst genau nahm er die Arbeit des jungen Preuß in Augenschein.
„Hat er genügend gefressen?“
„Ja. Sogar eine Extraportion Möhren. Genau, wie Sie es wünschten.“ Ludwig griff in seine Tasche und warf ihm unverhofft eine Münze zu.
„Gute Arbeit. Hilf mir noch beim Aufsitzen.“ Zögerlich trat der Stallbursche näher, verschränkte seine Finger und half Faber mit einem kräftigen Ruck in den Sattel. Dieser wollte gerade losreiten, da hielt Fritz das Pferd an den Zügeln zurück. Ernst starrte Ludwig ihn an.
„Auf ein Wort, Herr Major.“ Er nahm seine vergoldete Taschenuhr hervor und antwortete: „Du hast zwei Minuten. Also?“
„Sie wissen, dass ich morgen achtzehn werde.“ Kurt kam ins Stocken. Seine Hände wurden feucht und das Herz hämmerte in seiner Brust.
„Dessen bin ich mir bewusst. Willst du einen freien Tag oder soll ich dir ein Geschenk machen?“, knurrte der Alte zynisch.
„Nein, Herr Major. Ich wollte Sie nur bitten, mir eine Empfehlung für das 30. Pionierbataillon auszustellen.“ Die Überraschung des Infanterieoffiziers mischte sich mit Fassungslosigkeit.
„Du willst zur Armee? Warum dann zu den Pionieren? Junge Männer mit deinen körperlichen Voraussetzungen melden sich zur Infanterie, mein Junge.“ Fritz wirkte eingeschüchtert, dennoch wollte er von seinem Vorhaben nicht abweichen.
„Es wäre mir eine Ehre der Infanterie beizutreten. Aber ich denke, dass ich zu den Vorbereitungen besser geeignet bin. Ich habe Kraft und technisches Verständnis.“
„Du weißt, der Krieg ist nicht mehr fern. Bist du dir bei deiner Entscheidung sicher? Oder ist es wegen Kurt?“ Ertappt stand Preuß wie angewurzelt da. Er sah seine Chancen schwinden. Nun blieb ihm nur noch übrig, dem Offizier zu schmeicheln.
„Es liegt mir fern in dieselbe Einheit, wie ihr Sohn zu kommen. Ich will einfach meinem geliebten Kaiser dienen und den tapferen Männern den Weg zum Sieg ebnen.“ Wenn auch skeptisch, stimmte Faber zu.
„Wenn es dir wirklich so ein ernstes Anliegen ist. Meine Enttäuschung ist groß, dich nicht unter die Fittiche nehmen zu dürfen. Aus dir hätte ein gestandener Offizier werden können… Wie auch immer. Dein Schneid gefällt mir. Sei dir meiner Unterstützung gewiss. Morgenfrüh erhältst du deine Empfehlung.“
„Haben Sie vielen Dank, Herr Major. Das bedeutet mir viel.“ Ludwig gab Zeus die Sporen und galoppierte vom Hof. Nicht aber, ohne dem Burschen noch eine Mahnung mit auf den Weg zu geben.
„Halt dich von meinen Söhnen fern. Sie werden dir ein Stolperstein in deiner glorreichen Karriere sein, auch wenn es bei den Pionieren ist.“ Einerseits erleichtert sah er Faber nach. Anderseits war er über die Art, wie er über sein eigenes Fleisch und Blut sprach, bestürzt. Bis zu seinem Schichtende hatte er niemand bei sich, mit dem er seinen Erfolg teilen konnte. Umso erleichterter wirkte der Stallknecht, nachdem er am Abend im Kreis seiner Familie darüber gesprochen hatte.
Tags darauf gratulierte ihm selbst Ludwig Faber zu seinem Geburtstag. Er überreichte ihm das heißbegehrte Schreiben und lobte seine außerordentlichen Leistungen, bevor er zu seinem Sonntagsausritt aufbrach. Womit Fritz überhaupt nicht rechnete, war, dass der Major ihn den Rest des Tages vom Dienst freistellte.
Warum reagiert er in solchem Maße positiv? Immerhin lasse ich Zeus im Stich.
Diese Frage quälte den Burschen die nächsten Stunden. Schließlich vergaß er die Vorkommnisse, geschweige denn, was um ihn herum geschah.
Schließlich warf der 4. August seine Schatten über das Land. Fritz ahnte keineswegs, was dieser Tag verändern sollte. Beschwingt ging er an seine Arbeit und mistete die Ställe aus. Er hatte gerade auf einem Strohhaufen Platz genommen, um sein Frühstück zu genießen, als die Glocken aus der Ferne Sturm läuteten. Im selben Augenblick erschien sein Vater mit ängstlicher, bedrückter Miene. In seiner Hand hielt er das Empfehlungsschreiben, welches Fritz auf dem Küchenschrank liegen gelassen hatte.
„Es ist so weit, mein Junge.“ Seine Stulle blieb dem ältesten Sohn fast im Halse stecken. Mit bebender Hand und rasendem Herzen nahm er den Brief entgegen. „England und Frankreich haben uns den Krieg erklärt.
„Warum?“, fragte Friedrich.
„Der Einmarsch ins neutrale Belgien war anscheinend zu viel des Guten. Wie man hört, hat der Kaiser in einer Ansprache zur Mobilmachung aufgerufen. Alle Streitkräfte sollen in sofortige Alarmbereitschaft versetzt werden. Das heißt, du musst nun gehen.“ Der junge Preuß spürte, dass dies ein Abschied auf unbestimmte Zeit war. Sein Vater fürchtete jedoch, seinen Sohn nie mehr wiederzusehen. Tränen füllten Konrads Augen. Schweigend nahmen sie sich ein letztes Mal in den Arm.
„Gib auf dich Acht. Du musst immer hellwach sein.“
„Ich verspreche es, Papa.“
„Tu mir bitte einen Gefallen.“ Fragend schaute Fritz seinen alten Herrn an. „Wenn du nach Hause gehst, um deine Sachen zu holen, versuche deiner Mutter die Angst zu nehmen. Sie weint ohne Unterlass, seit die Meldung kam. Und mach dir keine Gedanken. Ich halte hier die Stellung.“
„Natürlich. Du kannst dich auf mich verlassen. Danke.“ Mit einem mulmigen Gefühl winkte der besorgte Vater seinem Sohn nach und betete im Stillen um die unversehrte Rückkehr seines Friedrich. Bei dem Achtzehnjährigen überschlugen sich die Emotionen. Er schwankte zwischen Furcht, Nervosität, aber auch Neugier. Für ihn wirkte es wie ein Abenteuer, von dem niemand wusste, welches Ende es finden würde. Außer Atem rannte er durch die Querstraßen, bis hin zu seinem Elternhaus, in welchem er die besten Jahre seines Lebens verbracht hatte. Gabi wartete schon auf ihn. Auch sein jüngerer Bruder stand neben ihr. Tröstend hielt Willi sie in den Armen. Dieses Bild brannte sich in das Gedächtnis des Stallknechts ein.
„Mama, nicht weinen“, bettelte er förmlich, während auch er Gabi fest an seine Brust drückte.
„Ich habe inständig gehofft, dass dieser Kelch an uns vorübergehen möge“, schluchzte Frau Preuß. Ihr Jüngster versuchte indessen Stärke zu zeigen.
„Mach dir keine Sorgen. Es wird ja nicht lange dauern. Ich bin schneller zurück, als du denkst.“ Danach nahm er seinen Bruder in den Arm und flüsterte ihm zu: „Pass auf die beiden auf. Ich will keine Klagen hören.“ Wilhelm lächelte zuversichtlich und versicherte ihm, alles zu tun, damit es ihren Eltern gut ging.
„Ich muss nun gehen, Mama.“
„Schreib uns, wann immer du Gelegenheit dazu hast.“
„Das schwöre ich dir.“ Hastig küsste Fritz seine Mutter auf die Wange, schulterte seinen Kleidersack und machte sich auf zur Ehrenbreitstein. Die Meldestelle befand sich in der Festungsanlage, von der man einen noch majestätischeren Ausblick über Koblenz hatte. Doch je näher er kam, umso unwohler wurde ihm. Vor dem Eingang bildete sich schon jetzt eine lange Schlange. Es waren so viele Freiwillige, die eingeschrieben werden wollten, dass Friedrich sie kaum überblicken konnte. Endlich, nach zwei Stunden, stand der junge Mann vor dem Meldesoldaten. Ohne ihn eines Blickes zu würdigen, raunte der Uniformierte: „Name, Geburtsdatum, Adresse.“ Die Aufregung stieg. Sein Körper schien unter Strom zu stehen. Entschlossen sah Friedrich Preuß den Mann an, stand stramm und antwortete in zackigem Ton: „Preuß, Friedrich. Geboren am 26. Juli 1886. Wohnort… Auf dem Asterstein 6, Koblenz.“ Akribisch notierte der Offizier seine Daten und wollte ihn gerade einer Einheit zuteilen, als er die Signatur des Majors unter einem der Schreiben sah.
„Also 30. Pionierbataillon?“, murmelte er. „Mit diesem Brief ist jegliche Entscheidung hinfällig.“ Der Soldat wies auf einen riesigen Raum, gegenüber der Meldestelle, welcher gefüllt mit Uniformen war. Schwungvoll stempelte er die Einträge in die Stammrolle und die Empfehlung ab. „Weiter zur Kleiderausgabe. Danach melden Sie sich in Zimmer 8 zur medizinischen Befähigungskontrolle. Wenn der Arzt von Ihrer Tauglichkeit überzeugt ist, begeben Sie sich umgehend zum Kasernengelände auf dem Asterstein. Beeilung! Abfahrt ist bereits um vierzehn Uhr.“
„Jawohl!“, sprach Friedrich, salutierte und nahm unter dem musternden Blick eines weiteren, altgedienten Soldaten in der Ausgabe seine Uniformen entgegen. Von der Vermessung seiner Stiefelgröße, bis hin zur ärztlichen Untersuchung verging eine weitere Stunde. Es schein eine Ewigkeit zu dauern. Der Militärarzt prüfte die Lungenfunktion, horchte sein Herz ab, nahm Puls, Blutdruck und Temperatur. Nachdem er auch die Beweglichkeit des Burschen eingeschätzt hatte, setzte der Mediziner seine Unterschrift sowie den kaiserlichen Stempel unter das Gutachten.
„Viel Glück, Junge“, flüsterte der grauhaarige Mann. Seine Miene sprach jedoch eine andere Sprache. Er stand auf, salutierte vor dem Stallknecht und fuhr fort. „Sehen Sie zu, dass Sie heil zurückkommen.“ Mit der rauen, dürren Hand reichte er ihm die Bescheinigung. „Dies werden Sie brauchen. Leben Sie wohl, Herr Preuß.“ Die Zeit lief ihm zusehends davon. Ohne einen Gedanken zu verschwenden, presste sich Fritz durch die überfüllten Flure. Seine rosige Gesichtsfarbe wich der fahlen Blässe, als er auf das große Zifferblatt in der Eingangshalle starrte.
„Schon ein Uhr. Ich muss los.“ Immerhin lagen die Kasernen auf der anderen Seite des Höhenzuges. Die Hitze bereitete ihm immense Schwierigkeiten. Schwitzend, einem Schlag nahe, erreichte der Junge endlich das riesige Barackengelände. Außer Atem blieb er stehen. Ein Offizier kreuzte seinen Weg.
„Verzeihung. Können Sie mir sagen, wo ich mich als Freiwilliger melden muss?“ Rasch schaute der Soldat Preuß Unterlagen durch und wies auf ein kleines, unscheinbares Gebäude neben den Unterkünften.
„Dort drüben.“
„Haben Sie vielen Dank.“ Fritz salutierte standesgemäß und rannte mit letzter Kraft los. Inzwischen läuteten aus der Ferne die Glocken schon halb zwei, als er die Tür öffnete und an den großen Schreibtisch herantrat. Erschöpft schaute er in die Augen eines jungen Pioniers, der für die Zusammenstellung der Regimenter und die Verteilung der Freiwilligen verantwortlich war.
„Mein Gott“, raunte er entsetzt. „Sie kippen mir ja gleich um.“
„Nein. Es geht schon.“ Der Stallbursche übergab ihm die Unterlagen sowie das Empfehlungsschreiben und fuhr fort. „Man sagte mir im Rekrutierungsbüro, dass ich mich hier unverzüglich melden solle.“
„Aha… Ausgestellt von Major Ludwig Faber“, flüsterte der Meldesoldat überrascht. „30. Bataillon. Da haben Sie aber Glück gehabt. Sie befinden sich bereits im Aufbruch. Zehn Minuten später und man hätte Sie in eine andere Einheit gesteckt.“ Aufgeregt schaute sich Fritz um und fragte: „Muss ich in diese Kaserne?“
„Ja. Aber Ihre Privatkleidung bleibt hier.“ Verunsichert schaute der Rekrut drein, während der Pionier den Kleiderbeutel vor sich auf den Tisch stellte. In Windeseile zog er sämtliche Kleidungsstücke hervor und ließ ihm neben den Uniformen nur die Unterwäsche. „Mehr werden Sie nicht brauchen.“ Der Meldesoldat schob ihm die aussortierten Schmuckstücke, Erinnerungen und persönlichen Dinge zu und flüsterte: „Verstecken Sie dies gut. Es wird für lange Zeit das Einzige sein, was Sie an die Heimat erinnert.“ Nickend nahm er den Rest seiner Habseligkeiten entgegen und verließ mit dem abgestempelten Meldedokument den Raum in Richtung des Kasernengebäudes. Es war Punkt viertel vor zwei, als er eintrat und das schiere Chaos sah. Die Soldaten sowie die Rekruten packten hastig ihr Gepäck zusammen. In diesem Durcheinander etwas zu erkennen, fiel ihm sichtlich schwer. Unsicher schaute sich der Stallknecht um. Schließlich fiel ihm ein Stein vom Herzen. Inmitten des Saales voller Etagenbetten standen Kurt und Albert, die ihn in all der Aufregung nicht bemerkten.
„Wir sind einfach zu spät dran“, murrte Kurt.
„Mach weiter“, fauchte sein Bruder und steckte hastig seine Ersatzuniform in den tarngrünen Wäschebeutel. „Es hagelt drakonische Strafen, wenn wir nicht rechtzeitig zum Appell fertig sind.“
„Das weiß ich auch.“ Aus den Augenwinkeln bemerkte der jüngste Faber seinen besten Freund, der verloren an der Eingangspforte stand. Er konnte es nicht glauben, dass sein bester Freund nun wirklich da war.
„Fritz!“, rief er laut, rannte zu ihm und nahm ihn in den Arm. „Du hast es also geschafft.“
„Gott sei Dank“, flüsterte Friedrich, erschrocken von diesem Durcheinander. „Es war knapp. Fast hätte ich euch allein gehen lassen müssen.“
„Umso besser, dass du jetzt da bist, mein Freund.“ Er nahm ihn mit zu dem achten Stockbett, wo sein Bruder die letzten Handgriffe verrichtete. „Du kennst ja Albert.“ Beiläufig schüttelte dieser Friedrichs Hand. „Zieh dich schnell um. Der Zug wartet nicht auf uns.“ Noch nie zuvor hatte Friedrich so zügig seine Kleidung gewechselt. Schnell streifte er noch die Uniformjacke über, knöpfte sie zu und zog die mit grünem Stoff bedeckte Pickelhaube auf.
„Hast du deine Wertgegenstände am Mann?“, erkundigte sich Albert und schulterte sein Gepäck.
„Ja. Ich habe alles bei mir.“
„Dann lasst uns gehen.“ Im Stechschritt stürmten sie ins Freie und nahmen Aufstellung. Ihr Hauptmann Paul von Dürer erwartete seine Truppe. Es dauerte nicht lang, bis der letzte Bursche vor ihm strammstand. Dürer war ein scharfer Ausbilder, der seiner Einheit alles abverlangte. Seinen messerscharfen Blick fürchteten die Rekruten.
In Seelenruhe schritt er die Reihen ab und begutachtete die Kleidung, die Bewaffnung und das Schuhwerk. Wer nicht seinen Vorstellungen entsprach konnte sich auf was gefasst machen. Nervös, wohlwissend, dass er einige der Rekruten nie mehr wiedersehen würde, bildeten sich Falten auf der hohen Stirn des Kommandierenden und die Hand strich immer wieder über sein schütteres Haar. Nach Abschluss der Begutachtung, trat der Offizier vor seine Schützlinge.
„Männer! Ihr werdet Großartiges für euer geliebtes Kaiserreich leisten. Wir alle sind zutiefst bestürzt, dass die Verwandtschaft unseres obersten Heeresführers uns den Krieg erklärt hat. Doch ich blicke in so viele strahlende Augen, welche nur darauf brennen, diesen Krieg für und im Namen unseres Kaiser Wilhelm zu gewinnen. Auch wenn sich viele Rekruten unter euch befinden, schmälert es in keinster Weise den Willen, für unser Land zu kämpfen und zu sterben.“ Er vereidigte die jungen Soldaten auf den deutschen Kaiser und nach kurzem Schweigen fuhr der Kommandierende fort: „Viel Glück, Kameraden! Ihr seid die Vorhut… Der Stolz unseres geliebten Vaterlandes. Abmarsch!“ Im Gleichschritt setzte sich die Einheit in Bewegung. Als würde der Boden beben, schritten sie durch die Koblenzer Gassen. Je näher sie dem Bahnhof kamen, umso stärker wurde der Jubel der Bevölkerung.
„Ich hätte gern die Zuversicht dieser Menschen“, murmelte Kurt besorgt. Den Missmut seines alten Freundes vermochte Preuß nicht zu teilen. Er genoss das Aufsehen, das die Einheit auf sich zog. Albert, der sich zu seiner Linken befand, schien abwesend zu sein. Während sich das Bataillon dem Bahnsteig näherte, wurden auch die Menschenmassen dichter. Wie ein schwarzes Monster lag die bullige Lok auf den Schienen. Ihr furchterregender, grimmiger Blick drang durch Mark und Bein. Doch dafür hatten die Männer keinen Sinn. Sie ließen sich von den Küssen der Mädchen oder dem Schulterklopfen der älteren Herrschaften ablenken. Plötzlich rief eine helle Stimme aus der Masse.
„Kurt! Albert!“ Es war deren Mutter, die sich noch einmal von ihren Söhnen verabschieden wollte. Unter bitterlichen Tränen umarmte sie ihre Jungen. Fritz blieb etwas abseits. Er wollte diesen wichtigen Moment nicht stören. Suchend schaute er sich um, immer in der Hoffnung, dass auch seine Familie ihn verabschieden würde. Aber dies blieb nur ein frommer Wunsch. Frau Faber hatte jedoch ein großes Herz und nahm auch den bekannten Stalljungen zu sich, den sie schon aus den Kindertagen kannte.
„Friedrich?“, sprach Maritta ihn leise an. „Ist keiner da, der dich verabschiedet?“ Betrübt schüttelte er den Kopf. Ehe er sich versah, umarmte ihn die Offiziersfrau und sprach zu allen dreien: „Kommt mir heil zurück. Ich bin in Gedanken immer an eurer Seite.“
„Danke, Frau Faber. Das bedeutet mir viel.“ Kurt hingegen schaute sich gebannt um. Er sah, wie in riesigen Schütten die Kohlen herangekarrt wurden. Blitzschnell schippten die Heizer ihren Brennstoff in den Tender, der sich hinter der Lok befand. Nur Sekunden verstrichen, bis die starken Männer die ersten Klütten in die Feuerbüchse schaufelten und die Stöße grauen Rauchs den Schornstein verließen.
„Viel Glück. Ich bete für euch.“ Maritta gab ihren Söhnen einen Abschiedskuss, bevor sie mit Fritz zusammen den Wagon bestiegen. Albert schaute nicht mehr aus dem Fenster. Stattdessen ging er in sich und betete. Sein Bruder schaute auf die Massen, während der Stallbursche vom Jubel der Menschen in den Bann gezogen war. Er beugte sich, wie seine Kameraden, nach draußen und winkte der tosenden Menge zu.
In der brütenden Hitze dieses Augustnachmittags setzte sich die Bahn unter schrillen Pfiffen in Bewegung. Mit lautem Klacken der Räder auf den Schienen nahmen sie Fahrt auf. Letztendlich verschwand die Heimat hinter ihnen am Horizont.
„Weißt du, wohin die Reise geht?“, fragte Friedrich. Kurt zuckte nur abwesend mit den Schultern.
„Davon war nie die Rede. Vielleicht Belgien. Aber auch Frankreich ist möglich… Ich habe keine Ahnung.“
2. Kapitel
Auch in der Normandie, im Norden Frankreichs, war eine Woche vorher die Aufregung spürbar. Gebannt diskutierten die Fischer und Bauern des idyllischen Fischerortes Honfleur über die Meldungen, welche in den Tageszeitungen abgedruckt wurden. Dazu trafen sie sich jeden Abend bei Michèl Vandrais in dem kleinen gemütlichen Eckbistro, nahe dem Hafen. Unter ihnen befanden sich zu dieser Zeit regelmäßig der Bauer Samuel Sinclair und sein bester Freund, der ansässige Schmied Patrick Grouché. Die beiden kannten sich schon seit der Kindheit. Wie ihre Väter, pflegten auch die Söhne, Gilbert Sinclair und Philippe Grouché, eine enge Freundschaft. Wann immer sie eine Möglichkeit hatten, trafen sie sich, um zu fischen oder zu jagen. Insbesondere die Monate, in denen die Vögel gen Süden zogen oder zurückkehrten, boten einen nützlichen Zeitvertreib. Dann kauerten sie in einem groben Verschlag nahe den Feldern, welcher von Gilberts Großvater, Richard Sinclair, errichtet wurde. Er weihte die beiden Burschen in die Vogeljagd ein, denn diese waren ein Ärgernis für jeden Landwirt, da sie den Samen aus dem Boden pickten.
Drei Jahre zuvor erlitt Richard einen Schlaganfall, der ihn aus seinem täglichen Leben riss. Obwohl sich Väter und Söhne an fast jedem Abend in dem Bistro trafen, blieben die alten Herren diesmal allein. Die Sonne strahlte immer noch und nur der frische Meereswind brachte die nötige Abkühlung.
„Weißt du, wo unsere Burschen bleiben?“, fragte der neunundvierzigjährige Patrick, nahm noch einen Schluck Rotwein und rieb sich die schwieligen Hände.
„Je ne sais pas. Aber ich denke, sie werden noch Vögel schießen. Eine wahre Plage. Dieses Jahr picken sie mir das gesamte Saatgut aus den Feldern.“ Auch Samuel trank in einem Zug sein Glas aus und wandte sich an den Wirt.
„Michèl? Hast du neue Nachrichten für uns?“ Der grauhaarige Bistrobesitzer kratze sich nachdenklich am Kopf.
„Non, mon ami. Es ist erschreckend ruhig.“ Besorgt um die politische Lage und die Zukunft ihrer Söhne, sah der Bauer seinen Freund an.
„Hast du vielleicht schon etwas gehört?“
„Kein Sterbenswörtchen. Aber ich denke, es ist nur die Ruhe vor dem Sturm… Warten wir es ab. Es liegt eh nicht in unserer Hand.“
„Wahrscheinlich hast du Recht. Dennoch mache ich mir Gedanken um unsere Jungen. Ich hoffe, dass sie sich nicht freiwillig zum Dienst melden.“ Samuel starrte aus der breiten Fensterscheibe, hinaus auf den kleinen Hafen. Die leichten Wellen brachen sich sanft an der Kaimauer. „Ich vermag es nicht, meinem Gilbert Vorschriften zu machen. Dies muss er selbst entscheiden. Sie werden eh bald zur Wehrpflicht zurückkehren. Das fühle ich… Und dann haben sie keine Chance mehr, diesem Wahnsinn zu entgehen.“ Der kräftige, wenn auch mit seinen ein Meter sechzig nicht sehr groß geratene Landwirt wirkte betrübt. Nervös zündete er sich noch eine Gitane an. Die Zukunftsaussichten ihrer Söhne gefielen dem gestandenen Mann überhaupt nicht. Dem Schmied erging es genauso. Auch wenn er wusste, dass das geschichtliche Rad nicht aufzuhalten war, bangte er ebenso um die Gesundheit ihrer Söhne. Nun kamen auch Samuel Bedenken, nachdem er auf die Uhr geschaut hatte.
„Wo bleiben die Zwei?“
„Vielleicht sind sie schon zu Hause. Immerhin warten Claire und Sophie auf sie.“ Doch die jungen Männer saßen in ihrem Verschlag und hatten die Zeit vergessen. Gilbert nahm mit der Büchse seines Opas die Vogelscharen ins Visier, die sich auf einem Feld, welches in diesem Jahr brach lag, an Saatresten bedienten.
Die beiden Freunde wuchsen in behüteten Verhältnissen auf. Respekt, Liebe und Höflichkeit waren ihren Eltern sehr wichtig. Gilbert wurde nach dem Tod seiner Mutter in die Rolle des jungen Bauern hineingepresst. Bis zu sechzehn Stunden auf dem Feld waren in der Frühlings-, Sommer- und Herbstzeit nichts Besonderes. Philippe hingegen arbeitete erst seit vier Jahren, nach Ende der Grundschulzeit, zusammen mit seinem Vater in der elterlichen Schmiede. Auch wenn er nicht die körperliche Stärke von Gilbert besaß, hatte er andere Tugenden. Der junge Schmied verfügte über einen hohen technischen Sachverstand und vermochte es Probleme jeglicher Art schnell zu lösen. Sein einziger Makel bestand in seiner Ungeduld, was Patrick seinem Sohn auf spielerische Art und Weise versuchte abzugewöhnen. Streitereien, zum Beispiel auf dem Schulhof des Fischerorts Honfleur, ging der junge Grouché stets aus dem Weg. Er sah keinen Sinn in der Gewalt. Ebenso wenig wie sein Freund Gilbert Sinclair.
Beide waren hart arbeitende, junge Männer, denen das Wohl ihrer Liebsten am Herzen lag. Sie hätten alles dafür gegeben, Schaden von ihren Liebsten fernzuhalten. Angespannt saßen die beiden im Unterstand.
„Ich habe wieder einen“, flüsterte Gilbert, hielt den Atem an und spannte unter einem lauten Klacken den Ladehebel. Plötzlich erschütterte ein dumpfer Knall den Unterstand. Eine riesige Schar erhob sich aufgeschreckt in den Abendhimmel.
„Klasse. Du hast einen erwischt“, wisperte der junge Grouché, ehe er nach dem Jutesack griff, indem sie später die leblosen Körper sammelten. „Der Wievielte war das jetzt?“ Sinclair rechnete nach und antwortete: „Fünfundzwanzig.“
Während die langsam sinkende Julisonne das Meer in ein warmes Gold tauchte, wurde die Stimmung der Freunde ernst.
„Gibt es eigentlich etwas Neues? Ich habe heute noch keinen Blick in die Zeitung werfen können.“
„Es wird Krieg geben. Die Frage ist nur wann. Wenn du mich fragst, dauert es nicht mehr lange“, sprach der junge Sinclair. „Ich werde mich schon frühzeitig freiwillig melden. Gehst du mit mir?“ Philippe überlegte kurz und nickte entschlossen.
„Ich habe keine Angst davor. Immerhin ist es zum Wohle unserer Nation.“ Gilbert legte erneut an und der nächste Vogel fiel seiner Kugel zum Opfer. Er nahm das Gewehr zur Seite. Mit ruhiger Hand lud der Bursche die restlichen Patronen nach.
„Ich denke an die Pioniere.“
„Wieso die Pioniere?“, fragte Philippe.
„Alles besser, als in der Infanterie zu dienen und schon zu Beginn erschossen zu werden.“ Grouché grübelte.
„Einverstanden“, antwortete sein Freund, ohne einen weiteren Gedanken zu verschwenden. Doch Gilbert schien mehr zu bedrücken.
„Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich es Sophie beibringen soll. Wir wollen heiraten, eine Familie gründen. Das alles wäre in Gefahr.“
„Früher oder später werden wir eh eingezogen.“
„Du hast Recht“, murmelte Gilbert.
„Lass uns hoffen, dass ihre Gebete ein offenes Ohr bei unserem Herrn finden.“ Sinclairs Aufmerksamkeit richtete sich wieder auf das Feld und die Schwärme, die sich darauf tummelten. Plötzlich fragte Philippe: „Weißt du, wie spät es ist?“
„Mon Dieu! Schon kurz vor acht… Lass uns für heute Schluss machen.“ Nachdem sie die leblosen Vögel verstaut hatten, gingen sie zusammen den fünfhundert Meter langen Feldweg entlang, welcher von den Äckern nahe der See in ihr geliebtes Honfleur führte.
„Wir haben ganz vergessen bei Michèl vorbeizuschauen. Unsere Väter werden sich bestimmt schon Sorgen machen.“
„Willst du noch zum Bistro gehen?“, erkundigte sich Gilbert, den Sack über der rechten Schulter, das Gewehr über der anderen.
„Wie sieht es bei dir aus?“
„Non, mon ami. Ich werde mich gleich noch um die Tiere kümmern, eine Kleinigkeit essen und dann schlafen. Es war ein strammer Tag.“
„Oui. Ich glaube, das ist ein guter Vorschlag.“ Sie verabschiedeten sich voneinander, bevor die Freunde ihrer Wege gingen. Als Gilbert den Hof erreichte, waren die Kühe bereits gefüttert, das restliche Heu aufgeschichtet und die Ställe gesäubert. Mit einem schlechten Gewissen betrat er sein Elternhaus. Außer Samuel saßen alle schon am breiten Esstisch. Während sein Großvater in die Tageszeitung vertieft war, bereitete seine jüngere Schwester, Florence, belegte Brote zu. Die Sechzehnjährige kümmerte sich um den gesamten Haushalt, da ihre Mutter von ihnen gegangen war. An manchen Tagen lag sie noch lange wach und weinte sich in den Schlaf.
„Bitte leg die Zeitung zur Seite, Grand-père. Es gibt gleich Essen“, forderte die junge Frau den alten Bauer entschlossen auf, um sich in diesem Männerhaushalt zu behaupten.
„Ich esse heute Abend nichts“, flüsterte Richard, dessen linke Gesichtshälfte von dem Schlaganfall gezeichnet war. Er hatte größte Schwierigkeiten sein Augenlid offen zu halten. Ebenso machte ihm die Taubheit in Arm und Bein schwer zu schaffen. Doch am meisten störte ihn die Lähmung in der Lippe, die seine Sprache verwaschen klingen ließ.
„Du musst etwas zu dir nehmen, Opa.“
„Dann gib mir halt ein kleines Stück Baguette und ein bisschen Ziegenkäse. Mehr brauche ich nicht.“ Überrascht schauten die beiden drein, als Gilbert ohne seinen Vater den Raum betrat. Wortlos trat er an den Tisch, küsste seine Schwester, danach seinen Großvater und nahm Platz.
„Bist du allein?“
„Ja, Florence. Ich habe über die Jagd die Zeit vergessen. Excuse-moi.“
Nur wenige Minuten verstrichen, bis die Haustür abermals in die Angeln fiel und auch Samuel Sinclair in die Küche kam. Gezeichnet von den Strapazen des langen Tages freute sich der Bauer auf das Mahl und endlich die Füße hochlegen zu dürfen.
„Wo warst du?“, erkundigte sich Samuel. „Patrick Grouché und ich haben im Bistro auf euch gewartet.“ Der Alte Bauer wirkte verärgert über die Gedankenlosikeit.
„Ich weiß, Papa. Aber wir hatten so viel mit den Vogelschwärmen zu schaffen… Es war einfach schon zu spät.“ Der starke, gedrungene Bauer nickte verständnisvoll und bediente sich an den belegten Baguettes. Doch es blieb ihm nicht verborgen, dass sein Sohn noch ein anderes Problem mit sich herumschleppte.
„Was ist los, Junge? Willst du darüber reden?“ Gilbert biss ein letztes Mal in sein Brot und schob den Teller von sich weg.
„Mon Dieu“, fuhr sein Großvater dazwischen, der mit dem Abendessen bereits fertig war und wieder in der Zeitung stöberte. „Wenn man unserem Präsidenten Poincaré Glauben schenkt, steht Europa vor einer Katastrophe.“
„Das ist der Grund, Papa.“ Samuel Sinclair stutzte, denn er wusste nicht, worauf sein Sohn hinauswollte. „Ich werde mich einschreiben lassen.“