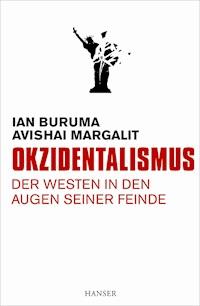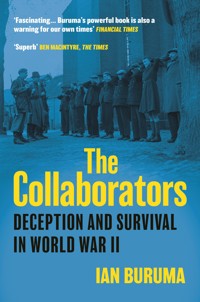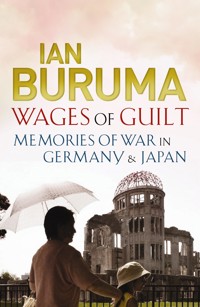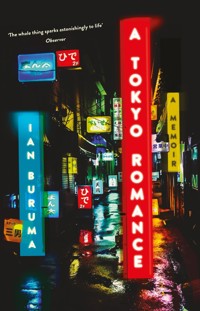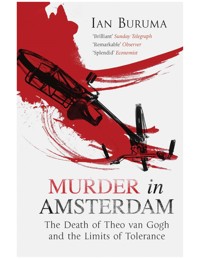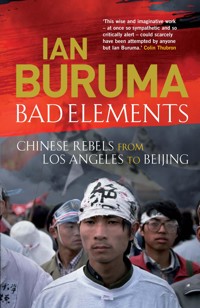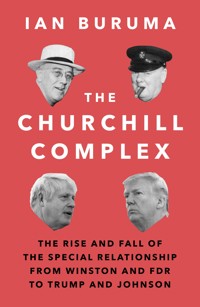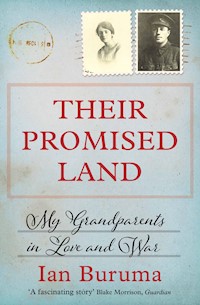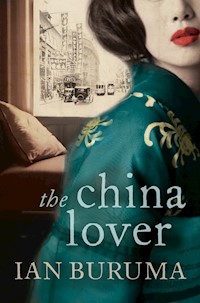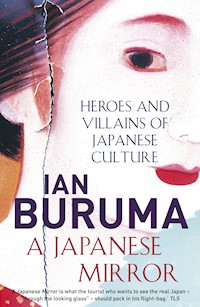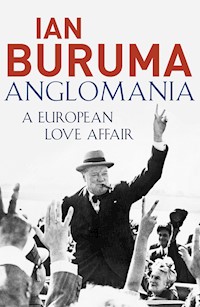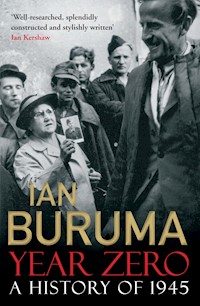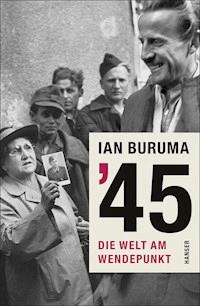
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Ende des Zweiten Weltkriegs setzte die bis heute letzte globale Zäsur – Ende und Anfang, die in unzählige einzelne Bilder und Geschichten zerfallen. Der niederländisch-amerikanische Historiker Ian Buruma hat Hunderte persönlicher Erinnerungen und Berichte aus Europa und Asien zu einer großen Geschichte der Welt zur Stunde Null zusammengefügt. Er erzählt von Feinden, die zu Befreiern wurden, blühenden Schwarzmärkten, Militärgerichten und Lynchjustiz, von Siegern und Besiegten, von Trauer, Angst und grenzenloser Freude. So anschaulich und vielstimmig war noch nie über den dramatischen Sommer 1945 zu lesen, in dem das Fundament für unsere Gegenwart gelegt wurde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 599
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Hanser E-Book
Ian Buruma
’45. Die Welt am Wendepunkt
Aus dem Englischen von Barbara Schaden
Carl Hanser Verlag
Titel der Originalausgabe:
Year Zero. A History of 1945
First published in the United States in 2013 by
The Penguin Press, a member of Penguin Group (USA) LLC.
First published in Great Britain in 2013 by Atlantic Books,
an imprint of Atlantic Books Ltd.
ISBN 978-3-446-24855-7
Copyright © 2013 by Ian Buruma
All rights reserved
Alle Rechte der deutschen Ausgabe:
© Carl Hanser Verlag München 2014
Umschlag: Peter-Andreas Hassiepen, München
Foto: Have You Seen Him?, 1947, © Ernst Haas/Getty Images
Satz: Greiner & Reichel, Köln
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Für meinen Vater, S.L. Buruma,
und Brian Urquhart
Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen, und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muß so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, daß der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm.
Walter Benjamin,
»Über den Begriff der Geschichte«, IX.
Inhalt
Prolog
Teil 1 Befreiungskomplex
Kapitel 1 Jubel
Kapitel 2 Hunger
Kapitel 3 Vergeltung
Teil 2 Trümmerbeseitigung
Kapitel 4 Heimkehr
Kapitel 5 Entgiftung
Kapitel 6 Rechtsstaatlichkeit
Teil 3 Nie wieder
Kapitel 7 Ein Tag, der strahlend hell beginnt
Kapitel 8 Zivilisierung der Unmenschen
Kapitel 9 Eine Welt
Epilog
Bilder
Anmerkungen
Bildnachweis
Textnachweis
Namenregister
Prolog
Es ist etwas an der Geschichte meines Vaters, das mich lange ratlos gemacht hat. Wie er den Zweiten Weltkrieg erlebt hat, ist für einen Mann seines Alters und seiner Herkunft nicht besonders ungewöhnlich. Es gibt viele schlimmere Geschichten; dabei war die seine schlimm genug.
Ich war noch ziemlich jung, als ich zum ersten Mal von seinen Kriegserlebnissen erfuhr. Im Unterschied zu anderen war er gar nicht zugeknöpft, obwohl manche Erinnerungen bestimmt schmerzhaft waren. Und ich hörte sie gern. Es gab sogar gewissermaßen Illustrationen dazu, nämlich winzige Schwarzweißfotos in einem Album, das ich mir zu meinem Privatvergnügen aus einer seiner Schreibtischschubladen holte. Dramatische Bilder waren es nicht, aber sie waren befremdlich genug, um mich ins Grübeln zu bringen: Fotos von einem primitiven Arbeitslager in Ostberlin, von meinem Vater, der mit einer grotesken Grimasse einen offiziellen Fototermin sabotiert, von beflissen wirkenden Deutschen mit Naziabzeichen am Revers, von Sonntagsausflügen an einen nahe gelegenen See, von blonden ukrainischen Mädchen, die den Fotografen anlächeln.
Das waren die relativ guten Zeiten. Fraternisierung mit Ukrainern war sicher verboten, aber die Erinnerung an die ukrainischen Frauen ruft bei meinem Vater heute noch einen wehmütigen Blick hervor. Es gibt keine Fotos von ihm, als er vor Hunger und Erschöpfung dem Tod nah war, als er von Ungeziefer geplagt wurde, einen wassergefüllten Bombenkrater als Gemeinschaftstoilette ebenso wie als einzig verfügbare Waschgelegenheit nutzte. Was mich ratlos machte, war nichts dergleichen, sondern etwas anderes, das später vorfiel, als er schon wieder zu Hause war.
Zu Hause, das war das weitgehend katholische Nijmegen im Osten von Holland, der 1944 Schauplatz der Schlacht um Arnhem war. Nijmegen wurde nach schweren Kämpfen von den Alliierten eingenommen, und Arnhem war die Stadt aus Die Brücke von Arnheim. Mein Großvater war in den zwanziger Jahren als protestantischer Geistlicher einer relativ kleinen Gemeinde von MennonitenI hierher versetzt worden. Vom Elternhaus meines Vaters in Nijmegen kam man zu Fuß nach Deutschland. Und nachdem Deutschland vergleichsweise billig war, wurden die meisten Familienferien jenseits der Grenze verbracht, bis um das Jahr 1937 die Nazipräsenz selbst für Touristen unerträglich geworden war. Mein Vater und seine Eltern und Geschwister wurden Augenzeugen, wie in einem Lager der HJ mehrere Jungen von uniformierten Jugendlichen schwer verprügelt wurden. Während einer Schifffahrt auf dem Rhein brachte mein Großvater (vielleicht absichtlich) die deutschen Passagiere in Verlegenheit, indem er Heinrich Heines Lorelei rezitierte. (Heine war Jude.) Meiner Großmutter reichte es: Keine Ferien in Deutschland mehr. Drei Jahre später strömten deutsche Truppen über die Grenze.
Das Leben ging weiter, auch unter deutscher Besatzung. Für die meisten Niederländer war es, solange sie keine Juden waren, immer noch merkwürdig normal, jedenfalls in den ersten ein, zwei Jahren. Mein Vater immatrikulierte sich 1941 zum Jurastudium an der Universität von Utrecht. Um eine Zukunft als Anwalt zu haben, war es damals – und ist es in gewissem Maß noch heute – zwingend, Mitglied in einer Verbindung zu werden, dem Studentenkorps, das exklusiv und ziemlich teuer war. Obwohl sozial angesehen, verdiente ein evangelischer Geistlicher nicht genug, um sämtliche Ausgaben meines Vaters zu bestreiten. Daher beschloss ein Onkel von der wohlhabenderen mütterlichen Seite der Familie, die gesellschaftlichen Verpflichtungen meines Vaters zu subventionieren.
Als mein Vater dem Korps beitrat, waren Studentenverbindungen jedoch bereits verboten, denn bei der deutschen Obrigkeit galten sie als potenzielle Widerstandsnester. Kurz zuvor waren jüdische Professoren von den Universitäten ausgeschlossen worden. In Leiden protestierte der Dekan der juristischen Fakultät, Rudolph Cleveringa, in seiner berühmt gewordenen Rede gegen den Ausschluss jüdischer Kollegen und hatte für den Fall seiner Verhaftung, die tatsächlich nicht auf sich warten ließ, schon Zahnbürste und Wäsche zum Wechseln gepackt. Studenten, viele von ihnen aus dem Korps, traten in Streik. Die Leidener Uni wurde geschlossen. In Amsterdam war die Studentenverbindung von den eigenen Mitgliedern aufgelöst worden, nachdem die Deutschen jüdische Studenten entfernt hatten.
Aber in Utrecht blieb die Universität offen, und die Studentenverbindung gab es noch, allerdings im Untergrund. Das bedeutete, dass die recht brutalen Einführungsrituale im Geheimen stattfinden mussten. Erstsemestrige, im Korps »Föten« genannt, wurden nun zwar nicht mehr zur Kopfrasur gezwungen, womit sie sich den Deutschen verraten hätten, aber es war noch immer üblich, die Föten wie Frösche hüpfen zu lassen, ausgedehntem Schlafentzug zu unterwerfen, zu versklaven und sie überhaupt mit einer Vielzahl sadistischer Spiele nach Lust und Laune der Älteren zu demütigen. Mein Vater unterzog sich der Tortur widerspruchslos, wie andere seiner Schicht und seines Bildungsstandes. So war es damals eben (und ist es immer noch). Es war, wie sie es recht pedantisch auf Latein ausdrückten, mos, die Sitte.
Anfang 1943 mussten junge Männer eine andere, folgenreichere Prüfung bestehen. Die deutschen Besatzer befahlen allen Studenten, einen Treueeid zu unterschreiben, mit dem sie schworen, sich jeglicher gegen das »Dritte Reich« gerichteter Handlungen zu enthalten. Wer sich weigerte, hieß es, würde nach Deutschland deportiert und Zwangsarbeiter in der NS-Rüstungsindustrie. Wie fünfundachtzig Prozent seiner Kommilitonen weigerte sich mein Vater und tauchte unter.
Später im Jahr erhielt er vom studentischen Widerstand in Utrecht die Aufforderung, in seine Heimatstadt zurückzukehren. Der Grund dafür ist unklar. Vielleicht war es ein dummer Fehler, aus einer momentanen Panik heraus begangen, oder es war einfach ein Fall von Inkompetenz; es waren schließlich Studenten, keine abgebrühten Guerillakämpfer. Mein Vater wurde von seinem Vater zum Bahnhof begleitet. Leider hatten sich die Nazis genau diesen Moment ausgesucht, um junge Männer für den Arbeitsdienst in Deutschland einzusammeln. Deutsche Polizisten riegelten auf beiden Seiten den Bahnsteig ab, und es hieß, dass für jeden, der entkam, die Eltern zur Verantwortung gezogen würden. Mein Vater wollte seine Eltern nicht in Verlegenheit bringen und unterschrieb. Es war ein rücksichtsvoller, aber kein besonders heroischer Akt, und er macht ihm gelegentlich noch heute zu schaffen. Zusammen mit anderen Männern kam er in ein scheußliches kleines Konzentrationslager, in dem holländische Verbrecher von der SS in den brutalen Techniken ihres Handwerks ausgebildet wurden. Nach kurzem Aufenthalt dort arbeitete mein Vater bis Kriegsende in einer Berliner Fabrik, wo er Bremsen für Eisenbahnzüge herstellte.
Es war eine zwiespältige Erfahrung, wenigstens am Anfang. Solange sie keinen aktiven Widerstand gegen die Deutschen leisteten, blieb den holländischen Werkstudenten das KZ erspart. Die Ödnis der Fabrikarbeit, die Schande, die es bedeutete, für den Feind zu arbeiten, und das physische Ungemach eiskalter, ungezieferverseuchter Baracken hatten unerwartete Kompensationen: Mein Vater erinnert sich, dass er Konzerte der Berliner Philharmoniker unter Wilhelm Furtwängler besuchte.
Auch in der Fabrik der Knorr-Bremse AG mag nicht alles so gewesen sein, wie es zunächst schien. Ein schweigsamer, dunkelhaariger Mann namens Elisohn pflegte sich diskret zu entfernen, wenn ihn ein holländischer Werkstudent ansprach, und außer ihm gab es noch andere, die vor zu engem Kontakt zurückschreckten, Männer mit Namen wie Rosenthal. Viel später vermutete mein Vater, dass in der Fabrik wohl Juden versteckt wurden.
Schlimmer wurde es im November1943, als die Royal Air Force mit dem Luftkrieg gegen die deutsche Hauptstadt begann. 1944 bekamen die Lancaster-Bomber der RAF Unterstützung von amerikanischen B-17. Aber die großflächige Zerstörung Berlins samt seinen Bewohnern begann eigentlich erst Anfang1945, als Bomben und Feuerstürme mehr oder weniger an der Tagesordnung waren. Die Amerikaner griffen bei Tag an, die Briten bei Nacht, und im April nahmen die sowjetischen Katjuschas, die »Stalinorgeln«, die Stadt vom Osten her unter Beschuss.
Manchmal gelang es den Studenten, sich in Luftschutzbunker und U-Bahn-Stationen zu drängen – ein Privileg, das KZ-Häftlingen in der Regel nicht zuteilwurde: Manchmal war ein hastig angelegter Graben der einzige Schutz vor Bombenangriffen, die, wie mein Vater sich erinnert, von den Studenten zugleich begrüßt und gefürchtet wurden. Eine der schlimmsten Qualen war der Schlafmangel, denn Bombardierung und Granatfeuer ließen praktisch nie nach. Es herrschte ein Dauerlärm aus Luftschutzsirenen, Explosionen, Schreien, fallenden Trümmern und berstendem Glas. Und doch bejubelten die Studenten die englisch-amerikanischen Bombenflugzeuge, die sie ohne weiteres hätten umbringen können – wie es manchmal auch der Fall war.
Im April 1945 war das Arbeiterlager unbewohnbar geworden: Wind und Feuer hatten Dächer und Wände hinweggefegt. Über einen Kontakt, den möglicherweise eine der weniger nazifizierten protestantischen Kirchen hergestellt hatte, fand mein Vater Obdach in einer vorstädtischen Villa, deren Eigentümerin, Frau Lehnhard, bereits mehrere Flüchtlinge aus der ausgebombten Berliner Innenstadt aufgenommen hatte; neben anderen das Ehepaar Dr. Rümmelin, Anwalt, und seine jüdische Frau. In ständiger Angst, sie könne abgeholt werden, hatte der Mann stets einen Revolver bei sich, denn im Fall ihrer Verhaftung wollten sie zusammen sterben. Frau Lehnhard sang gern, sie pflegte das deutsche Kunstlied, und mein Vater begleitete sie auf dem Klavier: Es war, wie er es ausdrückte, »ein letzter Rest Zivilisation« im Chaos von Berlins letzter Schlacht.
Auf seinem Weg in die Ostberliner Fabrik kam mein Vater durch die zerbombten Straßen, wo sich sowjetische und deutsche Truppen einen Häuserkampf lieferten. Am Potsdamer Platz stand er hinter den Stalinorgeln, die mit ihrem unverwechselbaren beängstigenden Pfeifen Hitlers Reichskanzlei beschossen. Er behielt davon einen lebenslangen Schrecken vor lautem Knallen und Feuerwerksraketen zurück.
Irgendwann Ende April, vielleicht auch Anfang Mai 1945 kamen sowjetische Soldaten auch in Frau Lehnhards Haus. Normalerweise fanden in solchen Fällen Gruppenvergewaltigungen statt, die keine Rücksicht auf das Alter der Frauen im Haus nahmen. Hier geschah nichts dergleichen. Mein Vater aber wäre beinahe ums Leben gekommen, als Dr. Rümmelins Revolver entdeckt wurde. Nachdem keiner der Soldaten ein Wort Englisch oder Deutsch konnte, war jeder Versuch, das Vorhandensein der Waffe zu erklären, sinnlos. Die beiden Männer im Haus, Dr. Rümmelin und mein Vater, wurden an die Wand gestellt. Mein Vater nahm es mit Fatalismus. Er hatte inzwischen so viel Tod gesehen, dass ihn sein eigenes bevorstehendes Ende nicht weiter überraschte. Doch ein Zufall der existenziellen Art sorgte dafür, dass in dem Moment ein russischer Offizier auftauchte, der Englisch konnte. Und dieser Offizier glaubte Dr. Rümmelins Geschichte: Die Hinrichtung wurde abgeblasen.
Zwischen meinem Vater und einem anderen sowjetischen Offizier, einem Oberschullehrer aus Leningrad, entstand eine gewisse Beziehung. Weil sie keine gemeinsame Sprache hatten, verständigten sie sich mit gesummten Phrasen von Beethoven und Schubert. Dieser Offizier, Walentin hieß er, nahm ihn mit zu einem Treffpunkt irgendwo in der Trümmerlandschaft, die einst eine Arbeitervorstadt in Westberlin gewesen war; von hier aus sollte sich mein Vater zu einem DP-Lager (für displaced persons) im Osten der Stadt durchschlagen. Auf seinem Irrweg durch die Ruinen schloss sich ihm ein anderer Holländer an, möglicherweise ein Nazikollaborateur oder ehemaliger SS-Mann. Nachdem mein Vater seit mehreren Wochen weder richtig geschlafen noch gegessen hatte, konnte er vor Schwäche kaum noch gehen.
Und sie waren auch noch nicht sehr weit gekommen, als mein Vater zusammenbrach. Sein zwielichtiger Gefährte schleppte ihn in ein bombenbeschädigtes Haus, in dem seine Freundin, eine deutsche Prostituierte, in einem Zimmer mehrere Stockwerke über der Erde wohnte. Mein Vater erinnert sich nicht, wie er hinaufkam und was danach geschah; wahrscheinlich war er die meiste Zeit bewusstlos. Aber die Prostituierte rettete ihm das Leben, denn sie päppelte ihn so weit wieder auf, dass er es bis zum DP-Lager schaffte, wo über tausend Menschen aller Nationalitäten, darunter auch KZ-Überlebende, mit einem einzigen Wasserhahn auskommen mussten.
Ein Foto von meinem Vater, das mehr als ein halbes Jahr später in Holland entstand, zeigt ihn noch immer aufgedunsen vom Hungerödem. Er trägt einen Anzug, der ihm kaum passt; vielleicht ist es der, den er von einer mennonitischen Wohltätigkeitsorganisation in den USA erhielt, die Hose voller Urinflecken, oder es ist ein Erbstück von seinem Vater. Aber, obwohl aufgequollen und bleich, wirkt er auf diesem Foto sehr munter, wie er inmitten lauter Gleichaltriger steht, die alle den Bierkrug heben, den Mund weit geöffnet – vielleicht jubeln sie oder singen ein Studentenlied.
Er war zu seiner Utrechter Verbindung zurückgekehrt. Das muss im September 1945 gewesen sein, mein Vater war zweiundzwanzig. Weil die Aufnahme der Neulinge in Kriegszeiten im Geheimen und entsprechend reduziert stattgefunden hatte, bestanden die Alten Herren jetzt darauf, die schikanösen Rituale zu wiederholen. Mein Vater erinnert sich aber nicht, dass er froschhüpfen musste oder allzu brutal herumgestoßen wurde. Diese Art der Behandlung war den Jüngeren vorbehalten, den Neulingen an der Uni, manche von ihnen vielleicht frisch aus Lagern, die noch viel schlimmer gewesen waren als das meines Vaters. Vermutlich waren jüdische Studenten unter ihnen, die jahrelang von mutigen Nichtjuden, die damit den eigenen Hals riskierten, unter den Dielenbrettern versteckt worden waren. Aber mein Vater erinnert sich nicht, dass man sich um derlei groß Gedanken gemacht hätte; an persönlichen Geschichten, jüdischen oder anderen, war niemand interessiert, denn eine persönliche Geschichte hatte jeder, und unerfreulich waren die meisten. Im Rahmen ihrer Aufnahme in die Verbindung mussten sich die neuen »Föten« anschreien, demütigen und in winzige Kellerabteile quetschen lassen (ein Spiel, das in Korpskreisen später »Dachau« hieß).
Und das ist es, was mich ratlos machte. Wie konnte mein Vater nach allem, was er erlebt hatte, ein derart groteskes Verhalten hinnehmen? Gab es niemanden, der das zumindest befremdlich fand?
Nein, versicherte mein Vater wiederholt. Nein, alle fanden es normal. Es war so üblich – mos eben: Niemand stellte den Brauch in Frage. Später schränkte er seine Aussage dahingehend ein, dass er sagte, er hätte es ungehörig gefunden, einen jüdischen Überlebenden zu schikanieren; aber er könne nur für sich sprechen.
Ich stand vor einem Rätsel, aber nach und nach, glaube ich, begann ich zu begreifen. Es war eben normal. Die Menschen damals waren so wild entschlossen, die Welt wiederherzustellen, die sie vor der Naziokkupation, vor den Bomben, Lagern und Morden gekannt hatten, dass ihnen die Schikanierung von »Föten« tatsächlich nicht weiter erwähnenswert schien. Es war ein Weg zurück zum früheren Zustand, sozusagen ein Heimweg.
Denkbar ist natürlich auch, dass Männer, die unaussprechliche Gewalt erlebt hatten, solche Studentenspiele als vergleichsweise harmlose Späße der Jugend betrachteten. Wahrscheinlicher aber ist, dass diejenigen, die mit der größten Begeisterung die Neulinge im Korps schikanierten, auch jene waren, die im Krieg gar nicht so viel erlebt hatten und hier eine Chance sahen, die harten Burschen zu markieren – ein Vergnügen, das umso stärker empfunden wurde, wenn die Opfer Menschen waren, die sehr viel Schlimmeres durchgemacht hatten.
*
Es war diese Geschichte meines Vaters – die, wie gesagt, nicht so schlimm war wie das, was andere erlebt hatten, aber schlimm genug –, die mich neugierig machte, wie es unmittelbar nach dem verheerendsten Krieg der Menschheitsgeschichte weiterging. Wie stand die Welt aus den Trümmern wieder auf? Was geschieht, wenn Millionen hungern oder auf blutige Rache sinnen? Wie setzen sich Gesellschaften – wie setzt sich »Zivilisation«: ein beliebtes Wort damals – wieder zusammen? Der Wunsch, zur Normalität zurückzukehren, ist eine sehr menschliche Reaktion auf Katastrophen; menschlich und absurd. Denn natürlich war es eine Illusion zu glauben, die Welt, wie sie vor dem Krieg war, ließe sich einfach wiederherstellen, als könnte eine mörderische Dekade, die lang vor 1939 begann, einfach verdrängt werden wie eine böse Erinnerung.
Es war aber eine Illusion, und Regierungen hingen ihr ebenso an wie Individuen. Die französische und die holländische Regierung bildeten sich ein, sie könnten ihre Kolonien wieder in Besitz nehmen, und das Leben ginge weiter wie vor der japanischen Invasion Südostasiens. Sie wurden bald eines Besseren belehrt. Natürlich konnte die Welt nicht mehr dieselbe sein wie vorher. Zu viel war passiert, zu viel hatte sich verändert, zu viele Menschen, ja ganze Gesellschaften waren entwurzelt worden. Auch wollten gar nicht so wenige, eingeschlossen manche Regierungen, auf keinen Fall den früheren Zustand der Welt zurückhaben. Britische Arbeiter, die für König und Land ihr Leben aufs Spiel gesetzt hatten, sahen nicht ein, weshalb sie sich wieder dem alten Klassensystem unterordnen sollten, und nur zwei Monate nach dem Sieg über Hitler wählten sie Winston Churchill aus dem Amt. Josef Stalin fiel es nicht ein, Polen, Ungarn, die Tschechoslowakei eine liberale Demokratie wiederherstellen zu lassen. Sogar in Westeuropa sahen viele Intellektuelle den Kommunismus, solange er im kuscheligen Gewand des »Antifaschismus« daherkam, durchaus als brauchbare Alternative zur alten Ordnung.
In Asien war der einsetzende Wandel womöglich noch radikaler. Nachdem Indonesier, Vietnamesen, Malaien, Chinesen, Birmanen, Inder und auch andere erlebt hatten, wie eine asiatische Nation, praktisch ihre Landsleute, die Kolonialherren demütigen konnte, war es mit dem westlichen Allmachtsanspruch unwiederbringlich vorbei, das Verhältnis konnte nie wieder so sein wie zuvor. Gleichzeitig waren die Japaner – nicht anders als die Deutschen, nachdem sie erlebt hatten, wie der Größenwahn ihrer Machthaber zu Staub zerfiel – sehr empfänglich für die Veränderungen, die ihnen von den alliierten Siegermächten teils vorgelebt, teils aufgezwungen wurden.
Und die Frauen, Britinnen und Amerikanerinnen, die durch den Krieg ins Arbeitsleben katapultiert worden waren, sahen nicht ein, weshalb sie ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit aufgeben und unter das häusliche Joch zurückkehren sollten. Natürlich blieb vielen erst einmal nichts anderes übrig, denn für alle Neuerungen braucht es Zeit – so wie die Kolonien Zeit brauchten, um ihre volle Unabhängigkeit zu erringen. Fortan aber stand das konservative Bedürfnis nach Rückkehr zur »Normalität« in Konkurrenz mit dem Wunsch nach Änderung, nach Neuanfang, nach einer besseren Welt, in der es nie wieder zu derart verheerenden Kriegen käme. Solche Hoffnungen waren von echtem Idealismus getragen. Das Scheitern des Völkerbunds, dem es nicht gelungen war, einen (zweiten) Weltkrieg zu verhindern, war kein Argument gegen den Idealismus jener, die 1945 hofften, die Vereinten Nationen könnten immerwährenden Frieden wahren. Dass solche Ideale sich mit der Zeit als ebenso illusorisch erwiesen wie die Vorstellung, die Uhr ließe sich zurückdrehen, nimmt ihnen nichts von ihrer Kraft, so wenig, wie es ihre Absicht entwertet.
Die unmittelbare Nachkriegsgeschichte ist in mancher Hinsicht eine sehr alte. Die alten Griechen wussten sehr wohl um die zerstörerische Kraft der menschlichen Rachgier, und ihre Tragödiendichter setzten in Szene, wie sich Blutfehden durch die Herrschaft des Rechts überwinden lassen: Gerichtsverfahren statt Vendetta. Und die Geschichte ist, im Osten nicht weniger als im Westen, voll von Träumen vom Neuanfang, von der Hoffnung, man könnte die Kriegsruinen als offene Baustelle für Gesellschaften nehmen, die auf neuen Idealen gründen – aber die waren oft nicht so neu, wie die Zeitgenossen glaubten.
Mein persönliches Interesse an der unmittelbaren Nachkriegszeit entzündete sich teilweise durch Ereignisse der Gegenwart: Wir haben in den letzten Jahren ja genügend Beispiele dafür erlebt, mit welchen immensen Hoffnungen Revolutionskriege geführt werden, um Diktatoren zu stürzen und neue Demokratien zu begründen. Noch mehr aber ging es mir darum, durch den Blick zurück die Welt meines Vaters und seiner Generation zu verstehen. Das mag zum Teil an der natürlichen Neugier eines Kindes auf die Erlebnisse der eigenen Eltern liegen, einer Neugier, die zunimmt, wenn das Kind älter ist, als die Eltern zu der Zeit waren. Besonders groß wird die Neugier, wenn der Vater eine Not erlebt hat, die sich der Sohn allenfalls vage vorstellen kann.
Aber es ist noch mehr. Denn die Welt, an der mein Vater mitwirkte, die Welt aus den Trümmern des Krieges, der ihn um ein Haar das Leben gekostet hätte, ist die Welt, in der wir aufgewachsen sind. Meine Generation wurde von den Träumen unserer Väter genährt: dem europäischen Sozialstaat, den Vereinten Nationen, der amerikanischen Demokratie, dem japanischen Pazifismus, der Europäischen Union. Und daneben von der dunklen Seite der Welt, die ebenfalls 1945 entstand: den kommunistischen Diktaturen in Russland und den osteuropäischen Ländern, Maos Aufstieg im chinesischen Bürgerkrieg, dem Kalten Krieg.
Von der Welt unserer Väter wurde vieles bereits wieder demontiert oder beginnt zu bröckeln. Natürlich ist das Leben heute fast überall weitaus besser, als es 1945 war, ganz gewiss in materieller Hinsicht. Manche unserer schlimmsten Befürchtungen sind nicht wahr geworden. Das Sowjetreich ist zusammengebrochen. Die letzten Schlachtfelder des Kalten Kriegs liegen auf der koreanischen Halbinsel und in der Formosastraße, der Meerenge zwischen China und Taiwan. Und doch ist, während ich schreibe, überall die Rede vom Niedergang des Westens, der USA wie Europas. Gewiss, manche Ängste der unmittelbaren Nachkriegszeit sind verflogen, aber dasselbe gilt auch für viele Träume. Kaum jemand glaubt noch, dass eine Weltregierung ewigen Frieden herzustellen vermöchte, dass die Vereinten Nationen die Welt wenigstens vor Konflikten bewahren könnten. Ideologien und wirtschaftliche Zwänge haben die Hoffnungen auf die Sozialdemokratie und den Sozialstaat – die eigentlichen Gründe für Churchills Niederlage 1945 – schwer lädiert oder überhaupt zerschlagen.
Ich glaube nicht recht an die Idee, es ließe sich aus der Geschichte viel lernen, jedenfalls in dem Sinn, dass das Wissen um frühere Verblendungen ähnliche Torheiten in der Zukunft verhindern könnte. Die Geschichte ist doch immer eine Frage der Interpretation; Fehlinterpretationen der Vergangenheit sind aber oft gefährlicher als Nichtwissen. Alte Kränkungen und alter Hass schüren neue Brände. Dennoch müssen wir wissen, was war, und versuchen, die Zusammenhänge zu verstehen. Denn wenn wir von der Vergangenheit nichts wissen, verstehen wir auch unsere eigene Zeit nicht. Ich wollte wissen, was mein Vater durchgemacht hat, weil es mir hilft, mich selber zu verstehen – und überhaupt unser aller Leben im langen dunklen Schatten der früheren Ereignisse.
I Der Klarheit halber sollte ich erwähnen, dass sich die holländischen Mennoniten von ihren amerikanischen Brüdern sehr unterscheiden. Die mennonitische Kirche der Niederlande ist recht fortschrittlich gesinnt, offen für andere Religionen und in keiner Weise zurückgezogen – sehr im Gegensatz zu den amerikanischen und deutschen Mennoniten, die immer ein verlegenes Unbehagen auslösten, wenn sie bärtige Kirchenvertreter in altmodischen schwarzen Anzügen zu offiziellen Besuchen bei meinem Großvater in Nijmegen entsandten.
Teil 1 Befreiungskomplex
Kapitel 1Jubel
Als die alliierten Truppen Millionen Häftlinge von Hitlers zusammengebrochenem Reich aus Konzentrations-, Zwangsarbeiter-, Kriegsgefangenenlagern befreiten, hatten sie fügsame, angemessen dankbare Menschen erwartet, die bereitwillig auf jede mögliche Weise mit ihren Befreiern kooperierten. In manchen Fällen traf das zweifellos zu. Häufig aber stießen sie auf den sogenannten »Befreiungskomplex«, wie er später definiert wurde, so etwa in der einigermaßen bürokratischen Formulierung eines Augenzeugen: »Dazu gehörten Rache, Hunger und Jubel, welche drei Bestandteile im Verein aus den frisch befreiten Displaced Persons (DP) ein Problem in punkto Einstellung und Benehmen machten, aber auch in Sachen Versorgung, Ernährung, Desinfektion und Repatriierung.«1
Der Befreiungskomplex beschränkte sich nicht auf die Bewohner der DP-Lager; man hätte ganze Länder damit beschreiben können – und nicht nur die frisch befreiten, sondern in mancherlei Hinsicht auch die besiegten Nationen.
Ich wurde zu spät, in einem zu wohlhabenden Land geboren, um noch eine Auswirkung des Hungers zu spüren. Aber von Rachlust und Jubel war nach wie vor ein kleiner Widerhall zu vernehmen. Noch immer rächte man sich an Menschen, die mit dem Feind kollaboriert oder, schlimmer, mit ihm geschlafen hatten; die Rache erfolgte allerdings still und heimlich und vorwiegend auf sehr tiefer Ebene: Man kaufte in einem bestimmten Laden keine Lebensmittel ein, in einem anderen keine Zigaretten, denn »jedermann« wusste, dass die Eigentümer im Krieg auf der »falschen« Seite gewesen waren.
Andererseits war der Jubel in Holland institutionalisiert: Man hatte ein jährliches Ritual daraus gemacht und den Befreiungstag eingeführt, den 5. Mai.
An diesem Tag, erinnere ich mich aus meiner Kindheit, schien immer die Sonne, alle Glocken läuteten, und rot-weiß-blaue Fahnen flatterten im sanften Frühlingswind. Der 5. Dezember, Nikolaus, mag ein größeres Familienfest sein, der Befreiungstag aber ist die große Zurschaustellung patriotischer Begeisterung – war es jedenfalls in meiner Jugend, den fünfziger und sechziger Jahren. Da die Niederländer am 5. Mai 1945 die deutschen Besatzer nicht aus eigener Kraft vertrieben, sondern von kanadischen, britischen, amerikanischen und polnischen Truppen befreit wurden, ist der alljährliche Ausbruch patriotischen Stolzes zwar ein wenig merkwürdig, aber nachdem sich die Holländer wie auch die Amerikaner und die Briten gern sagen, dass Freiheit ihre nationale Identität ausmacht, ist es ganz logisch, dass im nationalen Bewusstsein die deutsche Niederlage mit der kollektiven Erinnerung an den Sieg über die spanische Krone im Achtzigjährigen Krieg (in der zweiten Hälfte des 16. und der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts) verschwimmt.
Meine Generation, nur sechs Jahre nach dem Krieg geboren, vergießt gern sentimentale Tränen beim Anblick schottischer Dudelsackpfeifer, die mitten durch Maschinengewehrfeuer einen normannischen Strand entlangmarschieren, oder die »Marseillaise« singender französischer Bürger – natürlich nur noch auf der Leinwand, durch Hollywoodfilme. Einen Eindruck vom alten Jubel bekam ich exakt fünfzig Jahre nach dem 5. 5.1945, als zur Feier des Jahrestags der Einzug der kanadischen Soldaten in Amsterdam nachgestellt wurde. Dass die alliierten Truppen in Wahrheit erst am 8. Mai in Amsterdam eintrafen, tut nichts mehr zur Sache. Das Urereignis muss außergewöhnlich gewesen sein. Im Bericht eines britischen Kriegskorrespondenten, der vom Ort des Geschehens berichtete, heißt es: »Wir wurden geküsst, beweint, umarmt, geboxt, angeschrien und gerufen, bis wir blaue und grüne Flecken hatten und völlig erschöpft waren. Die Niederländer haben ihre Gärten geplündert, so dass der Blumenregen, der auf die Fahrzeuge der Alliierten niedergeht, kein Ende nimmt.«2
Fünfzig Jahre später fuhren ältere Kanadier, die ausgeblichene und inzwischen recht stramm sitzende Uniformbrust von Medaillen strotzend, noch einmal in den alten Jeeps und Panzerwagen durch die Stadt, grüßten die Menge mit tränenfeuchten Augen und entsannen sich der Tage, als sie Könige waren, einer Zeit, an der sich die Enkel längst satt gehört hatten, Tage des Jubels, ehe die Kriegshelden sich dann in Calgary oder Winnipeg niederließen, um Zahnärzte oder Buchhalter zu werden.
Was mich mehr beeindruckte als die alten Männer, die ihre Hoch-Zeit nacherlebten, war das Verhalten älterer Holländerinnen. Sie waren gekleidet wie die respektablen Matronen, die sie zweifellos auch waren, aber – sie waren in Ekstase. Außer sich wie Teenager im Rockkonzert. Kreischend wie junge Mädchen beim Anblick ihres Idols, streckten sie die Arme nach den Männern in den Jeeps aus, griffen nach ihren Uniformen: »Danke! Danke! Danke!« Sie waren machtlos gegen den Gefühlstaumel, der sich ihrer bemächtigt hatte. Auch sie erlebten die Stunden des Jubels noch einmal. Es war eine der sonderbarsten erotischen Szenen, die ich je erlebt habe.
*
In Wahrheit kamen die Kanadier, wie erwähnt, gar nicht am 5. Mai nach Amsterdam, so wenig wie der Krieg an dem Tag offiziell vorbei war. Allerdings waren am 4. Mai Generaladmiral Hans-Georg von Friedeburg und General Eberhard Hans Kinzel zu Feldmarschall Bernard Montgomery (»Monty«) in dessen Zelt in der Lüneburger Heide gekommen, um die Kapitulation aller deutschen Truppen im Raum Nordwestdeutschland, Niederlande und Dänemark zu unterzeichnen. Ein junger britischer Offizier namens Brian Urquhart sah die Deutschen in ihrem Mercedes-Konvoi über die Landstraße zu Montys Hauptquartier rasen. Kurz zuvor hatte er als einer der ersten Offiziere der Alliierten das nahe Konzentrationslager Bergen-Belsen betreten, in dem die meisten befreiten Gefangenen »zu artikulierter Rede nicht mehr imstande waren – vorausgesetzt, wir hätten überhaupt eine gemeinsame Sprache gefunden«. Was er aus der Ferne für aufgeschichtete Holzscheite gehalten hatte, waren Leichenstapel, »so weit das Auge reichte«.3 Als dem Admiral von Friedeburg, noch immer im prächtigen Ledermantel, ein paar Tage später ein amerikanischer Bericht über deutsche Greueltaten vorgelegt wurde, nahm er es als Beleidigung seines Landes und reagierte mit Zorn.
Am 6. Mai fand in einem halb zerstörten Bauernhaus in der Nähe von Wageningen und Arnhem eine weitere Zeremonie statt. Dort übergab General Johannes Blaskowitz seine Truppen dem kanadischen Generalleutnant Charles Foulkes. Von Arnhem selbst war nicht mehr viel übrig, nachdem es im September1944, als sich die britischen, amerikanischen und polnischen Truppen den Weg durch die Niederlande hatten erzwingen wollen, in Schutt und Asche gelegt worden war: Diese militärische Katastrophe ging als Operation Market Garden in die Geschichte ein. Eine der Personen, die das Verhängnis hatten kommen sehen, war Brian Urquhart, zu der Zeit Offizier beim militärischen Nachrichtendienst und einem der Chefstrategen der Operation unterstellt, General F. A. M. »Boy« Browning, einem Draufgänger mit viel Blut an den Händen. Als Urquhart seinem Befehlshaber den fotografischen Beweis vorlegte, dass rings um Arnhem deutsche Panzerbrigaden postiert waren und nur darauf warteten, die Truppen der Alliierten zu zersprengen, erhielt er die Aufforderung, sich krank zu melden. Niemand, und ganz bestimmt kein namenloser Nachrichtenoffizier, hatte das Recht, Monty die Party zu verderben.II
Aber der Krieg war noch nicht vorbei, auch in den Niederlanden nicht. Am 7. Mai hatte sich auf dem Dam, dem Hauptplatz im Zentrum von Amsterdam, vor dem königlichen Palast eine jubelnde, tanzende, singende Menschenmenge versammelt, schwenkte Fahnen in Orange, der Farbe des niederländischen Königshauses, und wartete auf die siegreichen britischen und kanadischen Truppen, deren Ankunft unmittelbar bevorstand. Deutsche Marineoffiziere, die das begeisterte Gedränge aus den Fenstern eines Herrenclubs am Rand des Platzes beobachteten, leisteten sich einen Anfall von Groll in letzter Minute und feuerten vom Dach aus mit einem Maschinengewehr in die Menge. Zweiundzwanzig Menschen starben, über hundert wurden schwer verwundet.
Selbst dies war nicht die letzte Gewalttat des Kriegs. Am 13. Mai, mehr als eine Woche nach dem Befreiungstag, wurden zwei Männer hingerichtet. Es waren deutsche Nazigegner, desertierte Wehrmachtsoldaten, die sich unter den Holländern versteckt hatten. Der eine hatte eine jüdische Mutter. Am 5. Mai waren sie aus ihrem Versteck hervorgekommen und hatten sich Mitgliedern des niederländischen Widerstands gestellt, die sie den Kanadiern auslieferten. Und damit fielen sie einer typischen kriegsbedingten Konfusion zum Opfer. Als Montgomery am 4. Mai die Kapitulation der Deutschen entgegennahm, gab es in den ganzen Niederlanden nicht genügend alliierte Truppen, um die Deutschen zu entwaffnen oder die Kriegsgefangenen zu ernähren. Vorläufig behielten die deutschen Offiziere den Befehl über ihre Männer. Die zwei glücklosen Deserteure wurden mit anderen deutschen Soldaten in einem aufgelassenen Ford-Montagewerk außerhalb von Amsterdam untergebracht. Aus dem Bedürfnis nach einer allerletzten Machtausübung beriefen deutsche Offiziere ein hastig improvisiertes Kriegsgericht ein, und die Männer wurden zum Tod verurteilt. Die Deutschen baten die Kanadier um Waffen, um die »Verräter« hinzurichten, und die Kanadier, die unsicher waren, welche Regeln hier galten, und das vorläufige Arrangement nicht stören wollten, entsprachen der Bitte. Die Deserteure wurden in Windeseile exekutiert. Sie waren offenbar nicht die einzigen, die dieses Schicksal erlitten, bis die Kanadier, leider recht spät, der Praxis ein Ende setzten.4
Das offizielle Kriegsende in Europa, der VE-Day (Victory in Europe), war tatsächlich der 8. Mai. Zwar war die bedingungslose Kapitulation aller deutschen Truppen am Abend des 6. Mai in einem Schulhaus in Reims unterzeichnet worden, doch die Feiern konnten noch nicht beginnen, denn Stalin tobte vor Wut, dass General Eisenhower sich erdreistet hatte, die deutsche Kapitulation nicht nur für die Westfront, sondern auch für die Ostfront entgegenzunehmen: ein Privileg, das seiner Ansicht nach allein den Sowjets in Berlin zustand. Daher wollte Stalin den Tag des Siegs in Europa auf den 9. Mai verschieben. Dies wiederum verdross Churchill.
In ganz Großbritannien wurde zur Feier des Tages bereits eifrig Sandwichbrot gebacken; Flaggen und Banner lagen bereit; die Kirchenglocken warteten darauf, geläutet zu werden. Im allseits herrschenden Chaos waren es die Deutschen, die als erste das Ende des Kriegs verkündeten, und zwar mittels einer Radioübertragung aus Flensburg, wo Admiral Dönitz nominell noch für den Rest des in Trümmern liegenden »Deutschen Reichs« zuständig war. Die BBC griff die Meldung sogleich auf. Kurz darauf kamen die Sonderausgaben der französischen, britischen und amerikanischen Zeitungen heraus. In London versammelten sich riesige Menschenmengen am Piccadilly Circus und am Trafalgar Square und erwarteten Churchills Verkündung des Siegs, damit die größte Feier der Geschichte endlich beginnen konnte. In den Straßen von New York regnete es Konfetti. Aber von der Führung der Alliierten kam noch immer keine offizielle Verlautbarung, dass der Krieg mit Deutschland vorbei sei.
Im sowjetischen Hauptquartier in Karlshorst, nahe dem ehemaligen Arbeitslager meines Vaters, nahm in der Nacht auf den 9. Mai, kurz vor Mitternacht, Marschall Georgi Schukow, das brutale Militärgenie, endlich die deutsche Kapitulation entgegen. Abermals setzte Admiral von Friedeburg seine Unterschrift unter das Eingeständnis der deutschen Niederlage. Ohne eine Miene zu verziehen, steif, jeder Zoll ein preußischer Soldat, ließ Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel die Russen wissen, er sei entsetzt über das Ausmaß der Zerstörung in der deutschen Hauptstadt. Woraufhin ein russischer Offizier Keitel fragte, ob er ebenso entsetzt gewesen sei, als auf seinen Befehl hin Tausende sowjetische Dörfer und Städte dem Erdboden gleichgemacht und Millionen Menschen, darunter zahlreiche Kinder, unter den Trümmern begraben worden seien. Keitel zuckte die Achseln und schwieg.5
Schukow schickte die Deutschen fort, und nun feierten die Russen mit ihren amerikanischen, britischen, französischen Verbündeten das Kriegsende, stilvoll, mit sentimentalen Reden und Strömen von Wein, Cognac und Wodka. Tags darauf fand im selben Raum ein Bankett statt, bei dem Schukow mit Eisenhower anstieß und ihn als einen der größten Generäle aller Zeiten pries. Die Trinksprüche nahmen kein Ende, und die russischen Generäle, Schukow eingeschlossen, tanzten, bis sich kaum noch jemand auf den Beinen hielt.
In New York jubelten die Menschen bereits am 8. Mai. Auch in London strömten sie auf die Straßen; dort aber waren sie immer noch eigenartig still, als wagten sie nicht zu feiern, bevor Churchill das Startsignal gegeben hatte. Churchill, dem es nicht einfiel, Stalins Wunsch zu erfüllen und den VE-Day auf den Neunten zu verschieben, sollte um drei Uhr nachmittags eine Rede halten. Präsident Truman hatte schon früher gesprochen. General Charles de Gaulle, der sich auf keinen Fall von Churchill die Schau stellen lassen wollte, plante seine Ansprache an die Franzosen exakt zum selben Zeitpunkt.
Churchills Rede in der BBC wurde an die Rundfunkstationen weltweit übertragen. Auf dem Parliament Square vor dem Westminster-Palast, wo Lautsprecher aufgestellt waren, hätte keine Stecknadel zu Boden fallen können, so dicht drängte sich die Menge. Die Menschen wurden gegen die Tore von Buckingham Palace gedrückt, und im West End kam kein Wagen mehr durch. Big Ben läutete drei Mal. Endlich verstummte alles, und Churchills Stimme dröhnte durch die Lautsprecher: »Der deutsche Krieg ist also zu Ende … Fast die gesamte Welt hat sich gegen die Übeltäter zusammengeschlossen, die jetzt vor uns auf dem Boden liegen … Wir müssen nun alle unsere Kraft und Möglichkeiten aufwenden, um unsere Aufgabe zu Ende zu bringen, im Inland wie im Ausland …« Und hier brach seine Stimme: »Vorwärts, Britannien! Lang lebe die Freiheit! Gott schütze den König.« Kurz danach machte er vom Balkon des Gesundheitsministeriums aus das Victory-Zeichen. »Gott segne euch alle. Dies ist euer Sieg!« Und die Menge schrie zurück: »Nein, es ist Ihrer!«
Der Daily Herald berichtete: »Es kam zu fantastischen Freudenszenen im Herzen der Stadt, als eine jubelnde, tanzende, lachende Menschenmenge außer Rand und Band Busse umlagerte, auf Autodächer sprang, Plakatwände niederriss, um auf dem Fahrdamm Freudenfeuer zu entfachen, Polizisten küsste und zum Mittanzen nötigte … Autofahrer machten das Siegeszeichen mit ihren elektrischen Hupen, und draußen vom Fluss kamen Echo und Nachhall der Victory-Sirenen von Schleppern und Schiffen.«
Irgendwo in dieser Menge waren meine achtzehnjährige Mutter, die von ihrem Internat freibekommen hatte, und ihr jüngerer Bruder. Meine Großmutter Winifred Schlesinger, Tochter deutsch-jüdischer Einwanderer, hatte jeden Grund, selig zu sein, und ihre Churchill-Verehrung kannte keine Grenzen. Aber sie fürchtete, dass ihre Kinder in der »begeisterten, trunkenen Menge – vor allem Yanks« verlorengingen.
In New York feierten fünfhunderttausend auf den Straßen. Die Ausgangssperre war aufgehoben. Die Clubs – Copacabana, Versailles, Latin Quarter, Diamond Horseshoe, El Morocco – waren brechend voll und hatten die halbe Nacht geöffnet. Lionel Hampton spielte im Zanzibar, Eddie Stone im Hotel Roosevelt Grill, und bei Jack Dempsey’s gab es »Jumbo-Portionen« zu essen.
In Paris, auf der Place de la République, beobachtete ein Reporter der Libération eine »wogende Menschenmenge, in der es vor Flaggen der Alliierten wimmelte. Auf seinen langen Beinen schwankend und seltsam aus der Balance, versuchte ein amerikanischer Soldat Fotos zu machen, während aus seinen Khaki-Taschen zwei Flaschen Cognac ragten, die eine leer, die andere noch voll.« Ein US-Bomberpilot versetzte die Menge in Begeisterung, weil er seine Mitchell B-25 durch den Bogen unter dem Eiffelturm steuerte. Auf dem Boulevard des Italiens begannen »ein gewaltiger amerikanischer Seemann und ein prächtiger Neger« einen Wettbewerb miteinander. Sie drückten jede Frau an ihren »mächtigen Brustkasten« und zählten anschließend die Lippenstiftspuren auf ihren Wangen. Es wurde auf den Sieger gewettet. Vor dem Arc de Triomphe hatte sich die größte Menschenmenge überhaupt versammelt, um General de Gaulle zu danken, in dessen Gesicht ausnahmsweise ein Lächeln stand. Laut sangen die Leute die »Marseillaise« und »La Madelon«, die Hymne aus dem Ersten Weltkrieg:
Pour le repos le plaisir du militaire
Il est là-bas à deux pas de la forêt
Une maison aux murs tous couverts de lierre
Aux Tourlourous c’est le nom du cabaret
La servante est jeune et gentille
Légère comme un papillon
Comme son vin son œil pétille
Nous l’appelons la Madelon
Nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour
Ce n’est que Madelon mais pour nous c’est l’amour
Quand Madelon vient nous servir à boire
Sous la tonnelle on frôle son jupon
Et chacun lui raconte une histoire
Une histoire à sa façon
La Madelon pour nous n’est pas sévère
Quand on lui prend la taille ou le menton
Elle rit c’est tout l’mal qu’elle sait faireIII
Dennoch erlebten in Paris manche den VE-Day sozusagen als Antiklimax. Schließlich war Frankreich bereits 1944 befreit worden. Simone de Beauvoir schrieb, ihre Erinnerung an diese Nacht sei »vielleicht infolge der Verwirrung meiner Gefühle viel verschwommener als die an unsere früheren Feste. Der Sieg war in großer Entfernung von uns errungen worden. Wir hatten ihn nicht, wie die Befreiung, fieberhaft und ängstlich erwartet. Er war seit langem vorauszusehen gewesen und weckte keine neuen Hoffnungen: … In gewisser Hinsicht ähnelte dieses Ende einem Sterben.«6
Die Moskowiter hingegen strömten sofort auf die Straßen, kaum war in den ersten Stunden des 9. Mai die Nachricht bekannt gegeben worden. Heerscharen von Menschen, viele noch in Nachthemd und Schlafanzug, tanzten und jubelten und riefen immer wieder »Sieg! Sieg!«, bis der Tag anbrach. Einer von Stalins Dolmetschern, Walentin Bereschkow, erinnerte sich in einem Brief an den britischen Historiker Martin Gilbert: »Der Stolz, dass endlich der Sieg über einen schmutzigen, heimtückischen Feind errungen war, die Trauer um die Gefallenen (und damals wussten wir noch nicht, dass fast dreißig Millionen auf den Schlachtfeldern umgekommen waren), die Hoffnung auf anhaltenden Frieden und fortdauernde Zusammenarbeit mit unseren Verbündeten im Krieg – dies alles erzeugte ein ganz besonderes Gefühl von Erleichterung und Hoffnung.«7
Die Libération vom 8. Mai hatte wohl recht: Es war vor allem eine Party für die Jugend: »Nur die jungen Leute waren voller Überschwang. Nur die jungen Leute sprangen auf die Jeeps, was aussah wie eine Tribüne beim Longchamp-Rennen, und fuhren die Champs-Élysées entlang, Flaggen über den Köpfen und Lieder auf den Lippen. Und so soll es auch sein. Für die Jungen ist die Gefahr vorbei.«
Meine Großmutter in England verzehrte sich unterdessen nach ihrem Mann, der noch immer in der britischen Armee in Indien diente, und konnte den Überschwang ihrer Kinder nicht teilen. So wie ihr erging es zweifellos vielen, die sich um ferne Männer und Söhne sorgten oder zu viel verloren hatten, um sich zu freuen. Die Reaktion der Einwanderertochter war zugleich eigenartig englisch. »Du fehlst mir zu sehr, als dass ich Lust zu feiern hätte«, schrieb sie meinem Großvater, »daher besserte ich die glückliche Stunde mit ein bisschen Extraarbeit im Garten auf.«
Mein Vater erinnert sich gar nicht an den Tag, an dem der Krieg offiziell beendet wurde. Undeutlich entsinnt er sich der russischen Kanonen, die zu dem Anlass abgefeuert wurden. Marschall Schukow erwähnt es in seinen Memoiren: »Wir verließen [am 9. Mai] den Bankettsaal begleitet von Geschützfeuer aus allen Rohren … In sämtlichen Stadtteilen Berlins und in seinen Vorstädten wurde weitergeschossen.«8 Mein Vater war Geschützlärm gewohnt und achtete nicht weiter darauf.
Brian Urquhart, der junge britische Nachrichtenoffizier, der in Norddeutschland feststeckte und noch den Schock von Bergen-Belsen verdaute, empfand ebenfalls keine reine Freude: »Ich kann kaum noch rekonstruieren, was ich bei dem überwältigenden Ereignis tatsächlich empfand. Fast sechs Jahre von der Verzweiflung bis zum Sieg, zahlreiche Freunde gefallen, aberwitzige Vergeudung und Zerstörung … Ich dachte an die vielen namenlosen Gesichter auf Kriegsfotografien, an Flüchtlinge, Gefangene, Zivilisten unter den Bomben. Russen im Schnee und in den Trümmern ihres Landes, Schiffsbesatzungen auf sinkenden Frachtern – wie viele von ihnen sehen ihre Familien nie wieder?«9
Die Stimmung der Feiernden in New York, Paris und London ließ sich davon nicht dämpfen. Es war nicht nur ein Fest der Jugend, sondern auch des Lichts: was ganz wörtlich zu verstehen ist. »Stadt hell erleuchtet!«, lautete die Schlagzeile der New York Herald Tribune am 9. Mai. »Der Nachthimmel über London strahlt wieder«, hieß es im Londoner Daily Herald am 8. Mai. In Paris erstrahlten die Lichter der Oper zum ersten Mal seit September 1939 in Blau, Weiß und Rot, und dann wurden nach und nach der Arc de Triomphe, die Madeleine und die Place de la Concorde beleuchtet. Und der Herald Tribune berichtete stolz von riesigen Fahnen, »Stars and Stripes, Union Jack und Tricolore, hell ausgeleuchtet«, die vor seinem Gebäude in der Rue de Berri im Wind flatterten.
New York City war seit der »Teilverdunkelung« im April 1942 und der »Totalverdunkelung« im Oktober 1943 immer finsterer geworden. Nur die Fackel der Freiheitsstatue blieb matt erleuchtet. Am 8. Mai um acht Uhr abends aber, stand in der New York Daily News, »funkelten wieder alle Juwelen in Broadways Krone, die mächtigen Menschenmassen schienen im Licht zu schwimmen, und allen wärmte es das Herz.«
Auf die Nelson-Säule am Londoner Trafalgar Square war ein Suchscheinwerfer gerichtet, und die St.-Pauls-Kathedrale, die beinahe allein aus dem zerbombten Finanzbezirk der Innenstadt aufragte, badete im Flutlicht. Kinos beleuchteten den Leicester Square mit grellen Farben. Und dazwischen war der weiche rötliche Widerschein von Zehntausenden Freudenfeuern, die in ganz London und darüber hinaus bis hinauf nach Schottland brannten.
Es war nicht nur die Erleichterung, dass man jetzt, da keine Bomben und »doodlebugs« (die deutschen Marschflugkörper V1) zu befürchten waren, wieder Lichter einschalten konnte: Die Rückkehr des Lichts hatte auch in symbolischer Hinsicht etwas Bewegendes. Als ich die ganzen Berichte las, musste ich an eine Geschichte denken, die mir einmal eine russische Wissenschaftlerin in Moskau erzählt hatte; die französische Literatur war ihr Fach und ihre Leidenschaft. Sie hatte ihr Leben lang davon geträumt, Frankreich und andere Teile Westeuropas zu sehen, Orte, die sie nur aus Büchern kannte.1990, nach dem Fall der Berliner Mauer, wurde ihr Traum endlich wahr; sie konnte mit dem Zug nach Paris fahren. Ich fragte sie, was sie am meisten beeindruckt habe, und sie sagte, es sei der Moment gewesen, als der Zug nachts von Ost- nach Westberlin kam und auf einmal alles hell erleuchtet war.
*
Lichtfeste, so universal und alt wie die erste Fackel, die der Mensch entzündet hat, sind oft mythischen Ursprungs und haben mit den Jahreszeiten und dem Beginn neuen Lebens zu tun. Manche Erinnerungen aus den ersten Tagen nach der Befreiung haben einen eindeutig religiös-schwärmerischen Ton. Das gilt besonders für den stürmischen Empfang, den die weibliche Bevölkerung den alliierten Soldaten bereitete. Maria Haayen, eine junge Frau aus Den Haag, erinnert sich, wie der erste kanadische Panzer dröhnend auf sie zukam und aus dem Geschützturm der Kopf eines Soldaten spähte: »Mir sackte alles Blut in die Beine, und ich dachte: Hier kommt unsere Befreiung. Und als der Panzer näher kam, stockte mir der Atem, und der Soldat erhob sich – er war wie ein Heiliger.«10
Unter jungen Frauen war dieses Gefühl womöglich verbreiteter, aber auch Männer erlebten es. Ein Holländer berichtete, dass es »ein Privileg [war], wenigstens den Ärmel einer kanadischen Uniform zu berühren. Jeder kanadische Soldat war ein Christus, ein Erlöser …«11
In einer Hinsicht lässt sich die Erfahrung der alliierten Soldaten in den befreiten Ländern im Sommer 1945 mit den Reaktionen auf die Ankunft der Beatles zwanzig Jahre später vergleichen: Auch dort äußerte sich die Befreiung als Manie, die vor allem erotisch war. 1945 fehlten in Ländern wie Holland, Belgien und Frankreich – und noch viel mehr im besiegten Deutschland und Japan – die Männer, weil sie entweder gefallen oder in Gefangenschaft waren oder arm, unterernährt und demoralisiert. Fremdbesatzung und Niederlage hatten männliche Autorität mehr oder minder zerstört, auf jeden Fall vorläufig. Ein damaliger niederländischer Historiker formulierte es so: »Militärisch wurden die niederländischen Männer 1940 geschlagen; sexuell 1945.«12 Dasselbe ließ sich über Frankreich oder Belgien oder überhaupt jedes Land sagen, das besetzt worden war. Eine der Kriegsfolgen war, dass viele Frauen ihre weibliche Unterwürfigkeit weitgehend aufgegeben hatten. Sie hatten Lohnarbeit verrichtet, für den Widerstand gearbeitet oder die Verantwortung für die Familie getragen. Sie waren, um es mit dem zutiefst missbilligenden Ausdruck zu sagen, der in Frankreich damals gebräuchlich war, hominisées; sie hatten begonnen, sich wie Männer zu verhalten.
Verglichen mit den ausgemergelten Niederländern oder Franzosen oder Deutschen, die ungewaschen und abgerissen daherkamen, müssen die adretten Kanadier und hochgewachsenen Amerikaner, wohlgenährt und gut bezahlt und sexy in ihren schmucken Erobereruniformen, tatsächlich gottähnlich gewirkt haben. Eine der vielen Holländerinnen, die am Ende einen Kanadier heiratete, formulierte es so: »Machen wir uns doch nichts vor – nach dem, was wir durchgemacht hatten, sahen die Kanadier einfach entzückend aus.«
Nichts drückt die Erotik der Befreiung besser aus als die Musik, die mit den alliierten Truppen kam – Musik, die bei den Nazis verboten war: Swing, Jazz, Glenn Millers »In the Mood«, Tommy Dorsey, Stan Kenton, Benny Goodman, Lionel Hampton, »Hey! Ba-Ba-Re-Bop«. In Paris tanzte die Jugend zu »Siegesplatten«, den Jazzaufnahmen, die es für amerikanische Truppen gab. Und der franko-amerikanische Geist ging sogar ins französische Chanson ein. Der Hit des Jahres1945, gesungen von Jacques Pills, ging so:
Oh ! Là là !
Bonjour mademoiselle
Oh ! Là là !
Hello, qu’elle fait comme ça
Oh ! Là là !
Je pense you are très belle
Oh ! Là là !
You very beau soldat …
Fraternisierung mit den Deutschen war den westlichen Alliierten 1945 offiziell noch verboten. In Holland und Frankreich hingegen wurde sie aktiv gefördert, es gab sogar eine sogenannte Operation Fraternisierung. Im Juli wurde unter der Schirmherrschaft von Prinzessin Juliana und Prinz Bernhard das Unterhaltungskomitee der Niederlande gegründet, insbesondere um den mehr als hunderttausend Kanadiern englischsprechende weibliche Begleitung zu offerieren. Gedacht war, dass die jungen Frauen Soldaten in Ausstellungen, Museen, ins Kino und, unter angemessener Aufsicht, zu Tanzveranstaltungen begleiteten.
Die hoffnungsvolle, gottesfürchtig formulierte Erwartung war, dass die Frauen »die Ehre unserer Nation aufrechthalten« würden. Meine holländische Großmutter war als Gattin eines protestantischen Geistlichen aufgefordert, das Tanzen zu beaufsichtigen und dafür zu sorgen, dass zwischen den Kanadiern und ihren holländischen Freundinnen nichts vorfiel, was ein Schandfleck auf der nationale Ehre gewesen wäre. Ihr Mitstreiter in diesem Bestreben war ein katholischer Priester, Pfarrer Ogtrop, dessen Name von den Tänzern zur Melodie von »Hey! Ba-Ba-Re-Bop« geschrien wurde. Wer weiß, was bei diesen Tanzveranstaltungen alles passierte; ein kanadischer Soldat jedenfalls sagte, er habe nie »eine geneigtere weibliche Bevölkerung angetroffen als in Holland«.13
Aus der Sicht der alliierten Truppen war das nicht das Schlechteste, denn das Oberkommando war von Prostitution gar nicht erbaut. Rotlichtbezirke waren tabu, sogar in Frankreich, wo die maisons de tolérance unter deutscher Besatzung floriert hatten. Manche älteren amerikanischen Veteranen hegten noch immer lieb gewordene Erinnerungen an das Paris von1918, als nach dem Ersten Weltkrieg die Bordelle von Pigalle (Pig Alley, sagten die Amerikaner: »Schweineweg«) den Landsern einen überaus herzlichen Empfang bereitet hatten. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Prostitutionsverbot nicht immer eingehalten. In wenigstens einem Fall, dokumentiert in der Stadt Cherbourg, wurden mehrere Bordelle indirekt von der U. S. Army betrieben.14 Manche waren nur für schwarze GIs, andere nur für weiße, und amerikanische Militärpolizisten sorgten dafür, dass die Leute draußen gesittet Schlange standen. Hauptsächlich aber fand diesmal die Fraternisierung, zum größten Kummer derer, die sich, sehr zu Recht, wegen der Verbreitung von Geschlechtskrankheiten infolge eines fehlenden organisierten Gunstgewerbes sorgten, auf rein freiberuflicher Ebene statt.
Selbstverständlich waren die Beziehungen zwischen Soldaten und einheimischen Frauen nicht gleichberechtigt. Die Männer hatten das Geld, die Luxuswaren, die Zigaretten und Seidenstrümpfe und, noch wichtiger, die Lebensmittel, die überlebenswichtige Nahrung. Und die zahlreichen Formen der Verehrung für die Befreier lassen auf ein potenziell demütigendes Ungleichgewicht schließen. Dennoch wäre es nicht ganz richtig, die Frauen, die so erpicht auf Fraternisierung waren, als naive Heldenverehrerinnen oder machtlose Opfer zu sehen. Simone de Beauvoir erwähnt in ihren Erinnerungen eine junge Pariserin, deren »hauptsächlicher Zeitvertreib« die »Jagd auf Amerikaner« (chasse à l’Américain) gewesen sei.
Benoîte Groult, später eine bekannte Romanautorin, verfasste mit ihrer Schwester Flora einen Bericht über die gemeinsame Ausbeute bei der Amerikanerjagd. Sie nannten ihr Journal à quatre mains (dt. Tagebuch vierhändig) einen Roman, aber es ist eigentlich ein kaum literarisch verbrämter Erlebnisbericht. Groult sprach Englisch und war eine der Französinnen, die als ehrenamtliche Mitarbeiterinnen des amerikanischen Roten Kreuzes fraternisierten. Ihr eigentliches Jagdrevier aber war der Gesundheit vielleicht weniger zuträglich: Fast jeden Abend verbrachte sie in Pariser Clubs, die alliierte Soldaten bewirteten und Französinnen willkommen hießen, für französische Männer aber geschlossen waren; Clubs mit harmlosen Namen wie Canadian Club, Independence, Rainbow Corner.
Groults detaillierte physische Beschreibungen amerikanischer und kanadischer Soldaten klingen so hingerissen wie die Schilderungen der Menschen, die Heilige vor sich zu haben glaubten – mit dem Unterschied, dass Groults Worte erstaunlich bodenständig sind und die Männer weit entfernt von jeder Heiligkeit. Sie schreibt über ihre Eroberungen nicht anders, als manche Männer mit Mädchen prahlen, die sie abgeschleppt haben. Die Clubs, die sie frequentiert, bezeichnet sie als »Sklavenmarkt«. In dem Fall aber sind die Sklaven die Helden und Eroberer.
Hier Benoîte Groult über Kurt, einen amerikanischen Kampfpiloten: »Eine eher kurze und ein bisschen stupsige Nase, was ihm das unerlässlich Kindliche verleiht, die Uniform des amerikanischen Gesichts; die Haut stratosphärengebräunt; kräftige Hände, Orang-Utan-Schultern, und, wie immer, die besondere Überraschung: makellose, schmale Hüften, die ausgleichen, was ansonsten ein wenig zu massig geraten ist …« Kurt liest nie ein Buch und interessiert sich »nur für die Fliegerei und fürs Essen«. Aber kümmert sie das? Keineswegs: »Ich sehne mich nach den Armen eines Idioten; nach den Küssen eines Idioten. Er hat ein wunderschönes, sehr markantes Lächeln, er zieht die Mundwinkel sehr hoch und zeigt das phantastische amerikanische Gebiss.«15
Kurzum, Groult dürfte auf ihre Landsleute entsetzlich hominisée gewirkt haben. Sie hatte geheiratet, ihren Mann aber im Krieg verloren, und die Befreiung im Sommer 1944 gab ihr den Freibrief – und das Verlangen –, in den Armen von Männern, die sie nie wiedersehen würde, Lust zu finden: was für eine Freiheit. Kurt war derjenige, der sich eine ernstere Beziehung gewünscht hätte, der ihr Fotos von seinen Eltern zeigte und hoffte, sie als seine Kriegsbraut in die Staaten heimzuführen – völlig undenkbar für Groult, eine junge Pariser Intellektuelle mit literarischen Ambitionen.
Benoîte Groult war vielleicht ungewöhnlich abgebrüht, oder sie gab sich so. Jedenfalls illustriert ihr Bericht ein Argument des französischen Historikers Patrick Buisson über die deutsche Besatzung: Die Anwesenheit so vieler junger deutscher Männer in Frankreich während des Krieges bot vielen jungen Französinnen eine Gelegenheit aufzubegehren: Frauen, die aus schlechten Ehen oder einem repressiven bürgerlichen Elternhaus ausbrechen wollten, Hausangestellten unter der Fuchtel ihres Dienstherrn, späten Mädchen, Frauen aus allen Schichten, die sich wenigstens für eine Weile von den Zwängen einer konservativen patriarchalischen Gesellschaft freimachen wollten. Dass eine Liaison mit einem Angehörigen der Besatzungsarmee solchen Frauen auch materielle Vorteile brachte und in vielen Fällen ermöglichte, ein besseres Leben zu führen, als andere es hatten, in manchen Fällen sogar ein besseres als das ihrer ehemaligen Dienstherren – dieser Nebeneffekt versüßte die Rache.16
Und es waren nicht nur Frauen. Minderheiten aller Couleur gehen oft Bündnisse mit mächtigen Außenseitern ein, um sich der Unterdrückung durch die Mehrheit zu entziehen. Dies war eine Facette aller Kolonialgesellschaften. Aber die unverhältnismäßig hohe Zahl französischer Homosexueller, die entweder mit den Deutschen kollaborierten oder das besetzte Paris als sexuelle Tummelwiese nutzten, kann auch mit einer allen gemeinsamen Kränkung durch das wohlanständige Bürgertum zu tun gehabt haben. Die Homophobie der Nazi- und der Vichy-Propaganda war an sich kein Hinderungsgrund. Man stand darum ja nicht unbedingt auf der Seite der Besatzer; die Okkupation war einfach eine Gelegenheit.
Die Fraternisierung mit den alliierten Befreiern war jedenfalls verlockender als die Kollaboration mit den Deutschen, denn es haftete ihr nicht der Makel des Verrats an. Über das Ausmaß des homosexuellen Fraternisierens lässt sich nicht viel sagen, denn natürlich wurde über die Sache als solche eher Stillschweigen bewahrt. Einen Fall beschreibt sehr schön Rudi van Dantzig, Tänzer, Schriftsteller und Choreograph des Niederländischen Nationalballetts. Er schrieb einen Roman, Der verlorene Soldat, basierend auf eigenen Erlebnissen im »Hungerwinter« 1944/45, nachdem er von Amsterdam in ein Dorf im Norden evakuiert worden war. Als die Kanadier sein Dorf erreichten, war er erst zwölf, hatte aber Sehnsüchte, die er selbst kaum verstand. Ein Jeep hält auf der Landstraße. Eine Hand wird ausgestreckt. Er wird hinaufgezogen. So lernt Jeroen, der Junge, Walt, den kanadischen Soldaten, kennen, der ihn am Ende verführt. Das Buch ist aber alles andere als eine Anklage gegen Pädophilie, im Gegenteil: Es ist als Elegie verfasst: »Der um mich gelegte Arm ist warm und bequem, es ist, als ob ich in einem Sessel sitze, der mich umfängt. Beinahe wohlig lasse ich alles geschehen. ›Das ist die Befreiung‹, denke ich, ›so muss es sein, anders als sonst. Ein richtiges Fest.‹«17
Benoîte Groult ist sich der materiellen Vorteile ihrer Beziehung zu einem Amerikaner durchaus bewusst, und sie stellt die Verbindung zwischen sexuellem Hunger und Hunger nach Nahrung ganz explizit her. Im Bett unter Kurt zu liegen, schreibt sie, sei so, als schliefe sie mit einem ganzen Kontinent: »Gegen einen Kontinent ist man machtlos.« Hinterher aßen sie: »Vier Jahre Besatzung und dreiundzwanzig Jahre Keuschheit (oder beinahe so viel) machen gierig. Ich verschlang Eier, die zwei Tage zuvor in Washington gelegt worden waren! In Chicago eingedosten Schinken. Mais, der viertausend Meilen von hier gereift war … Ja, der Krieg hat’s in sich!«
Frühstücksfleisch, Eier, Hershey-Schokolade aus der Feldration der U. S. Army konnte man sofort essen. Strümpfe konnten getragen werden. Aber Lucky Strikes, Camels, Chesterfields und Caporal-Zigaretten ließen sich auf dem Schwarzmarkt gegen weiteres Essen eintauschen. Die GIs waren mit allem reichlich versorgt – ein unschätzbarer Reiz, mindestens so überzeugend wie ihre breiten Schultern und schmalen Hüften, ihr strahlendes Lächeln und die gepflegten Uniformen. Allein der leichte Zugang zu Zigaretten machte sie in sehr armen Ländern zu reichen Männern. Es war einfach, daraus den Schluss zu ziehen, dass die Frauen, die mit ihnen schliefen, in Wahrheit nicht besser seien als Huren.
Denn so dachten die Leute, vor allem die Frauen, die kaum über die Runden kamen, und die Männer, die keinen Zugang zu den Tanzlokalen, Kinos, Freizeiteinrichtungen hatten, weil die den Befreiern und deren einheimischen Freundinnen vorbehalten waren. Dass einige der jungen Frauen, die sich mit alliierten Soldaten zusammentaten, Kopftücher trugen, um ihren noch geschorenen Kopf zu verbergen – die sichtbare Strafe für jene, die zuvor ein Verhältnis mit einem Deutschen gehabt hatten –, entschärfte den Argwohn gegen sie natürlich nicht.
Sicher waren manche Frauen freischaffende Prostituierte, vor allem in den besiegten Ländern, wenn sexuelle Dienste die einzige Möglichkeit boten, sich oder die eigenen Kinder am Leben zu erhalten. Doch auch bei den Frauen, die mit vielleicht ungebührlicher Eile vom deutschen zum britischen oder amerikanischen Liebhaber umschwenkten, waren die Gründe nicht immer eindeutig oder materiell. Eine frisch rasierte »horizontale Kollaborateurin« aus einer französischen Kleinstadt sagte vor einem selbsternannten Säuberungskomitee aus, das ihr mit weiteren Strafen wegen ihres »unmoralischen« Verhaltens drohte: »Es ist mir gleich, wenn Sie mir den Kopf scheren. Ich bin nicht mehr in Verbindung mit meinem Mann [einem ehemaligen Kriegsgefangenen]. Und ich lasse mich dadurch nicht abhalten, mich mit den Amerikanern zu vergnügen, wenn ich es so will.«18
Wenn man zeitgenössische Berichte und Kommentare in der Presse liest, könnte man den Eindruck gewinnen, der Sommer 45 sei eine einzige lange Orgie gewesen, der sich Besatzungssoldaten und einheimische Frauen hingaben, sei es aus Gier, aus Lust oder aus Einsamkeit. Die Statistik scheint den Eindruck zu bestätigen: In den Pariser Krankenhäusern wurden 1945 fünfmal so viele Frauen wegen Geschlechtskrankheiten behandelt wie 1939. In Holland wurden 1946 mehr als siebentausend uneheliche Kinder geboren, dreimal so viele wie 1939. Die gestiegene Zahl von Geschlechtskrankheiten lässt sich mit mangelnder ärztlicher Versorgung und Kondomknappheit, mit schlechter Hygiene in armen Gegenden, mit einer Vielzahl weiterer Ursachen erklären; Tatsache ist aber, dass viele Frauen und Männer auch einfach den starken Wunsch nach Wärme, Geborgenheit, Liebe, sogar Ehe hatten. Die ersten Monate nach der Befreiung boten nicht nur eine Gelegenheit, Hemmungen und soziale Zwänge über Bord zu werfen, sie waren auch eine Zeit, in der sich die Leute nichts sehnlicher wünschten als die Rückkehr zur Normalität. Immerhin stellen die zweihundertsiebenundsiebzigtausend ehelichen Kinder, die 1946 in den Niederlanden zur Welt kamen, die höchste Geburtenrate in der aufgezeichneten Geschichte des Landes dar.
*
Bergen-Belsen wurde am 12. April befreit. Britische Truppen unter dem Kommando von Lieutenant Derrick Sington hatten den Befehl, sich so schnell wie möglich ins Lager Belsen zu begeben. Der Krieg war noch nicht vorbei, aber die Lebensbedingungen im KZ waren so entsetzlich, dass die Menschen in der Umgebung eine Ausbreitung der im Lager grassierenden Typhusepidemie befürchteten – derselben, an der wenige Wochen zuvor Anne Frank gestorben war. Die deutschen Behörden konnten oder wollten nichts gegen die Typhusgefahr unternehmen und waren einverstanden, britischen Truppen Zugang zum KZ zu gewähren, obwohl sie noch immer Kriegsgegner waren.
Angesichts der Leichenberge, der nach Exkrementen und Verwesung stinkenden Baracken waren die Soldaten wie vom Donner gerührt. Die Fotos aus dem KZ Bergen-Belsen zählten zu den ersten, die in der westlichen Presse erschienen, und in Großbritannien wurde dieses Lager zum eigentlichen Symbol der NS-Massenmorde. Brian Urquhart hatte vom Antisemitismus der Nazis zwar gehört: »Dennoch war die ›Endlösung‹, die tatsächliche Vernichtung von Millionen Menschen, schlicht unvorstellbar. Bergen-Belsen traf uns vollkommen unvorbereitet.«19 Dabei – und das konnten weder er noch die anderen britischen Soldaten begreifen – war dieses KZ ja gar kein Vernichtungslager: Die eigentlichen Mordzentren befanden sich in Polen, und davon waren die meisten von den Deutschen vor dem Rückzug nach Westen evakuiert und zerstört worden.
Lieutenant Sington fuhr durch das Lager und teilte den Überlebenden über Lautsprecher mit, dass sie frei seien. Die meisten waren dem Tod zu nahe, um irgendwie darauf zu reagieren. Das Mikrofon noch in der Hand, kam er zum Hauptlager der Frauen:
Binnen weniger Sekunden war der Wagen von Hunderten Frauen umringt, die weinten und hysterisch schrien, vollkommen außer sich; kein Wort aus dem Lautsprecher war zu verstehen. Auf dem Gelände des Lagers wuchsen junge Birken, von denen die Frauen Zweige und kleine Äste abrissen und gegen den Wagen schleuderten.20
Diese Frauen zählten zu den Glücklichen; sie konnten noch gehen. Ein britischer Medizinstudent, der sich als freiwilliger Helfer gemeldet hatte, berichtet folgende Szene, die er in einer Baracke erlebte:
Fassungslos stand ich in diesem ganzen Unrat und versuchte mich an den Geruch zu gewöhnen, der eine Mischung aus Verwesung, Kloake, Schweiß, fauligem Eiter war. In dem Moment vernahm ich ein Scharren auf dem Boden, und als ich im dämmrigen Licht genauer hinsah, erblickte ich eine vor meinen Füßen kauernde Frau. Sie hatte schwarzes verfilztes Haar, in dem es wimmelte, und ihre Rippen standen heraus, als wäre zwischen den Knochen nichts … Sie entleerte ihren Darm, war aber so schwach, dass sie sich nicht vom Boden erheben konnte, und da sie Durchfall hatte, sprudelte der flüssig-gelbe Stuhl über ihre Schenkel.21