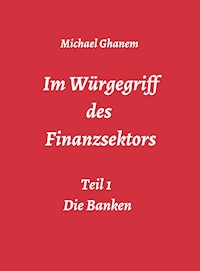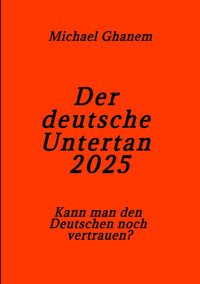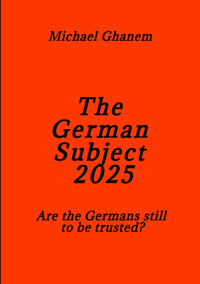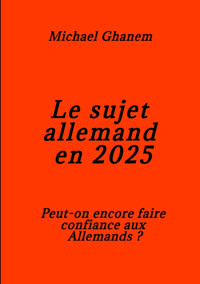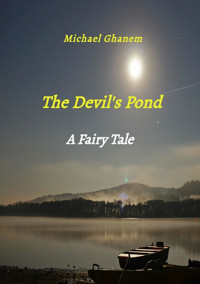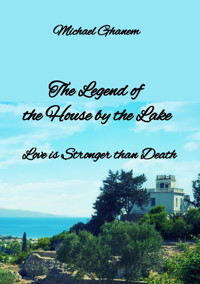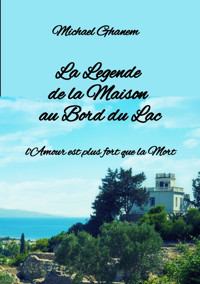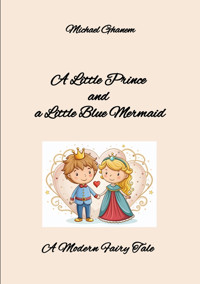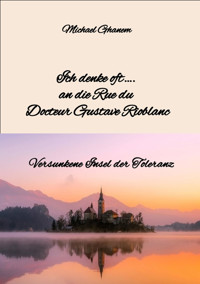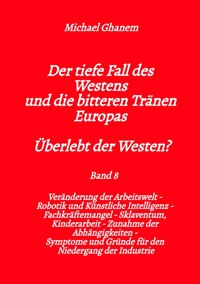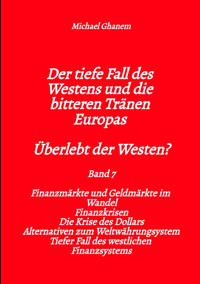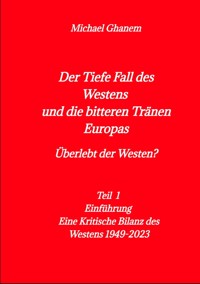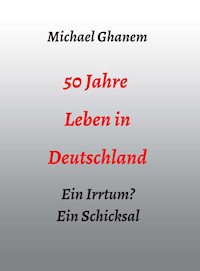
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch beschreibt das Schicksal eines Einwanderers in Deutschland aus der Sicht eines Beobachters. Der Protagonist, Marius, kam vor 50 Jahren mit vielen Erwartungen und Hoffnungen nach Deutschland, lernte die Sprache, studierte, fand die Liebe seines Lebens, war erfolgreich. Er brachte aus seiner Familie und seiner Heimat eine hohe Kultur, Bildung und Werte mit, die er in sein neues Leben in Deutschland eingebracht hat. Und trotzdem musste er ständig den Kampf um seine Daseinsberechtigung und gegen Vorurteile führen. Rückblickend zieht er für sich die Bilanz. Als er nach Deutschland kam, tat er dies gegen alle Warnungen und Vorbehalte seiner Familie. Er hat sich trotzdem für Deutschland entschieden und dafür einen hohen Preis bezahlt. Die Vorurteile, die man ihm mitgegeben hatte, haben sich in all den Jahren bestätigt. In seinen alten Tagen fragt er sich, ob sich dies alles gelohnt hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 384
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Dieses Buch ist allen Mahnern und einsamen Rufern gewidmet, denen das Wohlergehen unserer Gesellschaft am Herzen liegt. Jeder kritische Geist ist einsam und gehört zu einer Minderheit. Die Minderheit von heute kann jedoch die Mehrheit von morgen sein.
Diese Geschichte richtet sich an alle und besonders an Jugendliche, die sich auf die Reise in die ganze Welt aufmachen, ohne an die Konsequenzen zu denken.
Dieses Buch ist auch meiner Frau Marlene gewidmet für ihre kritischen und klugen Ratschläge, die mich in meinem Leben begleitet und die mir stets eine gute Ratgeberin ist.
Bonn, im März 2020
Michael Ghanem
„Die Gedanken sind frei“
50 Jahre Leben in Deutschland
Ein Irrtum?
Ein Schicksal
© 2020 Michael Ghanem
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44,22359 Hamburg
ISBN
978-3-347-03320-7
(Paperback)
978-3-347-03321-4
(Hardcover)
978-3-347-03322-1
(e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Über den Autor: Michael Ghanem
https://michael-ghanem.de/
https://die-gedanken-sind-frei.org/
Jahrgang 1949, Studium zum Wirtschaftsingenieur, Studium der Volkswirtschaft, Soziologie, Politikwissenschaft, Philosophie und Ethik, arbeitete viele Jahre bei einer internationalen Organisation, davon fünf Jahre weltweit in Wasserprojekten, sowie einer europäischen Organisation und in mehreren internationalen Beratungsunternehmen.
Bonn, im März 2020
Er ist Autor von mehreren Werken, u.a.
„Ich denke oft…. an die Rue du Docteur Gustave Rioblanc – Versunkene Insel der Toleranz”
„Ansätze zu einer Antifragilitäts-Ökonomie“
„2005-2018 Deutschlands verlorene 13 Jahre Teil 1: Angela Merkel – Eine Zwischenbilanz“
„2005-2018 Deutschlands verlorene 13 Jahre Teil 2: Politisches System – Quo vadis?“
„2005-2018 Deutschlands verlorene 13 Jahre Teil 3: Gesellschaft - Bilanz und Ausblick
„2005-2018 Deutschlands verlorene 13 Jahre Teil 4: Deutsche Wirtschaft- Quo vadis?“
„2005-2018 Deutschlands verlorene 13 Jahre Teil 5: Innere Sicherheit- Quo vadis?“
„2005-2018 Deutschlands verlorene 13 Jahre Teil 6: Justiz- Quo vadis?“
„2005-2018 Deutschlands verlorene 13 Jahre Teil 7: Gesundheit- Quo vadis? Band A, B und C“
„2005-2018 Deutschlands verlorene 13 Jahre Teil 8: Armut, Alter, Pflege - Quo vadis?“
„2005-2018 Deutschlands verlorene 13 Jahre Teil 9: Bauen und Vermieten in Deutschland - Nein danke“
„2005-2018 Deutschlands verlorene 13 Jahre Teil 10: Bildung in Deutschland“
„2005-2018 Deutschlands verlorene 13 Jahre Teil 11: Der Niedergang der Medien“
„2005-2018 Deutschlands verlorene 13 Jahre Teil 12: Literatur – Quo vadis - Teil A“
„2005-2018 Deutschlands verlorene 13 Jahre Teil 13: Entwicklungspolitik – Quo vadis - Teil A“
„Eine Chance für die Demokratie“
„Deutsche Identität – Quo vadis?
„Sprüche und Weisheiten“
„Nichtwähler sind auch Wähler“
„AKK – Nein Danke!“
„Afrika zwischen Fluch und Segen Teil 1: Wasser“
„Deutschlands Titanic – Die Berliner Republik“
„Ein kleiner Fürst und eine kleine blaue Sirene“
„21 Tage in einer Klinik voller Narren“
„Im Würgegriff von Bevölkerungsbombe, Armut, Ernährung Teil 1“
„Im Würgegriff von Rassismus, Antisemitismus, Islamophobie, Rechtsradikalismus, Faschismus, Teil 1“
„Im Würgegriff der politischen Parteien, Teil 1“
„Die Macht des Wortes“
“Im Würgegriff des Finanzsektors, Teil 1”
“Im Würgegriff von Migration und Integration“
„Weltmacht Wasser, Teil 1“
„Herr vergib ihnen nicht! Denn sie wissen was sie tun!“
„Verfallssymptome Deutschlands – Müssen wir uns das gefallen lassen?“
„Deutsche Identität und Heimat – Quo vadis?“
„I know we can. Eine Chance für Deutschland“
„Im Würgegriff der Staatsverschuldung, Teil 1 und Teil2“
Inhaltsverzeichnis
1. Vorwort
2. Marius Familie und Herkunft
3. Die Straße seiner Kindheit
3.1 Vorbemerkung
3.2. Die Straße
3.3 Die Bewohner der Straße
3.4 Das Leben in der Straße
3.4.1 Das gemeinsame Feiern
3.4.2 Die Sommer
3.4.3 Die gemeinsamen Ernten
3.4.4 Die gemeinsame Erziehung
3.4.5 Die geselligen Abende
3.4.6 Die politischen Diskussionen
3.4.7 Die religiösen Diskussionen
3.5. La Corniche
3.6. Le Cap Blanc
4. Paris: Elitäres Gymnasium und Elite-Hochschule
5. Die Entscheidung nach Deutschland zu gehen und die Warnungen vor diesem Schritt
6. Die Ankunft in Deutschland und das Erlernen der Sprache
7. Der Urlaub 1967
8. Die Lehrjahre an den Unis
9. Eine kleine Sirene
10. Das weitere Studium
11. Tod des Großvaters und die Folgen
12. Tod des Vaters und der Berufsanfang
13. Das Begräbnis des Vaters und die Folgen
14.Die Entscheidung eine Deutsche zu heiraten
14.1 Was verbindet ihn mit seiner Frau?
14.2 Die familiären Konsequenzen
15.Der Bruch
16.Die Entscheidung für die deutsche Staatsbürgerschaft
16.1. Die Gründe
16.2 Die familiären und gesellschaftlichen Konsequenzen
17.Sein beruflicher Werdegang
17.1 Vorwort
17.2. Arbeit in einer internationalen Organisation
17.3 Leitung einer Stahl- und Maschinenbaufirma
17.4 Mitarbeit bei einem internationalen Beratungsunternehmen
17.5 Einstieg bei einer internationalen Organisation
18.Der soziale Aufstieg
18.1 Vorbemerkung
18.2 Die Häuser
18.3 Die Investitionen
18.4 Das Schloss in Frankreich
18.5 Woher hat Marius das Geld?
19.Der tägliche Kampf um die Daseinsberechtigung und gegen Vorurteile
19.1 Vorbemerkung
19.2 Die Gerüchte um Marius Herkunft
19.3 Der ewige Feind
19.4 Die Zwischenfälle
19.5 Und Du bleibst doch ein Fremder!
19.6 Und sie haben doch nichts gelernt!
19.7 Der alltägliche Rassismus
19.7.1 Vorbemerkung
19.7.2 Rassismus in der Familie
19.7.3 Rassismus in der Straße
19.7.4 Rassismus beim Einkaufen
19.7.5 Rassismus beim Arztbesuch
19.7.6 Rassismus bei Rechtsanwälten und Juristen
19.7.7 Ist Deutschland ein rassistisches Land?
19.8 Die geschlossene Gesellschaft
19.8.1 Vorbemerkung
19.8.2 Fremde nur geduldet?
19.8.3 Am deutschen Wesen soll das Welt genesen: eine Realität?
19.8.4 Wer mag die deutsche Gesellschaft außer sie sich selbst?
19.8.5 Was hat die Gesellschaft aus der Geschichte gelernt: nichts!
19.8.6 Diktatur der Dummen und Gutmenschen!
19.8.7 Neuralgischer Punkt: Die deutsche Identität
19.8.8 Und doch eine geschlossene Gesellschaft!
19.8.9 Und sie fangen schon wieder an!
19.8.10 Eine Gesellschaft von Opportunisten?
19.8.11 Eine Gesellschaft von Untertanen?
19.812 Deutschland der Dichter und Denker: Quo vadis?
19.8.13 Kann man dieser Gesellschaft vertrauen?
20. Die Straße ohne Seele
20.1 Vorbemerkung
20.2 Der Wohnort
20.3 Die Straße ohne Seele
20.4 Die Bewohner der Straße
20.5 Kaum Kommunikation
20.6 Kaum Nachbarschaft
20.7 Jeder für sich
20.8 My home is my castle
20.9 Mein Nachbar ist “mein geborener Feind“
20.10 Die Straße ohne Seele - ein Abbild der deutschen Gesellschaft?
21.Die falsche Wahl? Oder Marius familiäres Leben in Deutschland
21.1 Das erste Treffen mit ihrer Schwester
21.2 Die Eltern
21.3 Die älteste Schwester, ihre Familie und ihre Tochter
21.4 Die Dritte im Bunde mit Familie und Kindern
21.5 Die jüngste Schwester und ihr Kind
21.6 Der Rest der Familie
21.7 Marius ist nur ein Ausländer, gerade nur geduldet und suspekt
21.8 Marius Reichtum nicht geheuer?
21.9 Verlogenheit und Heuchelei als Prinzip
21.10 Keiner bei der Hochzeit
21.11 Das Ende der Geduld und Marius Bruch mit der Familie
22.Die Schicksalsschläge
22.1 Vorbemerkung
22.2 Verlust des eigenen Kindes
22.3 Unfall im Chateau
22.4 Tod des Schwiegervaters
22.5 Tod der Schwiegermutter
23.Die falsche Wahl? Marius Fehler?
24.Marius als Vermieter
24.1 Vorbemerkung
24.2 Marius Erfahrungen
24.3 Benachteiligung des Vermieters durch das Mietrecht
24.4 Marius und die Mieter
24.5 Marius und die Handwerker
24.6 Marius Résumé aus der Vermietung
25. Marius Jugendwiege: Das Mittelmeer
26. Camus und Co
27. Marius und seine festen Überzeugungen
28. Marius ständige Begleiter: Zweifel und Hoffnung
29. Die Zwischenbilanz
30. Heimat ist ein Privileg
31. Die Sehnsucht nach dem Ausbruch aus dem Mief
32. War es doch ein Irrtum? Oder die geplatzten Träume und Hoffnungen
33. Epilog
1. Vorwort
Ich traf Marius vor anderthalb Jahren in einer mittelgroßen Stadt in Deutschland und war erstaunt über seine Persönlichkeit.
Unscheinbar nach außen, und trotzdem war Marius nicht gewöhnlich. Er hat sehr darunter gelitten, dass er einen ständigen Kampf um seine Daseinsberechtigung führen musste.
Nach 50 Jahren Aufenthalt in Deutschland wollte er für sich selbst eine Zwischenbilanz ziehen und vor allem herausfinden, inwieweit die Vorurteile gegenüber diesem Land eine Grundlage haben.
Er hatte sich damals, als er nach Deutschland kam, gegen alle Widerstände für dieses Land entschieden und hat dafür einen erheblichen Preis bezahlt. In seinen alten Tagen fragte er sich, ob sich dies alles gelohnt hat.
Wir haben uns befreundet und er hat mir versprochen, sein Schicksal zu erzählen und zwar mit der größtmöglichen Ehrlichkeit und mit der Bitte, seine Erzählungen in Schriftform weiterzugeben.
2. Marius Familie und Herkunft
Als Jahrgang 1949 war Marius in eine „gespaltene“ Familie hineingeboren. Gespalten insoweit, als dass seine Mutter aus einer adeligen, sehr konservativen Familie stammend mit den Werten des 19. Jahrhunderts behaftet war.
Deren Familienoberhaupt war ein Patriarch. Seine Ansichten und Worte galten als Gesetz. In diesem Teil der Familie wurden kein Widerspruch und keine Diskussion geduldet. Oberste Maxime des Patriarchen war die Vermehrung der Familie durch Heirat oder die Erhöhung des sozialen Standes durch Ausbildung.
Sein Großvater mütterlicherseits führte eine strenge Kontrolle der Ausbildung seiner Enkelkinder durch. So war es selbstverständlich, dass ihm bei jedem Quartalszeugnis alle Noten und Bewertungen der Enkelkinder vorgelegt wurden. Todsünde war, wenn eines der Kinder eine schlechtere Note als eine Eins hatte. Zudem war es Pflicht, dass jeden Sonntag die Familie inklusive aller Enkelkinder in Sonntagsanzügen an einem großen Tisch zum Mittag- und Abendessen anwesend war. Großzügiger Weise billigte sein Großvater mütterlicherseits gewisse Freiheiten am Tisch für die Kinder unter fünf Jahren. Alle Kinder, die älter als fünf Jahre alt waren, mussten die „guten Manieren“ beherrschen.
Sein Cousin und er waren von Geburt an Linkshänder. Sein Großvater mütterlicherseits trug dafür Sorge, dass sie beim Essen und beim Schreiben die linke Hand auf den Rücken geschnallt bekommen haben. Darunter leide Marius bis heute.
Keine Entscheidung über die Ausbildung, Weiterbildung, Verbindung oder Heirat durfte ohne die ausdrückliche Zustimmung des Großvaters mütterlicherseits getroffen werden.
Sein Großvater mütterlicherseits machte den Kindern selbst nie einen Vorwurf, sondern den Müttern und Vätern. Marius sah oft seine Mutter weinen, weil entweder sein Bruder oder er nicht die erwartete Note nach Hause brachten, oder weil sie am Sonntag vielleicht im Park Fußball spielten.
Außerdem verzieh sein Großvater mütterlicherseits seiner Mutter nie, dass sie einen nicht standesgemäßen Ehemann ausgewählt hatte, obwohl sein Vater eine elitäre Universität („Ecole Polytechnique“) absolviert hatte und dessen Vater immerhin über 30 Jahre Kapitän eines großen Frachtschiffs („Marine Marchande“) gewesen war.
Für hiesige Verhältnisse war das die Oberklasse des Bürgertums, aber eben nicht adelig.
Sein Großvater väterlicherseits war das Gegenteil seines Großvaters mütterlicherseits. Er liebte seine Mutter und seinen Sohn abgöttisch, war mehrsprachig und weltoffen. Und vor allem war er für seine Zeit sehr fortschrittlich und tolerant.
Aufgrund seiner beruflichen Erfahrung war er sowohl politisch als auch ökonomisch stets im Bilde (selbst im hohen Alter). Sein Großvater väterlicherseits war aufgrund dessen, dass seine Mutter seinen Vater sehr oft bei seinen Dienstreisen begleitet hat, immer für die Kinder da.
Er erzog sie liebevoll mit und förderte von jungen Jahren an sehr stark ihr kritisches Denken. Zudem war sein Großvater väterlicherseits ein ausgesprochen ebenbürtiger Gegner seines Großvaters mütterlicherseits.
Erstaunlicherweise respektierte sein Großvater mütterlicherseits ihn stets. Ein einziges Mal war er Zeuge einer Auseinandersetzung zwischen Großvater väterlicherseits und Großvater mütterlicherseits und war erstaunt, wie Großvater väterlicherseits sich durchgesetzt hat.
Sein Großvater väterlicherseits brachte den Kindern stets bei, jeden Menschen und jedes Tier zu respektieren, egal, wie er oder es sich verhielt und achtete stets darauf, dass sie, selbst wenn sie tief verletzt wurden, die Contenance nicht verloren.
Sein Großvater väterlicherseits brachte ihnen auch bei, dass Geschichte und Geopolitik sowie das vernetzte Denken eine Voraussetzung fürs Leben sind.
Er hat nie auf die Noten in der Schule gepocht. Die Noten waren für ihn ein notwendiges Übel, das niemals ein Kind in seiner Entwicklung behindern sollte.
Sein Großvater väterlicherseits hat stets darauf geachtet, dass sowohl sein Bruder als auch er gegenüber Ihren Nachbarn und Mitmenschen eine gewisse soziale Kompetenz an den Tag legten.
Ein Onkel der Familie mütterlicherseits, Onkel Joseph, darf in diesen Schilderungen nicht vergessen werden, denn er war in den Augen des Großvaters mütterlicherseits das „Schwarze Schaf“ der Familie.
Mit dem abgeschlossenen Philosophiestudium hat er sich an keine Konvention gehalten. Er nahm sich alle denkbaren und undenkbaren Freiheiten.
Er verführte die Kinder zum „Unsinn“, er stellte stets die Autorität seines Vaters öffentlich in Frage, begehrte gegen jegliche Art von Autorität auf. Er konnte wunderschön Geschichten und Märchen erzählen und hatte auf alle Kinder der Familie einen enormen Einfluss.
Trotz ihrer häufigen Frivolität besaßen seine Geschichten immer einen tiefen moralischen Wert. Er nahm sie stets vor Ihren Großvater mütterlicherseits in Schutz, selbst dann, wenn er Auseinandersetzungen riskierte. Zudem war er die eigentliche Vertrauensperson seiner Mutter und seiner Geschwister gegenüber seinem Vater.
Nicht zu vergessen ist, dass ein Sohn seines Großvaters mütterlicherseits ins Konzentrationslager gebracht wurde, weil er Kommunist war. Er starb in Buchenwald. Darum war Deutschland für seine Familie mütterlicherseits ein „rotes Tuch“.
Während seinem Großvater väterlicherseits eine relativ „objektive“ Geschichte von Deutschland zeichnete, fand seinem Großvater mütterlicherseits nichts Gutes in der gesamten deutschen Geschichte.
Er sprach sogar den deutschen Denkern und Philosophen ihren Rang ab. Das wiederum wurde von seinem Großvater väterlicherseits und seinem Onkel nicht toleriert. Marius werde nie vergessen, dass er einmal im ersten Teil des Abiturs eine Hausarbeit über Kant schrieb, welche von der ganzen Familie bejubelt, von Großvater mütterlicherseits allerdings heftigste kritisiert wurde, weil Kant ein deutscher Philosoph war.
Nach dem Tod seines Großvaters erfuhr Marius, dass er mit Heidegger (deutscher Philosoph des 20, Jahrhunderts) befreundet gewesen war und dass er ihm nie verziehen hatte, dass er eine Rolle bei der Nazi-Propaganda gespielt hatte.
Väterlicherseits sollte ebenfalls ein Onkel erwähnt werden, der Professor für Jura war und der die gesamten Juristen der Welt für Scharlatane hielt. Sein üblicher Spruch war: „Den achten Fluch, den der liebe Herrgott auf die Erde gebracht hat, sind die Juristen.“ Dieser Onkel war für die Kinder sehr spröde und passte nicht zur Familie väterlicherseits, obwohl er bei den Damen einen gewissen Ruf genoss.
Zu seiner Mutter sei gesagt, dass sie ihre Karriere als Absolventin der „Ecole Normale Superieure“ (ENS) begann. Das heißt, sie war prädestiniert an einer Universität oder Hochschule zu lehren. Sie war sanft und bildhübsch. Sie hatte schöne, blaue Augen und war stets elegant gekleidet. Sie achtete stets darauf, dass die Kinder und sie selbst eine Verbindung zur europäischen Literatur pflegten. Sie hatte sowohl das kleine als auch das große Latinum und sprach vier Sprachen. Sie starb relativ jung.
3. Die Straße seiner Kindheit
3.1 Vorbemerkung
Marius schloss die Augen und sah dieses große Wohnviertel in seiner Geburtsstadt, das an der „Plage“ anfing und bis zum Kanal und zum Industrie-/Militärhafen mit einer weltbekannten Werft und zum Stadtinneren hin bis zum alten Hafen reichte.
Allein dieses Wohnviertel war ca. sechs Quadratkilometer groß. Die Stadt befindet sich in einer großen Bucht und besitzt einen sehr großen inneren See, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit einem großen und modernen Kanal mit dem Seehafen verbunden wurde. Der alte Hafen wurde von den Phöniziern im Rahmen ihrer Eroberung des Mittelmeers vor mehr als 2000 Jahren gebaut.
Neben dem Seehafen lag ein strategisch wichtiger Militärflugplatz. Ein Teil der Bevölkerung gehörte zum Militär. Die Stadt hatte insgesamt vier Leuchttürme, die tief im Mittelmeer standen. Die grüne, gelbe und weiße Farbe waren stets bis in die Stadt deutlich zu sehen.
In dem Viertel waren ca. 40 Straßen, zwei Kinos, vier Metzger, vier Kolonialwarenläden und vier Gemüsehändler, Lebensmittelgeschäfte, zwei Wäschereien, drei Uhrmacher, ein Steinmetz, eine kleine Limonadenfabrik, vier Bäckereien/Konditoreien, vier Cafés, zwei Bars, eine Polizeiwache, ein Schiedsmann, zwei Horte, drei Kindergärten, eine Volksschule für Mädchen und eine für Jungs, ein Lyzeum, drei Notare, zwei Bestatter und eine Straße der Goldschmiede (denn die Frauen waren äußerst anspruchsvoll im Hinblick auf die Einzelanfertigung von Schmuck).
In diesem kleinen Kosmos haben Franzosen katholischer und evangelischer Richtung, jüdischen Glaubens, muslimischen Glaubens, buddhistischen Glaubens, orthodoxen Glaubens, hinduistischen Glaubens und einige Atheisten gelebt. Das Viertel kann als gutbürgerlich beschrieben werden. Viele hochstehende Persönlichkeiten waren dort angesiedelt: Ärzte, Notare, Rechtsanwälte, Professoren, Lehrer, Richter, religiöse Würdenträger, Ingenieure, Generäle, aber auch ganz normale Handwerker und Arbeiter. Zum Viertel gehörten auch außergewöhnliche Persönlichkeiten, drei Philosophen, drei Moralisten, zwei Soziologen, sechs Schriftsteller,Kinobesitzer, zwei Bar-Besitzer, sechs Generäle, zwei Richter, zwei Staatsanwälte, drei Außenpolitiker und vier Kapitäne größerer Schiffe.
Dieser Kosmos hat trotz dieser Unterschiedlichkeiten auf das Beste funktioniert, denn die Leute waren bereit, vorhandene Differenzen nicht so aufzubauschen. Zudem waren sie bemüht, nicht nur ihre Kinder, aber auch die Kinder des Nachbarn teilweise in ihren Werten zu erziehen. Es ging so weit, dass ab und zu, wenn religiöse Feiertage anstanden, eine Übereinkunft getroffen wurde, wie die Feiertage hintereinander zu feiern waren. Das Angenehme dieses Viertels war, dass die Bewohner nicht bestrebt waren, den höchsten Profit zu Lasten der anderen zu erzielen. Man hat dort nach dem Prinzip „Leben und Leben Lassen“ gelebt. Zudem haben diese Bewohner die Unterschiedlichkeit jedes Einzelnen akzeptiert.
Eines der besten Beispiele stellte für die damalige Zeit eine äußerst feministische Dame namens Lilly dar, dem jüdischen Glauben angehörend, über 1,80 groß, rothaarig, eine Mischung aus Milva und Dalida, die aus einer sehr reichen, jüdischen Familie stammte und hinter der alle Männer des Viertels her waren. Sie führte sehr selbstständig Geschäfte durch und verliebte sich zum Leid aller Männer in einen Buckligen (er sah aus wie ein Quasimodo). Er hatte sehr feine Gesichtszüge, aber sein Buckel verlieh ihm den Spitznamen „Quasimodo“. Er hatte ihre Avancen immer zurückgewiesen, bis sie ihm im Viertel öffentlich einen Heiratsantrag machte. Dies kam zwar einem Skandal gleich aber die beiden haben mit einer Hochzeitsfeier, die drei Tage dauerte, geheiratet.
Marius würde nie vergessen welchen Skandal es auslöste, als ein Pastor (evangelisch) sich mit einer geschiedenen Frau verheiraten wollte, obwohl dieses katholischen Glaubens war. Dieser Skandal war so weitreichend, dass in einer Nachtsitzung die Alten und Weisen des Viertels zusammenkamen und unter dem Einfluss mehrerer guter Weine beschlossen, die Hochzeit zu ermöglichen.
3.2. Die Straße
Die Straße wurde nach einem Arzt benannt, der sich um die Entwicklung des Sanitär- und Gesundheitswesens in Afrika verdient gemacht hatte.
Die Straße verläuft parallel zum Kanal verläuft und endet im Boulevard de la Plage. Der Boulevard de la Plage begann am Kanal und verlief parallel zu dem Meer und endete an der Grenze zum Alten Hafen. Der Boulevard war ca. 70m breit und gesäumt von hochragenden Palmen.
Gegenüber der Plage standen wunderschöne Häuser aus der Belle-Epoche Zeit. Die Straße war ca. 300m lang und 9m breit. Die Bürgersteige waren 1,50 m breit. Die Fahrbahn war kaum durch Verkehr belastet, und diente für die Kinder als Spielplatz oder für das Gemeinschaftsleben der Anwohner. Geht man von der Straße in Richtung Innenstadt so war man am Boulevard General Leclerc. An der Kreuzung Leclerc standen eine Limonadenfabrik und ein Kino, das Le Majestic. Dieses Kino hatte die Besonderheit, dass das Dach geöffnet werden konnte, sodass die Filme im Sommer quasi unter freiem Himmel gezeigt wurden. Die Bebauung der Straße wurde gegen 1860 fertig gestellt, sodass alle dort stehenden Häuser Belle-Epoche-Häuser mit drei bis vier Stockwerken waren. Sie hatten wunderschöne Fassaden und dekorierte Balkone. Die Häuser gingen stark in die Tiefe. Hinten hatten sie meistens einen Innenhof, der sehr intim war und sehr oft als eine Art Garten benutzt wurde.
In der Straße waren ca. 200 Wohnungen zwischen 200 und 500qm groß. Die Zimmerdecken waren 3,50m hoch. Und da die Helligkeit sehr stark war, waren alle Fenster mit Fensterläden aus Holz versehen, die oft nicht mehr richtig schließen konnten, weil sie sich wegen der Temperatur verzogen hatten.
Alle Häuser hatten Flachdächer, sodass oben eine Terrasse entstand, welche oft gefliest war und eine Sicht über die gesamte Bucht ermöglichte. In der Hitze des Julis und August dienten sie als Schlafplätze unter freiem Himmel.
Diese Nächte waren für jeden sehr reizvoll, denn neben der Geruchsmischung aus Jasmin, Salzwasser, Orangen, Datteln, Zitronen und Lavendel boten sie eine nicht bezahlbare Sicht auf die Sterne und das Meer.
Und wenn die Leute wegen der Hitze nicht so früh schlafen konnten, so wurde ein zweites Abendessen angerichtet und unter dem Gesang von berühmten französischen Chansonniers wie Edith Piaf oder Tino Rossi genossen. Sobald dieser erklang, waren die Frauen nicht mehr zu halten und es musste sehr oft zu den Tango-Liedern getanzt werden.
Diese Nächte haben manchmal bis drei oder vier Uhr gedauert, ehe eine gewisse kühle Brise vom Meer kam und es den Leuten ermöglichte, ein paar Stunden zu schlafen.
Im Sommer war das Aufstehen entweder sehr früh gegen fünf Uhr oder nach zehn. Für die Leute, die auf den Markt, insbesondere auf den Fischmarkt gehen mussten, war das Aufstehen schon vor vier Uhr nötig.
Die anderen trödelten langsam bis zehn Uhr. Das Frühstück war gerade im Sommer spartanisch, erst gegen elf Uhr hatte man etwas gegessen.
Da Ihren Eltern Angst vor Sonnenbränden hatten, mussten die Kinder der gesamten Straße sehr früh geweckt werden, um von acht bis neun Uhr zu schwimmen, wie eine kleine Schafherde zur Plage getrieben und unter strenger Aufsicht zwei oder drei Mal ins Wasser zu springen, um dann wieder nach Hause zu gehen. Erst gegen 17.00 durften sie wieder auf die Straße.
In der Straße wohnten ca. 120 Familien mit ca. 130 Kindern. Die Schulferien waren vom 15. Juni bis zum 15. Oktober, eine Woche zu Weihnachten und zu Ostern.
Die Schulen waren so ausgerichtet, dass die Eltern ihre Kinde gegen acht Uhr dort abgeliefert hatten und dass sie je nach Fach Schulstunden hatten, dass sie von 11.30 bis 14.00 Essen und Ruhen hatten und dann von 14.00 bis 17.00 erneut Unterricht. Abends zu Hause oder im Pensionat machten sie Hausaufgaben. Dies an fünfeinhalb Tagen in der Woche. Die Auslese war streng, denn die reichen Eltern konnten sich private bzw. kirchliche oder elitäre Schulen leisten.
Die Ausbildung der Kinder stand an höchster Stelle bei den Geldausgaben der Eltern. Zu diesem Zeitpunkt gab es im französischen Schulsystem das Prinzip, dass überdurchschnittlich gute Kinder die Klassen überspringen konnten. Marius hatte das Glück oder das Pech davon betroffen zu sein. Das hatte Marius in seinem Fall nie verstanden.
3.3 Die Bewohner der Straße
Die Bewohner der Straße waren sehr gemischt hinsichtlich ihrer Herkunft und Religion, der soziale Status war relativ homogen. 50% der Einwohner waren Urfranzosen, 10% waren Italiener, 5% Griechen, 5% Russen (die vor der Oktoberrevolution geflohen waren), 10% Türken, 3% Malteser, 1% Marokkaner, 1% Algerier, 1% Tunesier, 1% Albaner, 1% Inder, ein einziger Deutscher. Die restlichen Einwohner waren aus aller Herren Länder, von Amerika, Argentinien bis zu China.
Was Religionen anbetrifft, so hatten sie Katholiken, Evangelische Christen, Calvinisten, Juden, Orthodoxe Christen, Orthodoxe Juden, Buddhisten, Hinduisten, Moslems sunnitischer Richtung und relativ viele Atheisten. In Marius Straße wohnten zwei katholische Priester, ein protestantischer Priester mit Familie, zwei normale Rabbi und ein orthodoxer Rabbi, jeweils mit Familie, ein orthodoxer Priester ohne Familie, ein sunnitischer Vorbeter. Und ein buddhistischer Mönch.
Von der Altersstruktur her waren 10% der Bewohner älter als 60 Jahre, 10% zwischen 50 und 60, 20% zwischen 40 und 50, 20% zwischen 30 und 40, 15% zwischen 20 und 30, 25% Kinder und Jugendliche unter 20.
Folgende Berufe waren in der Straße vertreten: Ärzte, Ingenieure, hochrangige Militärs, Anwälte, Richter, Notare, Mittelständische Unternehmer, Handwerker, Schriftsteller, Lehrer, Wissenschaftler, Philosophen.
Eine Gemeinsamkeit hatten alle Bewohner der Straße: ihre Liebe zu Büchern. So hatten sie eine Wohnung in der Mitte der Straße, die stets offenstand und als eine Art Bibliothek fungierte. Wenn Marius sich zu Recht erinnere waren alle Wände voller Bücherregale und davor standen rundum Tische mit Stühlen. Die Elektriker haben dafür Sorge getragen, dass es stets genügend Licht gab, im großen Salon mit großen Fenstern zum Innenhof war ein wunderschönes altes Klavier, an dem seine Musiklehrerin Madame Fhyol den Kindern die klassische Musik näherbringen wollte. Auch wenn die Kinder dazu weder Begabung noch Muße hatten. Madame Fhyol war immer in schwarz gekleidet, da ihre große Liebe im ersten Weltkrieg gefallen war. kann sich nicht daran erinnern, dass sie sich jemals um einen anderen Mann bemüht hat. Sie war sehr streng, vor allem die theoretischen Grundlagen der Musik hat sie ihnen eingebläut. So kam Marius zum ersten Mal in seinem Leben mit vier Jahren in Berührung mit Mozarts türkischem Marsch, den er bis heute liebe. Dagegen waren ihre Bemühungen sie im Alter zwischen 8 und 9 Jahren Wagner näher zu bringen, voll gescheitert. Bis heute hat Marius starke Probleme, wenn er Wagner hören muss.
Außerdem sind ihre Bemühungen ihm das Geigenspiel beizubringen grandios gescheitert. Aber Marius hat bis heute die höchste Achtung vor den Geigenspielern. Dieses ständige stundenlange Üben mit immer gleichen Tönen hat ihm eine Zeitlang von jeder klassischen Musik entfernt.
Er möchte hier ansatzweise verschiedene Bewohner beschreiben, die ihm ein Leben lang in besonderer Erinnerung geblieben sind und stark seine Persönlichkeit mitgeformt haben:
Marius Mutter
Seine Mutter war für die Zeit eine relativ große Frau. Sie war etwa 1,75m groß und schlank. Sie hatte wunderschöne, lange schwarze Haare und eine leicht bronzefarbene Haut. Sie hatte klare blaue Augen und lange Wimpern und sehr zarte Gesichtszüge.
Sie hatte einen sehr eleganten Gang und trug sehr oft lange Kleider aus Seide. Manchmal flocht sie sich die Haare und wand sie zu einem Kranz um den Kopf.
Sie war immer nur leicht geschminkt. Sie sprach stets mit einer zarten Stimme. Für sie waren ihre Kinder, ihr Mann und die Kultur der Mittelpunkt ihres Lebens.
Da sie sehr oft mit seinem Vater, der im Auswärtigen Dienst tätig war, unterwegs war, war sie nicht die typische Hausfrau. Wenn sie zu Hause war, hat sie sehr gut für den Haushalt gesorgt, allein oder mit Hilfe einer Hausdame. Sie war selbstbewusst und konnte elegant bei politischen Diskussionen mithalten. Gegenüber den Kindern war sie immer streng und gleichzeitig liebevoll.
Sie war sehr streng hinsichtlich der sozialen Erziehung und eher sehr gütig hinsichtlich der Leistungen in der Schule, was ihr stets Ärger mit ihrem eigenen Vater einbrachte.
Sie besaß selbst eine beeindruckende Bibliothek, die mehrere hundert Bücher zählte. Sie war mehrsprachig ausgebildet und sehr sicher in der geopolitischen Geschichte.
Sie war eine erstklassige Köchin, wenn sie zu Hause war. Ab und zu brauchte sie nichts zu sagen, ihre Blicke waren wie Gesetze. Sie ist relativ jung gestorben und Marius glaubte, dass sein Vater darüber nie hinweggekommen ist.
Sein Vater hat sich erst nach sehr langer Zeit wieder auf eine Beziehung eingelassen. Den Grund ihres Todes kann Marius nur vermuten, möglicherweise litt sie an Brustkrebs. Marius hatte seine Mutter nur zwei Mal weinen sehen, einmal weil sein Großvater mütterlicherseits ihr vorwarf, dass sie einen minderwertigen Mann geheiratet hatte, der ihrerKlasse nicht ebenbürtig war und einmal, weil Marius die schulische Leistung trotz einem Durchschnitt über 17 von 20 Punkten in seinen Augen nicht erreichte. Sie hat den Kindern stets beigebracht, dass es bei der Beurteilung des Verhaltens von Menschen sehr wichtig sei gütig zu sein. Für sie gab es keine Unterscheidung in schwarz und weiß, sondern grau in grau. Zudem war es für sie sehr wichtig, dass jeder Mensch das Recht hatte, Fehler zu machen.
Marius Vater
Sein Vater war ein großgewachsener Mann von ca. 1,90m. Für einen Mann hatte er eine eher athletische Figur, stets sehr gut gepflegt, der Scheitel war stets perfekt, er trug nie eine Brille und hatte ausgesprochen aufrichtige, große, braune Augen.
Sein Gang war zügig und er konnte sehr gut zuhören. Er war stets höflich. habe ihn nie schreien hören, selbst wenn die Kinder Unfug veranstaltet hatten. Er machte ihnen zwar Vorwürfe, aber immer mit ruhiger Stimme. Top ausgebildet in der École Polytechnique beherrschte er fünf Sprachen in Wort und Schrift. Marius habe nie gesehen, dass er die Nerven verlor, bis auf ein einziges Mal gegenüber seinem Großvater mütterlicherseits. Als seine Mutter weinend nach Hause kam und er das mitbekam, hatte er Großvater mütterlicherseits zur Rede gestellt und sich mit lauter, klarer Stimme jegliche Einmischung verbeten.
Mit seiner stets diplomatischen Sprache konnte sich sein Vater sehr klar und sehr deutlich äußern, sodass keinerlei Missverständnisse aufkommen konnten. Die Kinder und deine Ehefrau liebte er abgöttisch. Er hat häufig auf manch persönliche Freude zu ihren Gunsten verzichtet.
Er war ein Mann des Friedens, Marius wird nie vergessen, wie er bemüht war, den Frieden zwischen der algerischen Befreiungsfront und der französischen Regierung zu vermitteln.
Er hat sogar Mitglieder der algerischen Befreiungsfront zu ihm eingeladen, um mit ihnen die ganze Nacht in einer entspannen Situation zu diskutieren.
Sein Vater war politisch eher sozialdemokratisch à la Willy Brandt eingestellt. Aber gleichzeitig war er auch Anhänger De Gaulles. Für die Kinder war er stets ein guter Freund mit Hilfestellungen für die Schule oder Ratschlägen für ihren weiteren Werdegang.
Er war einer der wenigen, der seinen Schritt, nach Deutschland zu gehen, verstanden hatte und dass Marius dem Mief der mütterlichen Familienseite entziehen wollte.
Er war irgendwie stolz, dass Marius mit seinem Querkopf gegen die von ihm verhasste Bourgeoisie trotzte. Da er sehr oft in der Welt beruflich unterwegs war, bat er seinen Vater und seine Mutter auf die Kinder aufzupassen, und ihnen die nötigen Werte zu vermitteln. Als Werte hat sein Vater die Kinder vor allem die Ehrlichkeit gegen sich selbst beigebracht, die klare, analytische Denkweise und die Notwendigkeit, manchmal gegen den Strom zu schwimmen, selbst dann, wenn man Nachteile erleiden sollte.
Seine Großmutter
Großmutter war auch eine elegante Dame, nicht besonders groß mit ca. 1,60m, jedoch selbst für ihr Alter relativ schlank.
Sie hatte aber blondes Haar und braune Augen und einen goldenen Eckzahn. Sie hatte kleine Ohrringe, der einzige Schmuck, den Marius neben ihrem Ehering je gesehen habe. Sie war gebildet, da sie zu ihrer Zeit bereits ein Abitur und ein so genanntes Vorphysikum, also Grundlagen der Medizin, studiert hatte.
Sie musste ihr Studium damals abbrechen, um Großvater zu heiraten. Sie hat die gesamten Jahre, als die Kinder groß waren, unentgeltlich im Krankenhaus ausgeholfen und Zeit ihres Lebens sich um Ihre Enkelkinder gekümmert. Sie war sanft, aber auch bestimmt. Sie hat den Kindern nicht alles durchgehen lassen, dafür hat sie Großvater nie erzählt, was sie falsch machten. Sie liebte ihre Kinder und Enkelkinder abgöttisch und Marius glaubte, sie war immer, bis zuletzt, verliebt in seinen Großvater.
Marius Großmutter hat die Kinder stets beigebracht, für die Armen und Kranken Mitgefühl zu haben und selbst wenn sie nichts zu verschenken hatten, dann ein gutes Wort zu schenken.
Sie hat die Kinder auch beigebracht, nicht bei jeder Kleinigkeit zu jammern und nicht jedes Risiko zu scheuen. Einer ihrer Lieblingssätze war: Das Leben ist selbst ein Risiko. Sie starb ebenfalls relativ jung. Großvater kam darüber nie hinweg und hat trotz Avancen von vielen Frauen nie wieder geheiratet.
Sein Großvater
Großvater war ca. 170-175 groß, stämmig, mit vollem Haar und einem Bart. Er hatte braune Augen und eine riesige Matrosenhand.
Er war selbst Kapitän in der Marine Marchande und fuhr über 30 Jahre auf See, jeweils acht Monate im Jahr. Vier Monate des Jahres verbrachte er zu Hause. Er fuhr über 70 Länder an und erzählte gern von den Teilen seiner Reisen, von denen sie wissen sollten. Vom Typ her erinnerte er an Jean Gabin.
Er war für seine klaren Ansprachen bekannt und war deswegen sowohl in der Stadt, als auch im Viertel und in der Straße sehr geachtet.
Marius hatte nie gehört, dass er über die Leute irgendwie schlecht sprach. Wenn er mit der jeweiligen Person ein Problem hatte, sprach er sie direkt an.
Er war sehr weltoffen und sprach selbst mehrere Sprachen und war das Gegenteil seines Großvaters mütterlicherseits. Er hasste die Adeligen, und die Groß-Bourgeoisie hasste er wie die Pest und warf ihnen stets Starrsinn und Denkfaulheit vor.
Er war das personifizierte „Leben und leben lassen“ und konnte mit den Vertretern aller Religionen sehr gut auskommen. Selbst von General Morell wurde er geachtet, weil er einer der wenigen war, die ihm klar widersprachen.
Er liebte abgöttisch seine Kinder und seine Enkelkinder und Marius hatte erlebt, wie er einige Male Großvater mütterlicherseits in den Boden stampfte. Er konnte sehr bissig mit seinen Kommentaren sein und machte Leuten sehr schnell klar, was er von ihnen hielt.
Er hat aber nie jemanden persönlich verletzt oder beschimpft und war im Viertel eine gewisse Instanz. Neben seinen unglaublich handwerklichen Fähigkeiten, die er den Kindern vergeblich versuchte beizubringen, besaß er die Fähigkeit sehr schnell Konzeptionen zu entwickeln und Probleme zu lösen.
Er war auch einer der wenigen, der Marius Schritt nach Deutschland zu gehen, verstand und das Verhalten von Großvater mütterlicherseits streng verurteilt und ihm sehr übelgenommen hat.
Er war Anhänger eines ausgesprochen fairen Verhaltens und hat sich nie nach vorne gedrängt. Sein Lieblingsspruch war: „Man muss sich in Acht nehmen, wenn man von Dritten nur gelobt wird“.
Und die Kinder sollten etwas für ihr Umfeld tun und nicht darüber reden. Man brauchte nach seiner Meinung nicht seine gute Tat beim Dritten erzählen, anzupreisen oder zu rechtfertigen, nur das Gewissen ist der Kompass des Verhaltens.
Zudem hat er sie immer vor den sogenannten Halbwissenden in der Gesellschaft gewarnt. Die stellten in seinen Augen eine der Ursachen des Niedergangs der europäischen Kultur dar.
Ein weiterer Punkt, der ihm sehr wichtig war, war das Nicht-Abschalten des kritischen Denkens. Kritisches Denken ist Pflicht insbesondere gegenüber Menschen und Gesellschaften, denen man sehr nahesteht. Für ihn war Marius bis kurz vor seinem Tod immer der kleine „Michou“ oder „Mimi“.
An folgende Einwohner der Straße erinnerte sich Marius sehr gerne, denn sie waren stets gut zu ihm.
Monsieur Joseph
Monsieur Joseph war eigentlich von zuhause her ein ärmerer Jude und er wurde von einer reichen Jüdin geheiratet (die ihm den Heiratsantrag gemacht hatte). Monsieur Joseph war damals um die 40 Jahre alt, nicht besonders groß und eher von schwacher Statur, auf dem Rücken einen kleinen Buckel. Er hatte wenige Haare auf dem Kopf und trug eine große dicke Brille. Seine Frau Hannah war dagegen mindestens 175 cm groß und stämmig mit einem enormen Busen, was sich als Kind stets beeindruckt hat. Sie war immer sehr elegant gekleidet, geschminkt und trug ihre langen Haare offen als Mähne. Sie war kinderlos und war für die Kinder eine liebe Tante. Sie hatte immer Bonbons und Schokolade und ein Küsschen (was mir hin und wieder Zuviel war). Monsieur Joseph hatte einen liberalen Beruf, ich glaube er war Notar. Und er war seinem Großvater väterlicherseits sehr dankbar, weil dieser ihn während der deutschen Besatzungszeit mit einem arabischen Pass versorgt und so vor Verfolgung und Deportation geschützt hatte. Er hat sich, solange er in dieser Straße gelebt habe, unerlässlich darum bemüht, die Deutschen, die Nazis und Hitler zu erklären. Er hat nie verstanden warum Marius später als Absolvent einer großen Ingenieurschule in Frankreich nach Deutschland gegangen ist und er nahm ihm das sehr krumm. Während seines Aufenthalts in der Straße hat er immer versucht, ihm die hebräische Sprache und Schrift beizubringen, vergeblich. Marius werde nie vergessen, dass er ihm als einem der Wenigen seine geheimen Schätze gezeigt hat. Dies war die größte private Bibliothek, die Marius jemals gesehen habe. Mit sehr schönen alten Büchern, die mit Gold verziert waren. Er hat ihm sogar Bücher gezeigt, die kurz nach der französischen Revolution gedruckt worden waren. Marius werde nie vergessen, dass er die Kinder der Straße nach dem Sabbat immer Päckchen mit kleinen Dragees geschenkt hat. Dies waren die besten Dragees, die Marius in seinem Leben gegessen habe. Marius werde nie vergessen, wie er ihm im Sommer 1967 sehr eindringlich warnte, den Deutschen zu vertrauen. Für ihn waren die Deutschen die unheiligen Menschen mit schwarzen Uniformen und SS Zeichen, die in seinen Augen eiskalt Kinder von ihren Eltern oder alte Leute von ihren Enkeln trennten. Marius hat von Monsieur Joseph einen wichtigen Grundsatz gelernt: „Nie sich selbst nach dem Preis seiner eigenen Entscheidung fragen.“
L’ Abbé André
Er war einer der katholischen Priester, ein gut genährter „Bon Vivant“ mit ca. 190cm von großer Statur und einem kleinen Bäuchlein, relativ rotes Gesicht mit einer dunkelroten runden Nase. Der Abbé André hatte eine klare Stimme und beherzigte klare Worte. Obwohl er der Kirche relativ treu war, hatte er für Voltaire eine heimliche Liebe. Er glaubte an das Gute im Menschen und vertrat den kritischen Verstand. Begabt dafür, die richtigen Worte zur richtigen Zeit und für jedermann verständlich zu finden, hatte er außerdem einen faszinierenden Humor. Mit Abbé André hatten die Kinder stets zu Lachen. Die Kinder mochten ihn sehr, die ganze Straße mochte ihn sehr. Für ihn war die Welt klar aufgeteilt: zwischen Gut und Böse, Schwarz und Weiß. Für alle schweren Probleme hatte er immer sehr einfache Lösungen. Moral und Ethik waren für ihn die Grundlage jeglichen Verhaltens, und zwar für jedermann gleich welcher Religion. Deswegen war er stets bei jeder Feier willkommen, seien es christliche, jüdische, moslemische oder sonstige. Marius erinnere sich sehr gern und mit tiefer Dankbarkeit an die nicht endenden Diskussionen zwischen ihm, dem Rabbi, dem Imam, dem Mönch und dem Atheisten über das Ranking der Religionen.
Die Kinder und Heranwachsenden, die diese Diskussionen kaum verstanden und gebannt und mit großen Augen verfolgten, verstanden nicht warum vier erwachsene Freunde sich so erbittert streiten konnten, wer denn eigentlich Recht hätte.
Bei den Messen war er sehr genau, aber gleichzeitig war er genervt, wenn er jeden Tag mehreren Witwen die Beichte abnehmen musste.
Er fluchte darüber, dass diese Weiber eigentlich nicht jeden Tag zu ihm kommen bräuchten, sondern nur wenn sie tatsächlich Sünden begangen hätten. Marius musste ihm wirklich konzedieren, dass 3/4 dieser Beichten nur von Bigotten durchgeführt wurden. Er konnte das Pharisäertum und die Hypokrisie überhaupt nicht leiden, was ihm manchmal eine Rüge des Bischofs beschert hat.
L’Abbé Paul
Wenn Marius an Abbé Paul denke, denke er meistens an Don Camillo. Der Abbé war ein großer, athletischer Mann mit schwarzen Haaren, in seiner Erinnerung wohl in seinen frühen 40ern. Er hatte in seinen jungen Jahren Rugby gespielt und liebte das Ringen abgöttisch. Außerdem liebte er Kartenspiele, wie Belotte. Dabei verlor er allerdings ständig.
Er war sehr streng, hatte eine gewisse Bauernschläue und südfranzösische Sicht der Dinge. Er war außerordentlich obrigkeitshörig und versuchte seine Schäfchen gegen den sozialistischen Bürgermeister der Stadt zu schützen.
Diese Hörigkeit seinen Vorgesetzen gegenüber war stets Streitthema mit seinem Kollegen, Abbé André. Es ging ein Machtkampf in der Gemeinde zwischen den Anhängern des Abbé André und Abbé Paul vonstatten.
Vor allem die bigotten Witwen waren Anhängerinnen des Abbé Paul. Die jungen Paare und auch Ihren Familie versuchten stets, einen gewissen Abstand zu ihm zu halten, was er Ihnen wiederum sehr krumm nahm und sie in die Nähe der Ungläubigen rückte. Marius muss gestehen, dass er diesen Abbé, warum auch immer, nie gemocht hat. Er war jedoch einer der wenigen, der seine Abwanderung nach Deutschland guthieß.
Der Rabbi Moses
Der Rabbi war ein großer Mann, dürr und mit einem langen grauen Bart. Er war ständig in schwarz gekleidet und trug einen großen schwarzen Hut.
Er war ständig gut gelaunt und trotz seiner eigenen vier Kinder liebte er alle Kinder der Straße, mit denen er sehr viel Unsinn angestellt hat. (Wenn er Fußball spielte, gingen häufig Scheiben zu Bruch).
Er liebte es die Kinder zu necken und hänselte auch die Heranwachsenden, vor allem Mädchen und Jungen, die ihre ersten Liebeleien und den ersten Liebeskummer hatten.
Er war berühmt für seine nächtelangen Diskussionen, vor allem im Sommer, mit dem Abbé André und dem Imam. Trotz seiner Offenheit war er äußerst konservativ in den jüdischen Angelegenheiten.
So duldete er nicht, wenn ein nicht-jüdischer Mann sich für ein jüdisches Mädchen interessierte. Marius hatte das am eigenen Leib gespürt, als Danielle, des jüdischen Glaubens war, ihm einen Heiratsantrag gemacht hatte und der Vater von Danielle bei ihm vorgesprochen hatte um zu besprechen, wie er zum jüdischen Glauben konvertieren könnte. Der Rabbi Moses, der Marius sehr gern mochte, hat trotzdem alle möglichen Schwierigkeiten aufgebaut, um dies zu verhindern. Marius war im Übrigen gar nicht danach gefragt worden, ob er Jude werden wollte. Als er dies empört zurückwies, nahm er es ihm noch nicht einmal krumm. Was er ihm jedoch aber krumm genommen hat, war seine Entscheidung, nach Deutschland überzusiedeln.
Der Rabbi Kako
Der Rabbi Kako war das Gegenstück von Rabbi Moses, klein, etwas rund, barttragend, trug stets seine Kipa. Auch er hatte fünf Kinder, auch er liebte abgöttisch alle Kinder im Viertel und spielte mit ihnen alle möglichen Spiele.
Außerdem hat er den Kindern, die in der Schule schwach waren, kostenlosen Nachhilfeunterricht gegeben, sei es in Mathematik, Französisch, Latein.
Er war aber viel liberaler eingestellt als Rabbi Moses. Und hatte eigentlich nichts dagegen, dass so viele Andersgläubige wie möglich dem Judentum beitreten. Sein Spruch lautete: je mehr Juden, desto besser.
Er war sehr belesen und war der ruhende Pol bei den hitzigen Diskussionen über die Stellung der Religionen. Er hat alle Vertreter der anderen Religionen als Brüder benannt und war einer der wichtigsten Schlichter bei allen Arten von Konflikten.
Er war bei allen verheirateten Frauen, seien es christliche, jüdische, moslemische, wegen seiner klugen Ratschläge sehr geschätzt.
Selbst wenn der Bürgermeister vor kniffligen Fragen stand, ist er zu ihm gekommen. Im Nachhinein hatte er gewisse Ähnlichkeiten zu Nathan dem Weisen.
Er sprach sieben Sprachen, darunter auch Deutsch, und war einer der wenigen, der Deutschland und den Deutschen irgendwie verziehen hatte, obwohl sein jüngster Bruder von der SS verschleppt und getötet wurde.
Er war einer der wenigen, die mit Marius nicht gebrochen hatten, als er seine Entscheidung für Deutschland mitgeteilt hatte. Bei ihm konnte man darauf vertrauen, dass vertrauliche Informationen nicht die Runde machten. Marius war sehr betrübt, als er Anfang der 90er Jahre erfahren habe, dass er gestorben war.
Der Imam Ibrahim
Der Imam Ibrahim war eher ein Durchschnittsmensch, auch er trug einen grauen Bart, der eher ungepflegt war und mit seiner langen grauen Djellaba (nur an Feiertagen trug er eine weiße Djellaba). Er trug um seinen Kopf eine rote Mütze, an Feiertagen einen weißen Turban. Er hatte vier Kinder und liebte trotzdem alle Kinder aller Religionen abgöttisch. Er sprach stets mit leiser Stimme, sodass man gezwungen war, ihm gut zuzuhören. Bei den großen Diskussionen hat er immer gütig gelächelt und hat sehr klar argumentiert, in einer Sprache, die jeder verstanden hat.
Dies nervte ständig den Rabbi Moses, weil er durch sein Lächeln immer verstanden hat, seine Argumente zu Ende vorzutragen und sich nicht unterbrechen zu lassen.
Marius hatte ihn noch nie fluchen sehen, bis auf ein einziges Mal. Als er auf die saudi-arabische Königsfamilie angesprochen wurde, hat er mit rotem Kopf geflucht, denn er hielt die gesamte Familie für Pharisäer.
Er war sehr liberal ausgerichtet und hat nie versucht, Mischehen zwischen Muslimen und Christen und umgekehrt zu verhindern oder zu erschweren. Er war sehr belesen, er konnte Platon rezitieren, er kannte Thomas von Aquin von vorn bis hinten und selbstverständlich Montaigne, Rousseau und Voltaire.
Er sprach vier Sprachen, selbst Hebräisch. Auch bei ihm fühlten die Kinder sich sehr sicher. Er hat den Kindern immer geholfen, wo er nur konnte. Aber er hatte äußerste Bedenken, als Marius ihm seine Reise in den Norden eröffnete. Irgendwie waren ihm die Leute aus dem Norden nicht geheuer. Man muss zugestehen, dass er im 2. Weltkrieg mit der SS schlechte Erfahrungen gemacht hatte.
Er hat aber nicht das gesamte Volk verdammt, meinte aber, das deutsche Volk werde einen teuren Preis für die Fehler der Geschichte bezahlen.
Der evangelische Priester
Der evangelische Priester war groß und hager. Er hatte eine spitze Nase und zog sich irgendwie immer legerer an als der katholische. Er war verheiratet und hatte fünf Kinder. Er war ausgesprochen sozial eingerichtet, das heißt, er hat nicht nur die evangelischen Witwen und die evangelische Gemeinde, sondern auch die katholische Gemeinde betreut.
Er lebte nach dem Motto „Wir sind doch alle Christen“. Abbe André legte ihm das immer als versuchte Abwerbung seiner Schäfchen aus.
Er war eigentlich ein lustiger Mann und sah die Teilung der Kirche in der alleinigen Verschuldung von Rom. Dies hat zu unzähligen nächtlichen, sehr lauten Diskussionen mit der katholischen Seite geführt. Er war sogar dafür, eine gemeinsame Liturgie zu veranstalten.
Er trank sehr gern und sang manchmal in diesen Situationen relativ laut. Für manche Ohren waren es ungehörige Lieder, die er sang. Er hielt absolut nichts von der Beichte und empfand es als eine billige Art die Sünde loszuwerden.
Er war weniger tolerant als Abbe André und bestand auf den Unterschieden zwischen den drei großen monotheistischen Religionen. Seine Frau war entgegen aller Erwartungen katholisch, was ihr den Unmut der katholischen Gemeinde einbrachte und zwar weil man einen Priester nicht heiraten konnte.
Schon gar keinen evangelischen. In der Schule und während seinen Predigten hat er stets darauf Wert gelegt auf eine Umverteilung der Vermögen der Reichen zugunsten der Ärmeren hinzuarbeiten. In manchen seiner Ausführungen konnte man Marx heraushören. Er war allerdings kein Karl-Marx-Anhänger. Für die Kinder verkörperte er eigentlich, dass alle Christen eine Religion haben und nicht in irgendeiner Art geteilt sind.
Die orthodoxen Priester Orlow und Georgiou
Bei den orthodoxen Priestern stammte Monsieur Orlow aus dem früheren Russland und war für den russischen Teil der Gemeinde zuständig.
Er war ausgesprochen groß, mit einem dicken Bart, der den Großteil seines Gesichts bedeckte. Er hatte gigantische Hände und war für die Kinder stets eine Respektsperson. Er sprach mit einer ausgesprochen tiefen Stimme, war nicht verheiratet und liebte die Kinder sehr.
Er hatte stets Honigbonbons bei sich, die er gern verteilte. Seine Einstellung war relativ konservativ, denn er hielt wenig von der katholischen oder evangelischen Seite und meinte, nur das orthodoxe Christentum sei der originale Vertreter der Religion, was ihm stets laute Diskussionen mit den anderen Religionsvertretern eingebracht hat.
Monsieur Georgiou war ein normal gewachsener Mann mit langem Bart und zusammen gebundenen Haaren, der zwar seinen Bruder im Glauben achtete, aber die griechische Version des Orthodoxentums für die Beste hielt. Er war eher progressiv und ließ zu, dass das Christentum verschiedene Facetten hatte, die man zwar nicht annehmen, aber respektieren sollte. Für die Kinder war er interessant, weil er sehr schöne Geschichten aus den griechischen Mythen erzählen konnte und dies so plastisch, dass die Kinder fast glaubten, dass es diese real gegeben hatte. Vor allem die Geschichte von Herakles hat die Kinder sehr beeindruckt.
Der Mönch Chipong
Der Mönch Chipong war stets mit seinem roten Tuch bekleidet. Marius hat nie erfahren, woher er tatsächlich kam, er vermute aber aus Tibet. Denn sie hatten in der Stadt einige Landsleute, die vor der chinesischen Invasion geflohen waren. Er war stets freundlich und predigte ausschließlich Liebe und Respekt gegenüber jedermann. Er war allerdings sehr zornig gegenüber der kommunistisch chinesischen Regierung, der er Völkermord vorwarf. Die Kinder verstanden das nicht und konnten sich nicht vorstellen, dass ein Mensch wegen seines Glaubens erschossen wurde oder ins Gefängnis musste. Da er sehr arm war, hat er für die Kinder keine Geschenke gemacht, ihnen jedoch seine Heimat in allen möglichen Farben ausgemalt. Der Mönch war jemand, der Marius eindringlich vor dem Ausland warnte, weil in seinen Augen das Heimweh sich bedrücken würde.
Monsieur François
Monsieur François hat sich von allen anderen unterschieden. Obwohl er ein gebürtiger Südländer war, sah er wie der typische Schwede aus: über 2m groß, sehr athletisch gebaut und stark, die Haare waren ergraut und er hatte sehr klare blaue Augen, sodass ein Teil der Frauen im Viertel hinter ihm her war.
Er hatte eine weiche, aber feste Stimme, er sprach immer relativ leise, aber deutlich. Er hatte sehr klare Ideen und für ihn waren die Religionen nur das Opium für das Volk. Vor allem war er ein hartnäckiger Kritiker der von den verschiedenen Religionen ausgeführten Riten und Feierlichkeiten sowie an der Organisation der Kirchen und deren Hierarchien.