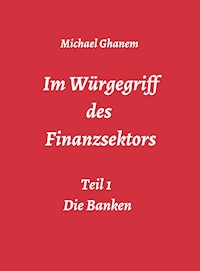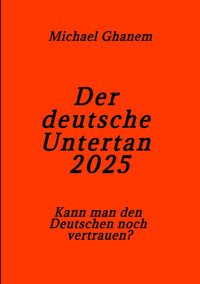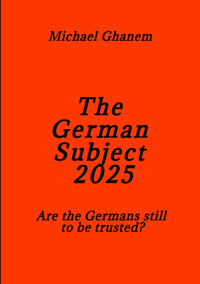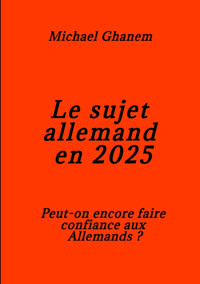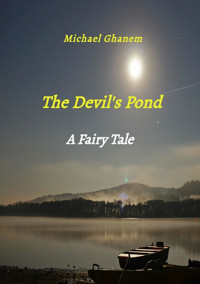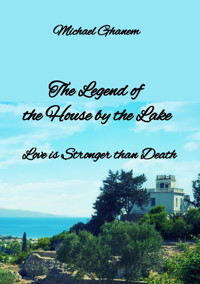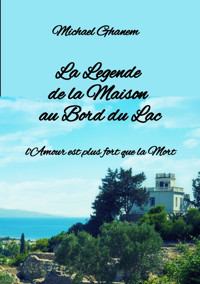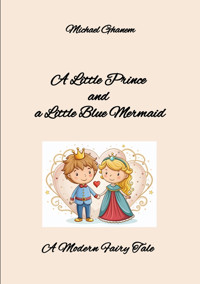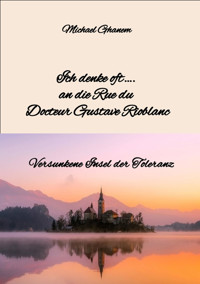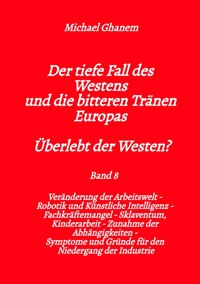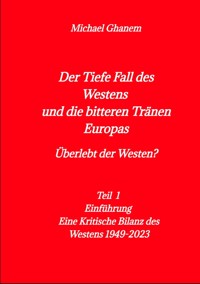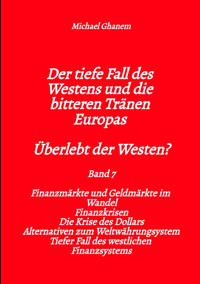
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die westliche Welt ist Veränderungen ausgesetzt, die zu ihrem Niedergang und dem Verlust der Zweitausendjährigen Herrschaft über den Rest der Welt führen wird. Diese Entwicklungen und die darauf basierende Analyse des Autors werden in dem mehrteiligen Buch über den tiefen Fall des Westens beschrieben. Der vorliegende Band behandelt das gegenwärtige Finanzsystem mit seinen historisch bedingten Stärken, die zur Dominanz des westlichen Wirtschaftssystem beigetragen haben. Die Kehrseite sind aber auch Ausbeutung, Skrupellosigkeit, Machtmissbrauch, Finanzkrisen, Bankenkrisen, Kriminalität, Kontrollverlust, die nicht nur den Menschen und Gesellschaften im Westen, sondern auch in anderen Ländern der Welt großen Schaden zugefügt haben. Vor allem die politisch motivierten Sanktionen gegenüber verschiedenen Staaten und nicht zuletzt gegen Russland - initiiert durch die USA mit ihrer dominanten Position - haben in den sanktionierten aber auch in den beteiligten Ländern erhebliche negative Auswirkungen. Zivilgesellschaft und Wirtschaft der Länder haben darunter stark gelitten. Die Sanktionen gegen Russland und der Krieg in der Ukraine haben jedoch die Zusammenarbeit der BRICS-Staaten gestärkt. Sie beabsichtigen den Dollar als Weltwährung abzulösen, um eine neue Weltordnung mit einer neuen Währung und einem weltweiten Zahlungssystem zu etablieren. Dies soll den Handel der BRICS-Staaten mit ihren Partner erleichtern und als Alternative zum Dollar sowie zur Finanzierung des Zwischenhandels dienen. Der Dollar macht nach wie vor etwa 80 % des Welthandels aus. Es ist zu erwarten, dass der Anteil auf weniger als 40 % fallen wird, abhängig davon, wie viele Länder dem neuen globalen Zahlungssystem beitreten. Die Refinanzierung von Krediten wird für die USA und andere Länder mit ihrer ausufernden Staatsverschuldung schon heute deutlich erschwert. Das könnte zu erheblichen Schwankungen in den weltweiten Währungen führen und das Währungssystem des Westens bedrohen. Großunternehmen, mittelständische Unternehmen und sogar bedeutende Banken könnten aufgrund von erschwerten Kreditvergaben Konkurse erleiden. Die Macht der westlichen Börsenplätze wird stark sinken, während die in Asien deutlich an Bedeutung gewinnen werden. Vermutlich werden digitale Währungen in großen Mengen zunehmen und sich damit der Kontrolle des Westens entziehen. In der Weltwirtschaft findet ein Paradigmenwechsel statt: Nicht mehr Geld, sondern Rohstoffe, Produktionskapazitäten, vor allem eine arbeitsfähige qualifizierte Bevölkerung bestimmen die Welt. Der Prozess des tiefen Falls im Bereich Geld- und Finanzsektor hat begonnen und nimmt an Dynamik zu, ob die USA und der Westen dies wollen oder nicht. Es ist zu erwarten, dass dies zu einer bedeutenden Verarmung des Westens führen wird. Die Menschen im Westen müssen diese schmerzhaften Entwicklungen erkennen und bei ihren politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen beachten, wenn sie ihre zukünftige Rolle in der Welt positiv mitbestimmen wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 372
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Widmung
Titelblatt
Urheberrechte
Autor Michael Ghanem
Erkenntnisse aus diesen Arbeiten:
Übersicht über die Inhalte der Buchreihe
1.Vorwort
2. Grundwissen über Banken und Finanzsektor
2.1 Vorbemerkung
2.2 Das Finanzsystem
2.3 Die Geldmenge
2.4 Die Zentralbanken
2.4.2 Die Deutsche Bundesbank
2.4.3 Die Federal Reserve System
2.5 Globale systemrelevante Banken
2.6 Die Islamischen Banken
2.7 Die Schattenbanken
2.8 Die Deutsche Bank
2.9 Das Investment Banking
2.10 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
2.11 IWF
2.12 Weltbank
2.13 BlackRock
2.14 Hedgefonds
3. Geldmärkte und Finanzmärkte
3.1 Finanzmarkt
3.2 Geldmarkt
4. Bewertung und Rating
4.1 Ratingagenturen
4.2 Schufa
5. Die Finanzkrise
5.1 Die globale Krise 2007-2008
5.2 Europäischer Stabilitätsmechanismus
6. Verfall der westlichen Banken
6.1 Raubzüge und Skrupellosigkeit der Banken im Westen
6.2 Skandale und Kriminalität im Finanz Sektor: Dividendenstripping, Cum-Ex, Cum-Cum
6.3 Und immer wieder der gleiche Fehler: mangelnde Eigenkapitaldecke der Banken
6.4 Digitalisierung der Banken um jeden Preis?
6.5 Strategische Fehler der Westlichen Banken
6.6 Brauchen wir noch Banken und welche?
7.US-Dollar: Quo vadis?
7.1 Leitwährung US-Dollar
7.2 Charakteristika einer Leitwährung
7.3 Die Zukunft des US-Dollar
7.4 Rolle des US-Dollars, seine strategischen Fehler und seine Bedrohungen
7.5 Die internationale Rolle des US-Dollars
7.6 Euro und US-Dollar
7.7 Der US-Dollar als führende Währung?
7.8 Gibt es keine andere Option?
7.9 Risiken des Dollars
7.10 Die Abwendung vom Dollar
7.11 Kritische Würdigung der Diskussion um den Dollar aus Sicht des Autors
8. Die Zukunft des Währungssystems
9. Europäische Alternativen für den Zahlungsverkehr
9.1 EU-Clearingstelle
9.2 Blockchain
9.3 Bank für Internationalen Zahlungsausgleich BIZ
10. BRICS und ein mögliches neues Währungssystem
10.1 Was haben die BRICS-Staaten also an der Leitwährung US-Dollar zu bemängeln?
10.2 Internationales Finanzsystem und globale Währung
10.3 Der Renminbi als weltweite Währung?
10.4 Ein neues Währungssystem der BRICS-Staaten?
10.5 Mögliche Konsequenzen eines alternativen Währungs- und Zahlungssystems
11. Ausblick auf die Zukunft
12. Sanktionen
12.1 US-Sanktionen
12.2. Konsequenzen der Europäischen Sanktionen
13. Gefahren für die wesentlichen Säulen des westlichen Finanzsektors
13.1 Vorbemerkung
13.2 Die Warnungen von Roubini
13.3. Machtverlust für die Wall Street und London?
13.4. Niedergang des Euros?
13.5. Niedergang des US-Dollars?
14. Geburt neuer Währungen: Alternativen zu Dollar, Yuan / Renminbi
15. Ein neues Zahlungssystem namens BRICS Bridge” soll den US-Dollar umgehen
16. Neue Entwicklungen im Handel: BRICS Pay
17. Devisenhandel und Lokalwährung
18. Tiefer Fall des Westens: Finanzwelt, Banken Dollar, BRICS Währung
18.1 Vorbemerkung
18.2 Fata Morgana des Westens: Geld und Welt
18.3 Die Händler des Geldes
18.4 Abgrundtiefer Rückschritt des westlichen Finanzplatzes
18.5 Geldentwertung und Geldaufwertung
18.6 Aufstieg alternativer Weltwährungssysteme: Eine Teilung?
18.7 BRICS-Geld?
18.8 Plant BRICS die Einführung einer digitalen Währung?
18.9 Welche Vorteile würde eine BRICS-Währung mit sich bringen?
18.10 Welche Auswirkungen hätte eine neue BRICS-Währung auf den US-Dollar?
18.11 Welche Effekte hätte eine BRICS-Währung auf die Ökonomie?
18.12 Wäre eine BRICS-Währung denkbar?
18.13 Ist es möglich, eine neue BRICS-Währung durch Gold abzusichern?
18.14 Wie hoch ist der Goldbestand der BRICS-Staaten?
18.15 Kooperation mit dem Finanzsystem der BRICS-Staaten? Als Lösung?
18.16 Vernachlässigte Facetten der Finanzwelt: Die Bedeutung von Religion, Kultur, Tradition und Geschichte für die Beziehung zum Geld
18.17 Der tiefe Fall: Kollaps des westlichen Zahlungssystems? US-Dollar? Euro?
19. Was können die Regierungen tun?
20. Epilog
21. Literaturverzeichnis
Inhalt
Cover
Widmung
Dieses Buch ist allen Mahnern und einsamen Rufern gewidmet, denen das Wohlergehen unserer Gesellschaft am Herzen liegt. Jeder kritische Geist ist einsam und gehört zu einer Minderheit. Die Minderheit von heute kann jedoch die Mehrheit von morgen sein.
Dieses Buch ist vor allem auch meiner Frau Magdalene Kahlert gewidmet für ihre kritischen und klugen Ratschläge. Sie begleitet mich in meinem Leben und ist mir stets eine gute Ratgeberin.
Bonn, im August 2025
Titelblatt
Michael Ghanem
Die Gedanken sind frei
Der tiefe Fall des Westens
und die
bitteren Tränen Europas
Überlebt der Westen?
Band 7
Finanzmärkte und Geldmärkte im Wandel
Finanzkrisen
Alternativen zum Weltwährungssystem
Die Krise des Dollars
Tiefer Fall des westlichen Finanzsystems
Urheberrechte
© 2025 Michael Ghanem
Website: https://michael-ghanem.de/
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland.Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]
ISBN:
Softcover 978-3-384-63311-8
Hardcover 978-3-384-63312-5
E-Book 978-3-384-63313-2
Die verwendeten Statistiken sind bei Destatis lizensiert.
Der vorliegende Band ist Teil 7 der Reihe:
Der tiefe Fall des Westens und die bitteren Tränen Europas
Autor Michael Ghanem
https://michael-ghanem.de/
https://die-gedanken-sind-frei.org/
Jahrgang 1949, aufgewachsen in Frankreich und Absolvent einer französischen Elitehochschule für Wirtschaftsingenieure. Nach seiner Übersiedlung nach Deutschland absolvierte er das Studium der Volkswirtschaft, Soziologie, Politikwissenschaft, Philosophie und Ethik.
Bonn, im August 2025
Im Bereich der Philosophie wurde er sehr stark geprägt von der Philosophie und den Lehren von Zarathustra, Sokrates, Platon, Aristoteles, Marc Aurel, Rabelais, Michael de Montaigne, Baruch de Spinoza, Thomas von Aquin, Ibn Chaldun, Niccolo Machiavelli, Rene Descartes, Blaise Pascal, Voltaire, Jean Jaques Rousseau, Immanuel Kant, Gottfried W. Leibniz, Auguste Comte, Arthur Schopenhauer, Pierre-Joseph Proudhon, Karl Marx, Henri Bergson, Karl Popper, Karl Jaspers, Erich Fromm. Die Frankfurter Schule mit seinen Lehrern Jürgen Habermas und Adorno haben ihn stark beeinflusst, so wie auch Michael Schmidt-Salomon, Claude Levy-Strauss, Dalai Lama, Luc Ferry, Peter Sloterdijk, Werner Lachmann, Amartya Sen, Oswald Nell-Brauning, Niklas Luhmann.
In der Soziologie orientiert er sich stark an der Kölner Schule mit seinen Lehrern Rene König und Erwin K. Scheuch sowie Gustave Lebon. In der Politikwissenschaft ebenfalls an der Kölner Schule oder der Köln-Mannheimer Schule.
Im Bereich der Volkswirtschaft haben ihn die Post Keynesianer und die Verhaltens Ökonomen stark geprägt. Den Lehren von Milton Friedmann, den Chicago Boys, der Feiburger Schule, Friedrich A. Hayek steht er sehr kritisch gegenüber. Mit Joseph Stiglitz, Paul Krugman, James K. Galbraith, Daniel Kahneman, Thomas Piketty und dem Club of Rome fühlt er sich sehr verbunden.
Sein beruflicher Werdegang führte ihn zunächst zu einer internationalen Organisation, für die er 5 Jahre als Projektcontroller für große Wasserprojekte überwiegend in Afrika tätig war und darüber eine Vielzahl von Ländern und deren Führer kennengelernt hat. Im Anschluss daran arbeitete er viele Jahre bei einer europäischen Organisation sowie in mehreren internationalen Beratungsunternehmen als Berater für die Modernisierung von unterschiedlichsten Industrien und Unternehmen.
Er sieht sich als Kritiker der heutigen Globalisierung und setzt sich seit 1974 sehr stark für die Themen der Wasserwirtschaft und des Wassermanagements ein.
Diese Erfahrungen resultieren in einem tiefen Verständnis für geopolitische Fragen und ermöglichen ihm die Bewertung von aktuellen politischen Entwicklungen insbesondere vor dem Hintergrund von ökonomischen Verflechtungen.
Seit seiner Pensionierung lebt er zurückgezogen in Bonn und ist als Schriftsteller tätig. Er widmet sich in seinen Veröffentlichungen vor allem den drängenden gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Fragen der heutigen Zeit sowie der Wasserwirtschaft.
Bisher sind zahlreiche Veröffentlichungen zu den Themen Politik und Geopolitik, Gesellschaft, Wirtschaft erschienen. Er ist Autor von bisher mehr als 100 Büchern. Im Bereich der Politik wird vor allem die kritische Betrachtung von Deutschland vorgenommen. Weitere Themenschwerpunkte sind Fragen der Gesundheit, Identität, Rassismus, Umwelt, Migration, Wasserwirtschaft, Afrika, Bevölkerungsentwicklung und alternative ökonomische Systeme wie die Anti-Fragilitäts-Ökonomie. Er hat aber auch einige Erzählungen und Märchen veröffentlicht.
Dies ist ein Auszug seiner Veröffentlichungen, die bisher erschienen sind:
Sachbücher Politik, Wirtschaft, Gesellschaft
Geopolitik
Der tiefe Fall des Westens und die bitteren Tränen Europas, Teil1 - Einführung - Eine Kritische Bilanz des Westens 1949-2023
Der tiefe Fall des Westens und die bitteren Tränen Europas, Teil 2: Tiefer Fall des Militärs, Bausteine der Geopolitik, Weltordnung im Wandel, Konfliktpotenziale
Der Tiefe Fall des Westens und die bitteren Tränen Europas, Teil 3: Bausteine der Militärpotentiale - Das Ende der Hegemonie
Der tiefe Fall des Westens und die bitteren Tränen Europas, Teil 4: Länderprofile - Mehrfaches Systemversagen - Unfälle der Geschichte - Wasser und Welthunger - Supergau Klima und Energie - BRICS versus G7
Der tiefe Fall des Westens und die bitteren Tränen Europas, Teil 5: Problemfälle: Bevölkerungsbombe Migration, Integration Armut und Hunger Rohstoffe
Afrika zwischen Fluch und Segen Teil 1: Wasser
Weltmacht Wasser – Teil 1: Überblick und Bilanz 2021
Zum Zustand Deutschlands
Deutschlands tiefer Fall, Band 1A Gesundheit
Deutschlands tiefer Fall, Band 1B Gesundheit
2005 – 2021 Deutschlands verlorene 16 Jahre – Die Bilanz der Angela Merkel
2005-2018 Deutschlands verlorene 13 Jahre Teil 1: Angela Merkel – Eine Zwischenbilanz
2005-2018 Deutschlands verlorene 13 Jahre Teil 2: Politisches System – Quo vadis?
2005-2018 Deutschlands verlorene 13 Jahre Teil 3: Gesellschaft – Bilanz und Ausblick
2005-2018 Deutschlands verlorene 13 Jahre Teil 4: Deutsche Wirtschaft- Quo vadis?
2005-2018 Deutschlands verlorene 13 Jahre Teil 5: Innere Sicherheit- Quo vadis?
2005-2018 Deutschlands verlorene 13 Jahre Teil 6: Justiz- Quo vadis?
2005-2018 Deutschlands verlorene 13 Jahre Teil 7: Gesundheit- Quo vadis? Band A
2005-2018 Deutschlands verlorene 13 Jahre Teil 7: Gesundheit- Quo vadis? Band B
2005-2018 Deutschlands verlorene 13 Jahre Teil 7: Gesundheit- Quo vadis? Band C
2005-2018 Deutschlands verlorene 13 Jahre Teil 8: Armut, Alter, Pflege – Quo vadis?
2005-2018 Deutschlands verlorene 13 Jahre Teil 9: Bauen und Vermieten in Deutschland – Nein danke
2005-2018 Deutschlands verlorene 13 Jahre Teil 10: Bildung in Deutschland
2005-2018 Deutschlands verlorene 13 Jahre Teil 11: Der Niedergang der Medien
2005-2018 Deutschlands verlorene 13 Jahre Teil 12: Literatur – Quo vadis – Teil A
2005-2018 Deutschlands verlorene 13 Jahre Teil 13: Entwicklungspolitik – Quo vadis – Teil A
Deutsche Politik
Deutsche Identität – Quo vadis?
Deutsche Identität und Heimat - Quo vadis?
I know we can! Eine Chance für Deutschland
Die Deutschen – ein verfluchtes Volk?
Die Grünen oder Der Club der Feministinnen – 10 Gründe die Grünen NICHT zu wählen
AKK – Nein Danke!
Eine Chance für die Demokratie
Nichtwähler sind auch Wähler
Deutschlands Titanic – Die Berliner Republik
Im Würgegriff der politischen Parteien, Teil 1
Herr vergib ihnen nicht! Denn sie wissen was sie tun!
Verfallssymptome Deutschlands – Müssen wir uns das gefallen lassen?
Ist Deutschland auf Sand gebaut?
Vier Millionen entrechtete Deutsche
Wirtschaft und Finanzen
Ansätze zu einer Antifragilitätsökonomie
Im Würgegriff des Finanzsektors, Teil 1”
Im Würgegriff der Staatsverschuldung, Teil 1
Im Würgegriff der Staatsverschuldung, Teil 2
Bevölkerung, Migration, Integration
Im Würgegriff von Migration und Integration
Im Würgegriff von Bevölkerungsbombe, Armut, Ernährung Teil 1
Rassismus
Im Würgegriff von Rassismus, Antisemitismus, Islamophobie, Rechtsradikalismus, Faschismus, Teil 1
Thesen zur Gleichheit der Rassen
Bilanz und Niedergang und die Angst des Weißen Manns, Teil 1: Grundlagen
Mensch und Gesellschaft
Die Macht des Wortes
Die neuen Reiter der Apokalypse
Krisen in Zeiten von Corona, Teil 1
Corona 2021 – Warten auf Godot
Die Zeit -eine verkannte Weltmacht” Band 1 der Reihe Mensch & Gesellschaft
Nur Mut – Steh auf
Erzählungen
Abenteuer Deutschland Bekenntnisse zu diesem Land - Eine Bilanz -
Ein kleiner Fürst und eine kleine blaue Sirene
Ich denke oft ... an die Rue du Docteur Gustave Rioblanc - Versunkene Insel der Toleranz
Erzählungen eines Schattenmanns
21 Tage in einer Klinik voller Narren
Sprüche und Weisheiten
Leonidas der Große – Ich bin ein Mensch
50 Jahre Leben in Deutschland – Ein Irrtum? Ein Schicksal
Eine Straße ohne Seele
Der Teich des Teufels – ein Märchen
Die Sage vom Haus am See
Wenn ich einmal der Herrgott wär
Liebe heißt
Danke Herr Lehrer
Die Legende der Quelle
Die Legende von Annette - Traum einer unerfüllbaren Liebe
Frieden und Freiheit: Ich wollte einen Olivenbau pflanzen - Ich wollte einen Orangenbau pflanzen
So schön ist die Welt
Das alte Schiff - Eine Hommage an altes Eisen
Wenn Sie das Lesen würde, Die für mich so tapfere kleine Grande Dame
Ich kann nie aufhören Dich zu lieben. Zärtliche Erinnerung an 50 gemeinsame Jahre
Die vergessene Haarsträhne
Der Flieder
Erkenntnisse aus diesen Arbeiten:
Wahrheit und Objektivität sind ...
wie eine zarte weiße Rose.
Sie haben verschiedene Perspektiven und verwelken sehr schnell.
Außerdem hat sie schmerzhafte Dornen.
Mit Zahlen kann man lügen.
Mit 51 Prozent Wahrheitsgehalt kann man lügen.
Mit 49 Prozent Wahrheitsgehalt kann man die Wahrheit sagen.
Jede Umfrage ist eine Manipulation.
Die Mehrheitsmeinung ist nicht immer die richtige Meinung.
Gib mir einen Text, und ich verfälsche seinen Sinn.
Gleichschritt und Mitläufer zeigen den tiefen Fall einer Gesellschaft an.
Der Westen entwickelt sich zu einer Diktatur, die Meinungsfreiheit verbietet und manipuliert.
Eine zunehmend Ineptokratie und Kakistokratie nimmt Gestalt an.
Die Konsequenzen für den beginnenden tiefen Fall des Westens nehmen Gestalt an: Abbau der Demokratie der USA, Schutz des Weißen um jeden Preis, Isolationismus um jeden Preis, Verlagerung von Unternehmen, auch wenn deren Produkte nur noch für die Clique der sehr Reichen möglich sind, Abbau der Meinungsfreiheit und der Toleranz, Forderung nach einem Umbau durch eine Techno-Diktatur. Trump und seine Unterstützer lösen einen weltweiten Handelskrieg aus, ohne den tiefen Fall der USA zu verhindern.
Abbau der Meinungsfreiheit in Europa und Trend
zu rechtsextremen Parteien.
Versagen der traditionellen Parteien aufgrund
der Inkompetenz ihrer Führungen.
Gefährdung der westlichen Demokratie durch ungezügelte Migration.
Staatsverschuldung und Abbau staatlicher Aufgaben
durch Ausgaben für den sozialen Bereich.
Inflation der Bürokratie
Tiefpunkt der Bildung und Forschung
Ungelöste Sicherung der Rohstoffversorgung im Westen
und daher Kriege: Ukraine, Russland.
Veraltete Gesellschaften im Westen, nicht vorbereitet.
Probleme werden unter den Teppich gekehrt.
Tiefpunkt der Presse- und Medienlandschaft: Anstatt Missstände aufzudecken, werden sie vertuscht und die Presse wird so zum Komplizen der Herrschenden zum Nachteil der Bevölkerung.
Wasserprobleme
Marode Zustände im Bildungswesen, Gesundheitswesen
und in der Altenbetreuung.
Zunehmende Abhängigkeit von BRICS und Afrika
Übersicht über die Inhalte der Buchreihe
Der tiefe Fall des Westens und die bitteren Tränen Europas:
Die 16 Teile der Buchreihe sind wie folgt gegliedert:
Band 1
Einführung
Eine kritische Bilanz des Westens 1949–2023
Band 2
Der tiefe Fall des Militärs
Bausteine der Geopolitik
Verschiedene Facetten der Verteidigung
Die Rolle der Presse und der Kriegspropaganda
Warum sind Sanktionen ungeeignete Mittel?
Band 3
Die Bausteine militärischer Potenziale
Rüstung und Armee
Militärische Bündnisse
Militärisches Gleichgewicht?
Das Ende der Hegemonie?
Konsequenzen aus dem Ukraine-Krieg
Hat der Dritte Weltkrieg begonnen?
Band 4
Tiefer Fall der Ökonomie (Teil 1)
Problemfall Bevölkerung
Problemfall Wasser
Geopolitik aus Sicht der Ökonomie
Band 5
Tiefer Fall der Ökonomie (Teil 2)
Problemfall Bevölkerung: Bevölkerungsexplosion
Migration, Integration
Rohstoffe und ihre Problematik
Problemfall Armut und Hunger
Band 6
Die Sünden des Westens
Welthandel
Basar-Ökonomie
Korruption, Tabuthemen
Inflation, Deflation
Neoliberale Globalisierung
Welthandel und seine Probleme
Staatsverschuldung
Band 7
Finanzmärkte und Geldmärkte im Wandel
Finanzkrisen
Die Krise des Dollars
Alternativen zum Weltwährungssystem
Tiefer Fall des westlichen Finanzsystems
Band 8
Veränderung der Arbeitswelt
Symptome des Niedergangs der Industrie
Gründe des Niedergangs
Zunahme der Abhängigkeiten
Sklaventum, Kinderarbeit
Band 9
Verfall der Gesellschaften
Band 10
Niedergang der Staatlichen Aufgaben
Migration, Integration, Kommunitarismus
Klima Änderungen? Klimabedingte Migration
Verfall der Infrastruktur
Band 11
Niedergang der Westlichen Kultur
Generation Gleichschritt
Niedergang der Presse und Medien
Band 12
Probleme der Gesellschaften:
Ehe und Scheidung
Drogenkonsum
Kriminalität
Terrorismus
Zerfall der Inneren Sicherheit
Zerfall der Justiz
Band13
Marode Gesundheitswesen
Marode Forschungsförderung
Marode Sozialsysteme
Band 14
Tiefer Fall der Westlichen Demokratie
Band 15
Die Hegemonie der USA ist vorbei
De-Dollarisierung und deren Konsequenzen
Rolle einer Alternativen Währung und eines neuen Weltwährungssystems
Bedeutung der Rohstoff Verteilung
Problembereich Lobbyismus
Weltkrieg: Gefahr durch Ukraine, NATO, Naher Osten?
Probleme mit dem Islam” /Nahen Osten
Problemfall Israel
Problemfall Ukraine
Problemfall NATO
Problemfall EU
Tiefer Fall: Was bedeutet er für den Westen?
Band 16
Der Tiefe Fall des Westens und seine Gründe
Die bitteren Tränen Europas
Gelernt aus der Geschichte?
Die neue Weltordnung
Der Machtkampf
Neue Hegemonie und ihre Konsequenzen
Abfederung der Konsequenzen - kann Seneca helfen?
1.Vorwort
In dem vorliegenden Band wird das gegenwärtige Finanzsystem in seinen verschiedenen Facetten beschrieben, ebenso wie die Art und Weise, wie der Westen die Welt in den letzten 70 Jahren im Stich gelassen hat.
Seit dem Ende der Sowjetunion haben die USA mit ihrer dominanten Position in der Welt sowohl dem Westen als auch anderen Ländern durch ihre starke Währung und den Dollar erheblichen Schaden zugefügt. Außerdem haben sie politische Sanktionen durch ein kriminelles Regime in Washington durchgesetzt. Die Einwohner der betroffenen Länder haben stark gelitten. Die Sanktionen gegen Russland und der Krieg in der Ukraine haben jedoch die BRICS-Staaten gestärkt, da sie gemeinsame Ziele haben und festgelegt haben.
Diese schlagen vor, den Dollar als Weltwährung abzulösen, um eine neue Weltordnung mit einer neuen Währung und einem weltweiten Zahlungssystem zu etablieren. Die Einführung einer neuen Währung und eines neuen Zahlungssystems steht kurz vor dem Abschluss. Dies soll den Handel zwischen den Ländern erleichtern und als Alternative zum Dollar sowie zur Finanzierung des Zwischenhandels dienen.
Der Dollar macht nach wie vor etwa 80 % des Welthandels aus. Experten sagen voraus, dass der Anteil auf weniger als 40 % fallen wird, abhängig davon, wie viele Länder dem neuen globalen Zahlungssystem beitreten.
Es ist jedoch schon jetzt kaum noch möglich für den Westen und die USA, politische und wirtschaftliche Sanktionen gegen andere Länder zu verhängen. Die Refinanzierung von Krediten wird für die USA und andere Länder deutlich erschwert. Das könnte zu erheblichen Schwankungen in den weltweiten Währungen führen und das Währungssystem des Westens bedrohen.
Großunternehmen, mittelständische Unternehmen und sogar bedeutende Banken könnten aufgrund von erschwerten Kreditvergaben Konkurse erleiden. Nicht zu vergessen ist, dass die Macht der westlichen Börsenplätze stark sinken wird, während die in Asien deutlich an Bedeutung gewinnen werden. Vermutlich werden digitale Währungen in großen Mengen zunehmen und sich damit der Kontrolle des Westens entziehen.
Der Prozess des tiefen Falls im Bereich Geld und Finanzen hat begonnen, ob die USA und der Westen dies bemerken oder nicht. Er wird wahrscheinlich zu einer starken Verarmung des Westens führen.
Die Menschen im Westen sollten diese Entwicklungen erkennen und bei ihren politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen beachten.
Der Autor versichert, dass er für das Zustandekommen dieses Buches keinerlei Erfahrungen und Begegnungen aus seinem beruflichen Werdegang verwendet hat, sondern lediglich auf jedermann zugängliche öffentliche Quellen zugegriffen hat.
2. Grundwissen über Banken und Finanzsektor
2.1 Vorbemerkung
Um die geopolitische Entwicklung beurteilen zu können, ist es erforderlich den Finanzsektor des Westens zu verstehen. Verschiedene Teile des Systems, wie Banken, Hedgefonds und Ratingagenturen, können unbeabsichtigte Probleme verursachen und die Wirtschaft stark negativ beeinflussen. Trotz der Risiken ist der Finanzsektor ein wichtiger Teil des Wirtschaftssystems des Westens, mit verschiedenen Möglichkeiten zur Veränderung oder Verbesserung.
2.2 Das Finanzsystem
Dasglobale Finanzsystemist das Zusammenspiel von Finanzmärkten, regulierten Finanzintermediären (z. B. Banken, Versicherungen), wenig bis nicht regulierten Schattenbanken (zum Beispiel Investmentfonds), der nationalen und supranationalen Finanzmarktaufsicht, der Zentralbanken und internationaler Organisationen wie beispielsweise dem Internationalen Währungsfonds.
Die Bedeutung des globalen Finanzsystems erhöhte sich durch zunehmende Globalisierung, die durch technische Innovationen wie Telekommunikation und Internet, Finanzinnovationen und den Sieg des Modells der Freien Marktwirtschaft befördert wurde. Die Bedeutsamkeit des globalen Finanzsystems zeigt sich auch dadurch, dass seit den 1970er Jahren das Volumen des internationalen Kapitalverkehrs hundertmal so hoch ist wie das Volumen des internationalen Güterverkehrs.
Einführung
Finanzsysteme können auf regionaler, nationaler oder globaler Ebene betrachtet werden. Finanzsysteme sind die Gesamtheit von Finanzmärkten, Finanzintermediären, Dienstleistungsunternehmen und sonstigen Finanzinstitutionen. Sie dienen der Umleitung von Ersparnissen in Investitionsvorhaben. Finanzsysteme haben die folgenden Funktionen:
Das Zustandekommen von Finanztransaktionen zu erleichtern (Finanzierungsfunktion).
Die Überwachungs- und Kontrollfunktion
Im Falle unsicherer Unternehmensinvestitionen ermöglicht es die Aufteilung des Risikos auf verschiedene Kapitalgeber (Risikoallokationsfunktion).
Es stellt Informationen über verschiedene Anlage- bzw. Finanzierungsfunktionen zur Verfügung (Informationserstellungs- und Kommunikationsfunktion).
Beim globalen Finanzsystem wird das Zusammenspiel von Finanzmärkten, regulierten Finanzintermediären (zum Beispiel Banken, Versicherungen), wenig bis nicht regulierten Schattenbanken (z. B. Investmentfonds), der nationalen und supranationalen Finanzmarktaufsicht, der Zentralbanken und internationaler Organisationen wie beispielsweise dem Internationalen Währungsfonds beobachtet.
Die Gefahr, dass sich Probleme bei einem oder mehreren Finanzinstituten, oder Märkten, oder Marktsegmenten, oder eines Zahlungsverkehrs- oder Wertpapierabwicklungssystems auf andere Bereiche oder Teilnehmer des Finanzsystems ausweitet bezeichnet man als systemisches Risiko. Als Verbreitungsmechanismus kommt der Dominoeffekt und / oder der Informationseffekt in Frage. Der Dominoeffekt tritt bei der Ansteckung nachfolgender Finanzsystemkomponenten ein. Wenn beispielsweise ein Kreditinstitut in existenzgefährdende Schieflage gerät müssen die Gläubiger ihre Forderungen abschreiben und können dadurch eventuell selbst in große finanzielle Schwierigkeiten geraten. Beim Informationseffekt führt beispielsweise eine existenzgefährdende Schieflage eines Kreditinstituts dazu, dass die Finanzmarktteilnehmer Angst vor einem Dominoeffekt bekommen und auch bei anderen Banken massiv Geldeinlagen abziehen (Bank Run), so dass auch gesunde Kreditinstitute in große finanzielle Schwierigkeiten geraten können.
So leihen zum Beispiel Zentralbanken Geld an Banken, Banken leihen Geld an Hedgefonds, Private-Equity-Institutionen und Regierungen. Die Wechselbeziehungen dieser Kredite erzeugen ein globales systemisches Risiko. Deshalb konnte beispielsweise aus der amerikanischen Subprime-Krise die internationale Finanzkrise ab 2007 werden.
Entwicklung
Für die Entwicklung des globalen Finanzsystems, wie es heute besteht, waren verschiedene historische Entwicklungen maßgeblich. Zum einen wurde die Bedeutung des Grundbesitzvermögens mit der Zeit deutlich von der Bedeutung von Finanzvermögen übertroffen.
Die Wirtschaftsordnung wandelte sich vom Merkantilismus hin zu liberalen Wirtschaftsordnungen. Primitivgeld entwickelte sich zum Goldstandard und weiter zu Papiergeld, Giralgeld, Buchgeld und elektronischem Geld. Handel und Finanzmärkte entwickelten sich vom Isolationismus zur Globalisierung.
Durch das Anwachsen großer Unternehmen, welche die Erde nach Rohstoffen und Absatzmärkten erkundeten, wuchs das Bedürfnis für ein globales Finanzsystem. Damit sich dieses entwickeln konnte, musste aber zunächst ein international akzeptiertes Geldsystem entstehen.
Ein international akzeptiertes Geldsystem entstand erstmals mit dem Goldstandard, der rechtssichere und von Währungsabwertungsrisiken freie Finanztransaktionen ermöglichte.
Bedingt durch den Goldautomatismus und die informelle Koordinierung durch die Bank of England war der Klassische Goldstandard das erste faktische globale Finanzsystem. Das erste als Rechtskonstrukt geschaffene globale Finanzsystem war das Bretton-Woods-System.
Klassischer Goldstandard (1870–1914)
Der Goldstandard markiert für viele Ökonomen den Beginn des globalen Finanzsystems. Der Wechselkurs vieler wichtiger Währungen wurde durch den Goldautomatismus reguliert.Nach Analyse von Barry Eichengreen funktionierte das Währungssystem des Goldstandard in dieser Phase vor allem deshalb, weil die Zentralbanken unter Führung der Bank of England ihre Geldpolitik koordinierten Die internationalen Finanztransaktionen unterlagen wenig bis keinen Regulierungen. Die Telegrafie beschleunigte die weltweite Kommunikation erheblich.
Zwischenkriegszeit und Ende des Goldstandards
Während des Ersten Weltkrieges wurde der Goldstandard in fast allen Ländern ausgesetzt. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden die USA durch beständige Handelsbilanzüberschüsse und niedrige Zinsraten zu dem wichtigsten Nettoexporteur von Kapital. Gleichzeitig verlor die Bank of England ihre führende Rolle in der Organisation des Goldstandards ohne dass die Federal Reserve System (FED) diese übernahm.
Wirtschaftshistoriker sind sich einig, dass der Goldstandard ein Transmissionsmechanismus zur Verbreitung der Weltwirtschaftskrise war und zu Entstehung und Länge der Großen Depression maßgeblich beitrug. Mit der Zeit wurde der Fehler der Geldpolitik offenbar. Nach und nach suspendierten alle Staaten den Goldstandard und gingen zu einer Reflationspolitik über. Nach fast einhelliger Ansicht besteht ein klarer zeitlicher und inhaltlicher Zusammenhang zwischen der weltweiten Abkehr vom Goldstandard und dem Beginn der wirtschaftlichen Erholung.
Bretton-Woods-System (1944–1973)
Mit dem Bretton-Woods-System wurde 1944 eine neue globale Finanzordnung beschlossen. Die einzelnen Währungen waren innerhalb von Wechselkursbandbreiten an den US-Dollar als Ankerwährung gebunden. Der Dollar wiederum war mit einem Wechselkurs von 35 $ je Unze an den Goldpreis gebunden. Zum Umtausch von Dollar in Gold waren nur Zentralbanken berechtigt. Die Abwertung einer Währung war nur mit Zustimmung des Internationalen Währungsfonds zulässig, diese Zustimmung wurde allerdings auch nie versagt. Die internationalen Kapitalströme waren durch nationale Kapitalverkehrskontrollen reguliert und beschränkten sich im Wesentlichen auf langfristige Investitionen. Der Internationale Währungsfonds wurde zur Stabilisierung von Ländern mit Zahlungsbilanzschwierigkeiten gegründet. Die Weltbank wurde zur Verfolgung entwicklungspolitischer Ziele gegründet.
Das Bretton-Woods-System stellte einen Kompromiss zwischen Freihandel und nationaler Autonomie vor allem in der Geldpolitik zur Wahrung bzw. Wiederherstellung eines hohen Beschäftigungsstands und eines hohen Nationaleinkommens dar. Die Autonomie nationaler Wirtschaftspolitik wurde bis zu einem gewissen Grad durch Kapitalverkehrskontrollen und Feste Wechselkurse gesichert.
Zunehmende Finanzglobalisierung und Ende des Bretton-Woods-Systems
Ähnlich wie unter dem Goldstandard zeigten sich auch im Bretton-Woods-System Schwierigkeiten Außenhandelsdefizite in den Griff zu bekommen.
Der einfachste Zahlungsbilanzausgleichsmechanismus, der Wechselkursmechanismus funktioniert nur in einem System flexibler Wechselkurse. Im Bretton-Woods-System waren Wechselkursanpassungen genehmigungsbedürftig und eher unerwünscht. Ein Zahlungsbilanzausgleich durch Innere Abwertung herbeizuführen war nach den Erfahrungen der Großen Depression unpopulär. Zu Beginn der 1970er Jahre geriet der US-Dollar aufgrund der chronischen Handelsbilanzdefizite und erhöhter Inflation in den USA unter Abwertungsdruck. Die Aufrechterhaltung des festen Wechselkurses zum Dollar hätte auch für die anderen Länder wie z. B. Deutschland und Japan die Inkaufnahme erhöhter Inflation erfordert. Dazu waren einige Länder nicht bereit. Auch war aufgrund der stark angewachsenen Eurodollar- und Petrodollar-Bestände die Eintauschbarkeit von Dollar in Gold nicht mehr gewährleistet. Da die außerhalb der USA gehaltenen Dollar keinen Kapitalverkehrskontrollen unterlagen, konnten an den Finanzmärkten auf eine Abwertung des Dollar spekuliert werden. Deshalb wurde das Bretton-Woods-System Anfang der 1970er Jahre aufgegeben, der Dollar wertete ab.
Heutiges globales Finanzsystem
Mit dem Ende des Bretton-Woods-Systems gingen die meisten Länder zu einem System flexibler Wechselkurse über. Der Internationale Währungsfonds (IWF) verlor die Aufgabe das Bretton-Woods-System zu stützen. Bald zeigte sich jedoch, dass es nach dem Ende des Bretton-Woods-Systems viel häufiger zu internationalen Finanz- und Währungskrisen kam, bei denen sich der IWF zur Krisenhilfe zuständig sah. Seit den 1990er Jahren wirbt der IWF für eine Deregulierung des Kapitalverkehrs. Mit der Abschaffung der Kapitalverkehrskontrollen in fast allen OECD Staaten entfielen die gesetzlichen Grenzen zwischen den heimischen und den internationalen Kapitalmärkten.
Internationaler Währungsfonds
Der internationale Währungsfonds verlor mit dem Ende des Bretton-Woods-Systems einen Großteil seiner ursprünglichen Aufgaben. Die Mitglieder des IWF änderten Artikel 4 dahingehend ab, dass jedes beliebige Währungssystem gewählt werden darf, abgesehen von einer Währung mit Goldbindung. Der IWF behielt eine Aufsichtsfunktion bei Wechselkursanpassungen. Verstärkt wandte sich die Organisation der Hilfe bei Währungskrisen zu. Länder die Kredite des IWF in Anspruch nehmen wollen, müssen mit dem IWF vereinbarte Bedingungen erfüllen (Konditionalität); umfasst sind oftmals auch Strukturanpassungsprogramme. Anfang der 1990er Jahre wurden die Aufgaben des IWF um die Propagierung und Unterstützung der Liberalisierung der Kapitalmärkte und des internationalen Kapitalverkehrs erweitert. Der IWF wandelte sich von einem Stabilisierungsfonds zu einer internationalen Finanzinstitution, die sich schwerpunktmäßig um Krisen in überschuldeten Nationen kümmerte, sowie um Entwicklungspolitik und um den Wandel der ehemaligen Ostblocknationen vom Kommunismus zum Kapitalismus. In den 1990er Jahren orientierte sich der IWF stark an dem umstrittenen Washington Consensus.
Weltbank
Hauptsitz der Weltbank Washington, D.C.
Die Weltbank soll die wirtschaftliche Entwicklung der Mitgliedsländer und einen höheren Lebensstandard fördern, indem sie private Direktinvestitionen und Außenhandel erleichtert und Maßnahmen zur Armutsbekämpfung unterstützt. Zu den Mitteln gehört die Vergabe von Darlehen (Finanzhilfen), die Gewährung von technischer Hilfe bei Entwicklungsprojekten und die Koordinierung von Entwicklungshilfe. Die Weltbankgruppe besteht aus den folgenden Organisationen:
die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD; die Weltbank im engeren Sinn)
die Internationale Entwicklungsorganisation (International Development Association, IDA)
die Internationale Finanz-Corporation (International Finance Corporation, IFC)
die Multilaterale Investitions-Garantie-Agentur (Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA)
das Internationale Zentrum zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten (International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID)
Die Internationale Entwicklungsorganisation vergibt z. B. Kredite zu Sonderkonditionen für ärmere Entwicklungsländer. Die Internationale Finanz-Corporation fördert u. a. private Direktinvestitionen in Entwicklungsländer. Die Multilaterale Investitions-Garantie-Agentur übernimmt Garantien gegen politische Ausfallrisiken bei privaten Direktinvestitionen.
Basler Ausschuss für Bankenaufsicht
Die G20 einigten sich beim Treffen in Seoul 2010 auf Kernelemente von Basel III.
Nachdem beobachtet wurde, dass die Banken mit immer weniger Eigenkapital arbeiteten, gründeten die G10 (Industrienationen) den Basler Ausschuss. Dieser entwickelte 1988 mit Basel I Regulierungsempfehlungen an die nationale Bankenaufsicht der G10-Länder, die im Kern vorsahen, dass Banken im Verhältnis zu ihren risikogewichteten Aktiva mindestens 8 Prozent Eigenkapital zur Abdeckung von Ausfallrisiken vorhalten müssen.
Basel I konnte die Finanzkrise ab 2007 jedoch nicht verhindern, weil ihre Eigenkapitalanforderungen umgangen wurden. Hochriskante Hypothekenkredite wurden mittels Conduit auf Zweckgesellschaften der Geschäftsbanken übertragen. Selbige werden als Schattenbanken bezeichnet, da sie bankähnliche Geschäfte tätigen, ohne der Bankenregulierung zu unterliegen. Die Zweckgesellschaften finanzierten den Kauf durch die Ausgabe von Geldmarktpapieren mit kurzer Laufzeit. Über die Geldmarktpapiere (englisch commercial papers) konnte Kapital von kurzfristig orientierten Kapitalgebern (z. B. Geldmarktfonds) akquiriert werden. Da diese Fristentransformation die Gefahr barg, dass bei Fälligkeit der Emission keine Anschlussrefinanzierung zu erhalten war, mussten die Mutterbanken Garantien in Form von Liquiditätslinien bereitstellen, die helfen sollten, den commercial paper-Investor bei Fälligkeit der Papiere vor Verlusten zu schützen. Diese Garantien wurden normalerweise rollierend mit einer Laufzeit von 364 Tagen gestellt, da die bankaufsichtsrechtlichen Regeln vor dem Inkrafttreten von Basel II für solche außerbilanziellen Verpflichtungen mit einer Laufzeit unter einem Jahr kein Eigenkapital forderten. Es konnten also Erträge generiert werden, ohne dass bankaufsichtsrechtliches Eigenkapital dafür in Anspruch genommen werden musste. Nach dem Platzen der Immobilienblase im Juli/August 2007 war niemand mehr bereit, Geldmarktpapiere von Schattenbanken zu kaufen. Auch ein Verkauf der strukturierten Hypothekenkredite war nicht mehr möglich. Die Zweckgesellschaften nahmen die Liquiditätslinie ihrer Mutterbanken in Anspruch (vgl. z. B. IKB Deutsche Industriebank, Sachsen LB). Die Mutterbanken mussten diese Kredite wegen der mangelnden Solvenz der Schattenbanken abschreiben.
2007 wurden mit Basel II verbesserte Regelungen beschlossen. Mit Basel II unterlagen auch kurzfristige Investments den Eigenkapitalanforderungen. Die Eigenkapitalanforderungen wurden stärker an der Bonität des Kreditnehmers ausgerichtet. Kurze Zeit später zeigte sich in der Finanzkrise ab 2007, dass die Kreditratings von Ratingagenturen und Banken sehr unzuverlässig waren. Basierend auf diesen Erfahrungen wurde 2013 Basel III beschlossen.
Europäische Währungsunion
Europäische Staaten entschieden sich zunächst auf das Ende des Bretton-Woods-Systems mit einer Intensivierung der Zusammenarbeit im Rahmen des Europäischen Währungssystems zu reagieren. In dem System bestanden für die europäischen Landeswährungen wie Franc oder Deutsche Mark innerhalb von Wechselkursbandbreiten feste Wechselkurse. Damit sollten Wechselkursunsicherheiten und Währungskriege verhindert werden.
Entgegen dem internationalen Trend zu flexiblen Wechselkursen entschieden sich die europäischen Staaten die bestehende Zusammenarbeit im Rahmen des Europäischen Währungssystems zu einer Währungsunion auszubauen. Auf Grundlage des Vertrags von Maastricht schufen die Mitglieder der Europäischen Union (EU) die Europäische Zentralbank (EZB) zur Koordinierung der Zentralbanken der Mitgliedsländer, führten den Euro als gemeinsame Währung ein und vereinbarten eine vollständige Liberalisierung des Kapitalverkehrs. Um die Basis für die Währungsunion zu legen, wurde vereinbart, die Wirtschafts- und Währungspolitik aufeinander abzustimmen. Die Eckpunkte wurden in den 5 Konvergenzkriterien festgelegt:
Preisstabilität: Der Anstieg der Verbraucherpreise sollte nicht mehr als 1,5 Prozentpunkte über dem der drei preisstabilsten EU-Länder liegen.
Haushaltsdefizit: Das jährliche Haushaltsdefizit einzelner Staaten sollte dauerhaft höchstens 3 % des Bruttoinlandsprodukt pro Jahr betragen.
Öffentliche Verschuldung: Die öffentliche Verschuldung sollte 60 % des BIP nicht übersteigen.
Zinsen: Die langfristigen Zinssätze sollten nicht höher liegen als zwei Prozentpunkte über dem Durchschnitt in den drei preisstabilsten Ländern.
Währungsstabilität: Die Währung sollte in den letzten Jahren vor Eintritt in die Währungsunion im Rahmen des Europäischen Währungssystems gegenüber den anderen EU-Währungen nicht in größerem Umfang Auf- oder Abgewertet haben.
1999 begann die eigentliche Währungsunion. Seit 2010 arbeiten die EU-Staaten und die EZB an den Herausforderungen durch die Eurokrise.
Aktuelle Entwicklungen und Debatten
Geldpolitik
Während des Bretton-Woods-Systems war den einzelnen Staaten eine autonome Geldpolitik nicht möglich. Da die Währungen an den US-Dollar gekoppelt waren und die USA eine expansive Geldpolitik verfolgten, mussten alle anderen Staaten auch eine expansive Geldpolitik verfolgen. Ende der 1960er Jahre verzeichneten die USA zwar ein Wirtschaftswachstum, aber auch hohe Haushaltsdefizite (u. a. durch den Vietnamkrieg), steigende Inflation und steigende Leistungsbilanzdefizite. Die Aufrechterhaltung des festen Wechselkurses zum Dollar hätte auch für die anderen Länder wie z. B. Deutschland und Japan die Inkaufnahme erhöhter Inflation erfordert. Dazu waren einige Länder Anfang der 1970er Jahre nicht mehr bereit.
Durch die Abschaffung fester Wechselkurse mit Ende des Bretton-Woods-Systems konnten die einzelnen Länder wieder eine autonome Geldpolitik betreiben. Allerdings begrenzt die hohe Finanzmobilität und das Aufkommen von Finanzinnovationen die Möglichkeit der nationalen Notenbanken die nationale Geldmenge und Inflation zu steuern. Wenn ein einzelner Staat eine expansive Wirtschaftspolitik verfolgt, dann führt dies dazu, dass an den globalen Finanzmärkten eine erhöhte Inflation in dem Land erwartet wird. Die Zinsen für Kredite an dieses Land erhöhen sich also um den Faktor der erwarteten Inflation. Dies kann den Effekt expansiver Wirtschaftspolitik konterkarieren und verteuert zudem die Staatsanleihen. Deshalb verfolgten die meisten Länder nach Ende des Bretton-Woods-Systems bis Anfang der 90er Jahre eine eher wachstumshemmende restriktive Geldpolitik, die eine niedrige Inflation erwarten ließ.
Auf die Finanzkrise ab 2007 und die Große Rezession von 2008/2009 reagierten die Zentralbanken mit einer Niedrigzinspolitik um eine Deflation zu verhindern und Investitionen und Konsum zu befördern und so die Krisen zu bekämpfen. Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich sprach sich 2017 dafür aus angesichts der wieder guten Konjunktur die Niedrigzinspolitik zu beenden um die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft zu stärken und besser für den nächsten Schock oder Abschwung gewappnet zu sein. Der IWF urteilte anlässlich der IWF-Weltbank-Tagung 2018, dass das globale Finanzsystem stärker sei als vor der Finanzkrise ab 2007, allerdings gebe es finanzielle Ungleichgewichte, da die weltweite Schuldenlast auch wegen Konjunkturprogrammen gegen die Weltwirtschaftskrise und wegen der lockeren Geldpolitik seit 2007 deutlich stärker gestiegen ist als die Wirtschaftsleistung. Besonders deutlich ist die Entwicklung in den USA und in China. Der IWF empfiehlt die Zinspolitik schrittweise zu normalisieren und durch solide Staatshaushalte finanzielle Spielräume für die Bekämpfung eines nächsten Abschwungs zu schaffen. Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich sieht in einer Stellungnahme zum Jahr 2018 die Geldpolitik im Zuge der großen Krisen für erfolgreich an, warnt aber davor, dass eine expansive Geldpolitik über sehr lange Zeit zu einer Erhöhung der Gefahren für die Finanzstabilität sowie zu Fehlbewertungen von Vermögenswerten und zur Unterschätzung von Risiken führen kann. Es warnte vor dem schnellen Anstieg der Unternehmensschulden, insbesondere bei amerikanischen Unternehmen von geringer Kreditwürdigkeit. Dies sei das am besten sichtbares Symptom einer möglichen Überhitzung. Der Spielraum für geldpolitischen Aktivismus sei enger geworden. Als Gefahren für das globale Finanzsystem werden heute neben der Zinspolitik aber auch der Brexit, zunehmende Handelsstreitereien und besonders Cyberattacken angesehen. Laut einer Studie des Internationalen Währungsfonds macht der Schaden, der durch Cyberangriffe im Finanzsystem angerichtet wird, mittlerweile mehr als hundert Milliarden Dollar pro Jahr aus.
Wechselkurse und Zahlungsbilanzungleichgewichte
Mit dem Ende des Bretton-Woods-Systems war es den einzelnen Ländern nicht mehr verboten die Wechselkurse zu manipulieren. Zeitweise gingen einige Ökonomen davon aus, dass Devisenmarktinterventionen aufgrund der Finanzmarktglobalisierung und der Abschaffung der Kapitalverkehrskontrollen kaum noch Wirkung zeigen würden. Diese These wurde durch die Erfahrungen mit dem Plaza-Abkommen widerlegt. Als die USA in den 1980er Jahren eine Hochzinspolitik verfolgten um die Inflation einzudämmen und gleichzeitig eine expansive Fiskalpolitik vorantrieben um den wachstumsbremsenden Effekt hoher Zinsen abzumildern, führte dies zu einer starken Aufwertung des US-Dollars. In der Folge kam es zu einem starken Anstieg der Importe aus Deutschland, vornehmlich sogar aus Japan und gleichzeitig zu einer wirtschaftlichen Schwächephase in den USA. Im Plaza-Abkommen von 1985 wurde deshalb zwischen den G5-Staaten vereinbart, dass Maßnahmen zur Aufwertung der anderen Währungen gegenüber dem Dollar ergriffen werden. Die Devisenmarktinterventionen und die abgestimmte Geldpolitik führten zu einer scharfen Abwertung des US-Dollar, vor allem gegenüber dem Yen und der DM. Die Wechselkurspolitik verursachte vor allem in Japan große wirtschaftliche Probleme. Mit dem Louvre-Abkommen wurde vergeblich versucht der Abwertung des Dollar Einhalt zu gebieten.
Asiatische Schwellenländer, insbesondere China, betrieben bis mindestens 2007 eine Wechselkurspolitik, die auch als Bretton-Woods-II-Regime bezeichnet wird, denn China versucht, ähnlich wie es viele europäische Staaten (u. a. Deutschland) in den 1950er und 60er Jahren unter dem tatsächlichen Bretton-Woods-System taten, mit einer unterbewerteten Währung möglichst viele Arbeitsplätze im Exportsektor zu schaffen und große Bestände an Dollar-Devisen anzusammeln. Manche Ökonomen sehen die dadurch verursachte Sparschwemme als einen der Wegbereiter für die Finanzkrise ab 2007.
Internationale Finanzströme und sudden stop
Grundsätzlich ist der Zugang zu internationalen Krediten für Entwicklungs- und Schwellenländer vorteilhaft. Mit diesem Kapital kann der Wohlstand aber nur dann erhöht werden, wenn es so produktiv genutzt wird, dass der Nutzen die Kapitalkosten übersteigt. Es kommt aber immer wieder vor, dass in bestimmte Regionen mehr Investitionen und Kredite fließen, als dort produktiv genutzt werden können. Dann kommt es zu Finanz- und Wirtschaftskrisen, so in der Lateinamerikanischen Schuldenkrise der 1980er Jahre, der Tequila-Krise Mitte der 1990er Jahre, der Asienkrise Ende der 1990er Jahre. Auch im Vorfeld der Finanzkrise ab 2007 floss überproportional viel Geld in den US-Immobilienmarkt. Ungehinderte Kapitalströme erwiesen sich so als nicht wohlfahrtssteigernd.
Kurzfristige Gelder führen häufig zu schlecht geplanten Investitionen, weil die Anleger kurzfristig denken und Herdenverhalten verfallen. Erkennen sie Übertreibungen und Fehlinvestitionen, führt dies zu einem sudden stop, also einer Übertreibung nach unten. Sie ziehen ihr Kapital gleichermaßen aus unproduktiven wie aus produktiven Anlagen ab. Die aufgrund eines allgemeinen Misstrauens entstehende Kreditklemme führt dazu, dass auch intakte und produktive Wirtschaftsstrukturen aus Kapitalmangel notleiden.
Ein Beispiel, wie derartige Probleme verringert werden können, war Chile Anfang der 1990er Jahre. Der starke Zufluss ausländischen Kapitals wurde durch eine Rücklagepflicht reguliert (indirekte Kapitalverkehrskontrolle). Dadurch wurde sichergestellt, dass ein massiver Abzug ausländischen Kapitals nicht so schnell eine Finanzkrise verursachen würde können. Die Tequila-Krise von 1994/95 konnte somit nicht auf Chile übergreifen.
Fintech, Kryptowährungen und Digitales Zentralbankgeld
Seit 2015 führen Innovationen der Finanztechnologie zu einer starken Zunahme neuer Formen bargeldloser Zahlung für den Onlinehandel und internationale Zahlungen, welche den bürokratischen Aufwand und die Kosten verringern. Mit den neuen Zahlungsmöglichkeiten ergeben sich auch neue Herausforderungen der nationalen und internationalen Finanzmarktaufsicht vor allem in Hinblick auf die Transaktionssicherheit der Zahlungen und der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung. Auch Peer-to-Peer-Kredite und Social Trading im Investmentbereich führten zu neuen Regulierungen.
Der Anteil von Kryptowährungen an nationalen und weltweiten Zahlungsströmen ist aktuell noch unbedeutend. Maßgeblich dafür ist die (noch) geringe Akzeptanz als Zahlungsmittel, inadäquater Schutz für Nutzer insbesondere gegen Verlust und Diebstahl und die sehr hohe Volatilität der Kryptowährungen. Zwar untersuchen viele Zentralbanken die Chancen und Risiken von Kryptowährungen, effektiv sind diese bislang aber nicht reguliert. Während in Industrieländern das Interesse gering ist, arbeiten einige Zentralbanken von Schwellenländern wie zum Beispiel die Chinesische Volksbank an der Einführung von digitalem Zentralbankgeld.
Seite Globales Finanzsystem In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 29. Juli 2025, 14:02 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Globales_Finanzsystem&oldid=258396710 (Abgerufen: 3. August 2025, 07:38 UTC)
2.3 Die Geldmenge
Unter Geldmenge versteht man den Geldbestand einer Volkswirtschaft einer bestimmten Bindungsdauer, der sich in Händen von Nichtbanken befindet.
Geldmengen können durch Geldschöpfung im Rahmen der Kreditvergabe durch Geschäftsbanken erhöht und durch die Tilgung von Krediten gesenkt werden. Bargeld oder Giralgeld sind stets Verbindlichkeiten einer Bank oder Zentralbank gegenüber einer Nichtbank. Mit zunehmender Bindungsdauer schwindet der Charakter der Verbindlichkeit als flüssiges Zahlungsmittel für den Nutzer. Daher sind Geldmengen von ihrer Definition abhängig. Diese Definitionen unterscheiden sich zwischen den Währungsräumen.
Geldmengendefinitionen
Für die Messung der Geldmenge wird der Geldbestand der Nichtbanken herangezogen, also das sich in Händen von Privathaushalten, Unternehmen (ohne Kreditinstitute), Staat und Ausland (ohne Auslandsbanken) befindet.Volkswirtschaftslehre und Zentralbanken messen die Geldmenge durch Geldmengenaggregate, die durch M (für englisch money) und eine Ziffer bezeichnet werden.
Dabei ist das Geldmengenaggregat M1 eine Teilmenge von M2 und letztere eine Teilmenge von M3. Eine niedrigere Ziffer bedeutet eine größere Nähe der betrachteten Geldmenge zu unmittelbaren realwirtschaftlichen Transaktionen, d. h. je kleiner die Ziffer, desto wichtiger ist die Zahlungsmittelfunktion des Geldes.
Die Abgrenzung der einzelnen Aggregate ist konventionell und international nicht einheitlich.
Die GeldbasisM0 (auch Zentralbankgeld oder Reserven genannt) nimmt eine Sonderstellung ein. Sie ist gleich der Summe von Bargeldumlauf und Zentralbankgeldbestand der Kreditinstitute (Überschussreserven plus Mindestreserven). M0 ist bis auf den Bargeldanteil bei Nichtbanken nicht Teilmenge von M1 bis M3, da Zentralbankreserven nur zwischen Geschäftsbanken als Zahlungsmittel dienen. Auch steht die Geldbasis in keinem festen Verhältnis zu den Mengen M1 bis M3.
Geldmengen weltweit
Land
Geldmenge in Milliarden Dollar
Zeitpunkt
M1
M2
Volksrepublik China
8.160
25.240
Oktober 2017
Vereinigte Staaten
3.627
14.000
Dezember 2017
Japan
6.426
8.917
Dezember 2017
Deutschland
2.312
3.282
Dezember 2017
Vereinigtes Königreich
104,8
3.066
Dezember 2017
Frankreich
1.372
2.338
Dezember 2017
Südkorea
742,5
2.167
Dezember 2017
Indien
429,3
2.063
Dezember 2017
Hongkong
310,3
1.736
Dezember 2017
Italien
1.238
1.694
Dezember 2017
Australien
271,9
1.586
Dezember 2017
Kanada
715,3
1.554
Dezember 2017
Taiwan
535,1
1.374
Dezember 2017
Spanien
1.082
1.337
Dezember 2017
Schweiz
619,4
1.335
Dezember 2017
Niederlande
452,7
907,1
Dezember 2017
Mexiko
235,5
772,5
Dezember 2017
Brasilien
106,1
761,2
Dezember 2017
Russland
204,9
688,4
Dezember 2017
Geldmenge, Wachstum und Inflation
Die Reale GeldmengeMr bezeichnet die preisbereinigte nominale Geldmenge Mn
Gemäß der Theorie der Zentralbanken zur Geldschöpfung wird die reale Geldmenge endogen aus der Geldnachfrage bei einem gesetzten Leitzins bestimmt. Zunächst führt ein Anstieg der nominalen Geldmenge zu einem Anstieg der realen Geldmenge. Dies bedinge eine höhere Nachfrage nach Gütern, woraus ein Anstieg des Preisniveaus resultiere. Durch die Inflation (Anstieg des Preisniveaus) werde die reale Geldmenge wieder abgesenkt. Dieser Zusammenhang wird als Realkasseneffekt bezeichnet. Der Zusammenhang zwischen Geldmenge und Inflation wird auch von der Quantitätstheorie postuliert, die unter anderem von der Denkschule des Monetarismus vertreten wird. Heutige volkswirtschaftliche Theorien betonen allerdings den schwachen Zusammenhang zwischen Geldmenge und Inflation und sehen die Quantitätstheorie als nicht mehr ausreichend an, um die Inflation in modernen Volkswirtschaften zu verstehen.
Demgegenüber hat die Höhe von Zentralbankgeld im Markt (auch Liquidität genannt), das u. a. für die Abwicklung von Transaktionen zwischen Zentralbank und Geschäftsbanken sowie Geschäftsbanken untereinander verwendet wird, zwar Einfluss auf das allgemeine Zinsniveau, aber nur indirekte Auswirkungen auf Geldmengenwachstum und realwirtschaftliche Größen.
Seite Geldmenge. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 22. März 2025, 22:55 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Geldmenge&oldid=254450184 (Abgerufen: 3. August 2025, 07:20 UTC)
2.4 Die Zentralbanken
2.4.1 Europäische Zentralbank
Die Europäische ZentralbankEZB mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein Organ der Europäischen Union. Sie ist die 1998 gegründete gemeinsame Währungsbehörde der Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion und bildet mit den nationalen Zentralbanken (NZB) der EU-Staaten das Europäische System der Zentralbanken (ESZB).
Die Arbeit und die Aufgaben der EZB wurden erstmals im Vertrag von Maastricht 1992 festgelegt; seit dem Vertrag von Lissabon 2007 besitzt sie formal den Status eines EU-Organs (Art. 13 EU-Vertrag) Im November 2014 wurde die EZB zusätzlich mit der Aufsicht systemrelevanter Banken im Euro-Raum unter dem einheitlichen Bankenaufsichtsmechanismus (SSM) betraut. Die EZB ist eine supranationale Institution mit eigener Rechtspersönlichkeit.
Hintergrund
Eine Zentralbank ist eine Institution, welche für die Überwachung des Bankensystems und die Regulierung der Geldmenge in einer Volkswirtschaft zuständig ist. Im Euro-Raum übernimmt die Europäische Zentralbank (EZB) diese Aufgaben. Im Rahmen der europäischen Einigung entschieden sich einige Staaten zur Einführung einer gemeinsamen Währung, des Euros. Bei der Schaffung der einheitlichen Währung mussten auch die Voraussetzungen für eine gemeinsame Geld- und Währungspolitik geschaffen werden. Zu diesem Zweck wurde das Europäische System der Zentralbanken (ESZB) gegründet.
In diesem System befinden sich die alten Nationalen Zentralbanken (NZB) aller Staaten der EU und die neu gegründete Europäische Zentralbank. Ihr Hauptziel ist dabei die Preisniveaustabilität. Soweit dies ohne Beeinträchtigung dieses Ziels möglich ist, unterstützt das ESZB die allgemeine Wirtschaftspolitik in der Europäischen Union.
Aufgaben und Ziele
Da eine Zentralbank keine gewöhnliche Bank ist, sondern die Geldpolitik eines Landes führen muss, soll sie zwei wichtige Ziele verfolgen.
Das erste Ziel, meist auch das Hauptziel, ist die Preisniveaustabilität. Dabei gilt es, große Schwankungen des Geldwertes zu vermeiden. Die Zielgröße ist die Inflation (Inflationsrate).
Das zweite Ziel einer Zentralbank besteht in einer ausgeglichenen konjunkturellen Entwicklung des jeweiligen Landes. Dieses wichtige Nebenziel der Geldpolitik hat den Zweck, eine Rezession zu vermeiden. Die konjunkturelle Entwicklung wird an der Auslastung der Kapazitäten einer Volkswirtschaft gemessen. Die Zentralbanken verfolgen diese Ziele, indem sie den Preis für verliehenes Geld erhöhen oder senken (Leitzins verändern), also Einfluss auf die Wirtschaft nehmen. Somit kann eine Zentralbank sowohl auf die Inflation als auch auf die konjunkturelle Entwicklung einwirken.
Festlegung und Durchführung der Geldpolitik
Durchführung von Devisengeschäften,
Verwaltung der offiziellen Währungsreserven der Mitgliedstaaten (Portfolio-Management),
Versorgung der Volkswirtschaft mit Geld, insbesondere die Förderung eines reibungslosen Zahlungsverkehrs.
Genehmigung der Ausgabe des Euro-Papiergeldes
Aufsicht über Kreditinstitute und Beitrag zur Stabilität der Finanzmärkte,
Beratung der Gemeinschaft und nationaler Behörden, Zusammenarbeit mit anderen internationalen und europäischen Organen,
Sammlung der für die Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen statistischen Daten,
Erstellung einer Zentralbankbilanz.
Geldpolitik
Geldpolitische Ziele
Ihr geldpolitisches Instrumentarium setzt die EZB ein, um das ihr im EG-Vertrag vorgegebene Ziel der Preisniveaustabilität zu erreichen. Dieses definiert sie selbst als ein Wachstum des harmonisierten Verbraucherpreisindexes HVPI im Euro-Raum, das unter, aber nahe bei zwei Prozent pro Jahr liegen sollte. Das heißt, dass die Inflation mittelfristig bei 2 % gehalten werden soll.
Die geldpolitische Strategie wurde im Oktober 1998 vom EZB-Rat festgelegt. Untergeordnetes Ziel ist Unterstützung der allgemeinen Wirtschaftspolitik der EU.
Am 8. Juli 2021 gab die EZB als Ergebnis der strategischen Überprüfung unter der Leitung der neuen Präsidentin Christine Lagarde offiziell die Definition unter, aber nahe bei zwei Prozent auf und beschloss stattdessen ein symmetrisches Ziel von 2 %.
Die Zwei-Säulen-Strategie
Um das Inflationsziel zu erreichen, verfolgt sie ein so genanntes Zwei-Säulen-Konzept.
Als Erste Säule (wirtschaftliche Analyse) beobachtet sie die Inflationsentwicklung selbst und Größen, die Einfluss auf die Inflation haben, wie zum Beispiel:
Löhne und Gehälter
Wechselkursentwicklung
langfristige Zinssätze
Messgrößen für Wirtschaftstätigkeit
fiskalpolitische Indikatoren
Preis- und Kostenindizes
Unternehmens- und Verbraucherumfragen
Als Zweite Säule (monetäre Analyse) veröffentlicht sie einen Referenzwert (M3 unter Annahme eines Zuwachses des realen Inlandsprodukts von 2 % bis 2,5 % und Abnahme der Geldumlaufgeschwindigkeit um 0,5 % bis 1 %) für die wünschenswerte M3-Geldmengenentwicklung, der aber keine Zielgröße, sondern Informationen über Abweichungen darstellt. Ziel ist es, mittelfristig Gefahren für die Preisniveaustabilität zu erkennen. Kritik: Die Annahme der rückläufigen Geldumlaufgeschwindigkeit ist nicht vollends gesichert.