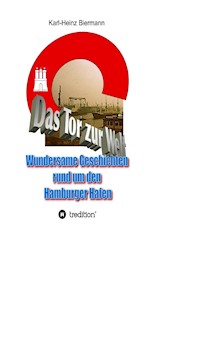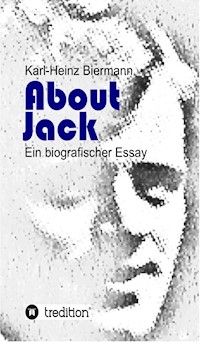
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Kaum ein namhafter Buchautor polarisiert so wie Jack London. Einige Jahre nach seinem Ableben - bis heute noch umstritten, ob durch Selbstmord oder nicht - trugen mehrere Biografien dazu bei, den Autor zahlreicher Erzählungen und Romane, darunter die bekanntesten wie "Der Seewolf" und "Lockruf des Goldes", mit einem Mythos auszustatten. Nach einer freudlosen Jugendzeit in den Armenvierteln Oaklands avancierte er zu einem der berühmtesten und bestbezahlten Schriftsteller, galt lange als sozialistischer Held, wenngleich er auch später dem Proletariat den Rücken kehrte. Seine Werke fanden irgendwann den Weg in die Regale der Kinderzimmer und gerieten allmählich in Vergessenheit. Erst als ein neuer Zeitgeist sich auf Klassiker der Moderne zu besinnen begann, wurde Jack London wiederentdeckt. Der Journalist Karl-Heinz Biermann setzt sich in seinem biografischen Essay auf eine etwas ungewöhnliche Weise mit dem wohl populärsten US-amerikanischen Schriftsteller auseinander und geht der Frage nach, wie viel Sozialismus wirklich in ihm steckte, und mit welchen Widersprüchen der Mythos behaftet ist, der ihn bis heute noch umgibt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 125
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Karl-Heinz BiermannAbout JackEin biografischer Essay
AboutJack
Ein biografischer Essay
© 2016 Karl-Heinz Biermann
Autor: Karl-Heinz Biermann
Lektorat: Michael Streeb
Titelgestaltung: HaBe
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN: 978-3-7345-6220-4 (Hardcover)
ISBN: 978-3-7345-6221-1 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt.Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags und des Autors unzulässig.Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung,Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Zum Gedenken an meinen Cousin Werner Biermann,Autor und Filmemacher
AboutJack
Prolog
2016 jährt sich zum hundertsten Male der Todestag des Schriftstellers Jack London. Einige Jahre nach seinem Ableben – bis heute noch umstritten, ob durch Selbstmord oder nicht – trugen mehrere Biografien dazu bei, den US-amerikanischen Autor zahlreicher Erzählungen und Romane, darunter wohl der bekannteste Der Seewolf,einigen Essays und dreier Schauspiele, mit einem Mythos auszustatten. Der nach seiner freudlosen Kinderzeit junge Jack begegnete in seiner kurzen Zeit als Student der neu gegründeten Sozialistischen Partei Oaklands. Nachdem er berühmt geworden war, wurde er von ihnen eingenommen, galt lange als ihr proletarischer Held – welch Widerspruch zu seiner Doktrin der Überlegenheit der arischen Rasse. Dennoch wurden seine Bücher in Nazi-Deutschland verbrannt – wegen seines Sozialismus, dem er bis zuletzt nachhing, wenngleich er auch irgendwann dem Proletariat den Rücken kehrte. Seine Popularität befand sich unterdessen im stalinistischen Russland auf einem Höhenflug, während sonst überall seine Werke ihren Weg in die Regale der Kinderzimmer fanden und allmählich in Vergessenheit gerieten. Erst als der Zeitgeist der 70er-Jahre des 20. Jahrhunderts sich auf Klassiker der Moderne zu besinnen begann, wurde Jack London wiederentdeckt, nicht zuletzt durch sein hundertjähriges Geburtsjubiläum 1976. Heute, im Jahr 2016, werden sicherlich anlässlich seines hundertjährigen Todestages einige Publikationen über ihn verbreitet werden. Der Autor dieses Buchs geht auf eine etwas ungewöhnliche Weise der Frage nach, wie viel Sozialismus tatsächlich in dem berühmten Schriftsteller steckte. Nicht als Kind, sondern erst als Erwachsener kam er in Berührung mit Jack Londons Literatur. Dieser Essay ist sicherlich nicht frei von Empathie, will aber den Widerspruch aufzeigen, der den Geist des wohl populärsten amerikanischen Schriftstellers trieb.
Zeige mir das Antlitz der Wahrheitnur auf einen flüchtigen Augenblick.Sage mir, was dem Antlitzder Wahrheit gleichkommt
Jack London, 1876.–1916
Sommer 2016. Skagway, Alaska, USA. Ich will meine Reise an jenem Ort fortsetzen, der für Jack seinerzeit den Beginn einer einprägsamen Etappe auf seinem Weg zum Schriftsteller bedeutete. Obwohl einundzwanzig Jahre jung, muss diese Strecke auf seinem Lebensweg für ihn sehr strapaziös gewesen sein. Ich für meinen Teil schaue zurück zur Pier und sehe das riesige Kreuzfahrtschiff, das mich von San Francisco hierher gebracht hat. Ich bin achtundsechzig und denke, wie komfortabel ich es bisher auf meiner Reise habe.
Noch vor ein paar Tagen besuchte ich das Schifffahrtsmuseum des San Francisco Maritime National Historical Park unten an der Bay. In einer Vitrine war das Modell der „Snark“ ausgestellt, jenes Schoners, mit dem Jack in den letzten Jahren seines kurzen Lebens den Beweis physischer Überlegenheit antreten wollte, der aber letztlich in Selbsttäuschung endete. Interessiert schaute ich mir alle Details des vor mir hinter Glas aufgestellten Zweimasters an. Ein Besucher, eine Weile neben mir still stehend und ebenso wie ich das Modell betrachtend, raunte mir irgendwann zu, dass Jack wohl „ein schlimmer Finger gewesen sei“, wandte sich um und ging. Hätte ich ihm nachrufen sollen, ob das seiner Weisheit letzter Schluss sei? Ich weiß es nicht, jedenfalls hatten mich seine Worte getroffen. Natürlich hatte ich mir bereits früher, über Jahre hinweg, in denen ich mich mit Jacks Literatur befasste, immer wieder die Frage gestellt, was den widersprüchlichen Geist des populären amerikanischen Schriftstellers antrieb. Einiges sah ich beantwortet, doch eine Frage blieb: War Jack wirklich ein Sozialist? Nun war ich auf dem Weg dahin, um die Frage beantwortet zu bekommen.
Von Skagway aus führt eine gut ausgebaute Straße um die Nahku-Bucht herum hinauf nach Dyea. Dieser kleine Ort ist also bequem mit dem Auto oder dem Bus zu erreichen. Zu Jacks Zeiten gab es da keine Straße, nicht mal einen Pfad, und er musste mit dem Boot den Sund hinaufrudern – oder konnte allenfalls segeln; ich könnte zum Beispiel ein Mietauto nehmen und hinfahren, in einer halben Stunde wäre ich dort. Aber anders als Jack damals und Tausende andere seiner Zeitgenossen, die über Dyea hinaus ihre Reise zu Fuß und danach mit dem Boot fortsetzen mussten, kann ich in Skagway ein Flugzeug besteigen. Hier, wo früher an grob hingehauenen hölzernen Bollwerken und klapprigen Bootsstegen die frühzeitlichen Dampfer anlegten und ihre menschliche Fracht an Land warfen und wo heute in derselben Bucht dreihundert Meter lange Kreuzfahrtschiffe an modern angelegten Terminals festmachen, befindet sich direkt nebenan ein Flugplatz, auf dem kleine Motorflugzeuge starten und landen können. Ich laufe die paar Schritte dorthin, ich bin dort verabredet – mit Jack!
Seine breite, die für heutige Modevorstellungen viel zu kurz gebundene Krawatte lässt ihn erscheinen, als sei er aus einem seiner bekannten Fotos entsprungen. Lässig lehnt er am Eingangstor des kleinen Flugfelds, und auch sein breites Lächeln füllt sein Gesicht vollständig aus, als ich ihm die Hand reiche. „Hi, Jack“, begrüße ich ihn. Er erwidert meinen Händedruck, eine Spur zu schlaff, wie ich empfinde. Er zeigt hinter sich auf eine knallrot lackierte Maschine und wir gehen hinüber. Ich schaue mir die schon etwas in die Jahre gekommene Cessna 182 genau an – Fahrwerk, Streben, Motorhaube –, bevor ich Jacks Aufforderung folge einzusteigen. Jack hat wohl meine prüfenden Blicke bemerkt, und bevor er Misstrauen dahinter erkennen will, stelle ich fest, indem ich auf den Rumpf des Flugzeugs zeige: „Die Farbe deiner politischen Ideologie.“
Sofort erkenne ich, wie recht abstrakt meine Bemerkung ist, will den Auftakt meines Treffens mit Jack nicht unnötig strapazieren und warte zur Milderung gleich mit einem ähnlichen Sophisma auf, die mir selbst widerfahren ist: „Ich war Betriebsrat in einem Verlag mittlerer Größe, drüben in Deutschland. Ab und zu waren auch mal Reden vor der Belegschaft fällig, die ich aus unserem Kollegium heraus dann meistens vorzutragen hatte. Bei diesen Gelegenheiten zog ich mir entgegen meinen sonstigen Gewohnheiten eine Krawatte an, und zwar eine knallrote ohne mir zunächst etwas dabei zu denken, es waren die 70er-Jahre und die Farben waren da eben knallbunt. Irgendwann warf mir die Geschäftsleitung vor, ich sei ein Sozialist, weil ich eine rote Krawatte trüge. Sie machten das also an der Farbe meiner Krawatte fest, nicht an dem, was ich vorzutragen hatte. Ich war bis dahin überzeugt, keiner zu sein, parteiideologisch sah ich mich neutral. Hätte man mir gesagt, ich sei ein Sozialist, weil ich sämtliche Bücher von dir gelesen habe und die ich über die gewerkschaftseigene Büchergilde Gutenberg bezog, hätte ich mich angesprochener gefühlt.“
Jack hat kommentarlos den Motor des einmotorigen Flugzeugs angeworfen, wir rollen nordwärts ans Ende der Startbahn – oder ihren Beginn? Das kann man betrachten, wie man will, denke ich und drücke mich in meinen Sitz zurück, die zunehmende Beschleunigung der Cessna tut ihren Teil dazu bei, und bald schweben wir, steigen höher und höher und fliegen entgegengesetzt unseres Zielkurses südwärts. Ich weiß, dass wir Höhe gewinnen müssen, und die erreicht die Cessna, indem sie erst einmal über die Bucht hinaus fliegt.
Dann dreht die Maschine scharf nach rechts ab. „Dyea“, sagt Jack, nur mit dem Kopf nach unten nickend. Ich vernehme zum ersten Mal seine Stimme, sie klingt nicht menschlich, sondern näselnd quäkend im Kopfhörer, den aufzusetzen er mich aufgefordert hatte, der Lärm des Motors dringt in die Kanzel, eine normale Unterhaltung ohne das Headset wäre unmöglich. Ich sehe auf den kleinen Ort, der bald unter uns hindurchgehuscht ist. Jetzt fällt mir wieder ein, dass es gemietete Kanus waren, die Jack und seine Mitreisenden damals 1897 von Skagway nach Dyea gebracht hatten.
Die Cessna steigt weiter und hält nun einen Nordkurs auf die schneebedeckten Gipfel vor uns. Warum wollen mir in diesem Moment die Schlussworte aus Hemingways Schnee auf dem Kilimandscharo einfallen, wo es am Ende der Novelle heißt: „… und dort vor ihnen, so weit er sehen konnte, so weit wie die ganze Welt, groß, hoch und unvorstellbar weiß in der Sonne lag der Gipfel … und dann wusste er, dorthin war es, wohin er ging.“
Jack muss meine Gedanken erraten haben. „Literaturkenner?“, höre ich ihn sagen. Kann er Gedanken lesen? Offenbar kann er es. Doch dann will ich seine Absicht erkennen, dass seine Frage meinem Treffen mit ihm gilt, vielleicht will er prüfen, ob ich überhaupt geeignet bin, mit ihm auf diese ungewöhnliche Exkursion zu gehen.
Anbetracht meines skeptischen Blicks auf die schroffen, vom ewigen Schnee bedeckten Felswände vor uns, beruhige ich mich mit dem Wissen, dass die Cessna eine Höhe von fünftausend Meter erreichen kann – die umliegenden Gipfel sind knapp über zweitausend.
Jack korrigiert den Kurs, und die Zahlen im Kompass vor uns wandern ein paar Striche nach links. „Der Chilkoot-Pass“, sagt er, „genau voraus.“ Ich blicke nach vorn und erkenne einen Einschnitt zwischen zwei fast senkrecht abfallenden Berghängen, ich sehe nackten Fels, Gestein und Geröll. Der Einschnitt steigt steil an, selbst aus dieser Höhe zu erkennen. Ich weiß aus den Büchern, dass die höchste Stelle des Trails über das Gebirge auf eintausendeinhundert Meter liegt.
Jack reduziert die Geschwindigkeit und fliegt dicht über den Pass. Mir kommen die Geschichten aus Jacks Alaska-Erzählungen in den Sinn und Bilder vor Augen, ich sehe schwarze Punkte im tiefen Schnee, Hunderte, Tausende und wie an einer Perlenschnur aufgezogen. Ein zehn Kilometer langer Pfad vom Fuß bis zu seiner höchsten Stelle ist ein einziger Menschenstrom.
„Und den bist du mehr als einmal rauf und runter“, bemerke ich.
„Wir hatten achttausend Pfund an Proviant und Ausrüstung über den Pass zu bringen“, erwidert Jack, „wir waren eine Gruppe von fünf Leuten.“
„Ich weiß“, antworte ich. „In deinen Erzählungen spüre ich trotzdem die Freude, die du hattest, weil du nicht weniger getragen hast, als die einheimischen Indianer und so manchen von ihnen beim Stieg über den Pass hinter dir gelassen hast.“ Meine Worte sollen eine Anspielung auf Jacks Glauben an die Überlegenheit der angelsächsischen Rasse werden und ihm nicht schmeicheln. Ich warte auf eine Antwort, die aber nicht folgt. Ich schaue daher aus dem Fenster, als sei ich abgelenkt worden. Wir haben den Pass längst überflogen, die Landschaft ist jetzt mehr zerklüftet und voraus zeigen sich in breiten Tälern graugrüne Gewässer.
„Ich habe deine Erzählungen und Romane gelesen“, fange ich dann doch wieder an, „und auch deine Essays. Allerdings sind mir deine Schauspiele bis jetzt unbekannt geblieben.“
„Typisch“, sagt Jack. „Aber ich nehme an, dass du über meine Biografie bestens Bescheid weißt“, fügt er hinzu, seine blecherne Stimme im Kopfhörer hat einen ironischen Beiklang.
Ich ziehe die Schultern hoch. „Was man so allgemein weiß.“
„Nichts wisst ihr!“ Jetzt klingt Jacks Stimme fluchend.
Sein Ausbruch kränkt mich etwas. Andererseits hat er „ihr“‘ gesagt und nicht „du“, da wäre ich betroffener gewesen. „Deswegen bin ich ja mit dir unterwegs“, ist meine Entgegnung, „damit ich mehr über dich erfahre. Zum Beispiel was dich damals trieb, zum Klondike zu gehen. War es allein der Goldrausch, der dich in die Wildnis zog?“ Ich habe absichtlich das Adverb allein vorgesetzt, Jack soll sich nicht darauf beschränken, er sei einfach einer herrlichen Ungewissheit gefolgt, wie einer mal über ihn geschrieben hat, nachdem die Kunde von großen Goldfunden in der arktischen Wildnis Kanadas die Außenwelt erreichte. Ich vermute andere Beweggründe. Jack musste im Frühjahr 1897 seinen Versuch als Schriftsteller zu leben aufgeben und verdiente wieder einmal nicht mehr als dreißig Dollar im Monat. Wieder einmal wurde er zum Arbeitstier wie schon als Junge, der seine Familie unterstützte mit jedem Cent, den er in der Konservenfabrik bekam und den ihm seine Mutter direkt an seinem Arbeitsplatz wegnahm.
„Für den Lohn, den du für deine harte Arbeit bekommen hast, sparte sich die Firma die Bezahlung für zwei Arbeiter. Dies war wohl deine erste Lektion in praktischem Sozialismus.“
„Du vergisst, dass ich vorher mit Kellys Armee unterwegs war.“
Ich bin erstaunt, dass Jack über meinen Sarkasmus hinweggeht. „Ja, richtig, deine Abenteuer auf dem Schienenstrang“, sage ich. Natürlich kenne ich die Geschichte von Tramps, die auf Güterwagen durchs Land fahren. Auch Jack hat die Waggons der Eisenbahnen geentert, hat auf den Puffern gesessen und mit dem Zugpersonal gerangelt, ist runtergeworfen worden oder ihnen entkommen, um gleich wieder auf den nächsten Zug zu springen. Quer durch die USA, nach Chicago, bis nach New York. Ich nehme an, Jack ist geflohen. Vielleicht erschöpft durch seine Plackerei wollte er seinen Körper und Geist erneuern, und dennoch wird aus der Flucht wieder eine Jagd, eine unbändige Jagd und Streben nach Erkenntnis. Unter der Führung eines Mannes namens Kelly, der sich selbst als General bezeichnet, gruppieren sich mehr als zweitausend Männer, die alle arbeitslos sind und die nach Washington wollen, um zu protestieren. Unter den Millionen Arbeitslosen will eine neue Bewegung aufmerksam machen, dass sie keine Faulpelze, sondern Arbeitsuchende sind.
„Die amerikanische Ruhelosigkeit nach dem Bürgerkrieg, so habe ich mal gelesen, und das Erbe der ersten Generation von Einwanderern in Kalifornien hinterließen einen hemmungslosen Reichtum weniger und Armut und Unzufriedenheit vieler“, zitiere ich. „Die Reden abends an den Lagerfeuern, die Parolen der Ausgegrenzten waren also deine erste Berührung mit dem Sozialismus.“
„Du irrst wieder“, entgegnet Jack. Er steuert die Cessna über den Lindeman-See, der alsbald in den Bennett-See übergeht, verbunden durch einen engen Durchlass, ich sehe Stromschnellen sogar aus unserer Höhe weiß aufschäumen.
„Lass mich auch mal zitieren“, fährt Jack fort: „Nach Ralph Waldo Emerson wurde Kalifornien durch eine Meute armer Abenteurer besiedelt. Was glaubst du, waren das alles Sozialisten?“
„Jetzt zielst du auf deine Herkunft ab. Deine Mutter hatte dir immer eingebläut, dass du aus einer guten alten amerikanischen Familie abstammst, deren Vorfahren aus England kamen. Aber alle Welt wusste, dass du der unehelich geborene Sohn eines Vagabunden und einer dich vernachlässigenden Mutter warst.“
„Das gebe ich zu. Und am Ende ist meine – wie ihr es nennt – Absonderlichkeit nicht von meiner Mutter geprägt worden, sondern von meiner Gesellschaft verursacht worden, der Umwelt, wie ihr sie heute bezeichnet.“
Dem stimme ich wiederum in Gedanken zu. „Aber wann nahmst du nun endlich den Kampf gegen die Ausschweifungen des Kapitalismus auf?“, bohre ich weiter.
Jack schaut mich an, als verstünde er meine Frage nicht. Aber dann legt sich wieder sein breites Grinsen über sein Gesicht. „Ich war Austernpirat, ich habe mich mit anderen Dieben um Beute geprügelt.“
„Ja, unten in der Oakland-Bucht, da warst du sechzehn. Aber dann hast du die Seiten gewechselt, bist der Patrouille beigetreten und hast statt Fische Fischpiraten gefangen, Leute, die du bestens kanntest.“
Jack grinst wieder. „Sie haben meine Erfahrung gebraucht.“
„Also wieder nichts mit Sozialismus“, betone ich provokativ.
„Immerhin habe ich mit einem gleichaltrigen Mädchen in einem eheähnlichen Verhältnis gelebt, du glaubst gar nicht, wie sozial das war.“ Jack schaut zu mir herüber und scheint meine Reaktion abzuwarten.
Ich habe nirgends gelesen, dass Jack jemals so gesprochen hatte. Allerdings hat er darüber geschrieben. The Cruise of the Dazzler (Joe unter den Piraten)* und Tales of the Fish Patrol (Fischpiraten)