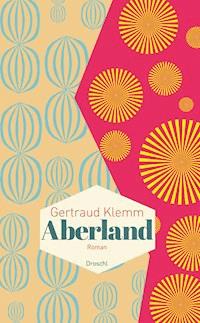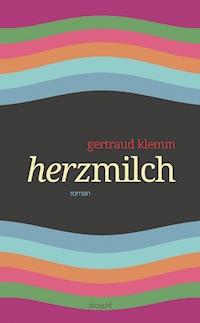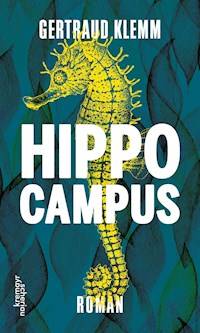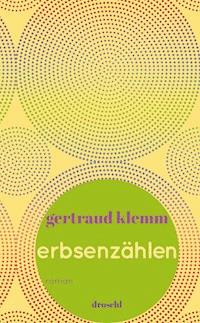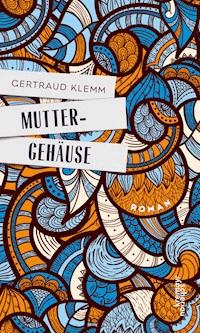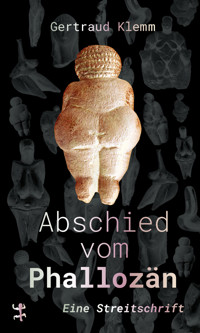
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Showdown des Anthropozäns scheint nah: Vor der Kulisse aus Klimakrise und Kriegen droht eine Handvoll machttrunkener und skrupelloser Politiker im Verein mit rücksichtslosen Techmilliardären die Welt gegen die Wand zu fahren. Was all diese Akteure von nie dagewesener globaler Wirkmacht gemein haben? Es sind ausnahmslos Männer. Ignoriert man diesen weißen Elefanten im Raum, hilft auch aller Aktivismus nicht, denn: Nicht der Mensch hat die Erde im Würgegriff, sondern das Patriarchat! Es zu überwinden hieße, den gröbsten globalen Problemen gebündelt entgegenzutreten. Sklaverei, Rassismus, Kolonialismus und Imperialismus schienen bis vor Kurzem noch »alternativlos«, doch sie konnten weitestgehend aufgearbeitet werden, weil sie entlarvt wurden: als Missstände, die der Spezies Mensch unwürdig sind. Warum sollte das mit dem Patriarchat nicht auch gelingen? Gertraud Klemm nimmt sich in ihrem leidenschaftlichen Essay matriarchale Gesellschaften aus Vergangenheit und Gegenwart zum Vorbild für ihre Ankündigung des Abschieds vom Phallozän – ein kraftvolles Gedankenspiel über matriarchale Inspiration, patriarchale Dekonstruktion und die Notwendigkeit der kolonialen Schubumkehr.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 151
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Abschied vom Phallozän
Gertraud Klemm
Abschied vom Phallozän oder: Wann sprechen wir endlich vom Matriarchat?
Matthes & Seitz Berlin
Inhalt
Prolog
1. Das Phallozän und seine Ursachen
2. Matriarchate – gestern und heute
3. Die (De-)Konstruktion des Patriarchats
4. Patriarchatskritik auf halbem Weg: Wir sind teilweise schon weiter, als wir denken
5. Hinterfragen, Empören, Fordern: Was konkret zu tun ist
Epilog: Die koloniale Schubumkehr
Danksagung
Anmerkungen
Literatur
Prolog
Es hat 35 Grad, wir stehen im Innenhof von Elmina Castle, einer sogenannten »Sklavenburg« in Ghana, vor der kleinen Kirche. Der portugiesische Gouverneur und seine Bediensteten haben hier im 18. Jahrhundert den Gottesdienst gefeiert, während ein Stockwerk tiefer Menschen in Verliesen zusammengepfercht auf ihren Abtransport über den Atlantik gewartet haben. Unser Guide deutet auf Lüftungsschlitze zu den Verliesen, über die man beim Betreten der Kirche praktisch steigen musste. »Sie müssen es gerochen haben, bevor sie zu ihrem Gott gebetet haben«, sagt er trocken.
Ich habe genug gehört und gesehen von den Scheußlichkeiten des Sklavenhandels. Von den Kerkern, mit ihren Ablaufrinnen für Fäkalien. Von dem zentimeterdicken, grauen Belag am Boden, der wissenschaftlich nachgewiesen aus Haut, Fäkalien und Blut besteht. Vom Frauenverlies, auf das der Gouverneur einen guten Ausblick hatte, von der kleinen Wendeltreppe zwischen seinem Schlafzimmer und dem Frauenverlies, über die er sich die eine oder andere Versklavte gewaschen und frisch eingekleidet zur Vergewaltigung kredenzen ließ. Ich habe genug von der Architektur des Unrechts. Ich mag meinem 10-Jährigen, der noch nicht Englisch kann, nichts mehr davon »kindgerecht« übersetzen. Dort haben sie die Frauen angekettet und sie bestraft. Dort haben sie den Menschen das glühende Eisen in die Haut gebrannt. Dort sind sie aufs Schiff gebracht worden. Warum? Wohin? Hatten die kein Mitleid? War das nicht verboten? Und der Pfarrer in der Kirche, was war mit dem los?
Während ich mir zuhöre, wie ich den Apparat des Missbrauchs zu erklären versuche, sehe ich auf einmal klar das Zusammenspiel der Mächte, das nötig ist, um diese humanistische Pleite zu ermöglichen. Die Auf- und Abwertung von Menschen anhand von Herkunft und Hautfarbe. Diese Hierarchie, die mit Gewalt durchgepeitscht wird. Der spezifische Missbrauch von Frauen und ihrer Reproduktionskraft, ohne die nichts geht. Der kapitalistische Sog der Kolonialmächte, der über Jahrhunderte ganze Kontinente entvölkert und ihre Rohstoffe abzweigt. Und alles unter dem wachsamen Auge Gottes und der christlichen Kirche, die ihren Segen darüberbreitete. Gier, Rücksichtslosigkeit und Grausamkeit alleine reichten nicht, um so etwas, allen ethischen Prinzipien Widersprechendes wie Sklaverei über Jahrhunderte zu tolerieren; es brauchte ein komplexes Zusammenspiel verschiedenster Kräfte, das den Missbrauch ermöglicht, organisiert, rechtfertigt und so die zivilisierte Spezies Mensch derart korrumpiert, dass sie ihre eigenen Werte kannibalisiert.
Und während ich das maliziöse Ineinandergreifen von Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Religion in eine kindgerechte Sprache übertragen muss, frage ich mich: Was, wenn wir die vielen Ursachen für die massive Krise, in die unsere Erde gerade schlittert, nicht mehr isoliert voneinander betrachten? Was, wenn Umweltzerstörung, Rassismus, Kriege, globale Ungerechtigkeit und Misogynie unter dem Schirm der Patriarchatskritik verstanden und vielleicht sogar bewältigt werden könnten?
Der Gedanke ließ mich auch zu Hause nicht mehr los. Das Patriarchat zu überwinden heißt, den gröbsten globalen Problemen frontal entgegenzutreten. Dieser evolutionäre Schritt ist riesengroß und zweifelsohne schwer realisierbar. Intellektuell und visionär sollte er jedoch unbedingt möglich sein. Denn viele Ausprägungen des Patriarchats wie Sklaverei, Rassismus, Kolonialismus und Imperialismus waren bis vor wenigen Jahrzehnten noch unumstößliche, gesellschaftliche Realität; theoretisch und auch realpolitisch sind sie in vielen Ländern der Welt (weitgehend) überwunden, weil sie als das erkannt wurden, was sie sind: Missstände, die der Spezies Mensch unwürdig sind. Warum sollte das mit dem Patriarchat nicht auch gelingen? Und erst recht, da wir matriarchale Gesellschaften nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch in der Gegenwart als Vorbild nehmen können?
Abschied vom Phallozän ist ein Gedankenspiel über patriarchale Dekonstruktion, matriarchale Inspiration, humanistische Reife, über die Notwendigkeit der kolonialen Schubumkehr und über die Frage: Kann der Feminismus mehr als »smash patriarchy«? Wer wird die Welt retten, und wie?
»His name was privilege, but hers was possibility.«
Rebecca Solnit, Men Explain Things to Me, 2014
1.Das Phallozän und seine Ursachen
»Eure ›Ordnung‹ ist auf Sand gebaut. Die Revolution wird sich morgen schon ›rasselnd wieder in die Höh' richten‹ und zu eurem Schrecken mit Posaunenklang verkünden: Ich war, ich bin, ich werde sein!«
Rosa Luxemburg, Die Ordnung herrscht in Berlin, 1919
Anthropozän oder Phallozän?
Wir leben im Anthropozän; der Mensch prägt den Planeten, die Natur und sogar den Weltraum, und er ist es, der die Erde in eine dauerhafte Krise gestürzt hat. Aber – kann man wirklich von einem Anthropozän reden, wenn sich so viel Kapital und Macht in den Händen so weniger Menschen befindet? Wenn die männliche Hälfte der Menschen die weibliche Hälfte weltweit systematisch unterdrückt und ausbeutet? Wenn ganze Kontinente vom Wohlstand ausgeschlossen sind, während sich woanders der Reichtum aufs Obszönste akkumuliert? Welche Art Mensch ist das eigentlich, die das Anthropozän zu verantworten hat?
Nicht der Mensch hat die Erde und ihre Biosphäre auf dem Gewissen, das Patriarchat ist es, das unseren Planeten seit 5000 Jahren im Würgegriff hält. Immer weniger Männer akkumulieren immer mehr Macht, und ihre Motive sind kriminell. Niemand spricht über den Elefanten im Raum: wie männlich diese Zerstörungsriege ist, die da am Werk ist. Wir befinden uns nicht im Anthropozän, sondern im Phallozän. Der Begriff Phallozän wird in verschiedenen Sprachen für unterschiedliche destruktive Ausprägungen des Patriarchats benutzt; ich möchte mit ihm das Zeitalter eines völlig aus dem Ruder gelaufenen Patriarchats verbildlichen, das sich an die Schaltstelle aller Mächte katapultiert hat und von dort aus seine zerstörerische Kraft ausübt. Es ist kein Zufall, dass der schleichende Rechtsruck in Europa und den USA viele »starke Männer« mit dicken Geldbörsen auf den Plan ruft; dass die zweite Amtszeit des Alpha-Männchens Trump mit wildester Kriegspropaganda beginnt, in die ein Chor von anderen verhaltensauffälligen Machtmännern einstimmt – eine Truppe, der etwas Verantwortungsloses, Pubertäres anhaftet. Alpha-Technologe Musk will menschliche Gehirne verkabeln und den Mars kolonialisieren, Alpha-Maskulinist Andrew Tate möchte eine Diktatur im Vereinigten Königreich errichten, und Alpha-Kommunikator Marc Zuckerberg läutet das Zeitalter der Fake News ein. Jeder von ihnen will auf der globalen Kommandobrücke sein mächtiges Spielzeug ausprobieren, und alle haben sie ein traditionelles, rückschrittliches Geschlechterbild mit im Gepäck.
Diese Männer vertreten eine individualisierte, verzwergte Männlichkeit, die sich in einem Zustand der permanenten Erregung befindet und nicht mehr an die Konsequenzen ihres Tuns denkt – denn das Tun ist immer nur auf den persönlichen Gewinn ein paar weniger ausgerichtet. Diese Männer versuchen sich als »Rudelführer«, um des Führens willen, ohne dass sie auch nur einen empathischen Gedanken an das Rudel verschwenden. Im Phallozän sind sehr emotionale Männer und ihre Doktrinen an die Macht geraten, die nur einen winzigen Bruchteil dessen, was Männlichkeit bedeuten kann, verkörpern. Nicht genug, dass Empathie für sie die größtmögliche Schwäche ist: Ihnen fehlen sogar die plakativsten männlichen oder väterrechtlichen Zuschreibungen wie Kontrolliertheit, Umsichtigkeit oder Ernährer- oder Beschützerinstinkt. Überspitzt ausgedrückt repräsentieren sie eine im Jugendstadium fixierte Männlichkeit,1 die nur von einer Ejakulation zur nächsten denkt. Im Phallozän drängen sich Männer mithilfe ihrer medialen und finanziellen Machtstellung in die Politik, sie kollaborieren mit ihresgleichen, sie werten alles ab, was anders ist als sie selbst. Der Rest der Welt muss dabei zusehen, wie sie Gesetze umgehen, auf die Umwelt pfeifen, die Medien demolieren, wie sie sich im fossilen Zeitalter verbeißen und die Wirtschaft kontrollieren. Sie kaufen den ganzen Planeten, und sie fahren ihn an die Wand, und zwar jetzt und sofort – weil sie es wollen und weil sie es können!
Nicht älter als 5000 Jahre ist es, das Patriarchat. In dieser kurzen Zeit wurde der patriarchale Herrschaftsanspruch qua Geschlecht(sorgan) argumentiert und gewaltsam durchgesetzt; die vaterrechtliche Männlichkeit hat sich ihre erhabene Position durch Erniedrigung alles Weiblichen ertrampelt. Diese Art von Männlichkeit begreift sich nicht als Teil eines Ganzen, sondern als Krönung der Schöpfung, und sie legt den Grundstein für die ausbeuterische Haltung gegenüber allem anderen. Sie ist der Grundstein für eine Vaterschaft, die die Mutterschaft ausbeutet, für eine Herrschaft, die Gewalt und Ungerechtigkeit legitimiert, für eine Wissenschaft, die das Weibliche pathologisiert hat, für eine Religion, die sich Götter ohne Penis nicht vorstellen kann und will. Dieses Paradigma gipfelt in jener ausbeuterischen Haltung, die unsere Spezies an den Rand der Auslöschung gebracht hat – und den Rest der Welt gleich mit. Das phallokratische Weltbild findet sich in der Politik, in der Philosophie, in der Naturwissenschaft, in der Ökonomie, in Religionen und in der Kunst – seine patriarchale Programmierung durchzieht ausnahmslos alle unsere Denkmuster und macht ein ganzheitliches Denken fast unmöglich.
Obwohl das »Vaterrecht« erd- und menschheitsgeschichtlich blutjung ist, wird es als eine Art Naturgesetz begriffen und als zivilisatorischer Ausgangspunkt behauptet – von der Zivilbevölkerung, von den Religionsgemeinschaften, aber auch von Intellektuellen, Vordenker:innen und in der Forschung. Vielleicht wird das Patriarchat aus diesem Grund nicht ausreichend als zentrale Problemquelle erkannt und behandelt – und von den immergleichen kritisiert: den Frauen. Die Patriarchatskritik hat fürwahr keinen leichten Stand. Viel zu abgedroschen sei das Vokabular, mit dem hantiert wird, unzumutbar der selbstkritische Gestus, der verlangt wird; viel zu einseitig die »weibliche« Herangehensweise, die zur Rettung der Welt beitragen könnte, viel zu esoterisch der religionskritische Ansatz, viel zu naiv der kapitalistische. Kurz: viel zu schmuddelig das feministische Eck, aus dem die Kritik seit Jahrzehnten tönt, und viel zu patriarchal die Sichtweise auf alles, was patriarchatskritisch ist!
Das Risiko, mit einem patriarchatskritischen Aufruf nicht gehört zu werden, ist bemerkenswert. Sag das Unwort »Patriarchat« und alle halten sich die Ohren zu, hat einmal eine kluge Frau zu mir gesagt, und: Rechne nicht damit, ernst genommen zu werden, wenn du diesem Machtapparat auf die Füße steigst! Wer will schon hören, dass oder wie das Patriarchat die Welt zerstört? Am wenigsten die Patriarchen, die gerade die Welt kaputt machen – und auch nicht jene, die sich mit dem Patriarchat abgefunden haben. Denn Patriarchatskritik wird traditionell als infame, kollektive Schuldzuweisung aufgefasst, an alle Männer, die sich mit dem Patriarchat identifizieren, und an alle Frauen, die mit ihm fraternisieren. Die Eigenverantwortung für einen Missstand erstmal zurückzuweisen ist ein gut geölter, wenngleich infantiler Reflex. Abgesehen davon gehört »Patriarchat« zur Familie jener Worte, die wir nicht gerne hören. So wie die Begriffe »Hunger in Afrika«, »Klimawandel« und »Frauenmord«: alles katastrophale Zustände, die selbstredend kritikwürdig, aber scheinbar unvermeidlich sind. Aber sind sie das tatsächlich?
Dieser Essay ist ein Hilferuf an alle, die sich ernsthaft mit der Lösung der globalen Krise befassen: Wir brauchen nicht weniger als eine neue Weltsicht, in deren Denkansätzen das Patriarchat mit der gleichen (Selbst-)Kritikfähigkeit behandelt wird, wie es etwa mit Kolonialismus, Rassismus und dem Holocaust geschehen ist. Erkennen wir das Patriarchat als das, was es ist: ein fataler Programmierfehler im Kern unseres nur scheinbar humanistischen Paradigmas. Seine Superkraft ist der Missbrauch, sein Vermächtnis ist die Zerstörung.
Das Patriarchat am Höhepunkt
Es gibt außer Homo sapiens keine Lebensform auf dieser Welt, die mehr Ressourcen für sich beansprucht, als sie zum Überleben braucht. Es gibt auch keine Lebensform, die sich unbegrenztes Wachstum als oberstes Ziel gesteckt hat. Um für unsere Spezies überhaupt eine taugliche Analogie zu finden, muss man schon Krebszellen oder Parasiten heranziehen.
Kurz vor der letzten Jahrtausendwende sah es noch so aus, als sei der Mensch lernfähig: Wir haben die Demokratie in die Welt gebracht, das Frauenwahlrecht, wir haben für ein halbes Jahrzehnt den Krieg aus Europa rausgehalten, den sauren Regen besiegt und das Ozonloch gestopft. Aber allerspätestens seit der Covid-19-Pandemie und der Klimakrise zeigt sich, dass es nicht mehr reicht, an den kleinen Schrauben zu drehen: Es gilt, an den großen Hebeln anzusetzen.
Der zeitnahe, globale Zusammenschluss, den es bräuchte, um die Erde vor einem unausweichlichen Kollaps zu retten, ist derzeit dennoch außer Reichweite. Dazu fehlt die kollektive Umsichtigkeit oder Besonnenheit der regierenden Eliten; dazu ist die ökonomische Macht auf viel zu wenige Personen und Institutionen konzentriert. Aber auch die Zivilbevölkerung ist nicht unbedingt hilfreich. Die große Chance, via Internet und soziale Medien global zu kommunizieren und letztendlich aus schierem Überlebenswillen solidarisch zu handeln, ist vertan; anstatt Probleme zu lösen, werden Katzenvideos, Hassnachrichten und Verschwörungsmythen ausgetauscht. Nicht einmal in den akademischen Denkfabriken, in den Feuilletons und auf den Podien wird der Ernst der Lage in ausreichendem Maße erkannt.
Zu allem ökologischen Übel kommt auch noch die Demontage unserer Demokratien: Immer mehr superreiche, verhaltensauffällige, strafrechtlich verurteilte und religiöse Fanatiker sitzen in demokratisch gewählten Regierungen. Für die Gleichberechtigung von Frauen und anderen schlechter gestellten oder marginalisierten Gruppierungen ist das eine fatale Nachricht; genauso wie für Länder des Globalen Südens, die auf faire Beziehungen zu den Industrienationen gehofft haben.
Wer noch glaubte, das Patriarchat sei ein Auslaufmodell, wurde zu Beginn des Jahres 2025 eines Besseren belehrt. Die (erneute) Amtseinführung von Donald Trump war der rituelle Auftakt zu einem Zeitalter, in dem wieder alles erlaubt ist, was die aufgeklärte Welt doch hinter sich lassen wollte: Petromaskulinismus, Protzerei, Imperialismus, Frauenverachtung, Rassismus, Umweltzerstörung, Queerfeindlichkeit, Ungerechtigkeit. Darauf einen Hitler-Gruß!
Wo ist die bedachte, nachhaltige Politik, die ausgleichend wirkt? Wo ist die revolutionäre Kraft der Friedensbewegung, der Ökobewegung und der Bürgerrechtsbewegung des 20. Jahrhunderts hin, wo ist der effektive Widerspruch von feministischer Seite, das Aufbegehren der Linken und der Frauen?
Ganz besonders der feministische Aktivismus, in den noch in den 1970ern große Hoffnungen gesetzt wurden, fällt durch kannibalistische Tendenzen auf. Während ganz basale Frauenrechte auch in den westlichen Staaten in Gefahr sind und die Gleichberechtigung global rückläufig ist, zerfällt die Frauenrechtsbewegung in mehr oder weniger radikale, einander auslöschende Gegenströmungen, die mit dem Erstellen und Dekonstruieren theoretischer Ansätze beschäftigt sind. Praktische, globale Lösungsansätze fallen kurzlebigen, regionalen Erregungstrends zum Opfer. Ökofeministische Visionen werden, wenn überhaupt, in diffamierender Absicht besprochen, obwohl sie das Zeug dazu haben, an den richtig großen Hebeln anzusetzen: Geschlechtergerechtigkeit, nachhaltige Energie- und Landwirtschaft, alternative Ökonomie, Friedensbestrebungen. Auf die Kulturen und Gemeinschaften, deren alternative, indigene Lebens- und Konsummodelle wie Matriarchate oder Subsistenzwirtschaft die scheinbaren Naturgesetze Patriarchat und Kapitalismus außer Kraft setzen, wird bestenfalls herabgesehen, meist aber wird über sie geschwiegen. Warum setzen sich all die guten gesellschafts- und klimapolitischen Ideen und Maßnahmen, die bereits im Kleinen greifen, nicht großräumiger durch? Warum wissen wir so wenig über Alternativen zum Patriarchat?
Dass eine Abkehr von Patriarchat und Kapitalismus im kollektiven Denken praktisch unmöglich scheint, ist schlimm genug; der Zivilbevölkerung, die mit der Bewältigung des Alltags mehr als beschäftigt ist, kann man es kaum vorwerfen. Warum aber können (oder wollen) nicht einmal die schlausten Köpfe, jene Menschen, die fürs Nachdenken bezahlt werden, außerhalb des patriarchalen Wendekreises denken? Warum entstammen so gut wie alle Lösungsmodelle für unsere kaputte Welt den eurozentrischen Denkschulen, die Probleme mit den immergleichen Werkzeugen zu greifen versuchen: Geld, Macht, Technologie, Hierarchie? Haben wir wirklich nichts Besseres zur Hand? Wer ist eigentlich wir?
In den letzten Jahren habe ich mich mit patriarchaler Wissenschaftskritik und mit ökofeministischen Projekten und Wegen aus der globalen Krise befasst – und ich bin auf Matriarchate gestoßen. Es gab sie und es gibt sie. Sie sind eine Alternative zum Patriarchat, sie sind ein möglicher Schlüssel zu vielen scheinbar unlösbaren Problemen unserer Zeit. Und doch werden sie so gut wie nie erwähnt – und wenn, dann von Frauen. Wie die gesamte Patriarchatskritik offenbar ausschließlich Frauen obliegt – vor allem solchen, die wissenschaftlich und intellektuell an den Rand gedrängt werden. Muss das so sein? Warum ist Patriarchatskritik nicht längst ein Thema, das auch männliche Intellektuelle umtreibt? Warum schließt der intellektuelle Diskurs so konsequent Problemlösungen aus, die bereits gelebt werden? Steht hier das biologische und soziale männliche Ego im Weg, ist es wirklich so simpel? Wann verurteilen Feuilletons, Universitäten und eine Politik, die sich als links denkend einordnet, endlich geschlossen und konsequent das Patriarchat, so wie es schon mit Rassismus, Sklaverei und Kolonialismus gelungen ist? Wann bitte sprechen wir endlich offen über gelebte Alternativen – über Matriarchate?
Der hilflose Feminismus
Matriarchate sind bestenfalls als Mythen bekannt. Nicht einmal Feministinnen beschäftigen sich ernsthaft mit ihnen. Warum ist das so? Warum verliert sich der Feminismus in theoretischen Silbenstickereien, anstatt postpatriarchale Strukturen auszuhecken, die auch alltagstauglich sind – kollektiv, für alle Frauen und alle Klassen? Warum wird eine global wirksame Gesellschaftsform wie ein Matriarchat nicht in Podiumsdiskussionen rauf und runter diskutiert – wenn schon nicht von den »großen Denkern«, dann wenigstens von Feministinnen?
Die erste und zweite Welle der Frauenbewegung haben dafür gesorgt, dass wir wählen dürfen, dass wir gesetzlich gleichgestellt sind. Es war eine »friedliche« Revolution, deren Opfer nicht in einem bewaffneten Krieg gefallen sind, sondern mitten im Leben – zivil- und strafrechtlich legitimiert – eingesperrt, gefoltert, getötet, gedemütigt und entmündigt wurden. Es kann nicht oft genug betont werden, dass diese Revolution, solange sie immer noch Opfer kostet und solange ihre Errungenschaften sehr schnell wieder rückgängig gemacht werden können, dass diese Revolution immer noch in ihren Anfängen steckt. Solange die Kolonialisierung des weiblichen Körpers weltweit perpetuiert, legitimiert und von einer Generation zur nächsten getragen wird, ist sie nicht überwunden. In manchen Ländern äußert sich die Benachteiligung von Frauen in Form ungleicher Bezahlung, geschlechtsspezifischer Gewalt oder Unterrepräsentation auf der Führungsebene; in anderen wird de facto ein Krieg gegen Frauen geführt, in dem die Waffen Entmündigung, Vergewaltigung, Vorenthaltung von Bildung, genitale Verstümmelung, reproduktive Ausbeutung und Hunger zum Einsatz kommen – nicht selten unter eifriger Mitarbeit der Religionen.
Natürlich war die Frauenpolitik erfolgreich, hier in Europa und in den Industrieländern, wo Frauen Männern rechtlich gleichgestellt sind und weitgehende Autonomie über ihren Körper haben. Und doch bleiben uns ein paar Knackpunkte erhalten: Macht und Geld akkumuliert bei Männern und die Fürsorgearbeit bleibt den Frauen. Das Dorf, das es braucht, um Kinder großzuziehen, können wir uns zwar stückweise dazukaufen, doch am Ende machen Frauen einen Großteil der unbezahlten Arbeit »freiwillig«. Auch noch hundert Jahre nach der Erlangung des Frauenwahlrechts werden Kinder nun mal krank und Eltern alt. Die Frauenpolitik kann immer noch recht wenig gegen kulturell eingefleischte, misogyne Positionen ausrichten: Sei es nun der ganz normale Alltagssexismus, sexualisierte Gewalt oder die Tatsache, dass alle monotheistischen Götter Männer sind – anhand der antifeministischen, auch antidemokratischen Backlashes in den wohlhabenden Industrienationen ist gut ersichtlich, dass die feministische Bewegung am Kapitalismus und am technologischen Zeitalter anbrandet. Die dritte Welle des Feminismus hatte schon nicht mehr jenen bahnbrechenden Charakter, den die ersten beiden Wellen hatten, und von einer vierten Welle ist weit und breit nichts zu sehen.