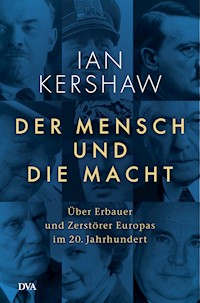18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Kershaws große Geschichte Europas im 20. Jahrhundert geht weiter
In seinem Bestseller »Höllensturz« hat Ian Kershaw meisterhaft die dramatische Geschichte Europas in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erzählt. In seinem neuen Buch »Achterbahn« nimmt der renommierte Historiker nun die Jahre von 1950 bis heute in den Blick und spannt einen großen Bogen von der existentiellen Unsicherheit, die die Staaten Europas im Kalten Krieg durchlebten, bis zu den Herausforderungen, vor denen sie heute, in Zeiten ökonomischer und politischer Krisen stehen. Trotz einer bis heute andauernden Phase des Friedens, so Kershaw, sind die Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs für Europa eine Achterbahnfahrt – voller Aufs und Abs, voller Nervenkitzel und Ängste. Und mit ungewissem Ausgang.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1119
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Ian Kershaw
ACHTERBAHN
Europa 1950 bis heute
Aus dem Englischen von Klaus-Dieter Schmidt
Deutsche Verlags-Anstalt
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel Roller-Coaster. Europe, 1950–2017 bei Allen Lane, einem Imprint von Penguin Books, London. Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2018 Ian Kershaw Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2019Deutsche Verlags-Anstalt, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München Covermotiv: © Andreas Herzau/laif Lektorat: Jonas Wegerer, Freiburg Karten: Peter Palm, Berlin Typografie: DVA/Andrea Mogwitz ISBN 978-3-641-18873-3V007www.dva.de
Zum Buch
In seinem preisgekrönten Bestseller Höllensturz hat Ian Kershaw meisterhaft die dramatische Geschichte Europas in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erzählt. Nun nimmt der renommierte Historiker die Jahre von 1950 bis heute in den Blick und spannt einen großen Bogen von der existentiellen Unsicherheit, die die Staaten Europas im Kalten Krieg durchlebten, bis zu den Herausforderungen, vor denen sie heute, in Zeiten vielfacher ökonomischer und politischer Krisen stehen. Trotz einer bis heute andauernden Phase des Friedens, so Kershaw, sind die Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs für Europa eine Achterbahnfahrt – voller Aufs und Abs, voller Nervenkitzel und Ängste. Und mit ungewissem Ausgang.
Zum Autor
Ian Kershaw, geboren 1943, zählt zu den bedeutendsten Historikern der Gegenwart. Bis zu seiner Emeritierung war er Professor für Modern History an der University of Sheffield, seine große zweibändige Biographie Adolf Hitlers gilt als Meisterwerk der modernen Geschichtsschreibung. Bei DVA sind außerdem von ihm erschienen Hitlers Freunde in England (2005), Wendepunkte. Schlüsselentscheidungen im Zweiten Weltkrieg (2010) und Das Ende (2013). Der erste Teil seiner großen Geschichte Europas im 20. Jahrhundert, Höllensturz (2016), ist ein hochgelobter und preisgekrönter Bestseller.
INHALT
VORWORT
EINFÜHRUNG
Europas zwei Epochen der Unsicherheit
EINS
Spannung und Spaltung
ZWEI
Die Herausbildung Westeuropas
DREI
Der Schraubstock
VIER
Gute Zeiten
FÜNF
Kultur nach der Katastrophe
SECHS
Herausforderungen
SIEBEN
Umbrüche
ACHT
Ostwind der Veränderung
NEUN
Die Macht des Volkes
ZEHN
Neuanfänge
ELF
Globale Herausforderungen
ZWÖLF
Krisenjahre
AUSBLICK
Eine neue Ära der Unsicherheit
DANK
KARTEN
Europa 1950
Europa 2018
Die Europäische Union 2018
AUSGEWÄHLTE BIBLIOGRAPHIE
SACH- UND PERSONENREGISTER
BILDTEIL
Impressum
VORWORT
Im Vorwort von Höllensturz schrieb ich, es sei das schwierigste Buch, an das ich mich jemals herangewagt hätte. Doch das war, bevor ich mich an Achterbahn setzte. Dieser zweite Band über die Geschichte Europas von 1914 bis in unsere Zeit stellte mich in Bezug auf Interpretation und Darstellung vor noch größere Probleme. Zum nicht geringen Teil lag dies daran, dass die europäische Geschichte zwischen 1950 und heute kein herausragendes übergreifendes Thema besitzt, das mit der offensichtlich zentralen Rolle der Weltkriege, die im Mittelpunkt des Vorgängerbands über die Zeit von 1914 bis 1949 standen, vergleichbar wäre. In Höllensturz folgte ich einem linearen Verlauf: in einen Krieg hinein und aus ihm heraus und dann noch einmal in einen Krieg hinein und aus ihm heraus. In der europäischen Geschichte seit 1950 lässt sich keine ähnlich geradlinige Entwicklung ausmachen, die ihre Komplexität angemessen beschreiben würde. Sie war voller Wendungen und Windungen, Auf und Abs und willkürlicher Wechselfälle, die einander zudem mit großem und immer rasanter werdendem Tempo ablösten. Die Geschichte Europas seit 1950 war eine Achterbahnfahrt, mit den damit verbundenen Nervenkitzel und Ängsten. In diesem Buch versuche ich zu zeigen, wie Europa in diesen Jahrzehnten von einer Epoche großer Unsicherheit in eine andere schlingerte.
Die Achterbahnmetapher hat ihre Grenzen. Immerhin fährt eine Achterbahn, trotz aller Anspannung und Erregung, auf einem festen Schienenstrang eine feststehende Runde zu einem bekannten Endpunkt. Vielleicht erscheint die Assoziation zu Vergnügungsparks auch zu trivial und oberflächlich für die Ernsthaftigkeit, Schwere und häufig sogar Tragik der europäischen Geschichte seit dem Zweiten Weltkrieg. Aber sie erfasst die Wechselhaftigkeit, die atemberaubenden Augenblicke und das Gefühl, von unbeherrschbaren Kräften mitgerissen zu werden, die, wenn auch auf unterschiedliche Weise, praktisch alle Europäer in diesen Jahrzehnten erlebt haben.
Die Komplexität der Geschichte Europas in dieser Zeit stellt ein erhebliches Problem für die »Architektur« dieses Buchs dar. Hinzu kommt die über vierzig Jahre währende Teilung Europas durch den Eisernen Vorhang. In diesen Jahrzehnten existierte Europa allenfalls als Idee einer gemeinsamen kulturellen Identität (die freilich durch religiöse, nationale, ethnische und soziale Unterschiede fragmentiert war). Seine beiden Hälften – Ost- und Westeuropa – waren rein politische Konstrukte. Bis zum Sturz des Kommunismus zwischen 1989 und 1991 war die innere Entwicklung beider Teile des Kontinents derart unterschiedlich, dass man sie nicht auf kohärente Weise zusammenfügen kann. Auch danach unterschieden sich Ost- und Westeuropa erheblich, aber die Folgen der Globalisierung – die ein Hauptthema dieses Buchs bildet – ermöglichen es, sie nicht mehr getrennt, sondern zusammen zu behandeln.
Bei einem derart breit angelegten Werk wie diesem Buch muss man sich zwangsläufig stark auf die Forschungsarbeit und die Schriften anderer stützen, umso mehr, als ich nie speziell zu irgendeinem Aspekt dieser Periode geforscht habe. Sie durchlebt zu haben ist kein Ersatz dafür. Als ich dieses Buch zu schreiben begann, hat jemand angemerkt, es müsste mir doch leichtfallen, da die Periode mit meiner Lebenszeit zusammenfalle. Aber wer eine Geschichtsperiode durchlebt, sammelt Erinnerungen, die nicht nur hilfreich, sondern auch ungenau sein können und den Blick möglicherweise verzerren. An einigen wenigen Stellen habe ich in Anmerkungen persönliche Erinnerungen erwähnt, aus dem Haupttext aber herausgehalten. Meiner Ansicht nach sollte man persönliche Anekdoten und historische Einschätzungen voneinander trennen. Abgesehen von der Unzuverlässigkeit des Gedächtnisses, sind die meisten Alltäglichkeiten flüchtig in ihrem Nachhall. Um die Bedeutung großer Ereignisse beurteilen zu können, bedarf es in der Regel nicht nur eingehender Kenntnisse, sondern auch einer gewissen Zeit, die man benötigt, um sie zu verarbeiten.
Deshalb sind die wissenschaftlichen Arbeiten anderer unverzichtbar, darunter eine Vielzahl von Studien über spezielle Themen und Aufsätzen in akademischen Zeitschriften. Im Vorwort zu Höllensturz habe ich eine Reihe ausgezeichneter allgemeiner Darstellungen der europäischen Geschichten des 20. Jahrhunderts erwähnt, zu der jetzt Konrad Jarauschs Buch Out of Ashes hinzugefügt werden muss. Speziell in Bezug auf die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts ist Tony Judts Die Geschichte Europas seit dem Zweiten Weltkrieg das herausragende Werk. Timothy Garton Ashs Bücher, die erstklassigen Journalismus mit zeithistorischem Scharfblick verbinden, waren insbesondere in Bezug auf Mitteleuropa von unschätzbarem Wert. Auch eine ganze Reihe von Werken deutscher Historiker, wie Heinrich August Winkler, Andreas Wirsching, Hartmut Kaelble, Andreas Rödder und Philipp Ther, war äußerst hilfreich. Sie alle sind, neben anderen Schriften, die sich als besonders nützlich erwiesen haben, in der Auswahlbibliographie aufgeführt. Sie bilden indes nur die Spitze eines riesigen Eisbergs. Wie im Vorgängerband gibt es, entsprechend dem Format der Reihe Penguin History of Europe, keine Anmerkungen. Ebenfalls wie im ersten Band habe ich Schriften, denen ich Zitate entnommen habe, in der Bibliographie mit einem Sternchen gekennzeichnet.
Meine Herangehensweise bleibt diejenige von Höllensturz. Wie dort habe ich mich bemüht, dem Drama und häufig der Ungewissheit der sich entfaltenden Geschichte zu folgen, wobei ich gelegentlich zeitgenössische Ansichten über die Ereignisse eingestreut habe. Deshalb habe ich das Buch chronologisch aufgebaut, mit Kapiteln über relativ kurze Zeiträume, die ihrerseits in thematische Abschnitte unterteilt sind. In der kurzen Einführung werden die Grundzüge der Interpretation erläutert. Die ersten drei Kapitel behandeln die Unsicherheit der Nachkriegszeit, von den Spannungen des Kalten Krieges und dem Aufbau der beiden einander gegenüberstehenden Blöcke von Ost- und Westeuropa bis zur Mitte der 1960er Jahre. Gegenstand der Kapitel vier und fünf sind der erstaunliche und lang anhaltende Nachkriegsboom und seine sozialen Auswirkungen sowie die Gabelung der Kultur – zwischen dem traurigen Erbe der jüngsten Vergangenheit auf der einen Seite und der bewussten Beschwörung einer neuen, modernen und erregenden Atmosphäre auf der anderen. Wie dies in den jugendlichen Protest in den späten 1960er Jahren und den Wandel der sozialen und kulturellen Werte, der von der Studentenbewegung geblieben ist, überging, behandelt das sechste Kapitel. Das siebente Kapitel beschäftigt sich mit einem Schlüsseljahrzehnt: mit den tiefgreifenden Veränderungen in den 1970er und frühen 1980er Jahren. Obwohl die Probleme östlich des Eisernen Vorhangs in den 1980er Jahren generell auf für die Führer der kommunistischen Staaten bedrohliche Weise anwuchsen, wird im achten Kapitel insbesondere die Rolle von Michail Gorbatschow beleuchtet, der die Sowjetherrschaft unabsichtlich, aber auf fatale Weise untergrub. Im neunten Kapitel wird untersucht, welche Rolle der Druck von unten in der »samtenen Revolution« von 1989 bis 1991 spielte. Wie schwierig und häufig enttäuschend der Übergang zu pluralistischer Demokratie und kapitalistischer Wirtschaft für die Länder Osteuropas war, ist neben dem katastrophalen Absturz Jugoslawiens in den Bürgerkrieg Thema des zehnten Kapitels. Im elften Kapitel werden die Veränderungen in Europa nach den Terroranschlägen von 2001 in den Vereinigten Staaten und den anschließenden Kriegen in Afghanistan und im Irak dargestellt. Das zwölfte Kapitel schließlich ist der Verkettung von Krisen gewidmet, die Europa seit 2008 heimgesucht haben und zusammen eine schwere allgemeine Krise des Kontinents bilden. Im abschließenden Ausblick wende ich mich dann von der Vergangenheit ab und der Zukunft zu, sowohl den kurzfristigen Aussichten als auch den längerfristigen Problemen, denen Europa in einer neuen Epoche der Unsicherheit gegenüberstehen wird.
Höllensturz endete versöhnlich. Als Europa zwischen 1945 und 1949 aus der Doppelkatastrophe zweier Weltkriege hervortrat, zeigten die Wegweiser unübersehbar in eine hellere Zukunft – wenn auch im Schatten des Atombombenbesitzes beider Weltmächte. Achterbahn endet, zumindest hinsichtlich der längerfristigen Zukunft des Kontinents, weniger eindeutig.
Die Dinge können sich rasch ändern. Dies gilt auch für die Geschichtsschreibung. Eric Hobsbawm blickte in den frühen 1990er Jahren bedrückt auf die langfristigen Krisen, von denen Europa wahrscheinlich erschüttert werden würde, und hob in seiner pessimistischen Schlussfolgerung die destruktiven Kräfte des Kapitalismus hervor. Die meisten Analytiker sahen die jüngste Geschichte Europas jedoch positiver. Eine ganze Reihe um die Jahrtausendwende verfasster Studien über das europäische 20. Jahrhundert schlug einen optimistischen Ton an. Mark Mazower erschienen die Aussichten am Ende des 20. Jahrhunderts »konfliktfreier als je zuvor«. Richard Vinen sprach von einer »Ära des gesunden Geldes«. Harold James konstatierte einen »fast vollständigen Sieg von Demokratie und Kapitalismus« (auch wenn er einschränkend auf den zunehmenden Unmut über diese Entwicklung hinwies) und betrachtete die Globalisierung in nahezu ungetrübter Weise als »Wiederaufstieg einer internationalen Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft«. Angesichts mancher Entwicklung im frühen 21. Jahrhundert sind Zweifel an solch positiven Einschätzungen angebracht.
Auch Tony Judts fünf Jahre nach der Jahrtausendwende fertiggestelltes Standardwerk endet im großen Ganzen optimistisch. Der Nationalismus sei in Europa »gekommen und gegangen«, konstatiert er, und die letzten Worte seines Buchs lauten: »[D]as 21. Jahrhundert könnte das Jahrhundert Europas werden.« Bedenkt man das seit 2008 in Europa herrschende Durcheinander, den Aufstieg nationalistischer, fremdenfeindlicher Parteien in vielen Ländern, die langfristigen Herausforderungen, vor denen der Kontinent steht, und den offenbar unaufhaltsamen Aufstieg Chinas zur Weltmacht und zu globalem Einfluss, erscheinen solche Annahmen indes höchst zweifelhaft.
Kurzfristige Veränderungen sind natürlich schwer vorauszusagen. Europa – das weiterhin Achterbahn fährt – kann in rascher Folge aufsteigen und abstürzen. Gegenwärtig (im Herbst 2017) sind die Aussichten besser als noch vor wenigen Monaten, obwohl die Kristallkugel trüb bleibt. Langfristige Entwicklungen sind eine andere Sache. In dieser Hinsicht sind die Probleme, vor denen Europa (und die übrige Welt) steht, gewaltig. Klimawandel, Demographie, Energieversorgung, Massenmigration, Spannungen des Multikulturalismus, Automatisierung, die größer werdende Einkommenskluft, die internationale Sicherheit und die Gefahr weltweiter Konflikte: All dies sind große Herausforderungen für die nächsten Jahrzehnte. Wie gut Europa für die Bewältigung dieser Probleme gewappnet ist, lässt sich kaum sagen. Wie es auf die Herausforderungen reagieren und die Zukunft des Kontinents gestalten wird, liegt nicht nur, aber doch zu einem guten Teil in den Händen der Europäer selbst. In gefährlichen Gewässern bleibt der Konvoi am besten zusammen und vermeidet es, auseinanderzudriften. Dies bedeutet, ungeachtet aller Mängel auf dem Maß an Einheit, Kooperation und Konsens aufzubauen, das seit dem Zweiten Weltkrieg nach und nach geschaffen worden ist, und es weiter zu stärken. Durch gutes Navigieren könnten alle die vor uns liegende gefährliche Meerenge unbeschadet passieren und sicherere Küsten erreichen.
Die Geschichte meiner eigenen Zeit zu schreiben war eine überaus schwierige Aufgabe, aber auch eine, die sich für mich als lohnend erwies. Ich habe unermesslich viel dazugelernt über Ereignisse und Entwicklungen, die mein Leben bestimmt haben. Am Ende konnte ich besser als vorher nachvollziehen, wie mein eigener Kontinent zu dem wurde, was er heute ist. Allein schon deshalb hat sich die Anstrengung für mich gelohnt. Was die Zukunft angeht: In dieser Hinsicht sind die Voraussagen eines Historikers nicht besser als diejenigen aller anderen.
Ian Kershaw, Manchester, November 2017
EINFÜHRUNG
EUROPAS ZWEI EPOCHEN DER UNSICHERHEIT
Es ist mit der Geschichte wie mit der Natur, wie mit allem Profunden, es sei vergangen, gegenwärtig oder zukünftig: Je tiefer man ernstlich eindringt, desto schwierigere Probleme tun sich hervor.
Johann Wolfgang von Goethe, Maximen und Reflexionen
1950 erwachte Europa aus dem Alptraum der dunklen Jahre des schrecklichsten Krieges der Geschichte. Die physischen Narben waren überall auf dem Kontinent in Gestalt der Ruinen zerbombter Gebäude zu sehen. Die psychischen und moralischen Narben zu heilen sollte jedoch wesentlich länger dauern als der Wiederaufbau von Städten und Gemeinden. Tatsächlich warf die Unmenschlichkeit der jüngsten Vergangenheit noch jahrzehntelang einen dunklen Schatten auf Europa. Seit Kriegsende waren bedeutende Schritte in Richtung eines neuen Europa gemacht worden. Doch die gravierendste Hinterlassenschaft des Krieges für die unmittelbare Nachkriegszeit waren zwei Phänomene: Europa war jetzt durch den Eisernen Vorhang in der Mitte gespalten, und ein neues Zeitalter hatte begonnen, eine nukleare Ära zweier Supermächte, die beide über atomare Massenvernichtungswaffen verfügten.
Europa befand sich nicht mehr im Krieg. Aber die Gefahr eines Atomkriegs, der keineswegs nur eine ferne Möglichkeit zu sein schien, bedrohte die Grundlagen der Überlebensfähigkeit der europäischen Zivilisation. Zudem war die Atomkriegsgefahr, die wie ein Damoklesschwert über Europa hing, nicht allein von Ereignissen auf dem Kontinent selbst abhängig. Denn dieser war den Folgen der globalen Konfrontation zwischen den nuklear aufgerüsteten Supermächten ausgesetzt. Anfang und Ende der für Europa gefährlichsten Phase des Kalten Krieges – auch wenn die Gefahr Anfang der 1980er Jahre noch einmal für kurze Zeit zunehmen sollte – markierten Ereignisse in weit entfernten Weltgegenden: der Ausbruch des Koreakriegs im Jahr 1950 und die Kubakrise von 1962.
Die Kinder des »Babybooms« der Nachkriegszeit, die in diese neue Ära hineingeboren wurden, sollten Veränderungen erleben, die sich ihre Eltern nicht einmal hätten vorstellen können. Außerdem sollten sie eine Beschleunigung des Wandels erleben – in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur –, die alles übertraf, was man aus früheren Friedenszeiten kannte. Sie wurden in eine Zeit schmerzlicher Entbehrungen hineingeboren, die zum großen Teil eine direkte Folge des Kriegs waren. Die Wohnsituation war häufig durch Notbehelfe geprägt, während Wohnungsbauprogramme anliefen, um den Millionen von Vertriebenen und Ausgebombten in weiten Teilen des Kontinents, insbesondere in Mittel- und Osteuropa, ein Heim zu geben. Selbst Häuser, die nach dem Krieg noch standen, befanden sich oft in stark reparaturbedürftigem Zustand. Die sanitären Zustände waren für den Großteil der Bevölkerung primitiv, Lebensmittel und Kleidung waren knapp. Nur reiche Familien verfügten über Haushaltsgeräte, die Frauen von der täglichen Plackerei im Haushalt entlasteten, wie beispielsweise eine Waschmaschine, ein Telefon, ein Kühlschrank oder Auto. Einen Fernseher dürften die wenigsten besessen haben.
Die Babyboomgeneration profitierte im Lauf des Lebens von erstaunlichen medizinischen Fortschritten. Ihr kamen der durch ein hohes Wirtschaftswachstum ermöglichte Aufbau des Sozialstaats und seine ständige Ausweitung zugute. Obwohl der Lebensstandard östlich des Eisernen Vorhangs bald deutlich hinter demjenigen in Westeuropa zurückblieb, gehörten weitreichende Wohlfahrtssysteme auch zu den kommunistischen Systemen (auch wenn sie in der Praxis für gewöhnlich korrupt waren). Dies war der erste entscheidende Durchbruch: Ein Maß an sozialer Sicherheit wurde erreicht, wie es frühere Generationen in beiden Hälften Europas nicht gekannt hatten. Zumindest in Westeuropa lenkten der lang anhaltende Nachkriegsboom, die von ihm ermöglichten sozialen Fortschritte und das Aufblühen des Konsumismus von der generellen Unsicherheit eines Kontinents ab, der sich ständig im Schatten der Atomkriegsgefahr befand.
Der materielle Fortschritt seit jener Zeit ist atemberaubend. Das Überangebot an Lebensmitteln, das heute in jedem europäischen Land herrscht, wäre 1950 oder zu jedem Zeitpunkt davor auf blankes Unverständnis gestoßen. Heutige Familien wären entsetzt, wenn man ihnen eine Wohnung ohne Badezimmer und mit einer (häufig mit anderen Familien gemeinsam genutzten) Toilette im Hof oder Treppenhaus anbieten würde. Annehmlichkeiten, die einst einen Luxus darstellten, dessen sich nur eine winzige Minderheit erfreuen konnte, sind heute alltäglich. Die meisten Familien besitzen ein Auto; auch Haushalte mit zwei Autos sind nichts Ungewöhnliches. Das Vorhandensein eines Kühlschranks wird als selbstverständlich betrachtet. Auslandsreisen, die in den 1950er Jahren ein Privileg der Reichen waren, sind heute für Millionen erschwinglich. Fast jeder Haushalt besitzt einen Fernseher. Satelliten im Weltraum ermöglichen es, Fernsehnachrichten oder Sportveranstaltungen von der anderen Seite der Erde live zu verfolgen. Heute kann man auf mobilen Geräten Fernsehen schauen, auch das war vor noch nicht allzu langer Zeit geradezu unvorstellbar. Und während man früher bei Auslandsreisen eine Telefonzelle brauchte, um zu Hause anzurufen, dienen mobile Telefone heute nicht nur dazu, mühelos solche Gespräche zu führen oder Textnachrichten rund um die Welt zu verschicken, sondern bieten als handliche Minicomputer auch eine Vielzahl weiterer Nutzungsmöglichkeiten. Dazu gehören der ständige Zugang zu den neuesten Nachrichten und die Möglichkeit, mit Verwandten und Freunden, die Tausende von Kilometern entfernt leben, nicht nur zu sprechen, sondern sie auch auf dem Display zu sehen. Immer kleinere und leichter verfügbare Computer haben das Leben in einer Weise verändert, wie es noch vor kurzer Zeit – von 1950 ganz zu schweigen – undenkbar war.
Nicht nur der materielle Besitz, auch Einstellungen und Mentalitäten haben sich erheblich geändert. Im Europa von 1950 vertraten die meisten Menschen Ansichten, die siebzig Jahre später als unhaltbar gelten. Zwar hatten die Vereinten Nationen im Dezember 1948 in Reaktion auf ihre Verletzung während des Zweiten Weltkriegs die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte beschlossen, aber die breite Öffentlichkeit hatte kaum eine Vorstellung davon, was dies in der Praxis bedeutete. Rassistische Ansichten und offen rassistische Diskriminierung wurden weithin akzeptiert und kaum als der Rede wert betrachtet. In Europa lebten nur wenige Menschen nichtweißer Hautfarbe. Die Todesstrafe war noch in Kraft und wurde bei schwersten Verbrechen auch vollstreckt. Homosexualität war kriminalisiert, Abtreibung verboten. Die christlichen Kirchen besaßen beträchtlichen Einfluss, und die Gottesdienste waren noch recht gut besucht. Als die Nachkriegskinder in die späte Phase ihres Lebens traten, waren die Menschenrechte eine Selbstverständlichkeit geworden (wie unvollkommen sie in der Praxis auch verwirklicht wurden), galten rassistische Ansichten als gesellschaftlich untragbar (wenn auch in Westeuropa mehr als in Ost- und Südeuropa), bildete die multikulturelle Gesellschaft die Norm, war die Todesstrafe in Europa abgeschafft, während gleichgeschlechtliche Ehen und Abtreibung weithin akzeptiert wurden. Und auch die Rolle der christlichen Kirchen war erheblich geschrumpft (während die Vielzahl von Moscheen, ein Merkmal heutiger europäischer Städte, das 1950 völlig unbekannt war, die Bedeutung der Religion bei Muslimen bezeugt).
Diese und viele andere Veränderungen können als Teil jener Entwicklung betrachtet werden, die man allgemein »Globalisierung« nennt. Sie umfasst nicht nur die ökonomische Integration aufgrund der freien Bewegung von Kapital, Technologie und Information, sondern auch die Verknüpfung von gesellschaftlichen und kulturellen Fortschrittsmustern über Ländergrenzen hinweg in der gesamten sich entwickelnden Welt. Globalisierung war weit mehr als nur eine zu immer besserer materieller Versorgung führende Entwicklung. Sie besaß offensichtliche dunkle Seiten. So hat sie massive Umweltschäden verursacht, die Kluft zwischen Arm und Reich vergrößert, die (weitgehend unkontrollierbare) Massenmigration verstärkt und den Arbeitsplatzabbau durch Automatisierung aufgrund technischer Fortschritte ausgeweitet – und sie bewirkt all dies weiterhin. Die von der Globalisierung vorangetriebene Transformation zieht sich wie ein roter Faden durch die Kapitel dieses Buchs, das alles andere als eine eindeutige Erfolgsgeschichte erzählt. Die neue Epoche der Unsicherheit in Europa ist unauflöslich mit der sich vertiefenden Globalisierung verbunden.
Dieses Buch beschäftigt sich mit den Wendungen und Windungen, den Auf und Abs, die Europa von einer Epoche der Unsicherheit in die nächste geführt haben – von der Atomkriegsgefahr zu dem vielschichtigen, alles durchdringenden Unsicherheitsgefühl der Gegenwart. Es versucht den komplexen, facettenreichen Veränderungsprozess zu erklären, der Europa zwischen 1950 und heute umgestaltet hat. Markiert wird er durch epochale Wendepunkte – 1973, 1989, 2001, 2008. Neben Fortschritten und Verbesserungen gab es Rückschläge, Enttäuschungen und gelegentlich Ernüchterung.
Ein Strang der Transformation, der sich durch die vergangenen sieben Jahrzehnte seit 1950 zog, ist die zentrale Bedeutung Deutschlands. Dort, in dem Land, das in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mehr als alle anderen dafür getan hatte, den Kontinent zu zerstören, waren die Veränderungen besonders tiefgreifend. Obwohl Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg als Nationalstaat verschwunden war, stand es weiterhin im Mittelpunkt der europäischen Entwicklung. Es spielte eine zentrale Rolle bei der wirtschaftlichen Erholung nach dem Krieg, im Kalten Krieg, bei der Ausweitung der europäischen Integration, bei der Einführung des Euros, während der Krise der Eurozone, in der Migrationskrise und bei den noch in den Anfängen steckenden Reformen der Europäischen Union nach den jüngsten ernsten Belastungen. Deutschland ist mittlerweile zu einem unverzichtbaren Pfeiler der liberalen Demokratie geworden, es besitzt Europas stärkste Wirtschaft, hat nach vierzigjähriger Teilung die nationale Einheit wiedergewonnen und ist widerstrebend in die Rolle einer europäischen Führungsmacht geschlüpft. Die Umgestaltung Deutschlands war ein Schlüsselfaktor in der europäischen Nachkriegsgeschichte – und keineswegs der erfolgloseste.
Für die Transformation Europas gibt es keine einfache Erklärung. Zu eng waren politische, ökonomische und kulturelle Entwicklungen verknüpft, um die Triebkräfte der Veränderung sauber voneinander trennen zu können. Ein großer Teil der Umgestaltung ging auf den nicht auf Europa beschränkten tiefgreifenden gesellschaftlichen und ökonomischen Wandel zurück, der als Globalisierung bezeichnet wird. Der Wiederaufbau Europas nach dem Zweiten Weltkrieg fand vor dem Hintergrund eines über zwei Jahrzehnte anhaltenden beispiellosen Wirtschaftswachstums statt, das nicht nur Europa, sondern die ganze Welt erfasste. Das Ende dieses Wachstums in den 1970er Jahren markierte einen Wendepunkt, der die Entwicklung bis zum Ende des 20. Jahrhunderts bestimmte.
Die erstaunliche Erholung in der unmittelbaren Nachkriegszeit war geprägt von dem, was man eine »Matrix der Wiedergeburt« nennen könnte, wie sie bereits im letzten Abschnitt von Höllensturz beschrieben wird. Elemente dieser Matrix waren das Ende der deutschen Großmachtambitionen, die geopolitische Neuordnung Mittel- und Osteuropas, die Unterordnung nationaler Interessen unter diejenigen der beiden Supermächte, ein beispielloser Wirtschaftsaufschwung und die abschreckende Wirkung der Atomwaffen. Um 1970 besaßen alle diese Faktoren wesentlich weniger Gewicht als in den ersten Nachkriegsjahren. Am gravierendsten war jedoch die deutliche Verlangsamung des Wirtschaftswachstums. Der lange Boom war vorüber. Die ökonomische Nachkriegsordnung stand vor einem grundlegenden Wandel. Der Paradigmenwechsel markierte das, was im Rückblick als Geburt einer neuen Matrix gesehen werden kann, die sich in den folgenden beiden Jahrzehnten nach und nach herausbildete und schließlich als eine »Matrix neuer Unsicherheit« erkennbar wurde, deren Elemente eine liberalisierte, deregulierte Wirtschaft, die unaufhaltsame Globalisierung, eine dramatische Revolution der Informationstechnologie und nach 1990 die Entstehung einer multipolaren internationalen Machtverteilung waren. Die Entwicklung Europas wurde davon in vieler Hinsicht positiv beeinflusst, aber es wurde auch von einer neuen Unsicherheit erfasst, die sich stark von der existentiellen Unsicherheit aufgrund der Atomkriegsgefahr in den 1950er und frühen 1960er Jahren unterschied.
Nach dem Abbau des Eisernen Vorhangs beschleunigte sich die Globalisierung deutlich, was zu einem guten Teil auf die explosive technologische Entwicklung und die rasche Verbreitung des Internets zurückzuführen war, insbesondere, nachdem das (1989 erfundene) World Wide Web ab 1991 allgemein zugänglich wurde. Schon davor waren tiefgreifende kulturelle Veränderungen im Gange, in deren Mittelpunkt der Kampf für soziale Freiheiten, die Betonung des Individualismus und das Aufkommen der Identitätspolitik standen. Bereits seit Mitte der 1960er Jahre hatten sich Wertesysteme und Lebensstile auf eine Weise verändert, die Europa in vieler Hinsicht toleranter, liberaler und internationalistischer machte. Gleichzeitig lösten sich jedoch viele frühere Gewissheiten und Normen auf.
Neben dieser weitreichenden, unpersönlichen Dynamik müssen die Rolle einzelner Personen sowie kurzfristige politische Entscheidungen in die Betrachtung einbezogen werden. Das Handeln einiger weniger Schlüsselfiguren – wie Michail Gorbatschow und Helmut Kohl – kann nicht einfach auf Überlegungen über strukturelle Entwicklungsdeterminanten reduziert werden. An entscheidenden Weggabelungen spielten solche Persönlichkeiten eine ausschlaggebende Rolle bei der Umgestaltung Europas.
Die Bilanz der Umgestaltung Europas in den sieben Jahrzehnten seit 1950 wird in den nachfolgenden Kapiteln präsentiert. Es handelt sich um keine reine Erfolgsgeschichte. Die jüngste Geschichte Europas ist keineswegs rundum erfreulich. Es gab außerordentlich positive Entwicklungen, doch das Gesamtbild bleibt gemischt. Und die Probleme werden in Zukunft nicht abnehmen.
EINS
SPANNUNG UND SPALTUNG
… ist es wahrscheinlicher, dass [die Atombombe] großangelegten Kriegen ein Ende setzen wird, doch um den Preis, auf unabsehbare Zeit einen »Frieden, der keiner ist«, zu verlängern.
George Orwell, »Wir und die Atombombe«, 1945
Als 1950 die unmittelbare Nachkriegszeit zu Ende ging, war ein neues, ideologisch, politisch und sozioökonomisch zweigeteiltes Europa entstanden. Es war der Beginn einer neuartigen, von einer beispiellosen Unsicherheit charakterisierten Ära in der Geschichte des Kontinents. Wesentlich geprägt wurde sie von der Spaltung, die der Krieg als Hauptfolge hinterlassen hatte – und der ungeheuerlichen Gefahr der nuklearen Auslöschung.
Mehr als vier Jahrzehnte sollte der Kalte Krieg die beiden Teile Europas auseinandertreiben. Die überwiegend getrennten Entwicklungen besaßen jedoch eine bedeutende Gemeinsamkeit: das Primat der Militärmacht. Und die Militärmacht, das dominante Merkmal Nachkriegseuropas auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs, wurde nun von nur zwei Ländern kontrolliert: den Vereinigten Staaten von Amerika und der Sowjetunion. Beide Mächte waren besessen von Sicherheit, und beide wollten verhindern, dass die jeweils andere Macht Europa beherrschte. Das Neue ihrer angespannten Beziehungen bestand darin, dass sie letztlich auf Waffen von solcher Zerstörungskraft beruhten, dass keine der beiden Seiten sie einzusetzen wagte. Binnen weniger Jahre waren diese Waffen so weit entwickelt, dass sie die totale Vernichtung ermöglichten. Seit 1949 produzierten sowohl die Vereinigten Staaten als auch die Sowjetunion – Erstere war bereits eine Supermacht, Letztere stand kurz davor, eine zu werden – Atombomben. Vier Jahre später entwickelten beide Staaten die noch wesentlich stärkere Wasserstoffbombe, und bald darauf verfügten sie über Atomwaffenarsenale, mit denen das zivilisierte Leben auf dem Planeten mehrfach vernichtet werden konnte.
Zwischen 1950 und 1962 war der Kalte Krieg am intensivsten und gefährlichsten. Zentraler Schauplatz war in dieser Zeit zumeist Europa – aber im Atomzeitalter hatte auch eine Konfrontation zwischen den Supermächten irgendwo auf der Welt direkte Folgen für Europa.
Die Hitze des Kalten Krieges
Der sich in der unmittelbaren Nachkriegszeit herausbildende Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion war zwar gelegentlich bedrohlich gewesen, aber eine Katastrophe war vermieden worden. Kaum hatte das neue Jahrzehnt begonnen, brach jedoch eine Krise aus, die erneut ernste Konsequenzen zu haben drohte. Dass sie im fernen Korea stattfand, war ein Anzeichen dafür, dass Europa unweigerlich Teil des globalen Konflikts zwischen den Supermächten war. Während die Vereinigten Staaten sich vor 1945 nur widerstrebend in die europäischen Angelegenheiten hineinziehen ließen und zur Beteiligung an zwei Weltkriegen durchrangen, wurde Westeuropa jetzt im Grunde zu einem Anhängsel – wenn auch einem wichtigen – der amerikanischen Außenpolitik. Auf der anderen Seite war der Ostblock – abgesehen von Jugoslawien, das in den Nachwehen des Krieges erfolgreich seine Unabhängigkeit behauptet hatte – sogar noch direkter darauf festgelegt, die Sowjetunion in der weltweiten Konfrontation mit den Vereinigten Staaten zu unterstützen.
Korea war 1910 von Japan annektiert und bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs von ihm regiert worden. An dessen Ende war die koreanische Halbinsel durch ein amerikanisch-sowjetisches Abkommen über die vorübergehende Teilung der Verwaltung des Landes entlang dem 38. Breitengrad mehr oder weniger in zwei Hälften gespalten worden. Bis 1948 war jede Aussicht auf eine Wiedervereinigung Koreas geschwunden. Im Norden entstand ein kommunistischer Satellitenstaat von Moskaus Gnaden, den die Sowjetunion ihrer Einflusssphäre zurechnete, und im Süden wurde ein vehement antikommunistischer Staat gebildet, der amerikanischen Interessen untergeordnet war. Als in China im September 1949 nach einem zwei Jahrzehnte andauernden Bürgerkrieg mit Tschiang Kai-scheks Nationalisten – der 1937 bis 1945 parallel zu dem überaus blutigen Krieg mit den japanischen Invasoren geführt wurde – die Kommunisten gesiegt hatten, war die Lage auf der koreanischen Halbinsel prekär. Der Süden lag als nichtkommunistische Enklave inmitten einer riesigen kommunistisch beherrschten Region. Als nordkoreanische Truppen am 25. Juni 1950 die Demarkationslinie überschritten und den Süden des geteilten Landes angriffen, eskalierte die Konfrontation der Supermächte auf gefährliche Weise. Für die Vereinigten Staaten, die den kommunistischen Einfluss unbedingt eindämmen wollten und auf die Aussicht auf eine Ausdehnung des Kommunismus, ob nun in Südostasien oder Europa, allergisch reagierten, kam ein Verlust Südkoreas unter keinen Umständen in Frage, zumal dadurch Japan in Gefahr geraten wäre.
Washington nahm mit Recht an, dass Nordkorea ohne Stalins Zustimmung niemals angegriffen hätte. Tatsächlich hatte der sowjetische Diktator einige Wochen zuvor grünes Licht gegeben, auch wenn er nicht bereit war, Kampftruppen zu entsenden, und stattdessen von den Chinesen erwartete, wenn nötig, Militärhilfe zu leisten. Nach Ansicht der US-Regierung musste die kommunistische Expansion an diesem Punkt aufgehalten werden, wenn man einen Dominoeffekt verhindern wollte. Sollte Südkorea fallen, erklärte Präsident Harry Truman, würden die Sowjets »ein Stück Asien nach dem anderen schlucken«. Und »wenn wir Asien verlieren sollten, würde als Nächstes der Nahe Osten zusammenbrechen, und niemand kann sagen, was dann in Europa geschehen würde«. Nicht zum letzten Mal im Nachkriegseuropa wurde die Appeasementpolitik der 1930er Jahre beschworen, um ein militärisches Vorgehen zu rechtfertigen. Die Politik der Beschwichtigung hatte Hitler damals nicht gestoppt. Wenn die Ausbreitung des Kommunismus jetzt nicht aufgehalten wurde, würde das zu einem dritten Weltkrieg führen.
Die Vereinigten Staaten versicherten sich der Rückendeckung der 1945 gegründeten Vereinten Nationen für den Einsatz von militärischer Gewalt zum Schutz eines angegriffenen Mitgliedsstaats. Dies geschah zum ersten Mal, und es wurde durch einen strategischen Fehler Moskaus ermöglicht. Sowohl Stalin als auch die US-Regierung waren zufrieden damit, dass sie sich, als sie im Februar 1945 auf der Konferenz von Jalta die Gründung der Vereinten Nationen beschlossen, im geplanten Sicherheitsrat, dem außer ihnen Großbritannien, Frankreich und China als ständige Mitglieder angehören sollten, das Vetorecht vorbehalten hatten. Mit Hilfe eines von den Großmächten kontrollierten Sicherheitsrats würden die Vereinten Nationen effektiver handeln können als einst der Völkerbund. Wie falsch diese Annahme war, wurde während des Kalten Krieges ein ums andere Mal demonstriert, wenn das Veto der einen oder anderen Großmacht den Sicherheitsrat lahmlegte. Die Ausnahme bildete die Zustimmung zu jener Hilfsaktion, die nötig war, um den Angriff auf Südkorea zurückzuschlagen und Frieden und Sicherheit wiederherzustellen. Möglich wurde sie, weil die Sowjetunion den Sicherheitsrat aus Protest gegen die Weigerung, das kommunistische China als Mitglied anzuerkennen, boykottierte. Stalin erkannte seinen Fehler rasch, und die Sowjetunion nahm ihren Sitz im Sicherheitsrat wieder ein. Aber da war es schon zu spät, um ein UN-Kommando zur militärischen Unterstützung Südkoreas unter Führung der USA aufzuhalten. Bei Kriegsende bestand das UN-Kommando, einschließlich der südkoreanischen Streitkräfte, aus fast 933 000 Soldaten. Die große Mehrheit von ihnen stellten Südkorea (591 000) und die Vereinigten Staaten (302 000), aber auch eine Reihe europäischer Länder hatte sich beteiligt – Großbritannien sowie mit kleineren Kontingenten Frankreich, Belgien, Griechenland und die Niederlande.
Die Initiative lag während des gesamten Krieges bei den Amerikanern. Die Nordkoreaner wurden aus dem Süden zurückgedrängt und bis über die Demarkationslinie verfolgt. Aus Angst vor offenen Feindseligkeiten mit den Vereinigten Staaten lehnte Stalin die nordkoreanische Bitte um eine sowjetische Invasion ab. Der chinesische Führer Mao Zedong war jedoch nicht bereit, Korea ganz den Amerikanern zu überlassen, die es später womöglich als Ausgangsbasis für einen Angriff auf China nutzen würden – dessen Verhältnis zur Sowjetunion bereits alles andere als harmonisch war. Im Herbst 1950 hatte Mao eine beachtliche Truppe entsandt, die schließlich auf rund 300 000 Mann anwuchs und die 8. US-Armee zu einem panikartigen Rückzug zwang. Es war das erste Anzeichen dafür, dass der Westen mit China als bedeutender Militärmacht würde rechnen müssen. Binnen zweier Monate war ganz Nordkorea wieder in kommunistischer Hand, und die südkoreanische Hauptstadt Seoul war gefallen. Washington war entsetzt und erwog den Abwurf einer Atombombe.
Die Vereinigten Staaten besaßen, was die einsatzbereiten Atombomben angeht, immer noch ein riesiges Übergewicht gegenüber der Sowjetunion – laut Schätzungen ein Übergewicht von 74 zu 1. Aber welche Ziele sollte man bombardieren? In einem Krieg, der vorwiegend in ländlichen Gebieten ausgefochten wurde, war diese Frage schwer zu beantworten. Außerdem lag eine Eskalation des bislang regionalen Krieges durch eine massive Vergeltung – möglicherweise durch eine sowjetische Invasion Westeuropas oder sogar Atombombenabwürfe auf europäische Städte – im Bereich des Möglichen. Ende 1950 bestand die reale Gefahr der Ausweitung des Konflikts zu einem dritten Weltkrieg. Die amerikanische Militärführung hatte eine Liste russischer und chinesischer Städte aufgestellt, die als Bombenziele in Frage kamen, und dachte über die ultimative Forderung an China nach, sich hinter den Jalu, der die Grenze zwischen China und Korea bildete, zurückzuziehen. Wenn nötig, würde man auf den »prompten Einsatz der Atombombe« zurückgreifen.
Letztlich setzten sich klügere Ratgeber durch. Bis zum Frühjahr 1951 hatten die Amerikaner die chinesische Offensive unter großen Verlusten aufgehalten und die Initiative zurückgewonnen, die UN-Truppen konnten die kommunistische Armee schließlich zurückdrängen. In den nächsten beiden Jahren verstrickten sich beide Seiten in einen furchtbaren Abnutzungskrieg. Als der Koreakrieg im Juli 1953 durch einen Waffenstillstand beendet wurde, entsprach die Lage derjenigen an seinem Beginn: Beide Seiten standen sich am 38. Breitengrad gegenüber. Der erbittert geführte dreijährige Krieg hatte fast drei Millionen Gefallene und Verwundete gefordert – in ihrer großen Mehrheit Koreaner von beiden Seiten der Trennlinie. Die amerikanischen Verluste betrugen 170 000 Mann, darunter 50 000 Tote, die europäischen Kontingente hatten 8000 Tote und Verwundete zu beklagen, überwiegend Briten.
Obwohl der Koreakrieg weit entfernt stattfand und Europäer nur am Rande beteiligt waren, hatte er für Europa erhebliche Folgen, die aus dem drastischen Anstieg der amerikanischen Verteidigungsausgaben resultierten. Der erste Test einer sowjetischen Atombombe im August 1949 – vor dem Koreakrieg – auf dem Testgelände Semipalatinsk im heutigen Kasachstan hatte die Vereinigten Staaten bereits veranlasst, die Entwicklung der Nukleartechnik verstärkt voranzutreiben, um den Vorsprung vor der Sowjetunion zu behalten. Präsident Truman hatte nicht nur die beschleunigte Produktion von Atombomben, sondern am 31. Januar 1950 auch die Entwicklung einer »sogenannten Wasserstoff- oder Superbombe« angeordnet. Der Anstieg der Militärausgaben war bereits beschlossen, als der Koreakrieg sie zusätzlich in die Höhe schießen ließ. Binnen eines Jahres stieg der Verteidigungshaushalt der USA auf mehr als das Vierfache. 1952 verschlangen die Militärausgaben knapp ein Fünftel des amerikanischen Bruttoinlandsprodukts, nachdem dieser Anteil drei Jahre zuvor noch bei weniger als einem Zwanzigstel gelegen hatte. Am 1. November 1952 führten die Vereinigten Staaten den ersten Test ihrer »Superbombe« durch – die Wasserstoffbombe, deren Explosion »den ganzen Horizont verdunkelte«, löschte dabei die Insel Elugelab des Pazifikatolls Eniwetok, auf welcher der Test stattfand, vollständig aus. Nur neun Monate später, am 12. August 1953, folgte in der zentralasiatischen Wüste der erste sowjetische Wasserstoffbombentest. Winston Churchill erklärte später zutreffend, der »neue Schrecken« habe ein »gewisses Element der Gleichheit in die Vernichtung« gebracht.
Es überrascht nicht, dass die Amerikaner sich im Sinne einer Politik der globalen Eindämmung einer sowjetischen Bedrohung, die als rasch wachsende Gefahr empfunden wurde, verpflichtet fühlten, nicht nur ihre Militärausgaben zu erhöhen, sondern auch ihr überseeisches Engagement. Dies wirkte sich natürlich auf Europa aus. Die Amerikaner verstanden Hilfe für Europa immer mehr in militärischen Begriffen. Der Marshallplan, der 1947 eingeführt worden war, um mit einer Finanzspritze von rund 13 Milliarden Dollar die wirtschaftliche Erholung Europas nach dem Krieg anzuregen, wurde heruntergefahren. Dagegen belief sich die amerikanische Militärhilfe bis Ende 1951 auf fast fünf Milliarden Dollar. 1952, als die Aufrüstung aufgrund des Koreakriegs verstärkt wurde, waren fast 80 Prozent der Europa gewährten US-Hilfen nicht für den zivilen Wiederaufbau, sondern für militärische Zwecke bestimmt.
Im April 1949 war als Allianz zur Verteidigung Westeuropas die NATO (North Atlantic Treaty Organization) gegründet worden, der anfangs zwölf Länder angehörten – die Vereinigten Staaten, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Italien, Dänemark, Norwegen, die Niederlande, Belgien, Luxemburg, Portugal und Island –, zu denen 1952 Griechenland und die Türkei hinzukamen. Der US-Führung war jedoch von Anfang an klar, dass die militärische Stärke der NATO nicht ausreichte. Außerdem sollten die europäischen Länder mehr zu ihren eigenen Verteidigungskosten beitragen. Die Vereinigten Staaten, die sich als Weltpolizist zu verstehen begannen, konnten nicht auf Dauer einen unverhältnismäßig großen Teil der europäischen Verteidigungskosten tragen. Dementsprechend erhöhten die europäischen NATO-Partner ihre Militärbudgets. Westdeutschland, das zwar keine Waffen herstellen durfte, aber in immer größerer Zahl militärische Maschinen, Ausrüstungen und Fahrzeuge produzierte, profitierte erheblich von der gestiegenen Nachfrage nach Stahl. Seine Stahlproduktion erhöhte sich zwischen 1949 und 1953 um über 60 Prozent – was dem beginnenden »Wirtschaftswunder« einen zusätzlichen Schub verlieh. Die Ausgaben mussten in militärische Stärke umgesetzt werden. Deshalb einigten sich die NATO-Mitglieder 1952 auf einer Tagung in Lissabon darauf, binnen zweier Jahre mindestens 96 neue Divisionen aufzustellen.
Zugleich konnte der Elefant im Raum nicht mehr ignoriert werden. Ohne die Wiederbewaffnung Westdeutschlands konnte die Stärkung der NATO kaum Fortschritte machen. Es war nicht lange her, da hatte es eines mächtigen Bündnisses bedurft, um die deutsche Militärmacht niederzuwerfen, und zwar ein für alle Mal, wie man glaubte, und so stieß der Gedanke an einen wiederauflebenden deutschen Militarismus bei den Nachbarn Deutschlands verständlicherweise auf wenig Gegenliebe – und genauso nachvollziehbar ist, dass diese Aussicht die Sowjetunion mit Schrecken erfüllte. Die Amerikaner hatten das Thema der westdeutschen Wiederbewaffnung schon 1950, kurz nach dem Ausbruch des Koreakriegs, aufs Tapet gebracht, und sie drängten weiter in diese Richtung. Die westeuropäischen NATO-Mitglieder mussten zugeben, dass die Sache eine gewisse Logik hatte. Warum sollten die Vereinigten Staaten weiterhin den Löwenanteil der Verteidigungskosten Europas tragen, wenn die Europäer nur so wenig beitrugen? Aus europäischer Sicht bestand stets die Gefahr, dass die Amerikaner sich vielleicht sogar ganz aus Europa zurückziehen könnten, wie sie es nach 1918 getan und ursprünglich auch für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg geplant hatten. Außerdem musste sichergestellt werden, dass Westdeutschland an das westliche Bündnis gebunden blieb, was Stalin 1952 durch ein – von westlichen Führern sofort zurückgewiesenes – Angebot auf die Probe stellte, das den Deutschen die Aussicht auf ein vereintes neutrales Deutschland vorgaukelte. Im Westen interpretierte man Stalins Initiative als Versuch, die Amerikaner zum Rückzug aus Europa zu bewegen. Darüber hinaus sollte sie ganz offensichtlich die stärkere Einbeziehung Westdeutschlands ins westliche Bündnis, wie sie die westdeutsche Regierung unter Bundeskanzler Konrad Adenauer anstrebte, verhindern, zumal diese mittlerweile eng mit dem Thema der Schaffung westdeutscher Streitkräfte verknüpft war.
Schon 1950 war ein Vorschlag unterbreitet worden, der einen Durchbruch in der schwierigen Frage zu versprechen schien, wie Westdeutschland wiederaufgerüstet werden konnte, ohne europäische Länder, die solch einen Schritt entschieden ablehnten, vor den Kopf zu stoßen. Er kam, was vielleicht überrascht, aus Frankreich. Mit dem, was der französische Ministerpräsident René Pleven im Oktober 1950 ins Gespräch brachte, sollte die von den Amerikanern angestrebte Aufnahme Westdeutschlands in die NATO verhindert werden, indem es in eine neu zu gründende europäische Verteidigungsorganisation einbezogen wurde, in der es unter Kontrolle gehalten werden konnte. Plevens Vorstoß sah den Aufbau einer europäischen Armee vor, zu der auch eine deutsche Komponente gehören sollte, die jedoch nicht unter deutschem, sondern unter europäischem Kommando, letztlich also unter französischer Aufsicht stehen sollte. Dieser Vorschlag bildete die Grundlage für den im Mai 1952 geschlossenen Vertrag über eine Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG).
Die Bezeichnung war irreführend. Die EVG sollte nicht einmal alle westeuropäischen Länder umfassen. Zudem stand sie von Anfang an vor dem grundlegenden Problem, das in den folgenden Jahrzehnten alle Schritte in Richtung einer europäischen Integration erschweren sollte: Wie ließen sich gleichzeitig supranationale Strukturen schaffen und die nationale Souveränität der Mitgliedsstaaten bewahren? Der nach dem französischen Außenminister Robert Schuman benannte Plan von 1950 bildete die Grundlage der im folgenden Jahr gegründeten Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS), die zum Kern des Gemeinsamen Markts und später der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) wurde. Mitglieder der EGKS waren Frankreich, Westdeutschland, Italien, die Niederlande, Belgien und Luxemburg. Großbritannien entschied sich dafür, außen vor zu bleiben. Die EVG sollte nach dem gleichen Modell aufgebaut werden und dieselben Mitglieder haben. Großbritannien, das neben Frankreich die größten Streitkräfte in Europa besaß, begrüßte zwar die geplante Schaffung der EVG und sagte im Rahmen seiner NATO-Mitgliedschaft die engste Kooperation zu, würde ihr aber nicht angehören. Es war nicht bereit, Truppen auf unbestimmte Zeit für die Verteidigung Europas abzustellen und sich an einem Projekt zu beteiligen, das, wie der britische Außenminister Anthony Eden 1952 erklärte, »einer europäischen Föderation den Weg ebnen« würde. Die Schwächung der nationalen Souveränität, die eine Mitgliedschaft in der EVG nach sich gezogen hätte, kam für die Briten nicht in Frage. Die skandinavischen NATO-Mitglieder sahen es ähnlich. Daher war die EVG, wie anfangs beabsichtigt, auf die Länder beschränkt, die begonnen hatten, ihre Wirtschaftspolitiken zusammenzuführen. Aber der Vertrag musste von den nationalen Parlamenten ratifiziert werden. Und dies bereitete ausgerechnet in dem Land, das ihn vorgeschlagen hatte, Frankreich, Schwierigkeiten. Auch hier war die nationale Souveränität der entscheidende Punkt. Als die Nationalversammlung am 30. August 1954 über den EVG-Vertrag abstimmte, lehnte sie ihn mit überwältigender Mehrheit ab. Damit war die EVG Geschichte.
Die deutsche Wiederbewaffnung war es indes nicht. Adenauer hatte das Scheitern der EVG, die er als wichtigen Schritt auf dem Weg zur Integration Westeuropas betrachtet hatte, zutiefst bedauert. Anfangs hatte er geglaubt, die Abstimmungsniederlage in der französischen Nationalversammlung hätte seine Hoffnung auf die Wiedererlangung der deutschen Souveränität zunichtegemacht. Tatsächlich aber hatte sie den Weg freigemacht für das, was Adenauer – ebenso wie die Briten und Amerikaner – schon immer gewollt hatte: die Wiederbewaffnung Westdeutschlands als Vollmitglied der NATO und seine Anerkennung als souveräner Staat. Die Zeit war günstig für einen solchen Schritt. Im März 1953 war Stalin gestorben. Der Koreakrieg war vorüber; Westdeutschland war fest ins westliche Bündnis eingebunden, und der Gedanke an eine Neutralität der Bundesrepublik – den die Führung der oppositionellen Sozialdemokraten und ein beträchtlicher Teil der öffentlichen Meinung weiterhin hegten – war so gut wie begraben. Auf Konferenzen im September 1954 in London und im folgenden Monat in Paris beschlossen die NATO-Mitglieder, die Besetzung Deutschlands zu beenden – obwohl alliierte Truppen mit deutschem Einverständnis im Land bleiben würden – sowie die Bundesrepublik als souveränen Staat anzuerkennen und in die NATO aufzunehmen. Am 5. Mai 1955 erhielt die Bundesrepublik Deutschland ihre staatliche Souveränität, und vier Tage später wurde sie Mitglied der NATO. Ihr war es jetzt erlaubt, eine Armee (von nicht mehr als einer Million Mann) aufzustellen sowie eine Luftwaffe und eine Marine aufzubauen; der Besitz von Atomwaffen blieb ihr jedoch verboten.
Aus sowjetischer Perspektive war die Entwicklung im Westen äußerst beunruhigend. Die Vereinigten Staaten waren das einzige Land, das Atomwaffen tatsächlich im Kampf eingesetzt hatte, und sie hatten als erstes Land die Wasserstoffbombe entwickelt. Sie hatten in Korea interveniert und lagen in dem sich herausbildenden Wettrüsten vorn, und nun war es ihnen gelungen, unter Einschluss eines wiederbewaffnetem Westdeutschland, in Westeuropa eine antisowjetische Allianz zu festigen. Moskau hatte alles getan, was es konnte, um dies zu verhindern. Aus Angst vor einem wiederauflebenden »deutschen Militarismus« hatte die Sowjetunion in dem vergeblichen Bemühen, die Allianz zu schwächen oder zu spalten, den Westmächten 1954 sogar ihre Bereitschaft signalisiert, in die NATO einzutreten – was der Westen schroff zurückwies.
Da abzusehen war, dass sowjetische Annäherungsversuche auf steinigen Boden fallen würden, und da die NATO in Moskau als aggressives, gegen die Sowjetunion gerichtetes Bündnis wahrgenommen wurde, war es kein Wunder, dass die Aufnahme der Bundesrepublik in den Nordatlantikpakt mit einem raschen Gegenzug beantwortet wurde: Nur zehn Tage später, am 14. Mai 1955, schlossen die UdSSR, Polen, die Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Albanien und die Deutsche Demokratische Republik (DDR) den Warschauer Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand, im Westen zumeist Warschauer Pakt genannt. Gleichzeitig bemühte sich die Sowjetunion um eine Verbesserung der Beziehungen zu strategisch wichtigen neutralen Staaten, insbesondere zu Österreich und Jugoslawien, um zu verhindern, dass sie ins westliche Bündnis hineingezogen wurden. So wurde am 2. Juni 1955 das seit Titos Bruch mit Stalin im Jahr 1948 bestehende Zerwürfnis zwischen Jugoslawien und der Sowjetunion durch eine in Belgrad herausgegebene Erklärung gekittet, in der man sich gegenseitig versicherte, die Unabhängigkeit und territoriale Integrität des anderen zu respektieren und jede Einmischung in die inneren Angelegenheiten des anderen zu unterlassen. Bereits am 15. Mai, einen Tag nach Abschluss des Warschauer Pakts, hatten die vier Kriegsmächte – die USA, die UdSSR, Großbritannien und Frankreich – durch die Unterzeichnung des Österreichischen Staatsvertrags (der am 27. Juli in Kraft treten würde) die Besetzung Österreichs beendet und es als unabhängigen souveränen Staat geschaffen. Die Sowjetunion war dazu nur bereit gewesen, weil Österreich zugesagt hatte, keine fremden Militärstützpunkte auf seinem Territorium zuzulassen und sich keinem Militärbündnis anzuschließen. Förmlich verkündet wurde die Neutralität Österreichs am 26. Oktober 1955, einen Tag, nachdem die Besatzungsmächte das Land verlassen hatten. Einen Monat zuvor hatte die Sowjetunion durch die Schließung eines Marinestützpunkts bei Helsinki ihre Bereitschaft zu verstehen gegeben, Finnland die Festigung seiner Neutralität zu gestatten, einschließlich einer echten Unabhängigkeit von seinem übermächtigen sowjetischen Nachbarn, solange es sich nicht auf die Seite der NATO schlug.
Der förmlichen Gründung zweier feindlicher Militärbündnisse, die sich am quer durch Europa verlaufenden Eisernen Vorhang gegenüberstanden, jeweils mit einer Supermacht an der Spitze, die im Besitz von Waffen mit unvorstellbarer Zerstörungskraft war, folgte ein kurzer Augenblick, in dem das im Kalten Krieg gefrorene Eis wenn auch nicht abzutauen begann, so doch nicht dicker wurde. Sowohl die sowjetische als auch die amerikanische Führung schien bereit zu sein, die Spannungen zwischen den Blöcken zu verringern. Am 18. Juli 1955 kamen in Genf zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder die Regierungschefs der USA, der UdSSR, Großbritanniens und Frankreichs zusammen. Zuletzt hatten sie sich unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa in Potsdam getroffen. Im Mittelpunkt der weitgefächerten Tagesordnung des Gipfeltreffens – wie solche Zusammenkünfte genannt werden sollten – standen Sicherheitsfragen. Das Treffen schien die Hoffnung aufkommen zu lassen, dass eine Basis für eine friedliche Koexistenz gefunden werden konnte. Zumindest waren die Führer der Supermächte bereit, sich an einen Tisch zu setzen und miteinander zu reden. Das war es, was man mitnahm. Doch etwas wirklich Greifbares brachte das Treffen nicht. US-Präsident Dwight D. Eisenhower schlug eine Politik des »offenen Himmels« vor, die es den beiden Supermächten erlaubt hätte, das Territorium der jeweils anderen aus der Luft zu überwachen. Doch die Sowjets, denen es widerstrebte, den Amerikanern Einblick in ihre Nuklearanlagen zu gewähren und so womöglich zu offenbaren, wie begrenzt ihre Fähigkeit zum Langstreckenbombardement war, lehnten dies umgehend ab. (Den USA war das egal. Sie sollten die Sowjetunion bald mit dem neuen Spionageflugzeug U-2 überfliegen, bis im Mai 1960 eine Maschine abgeschossen und ihr Pilot, Gary Powers, gefangen genommen wurde, was zu einer internationalen Affäre führte.) Der »Geist von Genf« verflüchtigte sich rasch. Binnen eines Jahres war der Kalte Krieg zurück. Die brutale Niederschlagung des ungarischen Aufstands gegen die sowjetische Herrschaft Anfang November 1956 und die zur selben Zeit ihrem Höhepunkt zustrebende Suezkrise – zu der die Drohung des Sowjetführers Nikita Chruschtschow gehörte, gegen Großbritannien und Frankreich »Raketenwaffen« einzusetzen – hatten zur Folge, dass die internationalen Beziehungen neuerlich zum Zerreißen gespannt waren.
Zu diesem Zeitpunkt hatte das Wettrüsten wahrhaft überwältigende Ausmaße angenommen, die meisten Menschen auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs hatten jedoch selten eine Ahnung davon, wie groß die Waffenarsenale waren. Großbritannien hatte bereits 1947 die Entwicklung einer eigenen Atombombe beschlossen – die als Garantie dafür gesehen wurde, in der internationalen Diplomatie einen Platz am Tisch der Großen zu behalten. Labour-Premierminister Clement Attlee hatte sich schon im August 1945, unmittelbar nach den amerikanischen Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki, nachdrücklich für diesen Schritt eingesetzt. Sein Außenminister, Ernest Bevin, ein prägendes Mitglied der Labour-Regierung der Nachkriegszeit, hatte diese Forderung ein Jahr später, als viele, einschließlich Attlees, schwankend geworden waren, aufgegriffen. »Wir müssen das Ding hier haben«, erklärte er, »was immer es kostet. Wir müssen sicherstellen, dass der verdammte Union Jack auf seiner Spitze weht.« Im Oktober 1952 wurde Großbritannien durch seinen ersten Atombombentest auf der vor Westaustralien gelegenen Insel Monte Bello zur dritten Atommacht. Zwei Jahre später beschloss die britische Regierung den Bau der Wasserstoffbombe, die dann 1957 dem britischen Waffenarsenal hinzugefügt wurde. Attlees Nachfolger im Amt des Premierministers, Winston Churchill, bezeichnete dies als »den Preis, den wir bezahlen, um am Spitzentisch [der Weltführer] zu sitzen«. Auch Frankreich betrachtete den Besitz der Atom- und anschließend der Wasserstoffbombe als unverzichtbares Zeichen des Großmachtstatus. Als es im Februar 1960 bei Reggane in der algerischen Wüste seinen ersten Atombombentest durchführte, wurde es zum vierten Mitglied des »Nuklearklubs«. 1968 gelangte es auch in den Besitz der Wasserstoffbombe. Diese Entwicklungen summierten sich zu einer beunruhigenden Weiterverbreitung von Atomwaffen, auch wenn sie noch auf die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs beschränkt war. Die entscheidende Entwicklung aber war der Wettkampf zwischen den beiden Supermächten um die größere Vernichtungsfähigkeit.
Im März 1954 hatten die Amerikaner auf dem Bikini-Atoll im Territorium der Marshallinseln eine Wasserstoffbombe gezündet, die 750-mal stärker war als die Atombombe, die Hiroshima verwüstet hatte. Der Fallout der Explosion führte noch in einer Entfernung von 130 Kilometern zum Strahlentod. Um nicht ins Hintertreffen zu geraten, testete die Sowjetunion im folgenden September bei dem Dorf Totskoje im Oblast Orenburg im Südural eine noch größere Bombe, und im nächsten Jahr zündete sie ihre erste aus der Luft abgeworfene Wasserstoffbombe, die hundertmal stärker war als die erste. Die Vereinigten Staaten waren inzwischen schon dabei, kleine »taktische« Atomwaffen zu entwickeln, die in die Spitze von Raketen passten. Ab Herbst 1953 hatten sie begonnen, in Europa ein Arsenal solcher Waffen von beachtlicher Größe aufzubauen. Bald wurden amerikanische Offiziersanwärter mit Szenarien von mit Atomwaffen geführten Schlachten in Europa konfrontiert. Der Hardliner und US-Außenminister John Foster Dulles – der eine neue Politik verfolgte, der es nicht mehr nur um die Eindämmung des sowjetischen Kommunismus ging, sondern die sein »Roll-back« verfolgte – erklärte 1954 vor NATO-Führern, Atomwaffen würden jetzt als konventioneller Bestandteil der westlichen Verteidigungsfähigkeit betrachtet. Ein begrenzter Atomkrieg mit Europa als Schlachtfeld schien eine reale Möglichkeit zu sein. Die Vereinigten Staaten erwogen einen raschen Vernichtungsschlag gegen die Sowjetunion. Im März 1954 stellte der Chef des Strategischen Luftwaffenkommandos, General Curtis LeMay (der die Bombenangriffe auf japanische Städte am Ende des Zweiten Weltkriegs geleitet hatte), bei einer Besprechung mit Vertretern der US-Streitkräfte den Plan für einen massiven Luftangriff vor. Er versprach, dass »buchstäblich ganz Russland nach zwei Stunden nur noch eine qualmende strahlende Ruine« sein würde, und zeigte sich »fest überzeugt, dass 30 Tage ausreichen, um den Dritten Weltkrieg zu beenden«.
Der Ausbau der nuklearen Feuerkraft war atemberaubend. Hatten die Vereinigten Staaten 1950 298 Atombomben besessen, waren es 1962 sage und schreibe 27 000. Für deren Transport standen 2500 Langstreckenbomber zur Verfügung. Die Sowjetunion besaß zwar ebenfalls Langstreckenbomber, die Ziele in Amerika erreichen konnten, hinkte aber in Bezug auf ihre Zahl und Fähigkeiten hinter den Vereinigten Staaten her. Gleichwohl erregte die Sowjetunion 1957 mit einem Doppelcoup beim Wettrüsten neue Ängste. Im August startete sie die weltweit erste ballistische Interkontinentalrakete. Noch spektakulärer war es, als sie am frühen Morgen des 5. Oktober (Moskauer Zeit) mit der gleichen Rakete den ersten, passenderweise »Sputnik« (Weggefährte) genannten Satelliten in den Weltraum beförderte. Während die meisten Europäer den Sputnik als außerordentliche Leistung feierten, als den ersten Schritt zur Eroberung des Alls, begriffen amerikanische Wissenschaftler und Politiker sofort, was er bedeutete, nämlich dass die Sowjetunion bald in der Lage sein könnte, die Vereinigten Staaten aus dem Weltraum heraus anzugreifen. In einem amerikanischen Bericht wurden eine beunruhigende technologische Unterlegenheit gegenüber der Sowjetunion hervorgehoben und ein massiver Ausbau der amerikanischen Raketenstreitkräfte gefordert, was natürlich eine erhebliche Aufstockung der für sie bereitgestellten Mittel erforderte. 1959 machten die Militärausgaben die Hälfte des US-Bundeshaushalts aus. Im Jahr zuvor waren die Amerikaner den Sowjets ins All gefolgt und hatten mit ihren Explorer- und (nach einem peinlichen Fehlversuch) auch den Vanguard-Raketen Satelliten in die Erdumlaufbahn gebracht. Im selben Jahr, im Juli 1958, war die National Astronautics and Space Administration (NASA) ins Leben gerufen worden. Ihre Aufgabe war die wissenschaftliche Erkundung des Alls, aber die militärische Bedeutung ihres sich rasch ausweitenden Forschungsprogramms wurde darin deutlich, dass ein Teil ihres Budgets vom Pentagon beigesteuert wurde und der Raketenforschung zugutekam. Während führende amerikanische Politiker und Militärs weiterhin wie besessen eine »Raketenlücke« gegenüber der Sowjetunion beschworen und Amerika im Rückstand sahen, verfügten die Vereinigten Staaten, als John F. Kennedy im November 1960 zum Präsidenten gewählt wurde, über etwa 17-mal so viele einsatzbereite Atomwaffen wie die Sowjetunion.
Zu diesem Zeitpunkt hatte drei Jahre lang wieder einmal die Berlinfrage im Mittelpunkt der Spannungen zwischen den Supermächten gestanden. Eine große Berlinkrise hatte es bereits 1948 gegeben, als Stalin die Westmächte aus der Stadt zu vertreiben versuchte. Berlin stand zwar unter Viermächtekontrolle, lag aber, von Westen aus gesehen, rund 160 Kilometer innerhalb der Sowjetischen Besatzungszone. Der Sowjetdiktator hatte im Frühjahr 1949 schließlich zurückgesteckt, nachdem die Westmächte eine Luftbrücke eingerichtet hatten, die es Berlin fast ein Jahr lang ermöglichte, der Blockade standzuhalten. 1958 hielt Stalins Nachfolger Chruschtschow die Zeit für gekommen, die Westmächte in der Berlinfrage erneut unter Druck zu setzen. Damit reagierte er auf die von der westdeutschen Regierung unterstützte amerikanische Absicht, in Westdeutschland nukleare Mittelstreckenraketen zu stationieren, die ihrerseits eine Reaktion auf den Start sowjetischer Satelliten und Chruschtschows Prahlerei mit den sowjetischen Nuklearfähigkeiten war.
Chruschtschow hatte sich in einem Machtkampf durchgesetzt, der nach Stalins Tod im Jahr 1953 im Kreml ausgebrochen war und sich über zwei Jahre hingezogen hatte. Als Vorsitzender des Ministerrats und Erster Sekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU) verband er die Position des Regierungschefs mit der umfassenden Machtfülle des Parteivorsitzenden, so dass er im Sowjetsystem die absolute Führungsrolle innehatte. Chruschtschow, einstiger Protegé Stalins – und Beteiligter an dessen Säuberungen –, kam aus einer armen, ungebildeten Familie. Er war aus grobem Holz geschnitzt, hatte aber einen scharfen Verstand. Seine oberflächliche Freundlichkeit konnte rasch Temperamentsausbrüchen und offenen Drohungen weichen. Mitte der 1950er Jahre hatte der Westen kurzzeitig gehofft, dass mit einer Sowjetunion unter seiner Führung bessere, weniger angespannte Beziehungen aufgebaut werden könnten. Aber Chruschtschow war ein sprunghafter Charakter, dessen außenpolitisches Handeln weniger vorhersehbar war als das Stalins. Dies erhöhte die Gefahr, dass ein Konflikt zwischen den Supermächten aus dem Ruder lief.
Der Status Berlins war stets ein Stachel im Fleisch sowohl der ostdeutschen Führung als auch ihres Herrn und Meisters in Moskau gewesen. West-Berlin war eine kleine westlich regierte Insel in einem sowjetisch beherrschten Ozean. Da ganz Berlin formal weiterhin der Kontrolle aller vier Besatzungsmächte unterstand, hatten Angehörige der westlichen Besatzungstruppen das Recht, Ost-Berlin zu betreten und zu verlassen, wie es ihnen beliebte, so wie sowjetische Militärpatrouillen immer noch gelegentlich West-Berlin betraten. Bewohner Ost-Berlins konnten immer noch problemlos nach West-Berlin gelangen, das als Schaufenster des stärker prosperierenden Westens diente. Sie kamen und gingen nicht nur; viele blieben auch, suchten sich eine Arbeit und genossen den höheren Lebensstandard im Westen. Zwischen 1953 und Ende 1956 stimmten über 1,5 Millionen Menschen mit den Füßen über das ostdeutsche System ab, indem sie in den Westen gingen. 1957/58 folgten ihnen eine weitere halbe Million Menschen. Dieses Ausmaß der Abwanderung war weder mit den politischen und ökonomischen Plänen der ostdeutschen Führung noch mit der Erhaltung der DDR als Bollwerk gegen den kapitalistischen Westen vereinbar. Jenseits ökonomischer Erwägungen spielten die jüngsten Entwicklungen eine Rolle: die Wiederbewaffnung Westdeutschlands und dessen Aufnahme in die NATO sowie die Stationierung amerikanischer Atomwaffen auf seinem Boden. Darüber hinaus war West-Berlin ein Zentrum westlicher Spionage und Propaganda, der eine zunehmende Zahl von Ost-Berlinern mittlerweile nicht mehr nur durch Radio-, sondern auch durch Fernsehsendungen, die von West-Berliner Boden ausgestrahlt wurden, tagtäglich ausgesetzt war. Nach Chruschtschows Ansicht war es Zeit, am Status quo zu rütteln. Und den Status Berlins erneut in Frage zu stellen bedeutete, die Deutschlandfrage insgesamt wieder auf die Tagesordnung zu setzen.
Am 27. Oktober 1958 verkündete Walter Ulbricht, der Generalsekretär der in Ostdeutschland herrschenden Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED), in einer großen Rede: »Ganz Berlin liegt auf dem Territorium der Deutschen Demokratischen Republik« und gehöre zu deren Hoheitsbereich. Dies stand in diametralem Gegensatz zum Viermächtestatus Berlins. Ulbricht hatte seine Äußerungen offenbar mit Chruschtschow abgestimmt, denn nur zwei Wochen später, am 10. November, stellte der Sowjetführer in Moskau fest, es sei an der Zeit, die Besetzung Berlins zu beenden. Am 27. November ließ er die ultimative Forderung an die drei westlichen Besatzungsmächte folgen, der binnen eines halben Jahres durchzuführenden Entmilitarisierung West-Berlins und damit der Beendigung des »Besatzungsregimes« zuzustimmen. Andernfalls müssten sie mit einem unilateralen Vorgehen der Sowjetunion und der DDR zur Erreichung dieses Ziels rechnen. In diesem Fall werde man die während des Krieges getroffenen Vereinbarungen, auf denen die Besetzung beruhe, als hinfällig betrachten.
Es hätte offensichtlich eine erhebliche Schwächung der Westmächte nicht nur in Berlin bedeutet, wären sie auf dieses Ultimatum eingegangen. Ein möglicher Showdown wurde jedoch durch quasi-konziliante diplomatische Schritte der Westmächte – ohne dass tatsächlich etwas zugestanden wurde – sowie durch eine von Eisenhower ausgesprochene Einladung Chruschtschows zu einem Besuch in den Vereinigten Staaten im nächsten Jahr vermieden. Die Frist des Ultimatums lief ab, ohne dass etwas geschah. Und am 15. September 1959 reiste Chruschtschow zu einem zwölftägigen Besuch nach Amerika, der zwar keine substantiellen Ergebnisse zeitigte, den Führern der beiden Supermächte aber die Gelegenheit gab, sich persönlich kennenzulernen, und die bislang frostige Atmosphäre zwischen beiden Ländern vorübergehend erwärmte.
Die Krise, die sich zusammengebraut hatte, blieb vorläufig aus. Dass die Sowjetunion bereit war, die Spannung in Mitteleuropa zu verringern, lag unter anderem an der Verschlechterung ihres Verhältnisses zu China – die Mao Zedongs geringer Meinung von Chruschtschow entsprach. Doch die Spannung in Europa sollte wiederaufleben, denn das Problem, das ihr zugrunde lag – die desaströse Abwanderung von Ostdeutschen über West-Berlin –, war ungelöst. Der ständige Bevölkerungsschwund hatte die ostdeutsche Führung schon 1952 veranlasst, die Demarkationslinie zur Bundesrepublik abzuriegeln. In Berlin war die Grenze jedoch offen geblieben und bildete ein Schlupfloch, durch das Ostdeutsche relativ ungehindert in den Westen gelangen konnten.
Täglich nahmen Hunderte von Ostdeutschen diesen Weg. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle passierten an einem einzigen Tag, dem 6. April 1961, nicht weniger als 2305 Menschen die Sektorengrenze zwischen Ost- und West-Berlin. Die meisten Flüchtlinge waren jung. Oftmals handelte es sich um Bauern, die vor der im Juni 1958 begonnenen Kollektivierung der Landwirtschaft flohen. Einen großen Anteil derjenigen, die im Westen ein besseres Leben suchten, bildeten auch Facharbeiter, Universitätsabsolventen und junge Freiberufler – die zu verlieren sich der ostdeutsche Staat nicht leisten konnte. 1960 kehrten rund 200 000 Ostdeutsche der DDR den Rücken. Im folgenden Jahr drohte diese Zahl weiter anzusteigen. Allein im April überquerten 30 000 Menschen die Grenze ohne Rückkehrabsicht. Zwischen Oktober 1949, als die DDR gegründet wurde, und August 1961 fällten 2,7 Millionen Ostdeutsche – 15 Prozent der Bevölkerung – auf diese Weise ihr Urteil über das sozialistische System im Osten.
Als Chruschtschow und Kennedy am 3. und 4. Juni 1961 in Wien zum ersten Mal zusammenkamen, stand die Berlinfrage im Mittelpunkt ihrer Gespräche. Chruschtschow hatte für den neuen, unerfahrenen amerikanischen Präsidenten kaum mehr als Verachtung übrig. Kennedy war durch das Schweinebucht-Debakel, eine von der Central Intelligence Agency (CIA) geförderte gescheiterte Landeoperation in Kuba mit dem Ziel, das kommunistische Regime zu stürzen, schwer angeschlagen. Bei dem Treffen in Wien ergriff Chruschtschow die Initiative und stellte Kennedy ein neues Ultimatum: Wenn die Westmächte nicht einwilligten, West-Berlin zu einer »Freien Stadt« zu machen und ihre Zugangsrechte aufzugeben, würde er der DDR die Kontrolle über den Luftkorridor zwischen West-Berlin und der Bundesrepublik Deutschland übergeben, so dass westliche Flugzeuge gezwungen werden könnten, auf ostdeutschem Territorium zu landen. Von Chruschtschows Gepolter unbeeindruckt, drohte Kennedy daraufhin mit Krieg.
Als einige Wochen später bekannt wurde, dass der NATO-Rat sich darauf geeinigt hatte, eine Blockade der Zugangswege nach Berlin mit militärischen Mitteln zu verhindern, sah sich Chruschtschow genötigt, seine Meinung, dass keine ernste Kriegsgefahr bestünde, zu ändern. Erst jetzt stimmte er Ulbrichts Ersuchen zu, die Grenze zwischen West-Berlin und dem Gebiet der DDR zu schließen. Ulbricht hatte dies schon im März auf einer Tagung des Warschauer Pakts in Moskau gefordert. (Tatsächlich reichten die Pläne, West-Berlin einzumauern, um den Grenzverkehr mit Ostdeutschland und Ost-Berlin zu unterbinden, bis 1952 zurück.) Am 24. Juli 1961 beschloss das Politbüro der SED