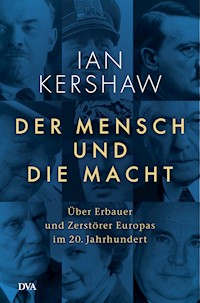
17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie groß ist der Einfluss Einzelner auf den Lauf der Geschichte? Bestsellerautor Ian Kershaw über die prägendsten politischen Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts: Lenin, Mussolini, Hitler, Stalin, Churchill, De Gaulle, Adenauer, Franco, Tito, Thatcher, Gorbatschow und Kohl
Zwölf Mächtige, elf Männer und eine Frau, die das 20. Jahrhundert in Europa tief geprägt haben, rücksichtslose, mörderische Diktatoren oder demokratische Staatenlenker: Was zeichnete diese Menschen aus, dass sie große Macht erlangten und Geschichte machten? Welche Voraussetzungen brachten sie mit? Wie weit wurden sie von den Umständen ihrer Zeit und Umgebung befördert oder getrieben? Vor dem Hintergrund der aktuellen Erfahrungen mit autoritären Führern ergründet der englische Historiker Ian Kershaw, einer der besten Kenner der europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts, die Bedingungen für den Aufstieg zur Macht und analysiert dabei grundsätzlich die Möglichkeiten und Grenzen »starker« Führungspersönlichkeiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 794
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Wie groß ist der Einfluss Einzelner auf den Lauf der Geschichte?
Der englische Historiker Ian Kershaw ist einer der besten Kenner und klügsten Erklärer der europäischen Geschichte im 20. Jahrhundert. In seinem neuen Buch betrachtet er diese unter dem Aspekt mächtiger Menschen und ihres Einflusses: Wie weit haben Politiker mit ihren Entscheidungen den turbulenten Lauf der Geschichte bestimmt? Wie weit wurden sie von den Umständen getrieben? Welche sind die Voraussetzungen für die Erlangung von Macht, und welche Eigenschaften bringen politische Anführer mit? In zwölf Porträts von Lenin bis Helmut Kohl ergründet Ian Kershaw die machtvollen Figuren des 20. Jahrhunderts, die Europa im Guten wie im Schlechten geformt haben, und analysiert dabei grundsätzlich die Möglichkeiten und Grenzen »starker« Führungspersönlichkeiten.
Über den Autor
Ian Kershaw, geboren 1943, zählt zu den bedeutendsten Historikern der Gegenwart. Bis zu seiner Emeritierung war er Professor für Modern History an der University of Sheffield, seine große zweibändige Biographie Adolf Hitlers gilt als Meisterwerk der modernen Geschichtsschreibung. Für seine Verdienste um die historische Forschung wurde Ian Kershaw mit zahlreichen Preisen geehrt, darunter mit dem Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung und der Karlsmedaille. 1994 erhielt er das Bundesverdienstkreuz, 2002 wurde er zum Ritter geschlagen. Bei DVA sind außerdem von ihm erschienen Hitlers Freunde in England (2005), Wendepunkte. Schlüsselentscheidungen im Zweiten Weltkrieg (2010) und Das Ende (2013). Die beiden Bände seiner großen Geschichte des 20. Jahrhunderts in Europa, Höllensturz (2016) und Achterbahn (2019), sind hochgelobte Bestseller.
Besuchen Sie uns auf www.dva.de
Ian Kershaw
der mensch und die macht
Über Erbauer und Zerstörer Europas im 20. Jahrhundert
Aus dem Englischen von Klaus-Dieter Schmidt
Deutsche Verlags-Anstalt
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem TitelPersonality and Power. Builders and Destroyers of Modern Europe bei Allen Lane, einem Imprint von Penguin Books UK. Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen. Copyright © der Originalausgabe 2022 Ian Kershaw Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2022 Deutsche Verlags-Anstalt, München in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München Redaktion: Jonas Wegerer Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt Coverabbildungen: picture alliance (ASSOCIATEDPRESS; akg-images; dpa/London Express; Photo12/Photosvintages; KEYSTONE/STR; empics/PA; Karl Schöndorfer/picturedesk.com; Ulrich Baumgarten) Satz, Bildbearbeitung und E-Book Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-28642-2
In Erinnerung an Stephen
Lenin spricht vor einer großen Menschenmenge in Petrograd bei der Eröffnung des Zweiten Weltkongresses der Komintern im Juli 1920. Fine Art Images/Heritage Images
vorwort
Es gibt politische Führer, Demokraten wie Diktatoren, jeweils ausgestattet mit einer markanten Persönlichkeit, die augenscheinlich tiefe Spuren in der Geschichte hinterlassen. Aber was bringt starke Persönlichkeiten an die Macht? Und was fördert oder beschränkt ihre Machtausübung? Welche sozialen und politischen Bedingungen bestimmen die Art der Macht, die sie verkörpern, was entscheidet, ob demokratische oder autoritäre Führer zum Zug kommen? Wie wichtig ist die Persönlichkeit selbst sowohl bei der Erlangung der Macht als auch bei deren Ausübung? Fernsehen, soziale Medien und Journalismus stellen die Persönlichkeit und ihre Rolle gern als eine nahezu elementare, unbeschränkte politische Kraft dar, die durch ihren individuellen Willen den Wandel erzwingt. Aber wird die Macht politischer Führer, wie groß sie auch erscheinen mag, nicht durch Kräfte beschränkt, die sie nicht zu steuern vermögen?
Dies sind grundlegende Fragen der historischen Analyse. Durch jüngste Erfahrungen mit politischer Führerschaft von Figuren wie Donald Trump, Wladimir Putin, Xi Jinping, Recep Tayyip Erdoğan, Boris Johnson und anderen »starken Führern« haben sie jedoch neue Relevanz erhalten.
Außergewöhnliche Zeiten, könnte man sagen, bringen außergewöhnliche Führer hervor, die außergewöhnliche Dinge tun – häufig schreckliche. Eine Systemkrise ist der gemeinsame Faktor. Die in diesem Buch vorgelegten Fallstudien über europäische Führer des 20. Jahrhunderts, unter ihnen Diktatoren wie Demokraten, behandeln alle, bis auf eine, solche außergewöhnlichen Führer, deren spezifische Art der Machtausübung von außergewöhnlichen Vorbedingungen ermöglicht wurde. Der eine der hier behandelten politischen Führer, der nicht in dieses Muster passt – Helmut Kohl –, erhielt einen außergewöhnlichen Anstoß, als der Zusammenbruch des Sowjetblocks ihm überraschend die Gelegenheit bot, die deutsche Vereinigung zu erreichen. Davor war er ein völlig durchschnittlicher demokratischer Führer gewesen. Sein Fall ist vielleicht ein Beleg dafür, dass politische Führer in ruhigen Zeiten, wenn keine Systemkrise herrscht, im Gedanken an die Wirkung auf die Wähler und von breiteren Kräften des ökonomischen, sozialen und kulturellen Wandels beeinflusst, die sie allenfalls teilweise steuern können, die Hebel des historischen Wandels lediglich antippen. Die von mir ausgewählten Fallstudien konzentrieren sich auf das Außergewöhnliche; das unspektakuläre, wenn auch manchmal schätzenswerte und nutzbringende Handeln jener europäischen Politiker und Politikerinnen des 20. Jahrhunderts, die kleine, schrittweise Veränderungen bewirkten, wird nicht untersucht. Hätte ich auch die »normalen«, nicht außergewöhnlichen politischen Führer in den Blick genommen, wäre ein anderes Buch entstanden. Aber ich musste eine Auswahl treffen, und es ist kaum bestreitbar, dass diejenigen, die ich ausgewählt habe, die europäische Geschichte in bedeutender – häufig äußerst negativer – Weise verändert haben.
Was folgt, ist eine Reihe von interpretativen Essays über die Erlangung und Ausübung von Macht durch einige beeindruckende politische Persönlichkeiten. Dabei handelt es sich ausdrücklich nicht um Mini-Biographien. Jeder der dargestellten Staatsmänner ist seiner Bedeutung und gewaltigen Wirkung gemäß Gegenstand zahlreicher Biographien geworden, die sich auf umfangreiche historische Forschungsarbeiten stützen. Ich habe diese Biographien und andere Studien über die hier Behandelten herangezogen und behaupte nicht, selbst Primärforschung zu ihnen betrieben zu haben, abgesehen von Hitler, bei dessen Darstellung ich mich auf meine eigene, vor Jahren unternommene Forschungsarbeit stützen konnte.
Die einzelnen Kapitel folgen alle dem gleichen Muster. Zuerst betrachte ich die Charakterzüge und Umstände, die einen bestimmten Persönlichkeitstyp mit dem Potential ausstatteten, als Führer die Macht zu ergreifen. Danach untersuche ich ausgewählte Aspekte ihrer Ausübung und der Strukturen, die dies ermöglichten. Die Kapitel schließen jeweils mit einer Betrachtung über die Hinterlassenschaft des behandelten politischen Führers. In der Einführung skizziere ich den Rahmen der Untersuchung und lege eine Reihe allgemeiner Annahmen über die Bedingungen des Aufstiegs zur Macht und ihre Ausübung dar, auf die ich dann in der Schlussbetrachtung zurückkommen werde. Anmerkungen und Literaturverweise habe ich auf ein Mindestmaß beschränkt.
Dieses Buch handelt von Geschichte, von jüngerer und häufig immer noch schmerzlicher Geschichte. Europa hat sich seit den hier geschilderten Zeiten weiterentwickelt, und zwar – trotz enormer gegenwärtiger Probleme – überwiegend zum Besseren, insbesondere wenn man an die Schrecken der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts denkt. Ereignisse der jüngsten Zeit haben soziale und politische Themen in den Vordergrund gerückt – Rassismus, Imperialismus, Sklaverei, Geschlechts- und Identitätsfragen –, die im Vergleich zum vorigen Jahrhundert neue oder wenigstens andere Ausdrucksformen angenommen haben. Und die Politik ist erfreulicherweise keine reine Männerdomäne mehr, wie sie es einst war. Dass nur eine der Fallstudien in diesem Buch eine Frau zum Gegenstand hat, spiegelt die Tatsache wider, dass die Politik im 20. Jahrhundert überwiegend Männersache war. Eine nichtweiße Persönlichkeit fehlt gänzlich, was daran erinnert, dass die europäische Politik im 20. Jahrhundert nicht einfach nur eine Domäne von Männern war, sondern eine von weißen Männern. Die Veränderungen in unserer Zeit sind ein Anzeichen dafür, dass weit stärkere Kräfte, als selbst der mächtigste politische Führer sie besitzt, eine langfristige soziale Transformation vorantreiben.
Geschichte bietet, wenn überhaupt, dann nur wenige Rezepte für die Zukunft. Sie zeigt jedoch, dass es nicht wünschenswert ist, die Politik mächtigen Persönlichkeiten zu überlassen, die behaupten, über ein Allheilmittel für die Missstände der Gegenwart zu verfügen, und durch einen umfassenden Wandel eine tiefgreifende Verbesserung versprechen. »Sei vorsichtig mit dem, was du dir wünschst«, ist eine nützliche Mahnung, die man beim Nachdenken über die Behauptungen potentieller politischer Führer im Kopf behalten sollte. Ich selbst wäre froh, wenn »charismatische« Persönlichkeiten gänzlich außen vor blieben, zugunsten solcher Führer, deren Persönlichkeit zwar weniger schillert, die aber kompetente, effektive Regierungsarbeit auf der Grundlage kollektiver Beratung und fundierter rationaler Entscheidungen, die auf die Verbesserung des Lebens aller Staatsbürger abzielen, leisten. Doch dies ist wahrscheinlich nur eine weitere Definition von Utopie.
Ian Kershaw
Manchester, Oktober 2021
einleitung
der einzelne und der historische wandel
Inwieweit wurde Europas turbulentes 20. Jahrhundert durch das Handeln politischer Führer geprägt? Waren es diese Führer, die das 20. Jahrhundert »gemacht« haben? Oder wurden sie vielmehr von ihm gemacht? Diese Fragen sind Teil der umfassenderen Frage, wie wichtig Einzelne bei der Gestaltung von Geschichte sind. Ändern sie deren Gang grundlegend? Oder leiten sie die Flut lediglich in neue, temporäre Kanäle? Man nimmt häufig nahezu automatisch und fraglos an, politische Führer seien mehr oder weniger persönlich – oder sogar allein, wie implizit manchmal unterstellt wird – dafür verantwortlich, welchen Kurs die Geschichte nimmt. Aber wie und warum sind sie in die Position gelangt, überhaupt so handeln zu können, wie sie es tun? Welchen Einschränkungen sind sie unterworfen? Welcher Druck lastet auf ihnen? Welche Unterstützung oder Opposition bedingt ihr Handeln? Unter welchen Umständen sind die Führer in unterschiedlichen politischen Systemen erfolgreich? Und wie wichtig ist dabei die Rolle der Persönlichkeit? Inwieweit färbt oder prägt sie sogar tiefgreifende politische Entscheidungen? In welchem Maß haben politische Führer selbst durch frei getroffene Entscheidungen den Wandel bewirkt, mit dem man sie später dann identifiziert hat? Diese Fragen betreffen sowohl demokratische als auch autoritäre Führer. 1
Die Frage des Einflusses des Einzelnen auf den historischen Wandel ist von Historikern häufig und wiederholt aufgegriffen worden, 2 und nicht nur von diesen. So hat Lew Tolstoi viele Seiten seines 1869 erschienenen Romans Krieg und Frieden der philosophischen Reflexion über die Rolle des individuellen Willens bei der Gestaltung historischer Ereignisse gewidmet und durch die Betonung des »Schicksals« den Gedanken zurückgewiesen, sie würden von »großen Männern« geprägt. 3 Indirekt lag die Frage aber stets dicht am Zentrum der historischen Forschung, seit das Studium der Geschichte im 19. Jahrhundert zu einer Fachdisziplin geworden ist. Während sie als theoretisches oder philosophisches Thema häufig untersucht wurde, ist sie jedoch selten direkt und empirisch behandelt worden.
Der deutsche Historiker Imanuel Geiss beschäftigte sich 1970 vor dem Hintergrund der in Deutschland herrschenden starken Abneigung gegen eine personalisierte Geschichtsschreibung mit der Rolle der Persönlichkeit. Diese Aversion war zum Teil auf die Ablehnung der früheren Tradition der deutschen Geschichtsschreibung zurückzuführen, die Rolle mächtiger, häufig visionärer Einzelner bei der Gestaltung der deutschen Geschichte zu überhöhen. Hauptsächlich war sie jedoch eine Reaktion auf die katastrophale jüngste deutsche Geschichte, die häufig implizit, wenn nicht sogar explizit als Werk eines einzigen Mannes, Adolf Hitlers, gesehen wurde. Der Führerkult im »Dritten Reich«, der alle »Leistungen« der »Größe« des »Führers« zuschrieb, und die Umkehr dieser Wertung nach 1945, als man nur zu bereitwillig das ganze Desaster, das Deutschland ereilt hatte, Hitler persönlich anlastete, hatten in den 1960er Jahren dazu geführt, dass man der Persönlichkeit eine Rolle in der Geschichte nahezu vollständig absprach. Dies war sowohl in Westdeutschland, wo die Strukturgeschichte vorherrschend wurde, als auch – aufgrund der marxistisch-leninistischen Betonung des Primats der Ökonomie – in extremer Weise in Ostdeutschland der Fall. Geiss schlug einen Mittelweg zwischen Übertreibung und Zurückweisung der Rolle des Einzelnen ein, ging aber nicht weit über – nicht sehr klare – Abstraktionen hinaus. »Die noch so große Persönlichkeit«, stellt er fest, »schafft nicht selbst den historischen Stoff oder formt ihn entscheidend selbst, sondern gibt ihm nur die ihr eigene persönliche Note.« Eine »große Persönlichkeit« präge »allenfalls ihrer Zeit den eigenen persönlichen Stempel« auf. 4
Die starke Betonung struktureller Determinanten historischen Wandels und die Geringschätzung der Rolle des Einzelnen hatten zur Folge, dass der Biographie, einem traditionellen Bestandteil der angloamerikanischen Geschichtsschreibung, in Deutschland bei der Interpretation der Vergangenheit lange Zeit keine besondere Bedeutung beigemessen wurde. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs hat sich dies in Deutschland und anderswo jedoch geändert. Der Rückgang des geistigen Einflusses des Marxismus nach dem Sturz des Sowjetblocks und die Ausbreitung der neuen »Kulturgeschichte«, die jede »große Erzählung«, jede dem historischen Wandel übergestülpte umfassende Theorie zurückweist, brachten eine Fragmentierung ohne grundlegendes Muster oder zu enthüllende Bedeutung mit sich, so dass sich das Augenmerk erneut auf den Willen, die Handlungen und die Wirkung von Einzelnen richtete. Eine »allgemeine Wende vom Abstrakten zum Konkreten« hatte eine »Abkehr von System und Struktur hin zum Subjekt, zum Einzigartigen und Individuellen« zur Folge. 5
Als das Millennium näher rückte, veröffentlichte einer der führenden deutschen Historiker, Hans-Peter Schwarz, eine umfangreiche, schwungvoll geschriebene »Porträtgalerie« des 20. Jahrhunderts, wie sie eine Generation zuvor in Deutschland noch undenkbar gewesen wäre. Durch die »Kunstform des biographischen Essays«, erklärte Schwarz, ähnle sein Buch einem »Durchgang durch ein Geschichtsmuseum, in dem die Porträts verschiedener Größen des 20. Jahrhunderts zu betrachten sind: das Gesicht des Jahrhunderts als Abfolge von Gesichtern«. Er räumte ein, dass »der Faktor Persönlichkeit nur einer unter vielen« sei, fragte aber anschließend rhetorisch: »Doch wer wollte seine Bedeutung ernstlich bestreiten?« 6
Die Vorstellungen von politischer Führung sind natürlich alles andere als statisch. Selbst ihre Anhänger verleihen heutigen »starken Führern« selten jene »heroischen« Züge von »Schicksalsmännern«, deren Taten das Geschick ihrer Nation prägen, wie sie noch politischen Führern im 19. Jahrhundert zugeschrieben wurden, als dem romantischen Zeitgeist entsprechend der Glaube an »große Männer« entstand. 7 Thomas Carlyles gefeierte Vorlesungsreihe Über Helden, Heldenverehrung und das Heldentümliche in der Geschichte von 1840 gab diesem Glauben enormen Auftrieb und trug wesentlich dazu bei, den »großen Mann« – Frauen schenkte man keine Beachtung – ins Geschichtsbild einzuführen. Nach Carlyles Ansicht ist »die Universalgeschichte, die Geschichte dessen, was der Mensch in dieser Welt vollbracht hat, im Grunde die Geschichte der großen Männer […]. Alle Dinge, die wir in der Welt fertig dastehen sehen, sind eigentlich das äußere wesentliche Ergebnis, die praktische Verwirklichung und Verkörperung von Gedanken, die in den Hirnen der uns in die Welt gesandten großen Männer lebten.« Für Carlyle waren »große Männer« vollkommen positive Figuren. Ein »großer Mann« war in seinen Augen nicht weniger als »die lebendige Quelle des Lichtes, und es ist gut und ersprießlich, ihr nahe zu sein«, dieser »strömende[n] Lichtquelle […] der angeborenen ursprünglichen Erkenntnis, der Mannheit und des edlen Heldentums«. 8
Die meisten von Carlyles »Helden« bewegten sich auf den Gebieten von Religion (wie Mohammed und Luther) und Literatur (Dante, Shakespeare). In der letzten Vorlesung wandte er sich jedoch der Politik zu, wobei er Cromwell und Napoleon herausgriff, die beide nach revolutionärem Chaos die Ordnung wiederhergestellt hatten, oder wie er es ausdrückt: »In aufrührerischen Zeiten, wo das Königtum an sich tot und vernichtet zu sein schien, treten Cromwell und Napoleon wieder als Könige hervor.« 9 Der »Held« oder »große Mann« prägt die Geschichte durch Willenskraft: Dies war die grundlegende Botschaft. Kein Wunder also, dass ein Jahrhundert später Hitler ein begeisterter Bewunderer Carlyles war – und dass Carlyle heute so wenig gelesen wird. 10
Auch der herausragende Schweizer Kulturhistoriker Jacob Burckhardt befasste sich in einem Essay mit dem Thema »historischer Größe«. In der erst 1905, nach seinem Tod, veröffentlichten Schrift, die auf 1870 gehaltenen Vorträgen beruht, räumt er ein, dass »wirkliche Größe […] ein Mysterium« sei, wir aber »unwiderstehlich dahin getrieben« seien, »diejenigen in der Vergangenheit und Gegenwart für groß zu halten, durch deren Tun unser spezielles Dasein beherrscht ist«. Große Männer zeichneten sich durch Einzigkeit und Unersetzlichkeit aus. 11 Burckhardts Hauptanliegen war die »Größe« in der Kultur, insbesondere von Malern, Dichtern und Philosophen sowie von religiösen Figuren (auch hier Mohammed und Luther). In der Politik unterschied er »Größe« von »bloßer Macht«; »bloßen kräftigen Ruinierern«, wie er sie nennt, spricht er jede Größe ab. 12 Wer nur zerstöre und nichts schaffe, habe jeden Anspruch auf Größe verspielt. Groß seien nur diejenigen, die sich als fähig erwiesen, die Gesellschaft von »abgestorbenen Lebensformen« zu befreien. 13 Zur »Größe« gehört nach Burckhardts Ansicht mehr als die Durchsetzung des eigenen Willens. Ihr bestimmender Faktor liegt vielmehr darin, ob er – je nach Standpunkt – dem Willen Gottes, der Nation oder des Zeitalters entspricht. 14 Wie dieser definiert werden sollte, ließ er offen.
Sowohl Carlyle als auch Burckhardt suchten »Größe« in der Persönlichkeit. Aber ihre Definitionsversuche blieben nebulös. Vielleicht ist es wirklich möglich, in Kunst und Kultur eine objektive Definition des Genies, das der Größe gleichkommt, zu finden. Vielleicht trifft es objektiv zu, wenn man sagt, Michelangelo, Mozart oder Shakespeare seien »große« Künstler gewesen, weil eine fachmännische ästhetische Einschätzung ihres Genies und ihrer künstlerischen Fähigkeiten zeige, wie weit sie sich damit über die Werke ihrer Zeitgenossen erhoben. Nach Burckhardts Ansicht liegt die Größe von Malern, Dichtern und Philosophen in ihrer Fähigkeit, sowohl den Zeitgeist wiederzugeben als auch einen grundlegenden interpretativen Rahmen für das Verständnis durch künftige Generationen zu liefern. 15 Auf einer anderen Ebene, auf der Leistungen genau gemessen werden können, ist es möglich, von großen Sportlern zu sprechen, wenn sie Leistungen erreichen, die weit über denjenigen aller anderen liegen. Doch dies alles ist weit von politischer »Größe« entfernt.
Lucy Riall, eine Expertin für die moderne italienische Geschichte, hat jüngst den Begriff historischer Größe neu gefasst, indem sie ihn als politische und kulturelle Konstruktion interpretierte und diese Perspektive in ihrer Garibaldi-Biographie anlegte. 16 »Für Italiener wie für Nichtitaliener«, führt sie aus, »war und bleibt Garibaldi der große Mann par excellence.« Aber dies sei ein Konstrukt, stellt sie klar, eine »Erfindung« der italienischen Gesellschaft, an der nicht zuletzt Garibaldi selbst beteiligt war. »Indem er den Begriff der Größe hinterfragt«, resümiert sie, »kann der politische Biograph den Prozess enthüllen, durch den Größe erlangt, manipuliert und ausgenutzt wird, und vielleicht eine Erklärung dafür geben, warum wir uns nach Helden sehnen.« 17 Kaum jemand wird den Nutzen bestreiten, den es hat, wenn man die Gründe erkundet, aus denen Gesellschaften – oder wenigstens Teile von ihnen – zuzeiten bereit sind, ihren politischen Führern Größe zuzubilligen (die sie sich nur zu gern auch selbst zuschreiben). Und dass es wichtig ist zu erkennen, wie Regime solche Ansichten manipulieren und ausnutzen, versteht sich von selbst. Aber sich die Bedingungen anzuschauen, unter denen Führerkulte geschaffen werden und gedeihen, beantwortet noch nicht die Frage, ob und nach welchen Kriterien bestimmte politische Führer tatsächlich als »groß« bezeichnet werden können.
Im Reich der Politik eine objektive Definition von »Größe« aufstellen zu wollen, scheint mir ein letztlich sinnloses Unterfangen zu sein. Welches sind die Kriterien? Burckhardt gestand Dschingis Khan »Größe« zu, weil dieser seine Gefolgschaft »vom Nomadenleben zur Welteroberung« geführt hatte. Timur dagegen, dessen selbsternanntem Nachfolger, sprach Burckhardt sie ab; in ihm sah er bloß einen »kräftigen Ruinierer«, der die Mongolen in einem schlimmeren Zustand hinterließ als den, in dem er sie vorgefunden hatte. 18 Ist diese Unterscheidung wirklich mehr als ein subjektives Urteil? Beide Herrscher waren zu Recht gefürchtet; den Streifzügen ihrer Armeen durch riesige eroberte Territorien fielen Zigtausende Menschen zum Opfer. Moralisch gesehen, waren beide abstoßende Beispiele ungezügelter Grausamkeit. Doch die Moral spielt bei Burckhardts Urteil über die »Größe« keine Rolle; ausschlaggebend scheint vielmehr die Effektivität ihrer Eroberungen zu sein (für die Eroberer, nicht die Eroberten). »Größe« scheint ausschließlich in den Augen bestimmter Betrachter zu liegen. Und überhaupt: Trägt es irgendwie zum besseren Verständnis dessen bei, wie Dschingis und Timur die Macht erlangten und ausübten, wenn man den einen als »groß« bezeichnet und dem anderen mangelnde »Größe« vorwirft?
Bei der Betrachtung der fernen Vergangenheit ist es vielleicht möglich, die Moral außer Acht zu lassen. Moralität als Urteilskriterium verblasst im Lauf der Zeit, bis sie schließlich ganz verschwindet. Vielleicht sollte dies nicht geschehen, aber es geschieht. Kaum jemand schenkt bei der Beurteilung der Leistungen von Eroberern aus lange zurückliegenden Epochen dem Ausmaß der von ihnen verübten Gemetzel Beachtung. Aber wie ist es in der Neuzeit? In der Moderne verlangt politische Macht unweigerlich moralische Entscheidungen und ideologische Stellungnahmen, die beide in der Regel sowohl Befremden als auch Bewunderung hervorrufen. Welches Maß an moralischer Verfehlung darf nicht überschritten werden, um jemandem »Größe« zubilligen zu können? Hitler dürfte der wohl am meisten geschmähte politische Führer der Neuzeit sein. Kaum jemand würde heute bei der Charakterisierung des Hauptschuldigen eines Weltkriegs, des Holocausts und der Zerstörung seines eigenen Landes das Epitheton »groß« verwenden. Es ist allerdings vorgeschlagen worden, ihm »negative Größe« zu bescheinigen. 19 Aus diesem Blickwinkel betrachtet, wiegt die Anerkennung seiner enormen, wenn auch katastrophalen Wirkung und zweifellos vorhandenen historischen Bedeutung den moralischen Abscheu auf. Abgesehen davon, dass es als implizite, wenngleich unbeabsichtigte Apologie verstanden werden kann, verweist es erneut auf die Leere des Begriffs historischer »Größe«. Selbst wenn sie adäquat definiert werden könnte, würde man den historischen Wandel in extremer Weise auf das Handeln von Einzelnen reduzieren. Es liefe auf eine Personalisierung von Geschichte hinaus, die, sofern sie nicht in einen tieferen kausalen Zusammenhang eingebettet ist, nur sehr begrenzte Erklärungskraft besitzt.
Der Definition politischer »Größe« steht noch ein weiteres Hindernis entgegen. Der Begriff ist nicht nur unklar, sondern auch für wechselnde Werte offen. Kaum ein westlicher politischer Führer der Neuzeit ist häufiger und nachhaltiger als »groß« bezeichnet worden als Winston Churchill. 20 Seine Führerschaft im Zweiten Weltkrieg wird zu Recht als wesentliche Voraussetzung des Sieges der Westalliierten, der Freiheit über die Tyrannei in der westlichen Welt betrachtet. Aber wenn man ihm »Größe« attestiert, muss man sich auch der Tatsache stellen, dass seine Ansichten über »Rasse« und Kolonien mittlerweile Anstoß erregen, und zwar so sehr, dass seine Statue in Westminster vor »Black Lives Matter«-Demonstranten geschützt werden muss, die ihn als rassistischen Imperialisten verabscheuen. Dass er die weiße »Rasse« als den einheimischen Bevölkerungen der britischen Kolonien überlegen betrachtete, entsprach der Auffassung der herrschenden Elite seiner Zeit (und vieler anderer Menschen). Viele seiner Äußerungen wirken heute abstoßend, sie drücken jedoch die Haltung seiner Zeit aus. (Mit dem Vorwurf, er sei für die furchtbare Hungersnot in Bengalen in den Jahren 1943/44 verantwortlich, schießt man allerdings über das Ziel hinaus. Ob er mehr hätte tun können, um das schreckliche Leid zu lindern, ist weiterhin umstritten. Aber der militärische Vorrang bei der Zuteilung von Schiffsraum mitten in einem Weltkrieg setzte dem, was möglich war, offensichtliche Grenzen.) 21 Für ein späteres Zeitalter ist Churchills Haltung zur »Rasse« ebenso abstoßend wie seine Billigung der Eugenik. (Den Juden stand er im Gegensatz zu vielen seiner Zeitgenossen jedoch stets positiv gegenüber; er unterstützte die Balfour-Erklärung, in der ihnen eine Heimstatt versprochen wurde, und war immun gegen Antisemitismus.) Nichts davon schmälert seine herausragenden Leistungen. Aber es führt zu moralischen Urteilen, die voller Unbehagen erwogen und subjektiv bewertet werden müssen, will man zu einer Einschätzung der »Größe« gelangen.
Nach meiner Ansicht ist es daher am besten, die Suche nach »Größe« bei politischen Führern hinter sich zu lassen. Die Frage ist nicht, ob sie nach irgendeiner nebulösen Definition »groß« waren oder nicht. Das Augenmerk sollte vielmehr auf ihrer historischen Wirkung und Nachwirkung, der Hinterlassenschaft, liegen. Dann fallen moralische Urteile fort – ob ein »großer« Führer Gutes bewirken sollte oder ob es »negative Größe« gibt (allerdings besitzt allein schon der Sprachgebrauch des Historikers moralische Untertöne). Damit ist jedoch die Frage nach der Rolle des Einzelnen in der Geschichte immer noch offen.
Dass bestimmte Einzelne herausragen, zu Berühmtheit gelangen, Macht gewinnen und in der Lage sind, sie auszuüben, um politische Veränderungen zu erreichen, hängt eng mit bestimmten Persönlichkeitszügen, ihnen unterstellter Charakterstärke und individuellen Fähigkeiten zusammen. Üblicherweise bezeichnet man eine solche Persönlichkeit als »charismatisch«. Im Allgemeinen besagt dies lediglich, dass jemand in irgendeiner Weise, die in der Regel nicht näher bestimmt wird, anziehend wirkt. Aber was für den einen attraktiv ist, ist für andere abstoßend. Und warum können die Persönlichkeitszüge eines bestimmten Menschen in der einen Zeit politisch unattraktiv und in der anderen höchst anziehend sein? Dies verweist offensichtlich auf den spezifischen Kontext, auf die Umstände und Vorbedingungen, unter denen ein Einzelner als »charismatisch« angesehen wird, was häufig erheblich zur Effektivität seiner politischen Tätigkeit beiträgt.
Für das Verständnis des Zusammenhangs zwischen der Rolle des Einzelnen und dem sozialen und politischen Rahmen, in dem seine Persönlichkeit besondere Wirkung entfaltet, ist die Art nützlich, wie der deutsche Soziologe Max Weber (1864 – 1920) den Begriff »Charisma« verwendet. Nach seiner Auffassung bedeutet er nicht notwendigerweise, dass jemandem außergewöhnliche Qualitäten eigen sind, die ihn objektiv »charismatisch« machen – auch wenn manche politischen Führer offensichtlich über besondere Talente verfügen, etwa öffentliche Reden zu halten, oder potentiell einnehmende oder attraktive persönliche Eigenschaften besitzen. Vielmehr legt er die Betonung auf die Wahrnehmung durch eine »Gefolgschaft«, die »charismatische Gemeinschaft«, die glaubt, dass der jeweilige Führer herausragende Eigenschaften besitzt. Insofern schafft die »Gefolgschaft« das »Charisma«, das sie dem »Auserwählten« zuschreibt, indem sie ihn als heldenhaft oder »groß« wahrnimmt, als Träger einer »Sendung« oder ideologischen Botschaft, die sie anziehend findet. 22 Unter modernen politischen Bedingungen wird das »Charisma« unweigerlich von regierungsnahen Medien und Massenparteien geschaffen und gestärkt, so dass das vermeintliche »Charisma« des jeweiligen politischen Führers zum großen Teil ein künstliches Produkt des »Marketings« durch eine politische Bewegung, Medienberichte oder offene Propaganda ist. Diktatoren verwenden viel Zeit und Kraft auf die Schaffung eines Personenkults, der neben einem starken Repressionsapparat dazu dient, ihre Macht zu festigen und aufrechtzuerhalten. 23 Die Massenverherrlichung der Führer diktatorischer Regime ist keine Reaktion auf echte persönliche Eigenschaften, sondern künstlich ausgelöst.
»Charismatische« Figuren können ihre spezifische Aura natürlich ebenso verlieren wie gewinnen, für gewöhnlich durch ein Versagen – manchmal ein katastrophales – und ihr Unvermögen, den an sie gestellten Erwartungen gerecht zu werden. Es gibt offensichtlich Ausnahmen von der Behauptung des rechts-konservativen britischen Politikers Enoch Powell, jede politische Karriere ende im Scheitern. Doch die Vielzahl gescheiterter politischer Führer, die man einst für herausragend gehalten, dann jedoch abgelehnt hat, verweist auf die Flüchtigkeit der Rolle von Einzelnen und die von ihnen nicht kontrollierbaren Kräfte, die ihren Handlungsspielraum einschränken und den tiefergehenden historischen Wandel bestimmen. Wer die Rolle des Einzelnen bei der Gestaltung der Geschichte einschätzen will, sollte deshalb von Anfang an nicht nur die Persönlichkeit betrachten, sondern auch die Umstände, die deren Beitrag prägen.
Einen möglicherweise ergiebigen Ansatz – der dem Konzept des »großen Mannes« diametral gegenübersteht – bietet der Anfang der 1852 verfassten Schrift Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte von Karl Marx, wo es heißt: »Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken, nicht unter selbstgewählten, sondern unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen.« 24 Man muss kein Marxist sein – und ich war nie einer –, um die Implikationen dieser Feststellung für das Verständnis des historischen Wandels zu sehen. Marx schaute nicht nach historischer »Größe«, sondern versuchte zu erklären, wieso eine unbedeutende Person, ja sogar eine Witzfigur, als welche er Louis Bonaparte, Napoleon III., betrachtete, in der Lage war, in einem Staatsstreich wie dem vom Dezember 1851 diktatorische Machtvollkommenheit zu erlangen. Seine Antwort lautete, dass keine der sozialen Klassen der französischen Gesellschaft ihre Herrschaft aufzuzwingen vermochte, was nach seiner Ansicht eine ungewöhnliche und notwendigerweise vergängliche Rahmenbedingung darstellte. Die Arbeiter waren in der Revolution von 1848 besiegt worden, während das Bürgertum gespalten und politisch schwach war. Die Schwäche sowohl des Proletariats als auch des Bürgertums ermöglichte es Louis Bonaparte, den Marx schneidend als »ernsthaften Hanswurst« charakterisiert, der auf ein »langes abenteuerliches Vagabundenleben« zurückblicke, die exekutive Gewalt im Staat zu übernehmen und durch Bestechung, Beschwatzen und sonstige Manipulationen das Lumpenproletariat und die Kleinbauern dazu zu bewegen, seine Diktatur zu unterstützen. 25
Nach deren Schaffung war das Ausmaß seiner persönlichen Machtausübung durch das Gleichgewicht der sozialen und politischen Kräfte bedingt, das die strukturelle Voraussetzung seiner Machtübernahme bildete. Es ermöglichte eine »relative Autonomie« von Klassenkräften; eine Zeitlang konnte er uneingeschränkt handeln. Man muss diese Interpretation des »Klassengleichgewichts« nicht beibehalten. Aber die Betonung der strukturellen Vorbedingungen beleuchtet die Möglichkeit, dass politische Führer Krisen und das Durcheinander außergewöhnlicher Umstände ausnutzen, um ein unübliches Maß persönlicher – häufig tyrannischer – Machtvollkommenheit zu erlangen. Allgemeiner gesprochen, stellt dieser Ansatz ein Korrektiv der verbreiteten Überbetonung der Rolle des Einzelnen bei der Gestaltung des historischen Wandels dar. Indem man am »falschen« Ende anfängt und anstelle von Persönlichkeit und individueller Leistung den Kontext und die Vorbedingungen hervorhebt, kommt man zu einer Analyse, welche die Rolle des Einzelnen nicht leugnet, aber zuerst die Rahmenbedingungen untersucht, unter denen sie möglich wurde. Aus einer solchen Perspektive hat der Politologe Archie Brown eine ebenso tiefgreifende wie anregende Analyse moderner politischer Führerschaft vorgelegt. Sein Ausgangspunkt ist, dass sich politische Führer »stets in einer historisch gewachsenen politischen Kultur« bewegen. Insbesondere Demokratien, fügt er hinzu, würden »den Handlungsspielraum der Person an der Spitze der Regierung mit gutem Grund erheblich einschränken, was nichts daran ändert, dass eine übermäßige Fixierung auf diese Person heute bedauerlicherweise sehr verbreitet ist«. 26
Selbstverständlich besitzt jedermann eine Persönlichkeit, welche die inneren Charakterzüge widerspiegelt, die in seiner Kindheit geformt und durch Erziehung, Bildung, Lebenschancen und soziales Umfeld geprägt wurden. Aber nicht jede Persönlichkeit weist Eigenschaften auf, die sie für eine Führungsrolle prädestinieren, sei es in Politik, Wirtschaft oder anderen Lebensbereichen. Psychologische Untersuchungen von Persönlichkeitstypen und Führungseigenschaften, wie sie in Wirtschaftskreisen verbreitet sind, sind in Bezug auf politische Führung vermutlich nicht allzu ergiebig. Zuverlässigkeit, Verantwortungsgefühl, geistige Offenheit, emotionale Stabilität, Geselligkeit, Fleiß, Verträglichkeit, Gleichmut unter Druck und Bereitschaft zur Teamarbeit sind bei Wirtschaftsführern zweifellos wünschenswerte Eigenschaften. 27 Aber es fällt nicht schwer, politische Führer zu nennen, die nicht in dieses Raster passen und dies sogar für nicht wünschenswert hielten, aber dennoch – wenigstens zeitweise – höchst effektiv waren (und in der heutigen Welt manchmal noch sind).
Die Bedingungen, unter denen ein bestimmter Persönlichkeitstyp als politischer Führer erfolgreich sein kann, variieren derart, dass Verallgemeinerungen schwerfallen. Was in einer etablierten Demokratie funktioniert, kann in den politischen Turbulenzen einer großen Krise völlig unwirksam sein. Ein Diktator kann persönliche Eigenschaften besitzen, welche in einer prosperierenden pluralistischen Gesellschaft die meisten Menschen abstoßen, aber in Krisen, wie sie viele Diktatoren an die Macht bringen, gutgeheißen werden. Man kann, zum Beispiel, Hitler nicht verstehen, ohne die unerträglich schmerzliche Wirkung der Niederlage im Ersten Weltkrieg und der Weltwirtschaftskrise auf die deutsche Gesellschaft zu beachten. »Wirksamkeit« kann kurzlebig sein und in eine Katastrophe führen, aber eine Zeitlang kann sie greifen und immense Folgen auslösen. Die Umstände bestimmen weitgehend die Wirkung eines bestimmten Persönlichkeitstyps.
Sie bestimmen auch die Art, wie die Macht wahrscheinlich ausgeübt wird. Laut Michael Mann gibt es vier Quellen der Macht, die miteinander in Wechselwirkung stehen: ideologische, ökonomische, militärische und politische. 28 Die Umstände diktieren, welche von ihnen in einer bestimmten Zeit dominieren. Je nach den Umständen und der besonderen politischen Konstellation gelangt wahrscheinlich ein bestimmter Persönlichkeitstyp zu Bekanntheit, findet breite Anerkennung und gewinnt institutionelle Unterstützung. Historisch waren sehr unterschiedliche Führungseigenschaften gefordert; dort, wo eine institutionalisierte Ideologie weitgehend unangefochten herrschte, waren die Anforderungen andere als in einer von Unruhe, politischer Krise oder Krieg erschütterten Gesellschaft.
Wenn Frieden herrscht, der Wohlstand zunimmt und sich ausbreitet sowie zentrale Werte – wie Menschenrechte, bürgerliche Freiheiten, pluralistische Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung – und eine relativ krisenfreie kapitalistische Wirtschaft allgemein als Grundlage einer stabilen, zivilisierten Gesellschaft anerkannt werden, werden Führer wahrscheinlich institutionelle Beschränkungen ihres Handlungsspielraums weitgehend akzeptieren und nicht danach streben, das politische System selbst zu verändern. Solche Bedingungen waren seit dem Zweiten Weltkrieg bis in jüngste Zeit in Westeuropa und den USA gegeben. Neue geopolitische Spannungen und Wirtschaftskrisen haben jedoch die prekären Fundamente der intensivierten Globalisierung enthüllt und zumindest vorübergehend einen anderen, populistischen Führungsstil gedeihen lassen – wie ihn Donald Trump in den USA und in geringerem Maß Boris Johnson in Großbritannien verkörpern.
In umstrittenen und krisengeschüttelten politischen Systemen, wie es sie zwischen den beiden Weltkriegen in großen Teilen Europas gab, fand ein völlig anderer Persönlichkeitstyp, der bereit und willens war, radikale Veränderungen zu fordern und mit massiver Gewalt durchzusetzen, Anerkennung und gelangte an die Macht. Während der Kriege selbst hatten selbstverständlich militärische Ziele und Erfordernisse Vorrang. Für eine kurze, aber überaus zerstörerische Zeit überragte die Rolle der Militärmacht alles andere. Unter solchen Umständen mussten sich selbst Diktatoren wie Hitler, Mussolini und Stalin teilweise deren Forderungen und Zwängen beugen. Militärkommandeure, deren Fähigkeiten sich von denjenigen der politischen Führer unterschieden, hatten in der Praxis einen großen Teil der Macht in Händen, auch wenn sie nur relativ autonom von der politischen Führung waren.
Individuelle Macht kann, nach Max Weber, als Fähigkeit eines Führers gesehen werden, seinen eigenen Willen auch gegen Widerstand durchzusetzen. 29 In pluralistischen, liberalen Demokratien drückt sich dieser Wille für gewöhnlich als Konsensentscheidung eines Kabinetts oder anderer Regierungsorgane aus, und die Macht ist zudem über ein Netz von Institutionen und Organisationen über die Gesellschaft verteilt. Opposition findet in der Regel im Kontext eines Parlaments oder einer anderen Versammlung, durch die Massenmedien sowie gelegentlich auch durch Demonstrationen und im Regierungsapparat selbst statt. Aber sie wird, so lautstark oder sogar erhitzt sie sein mag, innerhalb eines Systems geäußert, das auf Konsens beruht, und ein Regierungschef ist zumeist immer noch in der Lage, mit Hilfe eines die Gesellschaft durchdringenden institutionellen Netzwerks seinen Willen durchzusetzen. Macht kann daher, mit Michael Manns Worten, als »infrastrukturell« definiert werden. Es ist Macht durch den Staat.
Die entgegengesetzte Art der Macht in Diktaturen ist die »despotische Macht« oder Macht über den Staat. Hier wird die Macht direkt von einer autoritären Führung ausgeübt, die vollkommenen Gehorsam auf Befehle von oben erwartet und – mit einem großen Maß an Zwang – einfordert. 30 Opposition wird unterdrückt, die öffentliche Meinung massiv manipuliert, und der Wille des Führers ist offener und direkter auf die Machtausübung ausgerichtet. Aber auch die despotische Macht ist nicht völlig unabhängig von der infrastrukturellen Macht. Ihr Führer braucht starke institutionelle Unterstützung durch Militär, Sicherheitsdienste, Polizei, Justiz sowie eine Vielzahl von Parteiorganisationen. Selbst wenn die Macht des Führers schwindet, wie zum Beispiel diejenige Hitlers in den letzten Kriegsmonaten, kann der Unterstützungsmechanismus sicherstellen, dass die Diktatur extrem stark bleibt. Die Frage nach dem Verhältnis von Persönlichkeit und Macht umfasst also über die Biographie und die psychologischen Prädispositionen und persönlichen Eigenschaften von politischen Führern hinaus auch die Bedingungen, die ihre Führung ermöglichen und begrenzen.
Im Folgenden werden Ansichten des 20. Jahrhunderts am Beispiel mehrerer politischer Figuren präsentiert. Sie alle waren zuzeiten Staats- oder Regierungschef und ragen heraus, weil sie ihre Macht in besonderer Weise zum Guten oder – öfter – zum Schlechten nutzten. Ich habe mich auf Fallstudien über einige europäische Führer beschränkt, deren Wirkung von großer Bedeutung war und zudem über ihr eigenes Land hinausreichte. Andere Persönlichkeiten wären zweifellos auch in Frage gekommen. Nach reiflicher Überlegung habe ich einige – Willy Brandt und François Mitterrand zum Beispiel – ausgeschlossen, für deren Aufnahme einiges sprach. Sie hätten eine Gruppe von politischen Führern repräsentiert, überwiegend Sozialdemokraten oder Liberale der einen oder anderen Färbung, die vorwiegend in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wichtige Beiträge zum Fortschritt von sozialer Gerechtigkeit und Menschenrechten geleistet haben. Mein Schwerpunkt lag jedoch auf Krisenbedingungen, dem Führertyp, den diese hervorbringen, und der Rolle von Einzelnen an entscheidenden historischen Wegscheiden, und dies hat den Fokus unweigerlich – und vielleicht irrigerweise – von einer solchen Art der Führung entfernt. Andererseits gab es kaum einen Grund, die Führer, die ich aufgenommen habe, auszuschließen. Ihre Bedeutung ist offensichtlich.
Der Kreis der hier Behandelten hätte leicht um nichteuropäische Führer erweitert werden können – um US-Präsidenten von Woodrow Wilson bis Bill Clinton beispielsweise, aber auch um andere Figuren mit weltweiter Wirkung wie Mao Zedong oder Ajatollah Khomeini. Immerhin haben diese durch ihr Handeln wesentlich, wenn auch indirekt, zur Gestaltung von Europas 20. Jahrhundert beigetragen. Am schwersten fiel mir die Entscheidung im Fall von Franklin Delano Roosevelt, der zweifellos ein bedeutender US-Präsident und zudem eine faszinierende Persönlichkeit war. Die Rolle, die er während des Zweiten Weltkriegs nicht nur in der amerikanischen, sondern auch in der europäischen Geschichte spielte, muss nicht eigens hervorgehoben werden. Aber die Einbeziehung eines außereuropäischen Führers hätte unweigerlich den Einwand heraufbeschworen: Warum dann damit aufhören? Weitere Personen einzubeziehen, hätte jedoch bedeutet, die Untersuchung auf politische Arenen und die Rolle von Einzelnen in ihnen auszuweiten, die weit vom europäischen Kontinent entfernt liegen. Es wäre in solchen Fällen unmöglich gewesen, Überlegungen über die Innenpolitik anderer Länder zu vermeiden, die zwar den jeweiligen Führer geprägt, aber bestenfalls marginalen Einfluss auf Europa hatte. Dies hätte den Rahmen des hier Möglichen gesprengt.
Genauso wenig behandle ich Personen, wie einflussreich sie auch gewesen sein mögen, die zwar tiefe Spuren in der Politik hinterließen – in der Opposition oder in Protest- oder Widerstandsbewegungen –, aber nie Staats- oder Regierungschef waren. Aus diesem Grund musste ich auch Jean Monnet und Robert Schuman ausschließen, die, obwohl sie nie an der Spitze eines Staates oder einer Regierung standen, zu den Architekten dessen wurden, was schließlich die Europäische Union werden sollte. Dies war zweifellos eine der bedeutsamsten Entwicklungen des 20. Jahrhunderts, allerdings im Wesentlichen keine individuelle Schöpfung, sondern ein kollektives Projekt. Auch außerhalb der Politik sind natürlich leicht Figuren zu finden, die in Kunst, Wissenschaft, Medizin, Wirtschaft und auf vielen anderen Gebieten Herausragendes geleistet haben. Aber in diesem Buch geht es nicht um solche Persönlichkeiten.
Zusammengenommen haben die elf hier behandelten europäischen politischen Führer und die eine politische Führerin jedoch unbestreitbar den Gang der europäischen Geschichte im 20. Jahrhundert tiefgreifend beeinflusst, die meisten von ihnen in einer Krisenzeit für ihr Land. Lenin ging aus der Krise des Zarenregimes während des Ersten Weltkriegs hervor. Die Krise des verheerenden Bürgerkriegs, der auf die bolschewistische Revolution folgte, und das Machtvakuum nach Lenins Tod bildeten die Voraussetzungen für Stalins Machtübernahme. Mussolini war ein Nutznießer der politischen Nachkriegskrise in Italien. Noch weit über ein Jahrzehnt nach seinem Ende bildete das Trauma des Ersten Weltkriegs die Grundlage für Hitlers Aufstieg zur Macht inmitten einer umfassenden Staats- und Gesellschaftskrise, die in der Weltwirtschaftskrise der frühen 1930er Jahre die Zerstörung der deutschen Demokratie nach sich zog. Franco kam als Sieger eines grausamen Bürgerkriegs in seinem krisengeschüttelten Land an die Macht. Churchill wurde in einer ernsten politischen Krise, während deutsche Armeen weite Teile Westeuropas überrannten, zum Premierminister ernannt. De Gaulles Macht speiste sich aus zwei Krisen – derjenigen des besiegten und besetzten Frankreichs und später der Krise des Algerienkriegs. Tito zementierte seinen Machtanspruch durch seine Führung des militärischen Widerstands in der facettenreichen Krise des vom Krieg zerrissenen, besetzten Jugoslawiens. Gorbatschow wurde zum Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion gewählt, als diese mit der tiefreichenden Krise ihres gescheiterten ökonomischen und politischen Systems zu kämpfen hatte.
Auch in den Nachkriegsdemokratien brachten Krisen außerordentliche Führer hervor. Adenauers Führung war zum großen Teil bedingt durch die kritische Lage Deutschlands nach seiner Zerstörung und Besetzung im Jahr 1945 sowie durch die akuten Spannungen und Gefahren des Kalten Krieges. Thatcher gelangte in der Wirtschafts- und in mancher Hinsicht auch Kulturkrise, die Großbritannien in den 1970er Jahren erlebte, an die Spitze.
Die zwölfte Fallstudie ist die einzige, deren Protagonist nicht durch eine wie auch immer geartete nationale Krise an die Macht gelangte. Helmut Kohl übernahm zwar in den Nachwehen der ökonomischen Schwierigkeiten nach dem Ölschock von 1979 – dem zweiten nach dem ersten von 1973 – in Westdeutschland die Regierung, aber in einer grundsätzlich von politischer Stabilität und Prosperität gekennzeichneten Lage. Er amtierte bereits sieben Jahre als Bundeskanzler – und dies, verglichen mit seinen beiden unmittelbaren Vorgängern, Helmut Schmidt und Willy Brandt, auf relativ unauffällige Weise –, bevor er, als der Kalte Krieg zu Ende ging und die deutsche Vereinigung zu einem realistischen Ziel wurde, mit eine Krise konfrontiert war, die man als »gutartig« bezeichnen könnte. Aber in diesem Kontext wurde auch er zu einer bedeutenden Figur in Europas 20. Jahrhundert.
In den Fallstudien wird eine Reihe von Annahmen geprüft:
Die Wirkung von Einzelnen ist in oder unmittelbar nach großer politischer Unruhe, wenn vorhandene Strukturen zusammenbrechen oder zerstört werden, am größten.
Entschlossene Verfolgung leicht zu definierender Ziele und ideologische Unnachgiebigkeit, kombiniert mit taktischem Geschick, versetzen bestimmte Einzelne in die Lage, sich hervorzutun und Anhänger zu gewinnen.
Die Ausübung und das Ausmaß der persönlichen Macht sind durch die Umstände der Machtübernahme und die erste Phase ihrer Konsolidierung bedingt.
Machtkonzentration vergrößert das Wirkpotential des Einzelnen, häufig mit negativen, manchmal sogar katastrophalen Folgen. 31
In Kriegen unterliegen sogar mächtige politische Führer den überwältigenden Zwängen der Militärmacht.
Macht und Handlungsspielraum von Führern hängen in erheblichem Maß von der institutionellen Basis und der relativen Stärke ihrer Unterstützer ab, vor allem im zweiten Rang der Macht, aber auch in der breiteren Öffentlichkeit.
Eine demokratische Regierungsform legt dem Einzelnen hinsichtlich seiner Handlungsfreiheit und des Ausmaßes, in dem er den historischen Wandel bestimmen kann, die engsten Zügel an.
Es gibt keine mathematische Formel für die relative Gewichtung der persönlichen und unpersönlichen Faktoren, die eine historische Veränderung bewirkt haben. Das Augenmerk auf bestimmte Geschehnisse zu richten – auf prägende oder schicksalhafte Entscheidungen zum Beispiel –, bei denen persönliches Eingreifen eine bedeutende Wirkung erzielte, könnte jedoch helfen, allgemeinere Schlussfolgerungen zu ziehen.
Dieses Buch handelt von historischer Führung im 20. Jahrhundert, nicht von heutigen Führern in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts. Gleichwohl sind die in ihm aufgeworfenen Fragen in unserer eigenen Zeit ebenso relevant wie in derjenigen früherer Generationen, die Fragen danach, unter welchen Bedingungen welche Persönlichkeitstypen an die Macht gelangen, nach den staatlichen Strukturen, in denen die Machtausübung stattfindet, und nach den Bedingungen, unter denen einzelne Persönlichkeiten eine entscheidende Rolle im historischen Wandel zu spielen vermögen. 32
eins
wladimir iljitsch lenin
Revolutionsführer, Gründer des bolschewistischen Staats
Lenin hat am 3. Oktober 1922 nach längerer Krankheit den Vorsitz in einer besonders gut besuchten Sitzung des Rats der Volkskommissare (Sownarkom) inne. Hinter ihm stehen Alexei Rykow (links, bezeichnet mit der Ziffer 2) und Lew Kamenew (rechts, bezeichnet mit der Ziffer 3), die beide später im Zuge von Stalins Säuberungen hingerichtet wurden. Dies war möglicherweise Lenins letzte Sownarkom-Sitzung, da er ab Dezember 1922 wieder schwer erkrankt war. Hulton Deutsch / Corbis Historical
Zu den vielen weitreichenden Folgen des vom Ersten Weltkrieg ausgelösten enormen Aufruhrs gehörte eine, die in Europa und der Welt sieben Jahrzehnte und darüber hinaus nachwirken sollte: die bolschewistische Revolution von 1917. Im Zentrum dieses welterschütternden Ereignisses stand Wladimir Iljitsch Uljanow, der unter dem Pseudonym, das er um 1902 herum angenommen hatte, in die Geschichte einging: Lenin. 1
Lenin kann Anspruch darauf erheben, an die – oder in die Nähe der – Spitze der Macher von Europas 20. Jahrhundert gestellt zu werden. Dieser Anspruch wirft jedoch einige naheliegende Fragen auf: Inwieweit hing ein Ereignis von solchem Ausmaß – und solcher Nachwirkung – wie die russische Revolution von einer einzelnen Person ab? Welchen persönlichen Beitrag leistete Lenin zur Errichtung, Festigung und anhaltenden Wirkung der bolschewistischen Herrschaft? Immerhin war er seinerzeit nicht die dynamischste revolutionäre Triebkraft in Russland. Dies war der als »revolutionäres Genie« apostrophierte Leo Trotzki. 2 Außerdem starb er im Januar 1924, nach nicht mehr als sechs Jahren an der Macht, wobei er in den letzten rund 15 Monaten durch eine Reihe von Schlaganfällen zumeist außer Gefecht gesetzt war. Was tat er persönlich, um die revolutionäre Umwälzung Russlands zu gestalten, und wie konnte er in einem derart riesigen Land wie Russland – das größer ist als das gesamte übrige Europa – sicherstellen, dass seine Politik ausgeführt wurde?
Warum also entpuppte er sich als Führer der Revolution, die den Lauf der russischen und europäischen Geschichte veränderte? Er war keineswegs der Einzige, der entschlossen war, Russland umzugestalten. Die Unzufriedenheit mit der Zarenherrschaft und die Verbreitung des Marxismus im russischen Reich seit den 1880er Jahren hatten viele Möchtegernrevolutionäre hervorgebracht, unter ihnen bedeutende Figuren der zahlreichen subversiven politischen Gruppen, die in dieser Zeit entstanden. Was war an Lenin so besonders? Wie und warum wurde er allgemein als beherrschender Revolutionsführer anerkannt? Welche Persönlichkeitszüge ließen ihn zur obersten Macht im neuen Staat werden und ermöglichten es ihm, diese Stellung in dem unmittelbar an die Revolution anschließenden Bürgerkrieg zu behalten? Und warum hatte Lenin als Repräsentant eines Staats, dessen Philosophie die Bedeutung unpersönlicher Determinanten der Geschichte hervorhob und die Rolle des Einzelnen dementsprechend herunterspielte, innerhalb und außerhalb der Sowjetunion eine solch profunde und anhaltende Nachwirkung? Diese Fragen lassen mehr als nur erahnen, welch faszinierendes Fallbeispiel Lenin darstellt, wenn man den Einfluss des Einzelnen auf die Geschichte untersuchen will.
Vorbedingungen der Macht
Das Russland von 1917 war reif für die Revolution. Die enormen Todesopfer im Ersten Weltkrieg, eine zunehmende Demoralisierung der Frontsoldaten, unerträgliche Härten für die Zivilbevölkerung und die halsstarrige Weigerung des Zaren, Reformen auch nur in Erwägung zu ziehen, schufen eine akute Aufstandsstimmung. Von Streiks, Demonstrationen und Hungerunruhen begleitet, wurde die Forderung nach Frieden immer lauter, während der Zar zunehmend in Verruf geriet. Tatsächlich brach im Februar des Jahres die Revolution aus. Lenin hatte damit nichts zu tun: Er befand sich noch im Schweizer Exil.
Schon im Herbst 1905, als die innere Unzufriedenheit durch die demütigende Niederlage im Russisch-Japanischen Krieg verstärkt wurde, hatte es einen kurzlebigen Revolutionsversuch gegeben. Eine Mischung aus staatlicher Repression und überwiegend kosmetischen Verfassungszugeständnissen in Richtung einer repräsentativen Regierung nahmen der Gefahr, in der das Regime schwebte, die Spitze. Die Macht der zaristischen Autokratie hielt stand. Allerdings war das Ferment des Aufruhrs nicht aufgelöst, sondern nur eingedämmt.
Die Realität ließ nicht zu, dass das politische System durch graduelle Reformen grundsätzlich verändert werden konnte. Die Zivilgesellschaft war schwach, und ein unabhängiges Fundament des Rechts gab es nicht. Gewalt war allgegenwärtig. Die grundbesitzende Mittelschicht war klein und die Intelligenz winzig, wenn auch unter dem Eindruck staatlicher Unterdrückung und sich ausbreitender revolutionärer Ideen unverhältnismäßig radikalisiert. Jenseits einer kleinen Elite hatten nur wenige das Gefühl, einen Anteil am sozioökonomischen System und an dem Regime, das es aufrechterhielt, zu besitzen. Über achtzig Prozent der Bevölkerung des riesigen und überwiegend armen Landes waren Bauern, von denen viele dem Staat und seinen Beamten feindselig gegenüberstanden. Die meisten Bauern lebten unter primitiven Bedingungen in Dorfgemeinschaften und waren ökonomisch von Grundbesitzern abhängig. In den industriellen Großstädten, die in den vorangegangenen zwei Jahrzehnten enorm gewachsen waren, verfügte ein armes, unterdrücktes Proletariat über keinerlei Rechtsmittel, das ihm erlaubt hätte, seine Klagen vorzubringen. Anders als die weit größere deutsche Industriearbeiterschaft, in der Marxisten die wahrscheinliche Quelle der Revolution gesehen hatten und die am Vorabend des Ersten Weltkriegs von der größten Arbeiterpartei Europas repräsentiert wurde, besaß das russische städtische Proletariat weder eine Stimme in der russischen Gesellschaft noch irgendwelche politischen Mittel, um sie zu verändern. Dies machte es – unter den richtigen Umständen – für eine revolutionäre Mobilisierung empfänglich. 3
Der Erste Weltkrieg schuf diese Umstände. Durch die katastrophalen Verluste – über zwei Millionen Tote und etwa doppelt so viele Verwundete – und das enorme Kriegselend war eine Situation entstanden, die 1905 nicht vorhanden war. So groß die Unzufriedenheit damals auch gewesen war, die streikenden Arbeiter und die rebellischen Teile der Bauernschaft hatten die Unterschiede ihrer Interessen nicht überbrücken können, um eine kohärente, vereinigte revolutionäre Streitmacht zu bilden. 1917 dagegen verschmolz das revolutionäre Potential der Industriearbeiter zumindest vorübergehend mit demjenigen der Bauern. Auch ein anderer Unterschied war von entscheidender Bedeutung. 1905 war das Militär, eine wesentliche Stütze des Regimes, trotz einiger Unruhen und Meutereien in der Marine nach der Niederlage gegen Japan, in seiner überwältigenden Mehrheit dem Zaren treu ergeben gewesen. 1917 jedoch erwies sich die anschwellende Krise in der russischen Armee als unaufhaltbar. Defätismus, Desertionen und Demoralisierung führten dazu, dass immer lauter nach Frieden gerufen wurde, und schürten die Wut auf den Zaren und das von ihm angeführte Regime, das man für die Notlage verantwortlich machte. Die extreme Unzufriedenheit der Frontsoldaten verband sich mit der revolutionären Stimmung unter Arbeitern und Bauern, was das Zarenregime in ernste Gefahr brachte. Ein weiterer Revolutionsversuch wie 1905 war jedenfalls zu erwarten. Ohne den Krieg als einigenden Faktor für das Verlangen, das Zarenregime zu stürzen, hätte er allerdings wie schon 1905 erfolglos enden können. 4
Noch ein weiterer Unterschied kam hinzu. Eine erfolgreiche Revolution braucht Führung und Organisation. 1905 fehlte sowohl eine Führung, die den Aufruhr auf ein Ziel hätte ausrichten und die disparaten rebellischen Kräfte zu einer einzigen, unaufhaltsamen Streitmacht hätte vereinigen können, als auch eine Organisation. 1917 gab es Lenin und seine zwar kleine, aber wild entschlossene und eng verschworene Partei, die Bolschewiki. Das Zusammentreffen von revolutionärem Aufstand und Revolutionsführer war jedoch alles andere als unvermeidlich. Tatsächlich hing es von einem höchst unwahrscheinlichen Zufall ab, auf den Lenin keinen Einfluss hatte, ohne den aber die russische Revolution zweifellos anders verlaufen wäre und wohl auch ein anderes Ergebnis gehabt hätte.
Nur einem bemerkenswerten Glücksfall hatte Lenin es zu verdanken, dass er den enormen Aufruhr, der dem Aufstand in Petrograd – wie St. Petersburg zu dieser Zeit genannt wurde – in der letzten Februarwoche folgte, ausnutzen konnte. Der Ausbruch des Aufstands hatte ihn überrascht. Obwohl er damit gerechnet hatte, dass irgendwann eine Revolution ausbrechen würde, hatte er noch im Januar 1917 geglaubt, dass er selbst sie wahrscheinlich nicht mehr erleben würde. 5 Aber als der Zar am 2. März gezwungen war abzudanken, wusste er, dass die ersehnte Revolution da war. Diesmal wollte und musste er, anders als 1905, so schnell wie möglich nach Russland zurückkehren. Inmitten eines europäischen Krieges war dies indes leichter gesagt als getan. Doch an dieser Stelle griff das Schicksal ein und – es ist nicht zu viel gesagt – veränderte den Lauf der europäischen Geschichte.
Es ist kaum vorstellbar, wie Lenin ins revolutionäre Petrograd hätte gelangen können, wenn die deutsche Regierung ihm und rund dreißig seiner Mitstreiter nicht über Mittelsmänner gestattet hätte, mit einem Zug von der Schweiz nach Russland zu fahren. Es war natürlich kein reiner Zufall und noch nicht einmal eine unverständliche Fehlkalkulation der Deutschen, dass sie einwilligten, Lenin zu helfen. Angesichts zunehmenden militärischen Drucks auf Deutschland hielten sie es für vorteilhaft, die Revolution in Russland zu fördern, um so den Weg für einen Waffenstillstand an der Ostfront zu ebnen, der es ihnen erlauben würde, sich ganz auf den Kampf im Westen zu konzentrieren. Aber hätte man Lenin nicht geholfen und wäre er in jenem Frühjahr nicht nach Russland zurückgekehrt, ist es zweifelhaft, dass er unter den Revolutionären die Anerkennung gefunden hätte, die es ihm ermöglichte, in der radikaleren Revolution im Oktober die Führung zu übernehmen. Kein Geringerer als Trotzki glaubte, dass deren Erfolg von Lenin abhing. 6 Dass er vor Ort sein und sie anführen konnte, verdankte er jedoch infolge einer bizarren Ironie der Geschichte den deutschen Imperialisten, die er so sehr verachtete.
Als Lenin im April 1917 nach Russland zurückkehrte, war er für die große Mehrheit der Russen ein Unbekannter. Selbst unter den Arbeitern kannten nur wenige seinen Namen. 7 Er hatte seit einem Jahrzehnt im Exil gelebt, überwiegend in Westeuropa. Die Bolschewiki, an deren Spitze er stand, waren bei allem Fanatismus und aller Entschlossenheit nicht mehr als eine kleine revolutionäre Gruppe mit höchstens 23 000 Mitgliedern und ohne Massenbasis. 8 Für die außerordentliche Entwicklung dieses harten Kerns zu einer rasch wachsenden Partei, die innerhalb weniger Monate die Macht im Staat übernahm, spielte Lenins zielstrebiger politischer Scharfsinn eine entscheidende Rolle. Weder die Sozialrevolutionäre noch die Menschewiki, die beiden Hauptrivalen der Bolschewiki im Jahr 1917, besaßen einen Führer, der es mit dem Organisationstalent Lenins aufnehmen konnte.
Dessen Chancen, an die Macht zu kommen, schienen anfangs nicht sehr groß zu sein. Die Februarrevolution hatte den Zaren gestürzt und zur Bildung einer Provisorischen Regierung geführt, deren Ziel es war, die Grundlagen für die Einführung weitreichender sozialer Freiheiten zu legen und eine verfassungsmäßige Herrschaft aufzubauen. Das Ausmaß des politischen Aufruhrs und des revolutionären Furors zerstörte jedoch jede Hoffnung auf die Errichtung einer stabilen sozialen Demokratie auf der Grundlage eines rechtlichen Rahmens für eine verfassungsmäßige Regierung. Dies bedeutete aber nicht, dass die Provisorische Regierung von Anfang an dazu verdammt war, einer zweiten, diesmal bolschewistischen Revolution zu weichen. Schritte auf eine Beendigung des Krieges zu wären populär gewesen und hätten ihr Zeit erkauft. Damit hätte sie die bolschewistische Revolution möglicherweise abwenden können. 9 Stattdessen begann die Provisorische Regierung zu einem Zeitpunkt, als ihre Autorität bereits sichtlich schwand, eine neue, katastrophale Militäroffensive, deren Scheitern das vorhersehbare Ergebnis hatte: Sie selbst war diskreditiert, und das revolutionäre Feuer wurde weiter angefacht.
Anfangs schien eine Revolution unter Führung von Lenins Bolschewiki tatsächlich unwahrscheinlich zu sein. Lenin traf erst in der Nacht des 3. April in Petrograd ein. Es war das erste Mal seit zehn Jahren, dass er wieder einen Fuß auf Heimaterde setzte. Und binnen wenigen Wochen verschwand er erneut. Um der Verhaftung zu entgehen, war er gezwungen abzutauchen. Am 6. Juli ging er in den Untergrund, und drei Tage später überquerte er verkleidet die Grenze nach Finnland. Es schien, als sei er erledigt. In Wirklichkeit stand er gerade erst am Anfang.
Persönlichkeit und Auftritt eines Revolutionsführers
Lenins äußere Erscheinung war wenig einnehmend. Der amerikanische Journalist John Reed, der ihn während der Revolution von 1917 aus nächster Nähe beobachtet hatte, beschrieb ihn als untersetzten kahlköpfigen Mann mit »kleinen beweglichen Augen, großem sympathischen Mund und kräftigem Kinn«. In seinen »armseligen Kleidern« gab er einen »seltsamen Führer des Volkes« ab. Er führte »nur dank der Überlegenheit seines Intellekts« und der »Fähigkeit, tiefe Gedanken in einfache Worte zu fassen«. 10 Aber wie »seltsam« seine äußere Erscheinung auch war, niemand, der ihm begegnete, konnte ihn übersehen. Noch bestand irgendein Zweifel an seiner Intelligenz (die er in seiner politischen Laufbahn mit überragendem politischen, manipulativen und organisatorischen Geschick paaren sollte). Er besaß erstaunliche Energie und strahlte Tatkraft aus. Außerdem war er ein mitreißender Redner – für jene, die auf einer Wellenlänge mit ihm waren – und begabter Polemiker, dessen scharfer Verstand und aggressiver Debattenstil ihn in die Lage versetzten, in den meisten mündlichen und schriftlichen Disputen die Oberhand zu gewinnen. Ferner wusste er in seinen vielen Schriften die marxistische Dialektik meisterhaft anzuwenden. Aber es waren nicht nur seine geistigen Fähigkeiten, die ihn auszeichneten. Er war zudem enorm willensstark und selbstsicher, und ein cholerisches, launisches Temperament, Unduldsamkeit sowie die Gewissheit, immer recht zu haben, machten es jedem, der eine offenere Sichtweise hatte, weniger dogmatisch dachte oder weniger Selbstvertrauen besaß, schwer, seine Dominanz abzuwehren.
Lenin lebte für die Politik. Alles andere zählte nicht. Es war schwer, sich mit ihm anzufreunden. Tatsächlich besaß er kaum echte Freunde. Selbst der spätere enge Zirkel von Gefährten in der bolschewistischen Führung bestand aus Genossen im politischen Kampf, nicht aus persönlichen Freunden. Sein kleiner Kreis von Vertrauten erstreckte sich kaum über seine Frau, seine Schwestern, seinen jüngeren Bruder und seine einstige Geliebte Inessa Armand hinaus, die ihm auch nach ihrer zweijährigen Affäre, die 1912 endete, bis zu ihrem Tod im Jahr 1920 eng verbunden blieb. Lenin war ein Zwangscharakter, der pedantisch auf einer bestimmten Ordnung beharrte; schon wenn die sauber aufgereihten Stifte auf seinem Schreibtisch durcheinandergerieten, drohte ein Wutausbruch. Er war ehrgeizig und widmete seine ganze Kraft ebenso zielstrebig wie entschlossen der Aufgabe, die russische Gesellschaft durch eine Revolution umzugestalten. Zudem war er intolerant und gegenüber marxistischen Ideologen mit anderen Auffassungen völlig unduldsam, selbst wenn er sie einst als enge Verbündete betrachtet hatte. Tatsächlich war es praktisch unausweichlich, dass er sich irgendwann gegen einstige Gefährten wandte und mit anderen marxistischen Theoretikern zerstritt. Und gegenüber Klassenfeinden – eine sehr flexible Kategorie – war er gnadenlos und befürwortete oder billigte Terror, um sie zu vernichten.
Sein Leben lang hatte Lenin mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Lähmende Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, eine Nervenanspannung, die ihn an den Rand des Zusammenbruchs brachte, Magenschmerzen und tiefe Müdigkeit – die angesichts seines Arbeitspensums kaum überrascht – waren wiederkehrende Probleme, die sich in gelegentlichen unmäßigen Wutausbrüchen entluden. Es ist fast sicher, dass er unter Bluthochdruck und Arteriosklerose litt, die zu den schweren Schlaganfällen führten, an denen er Anfang 1924 schließlich sterben sollte. Bevor er 1917 die Macht in Russland ergriff, hatte er sich von dem Druck, der seine häufigen Krankheitsanfälle auslöste oder verschlimmerte, in ausgiebigen Urlauben erholen können, in denen er lange Spaziergänge unternahm, schwamm und sich auf andere Weise körperlich betätigte. 11 Die Entspannung gab ihm neue Kraft. Aber nach 1917 kam er kaum noch dazu, sich zu entspannen. Möglicherweise hat er gespürt, dass er wie schon sein Vater früh sterben würde. Er hatte sich lange als vom Schicksal auserkoren betrachtet. Vielleicht verstärkte die Vorahnung eines frühen Todes seine Entschlossenheit, sein Lebenswerk durch die Vollendung der Revolution so schnell wie möglich abzuschließen. 12
Seine Herkunft wies ihn auf den ersten Blick kaum als künftigen Revolutionsführer aus. Er war 1870 in Simbirsk, einer Stadt an der Wolga, rund 890 Kilometer östlich von Moskau, in eine gutbürgerliche Familie hineingeboren worden. Die Uljanows waren eine gebildete, an Literatur, bildender Kunst und Musik interessierte Familie, in der die damals üblichen bürgerlichen Werte hochgehalten wurden, wie Ordnung, Hierarchie und Gehorsam. 13 Man war nicht offen politisch und verstand sich als treue Untertanen des Zaren, obwohl man liberale, modernisierende Reformen begrüßte, die Russland den aufgeklärten westlichen Gesellschaften näher bringen würden – ein Standpunkt, der bei den konservativen Teilen der Simbirsker Oberschicht, so geachtet die Uljanows waren, wenig Anklang fand.
Wladimir war das dritte von sechs überlebenden Kindern (zwei starben im Säuglingsalter) und blieb seiner Familie stets verbunden, insbesondere – bis zu ihrem Tod im Jahr 1916 – seiner Mutter, seiner älteren Schwester Anna und seiner jüngeren Schwester Maria, die ihm bis zum Ende treu ergeben sein sollte. Seine Eltern hegten ehrgeizige Pläne für ihre Nachkommen und achteten streng auf ihre Ausbildung. Wladimir war ein intelligenter Junge, der gern las und das Gymnasium 1887 als Jahrgangsbester mit außerordentlich guten Noten in allen Fächern beendete. Im August dieses Jahres nahm er an der Universität von Kasan, ein Stück die Wolga hinauf, das Studium der Rechtswissenschaft auf. Nur vier Monate später wurde er jedoch zusammen mit einigen Kommilitonen von der Universität verwiesen, weil er sich an einem Protest beteiligt hatte, der die Aufhebung von Restriktionen für Studentenvereinigungen gefordert hatte. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits mit revolutionären Aktivisten in Kontakt gekommen und hatte begonnen, sich mit revolutionärer Politik zu beschäftigen.
Schon 1886 war sein Bruder Alexander, der sich während seines naturwissenschaftlichen Studiums an der Universität von St. Petersburg radikalisiert hatte, einer Gruppe von Freunden beigetreten, die von einer Umwälzung der russischen Gesellschaft träumten und konspirativ planten, durch die Ermordung von Zar Alexander III. eine Revolution auszulösen. Ihr amateurhafter Attentatsversuch am 1. März 1887 führte jedoch nur zu ihrer Verhaftung und Vernehmung durch die zaristische Geheimpolizei Ochrana. Alexander legte ein Geständnis ab, wurde zum Tod verurteilt und am 8. Mai des Jahres gehängt. Seit der Hinrichtung seines Bruders empfand Wladimir einen brennenden Hass auf die Dynastie der Romanows. Er war jetzt überzeugt, dass der Zarismus gestürzt werden müsse. Vielleicht brachte Alexanders Tod eine schon vorher latente Haltung zum Vorschein, doch dies ist nicht mehr als Spekulation. Auf jeden Fall sollte man der Versuchung, nach einer psychologischen Erklärung dessen, was nachfolgte, zu fahnden, grundsätzlich widerstehen. Was auch immer der ursprüngliche Auslöser war, Wladimir begann subversive Literatur zu lesen, und sein Engagement für die künftige Revolution sollte ihn in den nächsten dreißig Jahren – dem größten Teil seines Lebens – ausfüllen, bis zu der kurzen, dramatischen Phase nach 1917, in der er als Praktiker der realen Revolution wirkte.
Er begann in die marxistische Gedankenwelt einzudringen und fand Anschluss an den kleinen Kreis entschlossener Revolutionäre. In den 1890er Jahren führte dies zu einer Verhaftung durch die Ochrana und einer – komfortablen – Verbannung in einen angenehmen Teil Ostsibiriens, wohin ihm seine künftige Ehefrau – sie heirateten 1898 – Nadeschda Krupskaja folgte, die sich selbst bereits der revolutionären Sache verschrieben hatte. Aus Angst vor weiteren Verhaftungen und Gefängnisaufenthalten ging Lenin im Jahr 1900 ins selbstgewählte Exil, womit eine Odyssee über Zürich, München, Paris, Genf und Krakau begann, um nur die Wohnorte zu nennen, von denen aus er Abstecher in verschiedene andere europäische Städte unternahm. 14 Der künftige Arbeiterführer war nie gezwungen, seinen Lebensunterhalt durch konventionelle regelmäßige Lohnarbeit zu verdienen. Er wurde – auch noch in seinen Vierzigern – von seiner Mutter und in zunehmendem Umfang auch von reichen Sympathisanten der Bolschewiki finanziell unterstützt. Schließlich war er in der Lage, sich selbst aus der Parteikasse ein Gehalt zu zahlen. Es war genug, um ein relativ bescheidenes Leben zu führen, und ermöglichte es ihm, sich – fern von Russland – ganz dem Nachdenken über die Revolution und ihrer Planung zu widmen. 15
Lenins Persönlichkeit, die in seinen frühen Jahren allenfalls zu erahnen war, nahm in den vielen Jahren deutliche Züge an, die er damit zubrachte, zu schreiben, an Versammlungen und Kongressen teilzunehmen, sich an Disputen zu beteiligen, zu organisieren und Vorbereitungen für den revolutionären Moment zu treffen, von dem er sicher war, dass er kommen würde, auch wenn er nichts tun konnte, um ihn herbeizuführen. Wie zwecklos diese Existenz auch häufig erscheinen mochte, sie festigte in den Augen derjenigen, die mit ihm in Kontakt kamen, und nicht zuletzt auch den eigenen seine Glaubwürdigkeit. Die Ideen, die er entwickelte, verliehen ihm in den Reihen der revolutionären Opposition die Aura eines visionären Führers im Wartezustand. Aber in dem unablässigen Kampf um Vorrang im Milieu der Möchtegernrevolutionäre erlernte er auch viele der Tricks des politischen Geschäfts.
Zum ersten Mal als führender russischer Theoretiker der marxistischen Revolution wahrgenommen wurde er 1902, als seine Schrift Was tun?





























