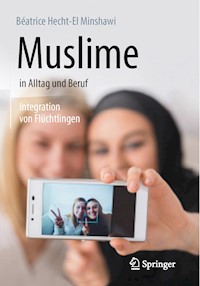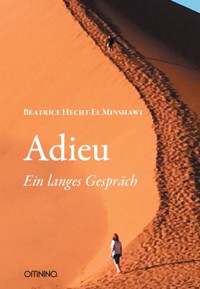
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Omnino Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Anderswo hätten wir sein wollen, neue Düfte, Farben und Geräusche aufnehmen, Menschen treffen unterwegs, durch Wüsten, Dschungel und über die ältesten Dünen der Welt reisen, uns neu erspüren, berauschen am Neuen. Anderswie hätte es werden sollen, auf der großen Reise um die Welt, doch das Leben fragt nicht nach Wünschen. Es geschieht einfach, vieles kommt unverhofft und so schlich sich der Tod in unser Leben. Béatrice Hecht-El Minshawi ist Reisende, die international unterwegs ist, den Menschen gerne zuhört. Abschiede und Tode gehören zu ihrer Lebensreise. In diesem Buch geht es der Autorin um das Entsetzen durch die plötzliche Erkrankung ihres Mannes, um das Erinnern gemeinsamer Reisen, um sein Sterben und um die Bedeutung für ihr eigenes Leben. Ein Dialog um das Sterben und Abschiednehmen - ein Ratgeber für alle Betroffenen. ___________ Stimmen zum Buch: "Béatrice Hecht-El Minshawi geht es um das Entsetzen durch die plötzliche Erkrankung ihres Mannes, um das Erinnern gemeinsamer Reisen, um das Abschiednehmen und Sterbebegleitung sowie um die Bedeutung für ihr eigenes Leben. (...) Eine beeindruckende, feinfühlig, sensible Trauerarbeit." - Dieter Hampel "Ein bewegendes, reflektiertes und ehrliches Gespräch souveräner Partner, die von heute auf morgen einen Alltag mit der Krankheit meistern, den langsamen Verlust der Kräfte und das näher kommende Sterben aushalten müssen. Und für die Ehefrau und Partnerin der neue Anfang des Lebens - und vielleicht des Reisens. Das Buch ist sehr zu empfehlen und die erfahrene Autorin kommt gerne zu Leseveranstaltungen." - Renate Lürssen "Für die LeserInnen lohnt es sich: Obwohl das Buch bisweilen die Perspektive wechselt, mal steht die Autorin in direktem Dialog mit Frank, mal schreibt sie über ihn, wird es nie mühsam, dem Text zu folgen. „Adieu“ ist ein mutiges, offenes, ehrliches Buch über einen langen Abschied, die Zeit davor und danach, eine Liebeserklärung an Frank, ans Leben und ans Reisen. Wehmütig – aber niemals bitter. Béatrice Hecht El-Minshawi trauert und wütet auf dem Papier, hat immer noch viele Fragen, aber sie hadert nicht. Sie macht weiter." - Janika Rehak
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 170
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
In Memoriam Frank
Impressum
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN: 978-3-95894-114-4 (Print) / 978-3-95894-115-1 (E-Book)
© Copyright: Omnino Verlag, Berlin / 2019
Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen und digitalen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten.
E-Book-Herstellung: Open Publishing GmbH
Inhalt
Stufen 1
Der Anfang hat mit dem Ende zu tun
Frieden mit der Mutter
Es ist schön, gemeinsam alt zu werden
Große Reise, Open End
Wenn das Leben Kopf steht
In Zeiten der Hoffnung
Ich hätte gern anders gelebt
Aussortieren und Loslassen
Kleine Fluchten
Das Problem ist selten das Problem
An der Grenze des Lebens
Danach
Adieu!
Stufen 2
Stufen 1
Wie jede Blüte welkt und jede Jugend
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe,
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.
Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern
In andre, neue Bindungen zu geben.
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.
Herrmann Hesse (1877 – 1962)
Der Anfang hat mit dem Ende zu tun
Du hattest recht als du sagtest, alles sei vergänglich aber nichts verschwindet. Auch nicht die älteste Düne in der Namib-Wüste.
So viel, wie ich in den letzten Jahren mit dir kommuniziert habe, haben wir vorher nicht miteinander gesprochen. Es bleiben Gedanken und Fragen, die sich wohl erst in der Erinnerung auftun und schärfen. Sobald ich anfing mit dem Schreiben, lag unser Leben vor mir. Warumfragen sind sinnlos, es ist wie es ist. Dennoch würde es dich nicht wundern, wenn du wüsstest, welche Gedanken mich umtreiben.
Die Zukunft, für die wir lange gearbeitet hatten, hatte sich unerwartet und voller Wucht aufgelöst und mit ihr die Idee eines Lebens, von dem wir glaubten, es stünde uns zu. Wir fühlten uns stark und offen für die Welt und waren uns immer sicher, vielleicht zu sicher. Jetzt suche ich demütig meinen neuen Weg.
Frank saß tief in seinem Sessel, etwas nach vorne und zur rechten Seite geneigt. Kraftlos, teilnahmslos. Der bunte Tulpenstrauß auf dem kleinen Tisch daneben integrierte sich in die Farben des riesigen Bildes dahinter. Auch in Franks Sweatshirt. Ein Arrangement, dessen Einzelteile farblich sich gut einfügten, auch wenn es mir in diesem Moment unpassend erschien.
„Schatz, was ist mit Dir?“
Er öffnete für einen Moment die Augen. Frank hörte mich also, konnte aber nicht sprechen.
Ich berührte seine linke Schulter und streichelte sein Gesicht und fragte noch einmal:
„Was ist mit Dir? Verstehst Du mich?“
Dann hob er den Kopf und blickte mich an, sah mich aber nicht, sah durch mich hindurch, als hätte er nur meine Stimme gehört, aber nicht den Sinn der Worte erfasst.
Schon am Vormittag, als er versuchte im Garten ein paar Schritte mit dem Rollator zu laufen, merkte ich, dass seine Beine zitterten und versagten, keinen Schritt vor den anderen setzten konnten. Es war ziemlich warm und stickig an diesem Tag und ich befürchtete, dass er ohnmächtig werden könnte.
„Hast du zu wenig getrunken und ist dir schwindlig?“
Ich bekam keine Antwort, setzte ihn auf den Rollator und schob ihn vorsichtig nach Hause.
Frank wurde kreidebleich und lallte, hatte keine Lust zu trinken. Auf ein paar Löffel Gemüsesuppe ließ er sich dann doch ein, bevor ich ihn zum Sessel schob, damit er sich ausruhen konnte.
Es war Nachmittag geworden. Irgendetwas geschah und veränderte seinen Krankenverlauf.
Alarmzustand!
Ich telefonierte nach unserem Freund und Arzt, der umgehend kam und uns ins Krankenhaus brachte. Frank war verwirrt und inzwischen sehr unruhig geworden und brauchte dringend eine Bluttransfusion. Durch die Blutabnahme stellten die Ärzte den Mangel an roten Blutkörperchen fest. Tumorleiden können die Bildung neuer Blutkörperchen verhindern. Das war wohl jetzt so weit.
Aus dem in sich gekehrten Mann entstand ein unruhiger, unmotiviert schlagender. Je länger er auf frisches Blut warten musste, desto wilder und rabiater schlug er um sich.
„In diesem Zustand kann man ihm keine Transfusion anlegen“,
erklärte der eine Arzt und gab Frank einen Schluck Beruhigungssaft zu trinken.
„Je länger man aber wartet, desto schlimmer wird sein Zustand“,
antwortete ich besorgt.
Ich blieb bei ihm. Frank wütete und schlug, schlug mich, boxte an die Wand, verletzte seine Füße im Gitter des Bettes. Ich versuchte seine Arme und Beine zu polstern, damit er nicht noch weitere Verletzungen bekam, redete mit ihm, summte eine Melodie seiner Lieblingslieder, hielt die Arme an seinen Körper. Nichts half. Nach mehreren Stunden schwerster Arbeit meinen rabiaten Mann zu bändigen, war ich verzweifelt und traurig, dass mir Tränen übers Gesicht rollten. Solche Gewaltausbrüche waren mir neu.
Wie kann ein so kranker Mensch, der am Ende seines Lebens steht, so viel Kraft entwickeln und um sich schlagen? Mehrere Stunden, was für ein Energieaufwand! Ich wusste nicht, was es zu bedeuten hatte. Die Nachtärztin klärte mich auf:
„Wenn zu wenig rote Blutkörperchen vorhanden sind, wird zu wenig Sauerstoff transportiert und das Gehirn leidet unter Sauerstoffmangel, es gerät in Panik und meldet Alarm, der sich bei vielen Menschen durch starke Unruhe zeigt. Wenn Patienten um sich schlagen, wissen sie später meist nichts davon.“
Die Tropfen haben nicht geholfen, Frank brauchte eine Beruhigungsspritze.
Es war dunkel geworden im Raum, tiefschwarze Nacht draußen, als du plötzlich riefst:
„Bring mich heim, bitte, bitte, bring mich heim! Bitte, bitte, bitte!“
Dein Flehen ging mir durch Mark und Bein. Noch immer, wenn ich daran denke. Ich fühlte mich so hilflos und schuldig, weil ich dich nicht nach Hause bringen konnte.
Als gegen Morgen das Blut in deine Vene tropfte, warst du des Kämpfens müde und eingeschlafen. Die Tage danach wirst du über Muskelkater stöhnen, dachte ich, und ich werde die Schürfwunden und Hämatome an deinen Armen und Beinen versorgen.
Ein paar Stunden später wollte ich dich abholen und traf auf einen gut gelaunten und ausgeruhten Mann, der mir einiges zu erzählen hatte.
„Ich hatte Panik, Todesangst und Halluzinationen, war weit weg, hab gedacht, so ist also das Sterben. Ich hab euch alle gesehen und gehört, aber ich konnte euch nicht verstehen und selbst nicht sprechen und ihr habt mich nicht verstanden.“
Frank konnte sich nicht daran erinnern, dass er mich geschlagen hatte und sich verletzte. Er wunderte sich über seine Wunden.
„Hab ich geschlafen? Ich habe von Kabul geträumt, damals, als ich dich zum ersten Mal sah. Du hattest ein blaues Kleid und Clogs an. Ich wunderte mich, wie sicher du in diesen Holzschuhen laufen konntest.“
„Meine Güte, unsere Zeit in Afghanistan liegt schon 45 Jahre zurück. Jetzt leben wir in Bremen und ich hol dich nach Hause.“
„Erinnerst du dich? Es war die Geburtstagsparty eines Mitarbeiters des Deutschen Entwicklungsdienstes, als wir uns im Frühjahr 1972 in Kabul kennenlernten. Du hattest dich angeboten, die Bowle auszuschenken, ein wenig hatte das Gesöff auch bei dir Spuren hinterlassen.“
Ich war als Krankenschwester nach Afghanistan gekommen und Frank hatte den Auftrag, Radio- und Fernsehtechniker auszubilden.
Er hatte später mal berichtet, dass das Aufregendste, was er in Afghanistan getan hatte, der Ritt auf dem Kamel in die Wüste war.
Damals, im Herbst 1972, als ich als medizinische Begleitkraft einer Forschungsgruppe der Universität Bonn in der Wüste Seistan lebte und er mich besuchen wolltest. Ich glaubte ihm sofort, es war bis dahin sein größtes Abenteuer, denn er hatte keine Vorstellung, was auf ihn zukommen würde: den ganzen Tag in der Sonne durch die Wüstenlandschaft geführt, breitbeinig sitzend, vom Staub eingehüllt, geschaukelt zu werden. Er war mutig und ich habe ihn dafür bewundert.
An diesem späten Nachmittag lag ich zum Ausruhen in meinem kleinen Einpersonenzelt und spähte in das Flimmern der Ferne, bis mir die Staubwolke auffiel, aus der schließlich ein Kamel mit einer Person darauf hervortrat, geführt von einem Kameltreiber. Frank wollte mich überraschen und das ist ihm gelungen.
Frieden mit der Mutter
Was treibt dich so um, was quält dich, wenn du an deine Familie denkst, besonders an deine Mutter? Was hält dich fest? Was bringt dich immer wieder in Trauer? Was trieb dich von ihr weg, schon damals, als du deine Heimat verlassen hattest um beim Entwicklungsdienst zu arbeiten?
Deine Mutter hatte mich Ende 1972 gefragt, warum du weggegangen bist.
„Frank wollte entfernt der Familie und der Heimat sein, um für sich andere Lebenswege zu finden, als die vorgegebenen.“
„Warum?“,
fragte sie sehr erstaunt und Stirn runzelnd.
„Hier ist doch alles gut und auch du kannst hier arbeiten.“
Hatte sie wirklich keine Ahnung, wie es dir ging?
Ihr Unterbewusstsein über die Geschehnisse aus der Zeit, als Du ein Kind warst, war wach und so hatte sie meine Antwort als Verrat oder Kritik empfunden und ich war die Überträgerin der bösen Nachricht, die sie mir all die Jahre wohl nicht verziehen hat. Ich schob schnell nach:
„Außerdem hatte er sich für den Bundeswehrersatzdienst gemeldet, den er im Entwicklungsland durchführen konnte.“
In deiner Familie lag so viel im Argen worüber du mir erst später nacheinander berichtet hattest.
Schließlich, nach mehreren Jahren der Umwege, haben wir ein Design für unser Zusammenleben entwickelt. Und dazu gehörten unsere beiden Herkunftsfamilien. So unterschiedlich sie auch waren, versuchten wir sie zu integrieren. Dennoch weiß ich jetzt, dass du mich in deine Familie nicht gut hineinvermittelt hattest.
Oft haben wir darüber gesprochen, dass Immobilien immobil machen können, wenn man Großes vorhat. Du wusstest, dass ich schon in den 70er Jahren daran dachte, woanders oder unterwegs zu sein und keinen Lebensmittelpunkt in Deutschland anzustreben. Damals hatte ich kein Geld und niemanden, der Mut genug zeigte, mit mir auf Dauer zu reisen. Auch du nicht. So entwickelte ich mit leidenschaftlicher Hingabe eine berufliche Veränderung, die mit meinen Auslandserfahrungen und mit anderen Ländern zu tun haben würde und wurde interkulturelle Trainerin. Ich gehörte zu den ersten in Deutschland, die interkulturelle Konzepte entwickelt hatte und damit sehr erfolgreich arbeiten konnte. Das war gut so.
Mit dir dann, planten wir nach Jahrzehnten endlich auch Großes und unser Leben sollte dafür leichter und mobiler werden. Deshalb hatten wir Anfang 2010 unser Bremer Haus verkauft, um genügend Geld für die große Reise und für eine neue Wohnart danach zur Verfügung zu haben.
Wir hatten vor, nach der Rückkehr an einem Projekt teilzunehmen, das Gemeinschaftliches Wohnen zum Ziel hatte und waren schon in einer Gruppe integriert. Das Haus sollte für mehrere Wohneinheiten gebaut werden: für Singles, für Paare, für größere und kleinere Familien, so dass sich ein Generationengemisch und mit Menschen aus verschiedenen Kulturen und Lebenssituationen ergeben würde. Es waren zu den Wohnungen auch Gemeinschaftsräume angedacht und ich stellte mir einen Dachgarten und eine Sauna vor, du wolltest eine Werkstatt. Das wäre großartig gewesen. Wir hatten viele Jahre mit einer Sauna im Hause gelebt und würden sie weiterhin genießen wollen. Und wir gingen davon aus, nachdem wir die Welt ausführlich bereist hatten, ein Reisemobil anzuschaffen, mit dem wir „im Alter“ in Europa reisen würden.
Alle Wünsche fügten sich in unseren Lebensplan und der fühlte sich sehr gut an. Aber es kam anders.
Als wir Mitte der 80er Jahre unser Haus kauften, hatten wir entschieden, ausländischen Personen Vorrang zu geben, wenn sie bei uns mieten wollten. Und es war eine gute Entscheidung, denn fast immer hatten wir interessante Menschen im Haus. Nur einmal war es schwierig geworden, als ein Opernsänger aus Südkorea, der beim Goethe-Institut Deutsch lernen wollte und nirgends untergekommen war, in unserem Gästezimmer einzog. Er, ein verwöhnter und sehr selbstbewusster Pfau, der aus einer wohlhabenden Familie stammte, hatte kein Gefühl für seine Umgebung bei uns. Er räumte weg, was ihm im Weg stand und das war offensichtlich viel. Er machte sich mit seinem elektronischen Equipment, das er zum Einüben von Arien nutzte, breit wie der Herrscher im eigenen Palast. Er besetzte das Bad und die Küche als ob er alleine im Hause lebte. Es wäre ihm wohl am liebsten gewesen, wir würden ausziehen oder ganz lange verreist sein. Auch die anderen Mieter und Mieterinnen im Hause störten ihn. Wir zeigten für sein Gehabe und Getue immer weniger Interesse und ahnten nun, warum es mit den vorherigen Unterkünften nicht geklappt hatte.
Du warst sehr wütend geworden.
Es wurde noch schwieriger, als eines Tages seine Freundin, die er aus Seoul kannte und die jetzt im Opernhaus Köln angestellt war, plötzlich im Bad vor uns stand und ihn dann immer öfter besuchte. Seine nicht abgesprochenen Entscheidungen passten uns nicht und der Herr Opernsänger zog mit Sack und Pack nach Heidelberg. Er benötigte ein großes Auto für seinen Umzug. Dennoch hatten wir überwiegend Glück mit den Menschen, die bei uns im Haus lebten.
Unser Bremer Haus war etwas größer und breiter als die meisten anderen in der Straße. Aber dieser Haustyp ist generell schmal und erstreckt sich über mehrere Stockwerke. Es hat einen von unten nach oben gehenden Flur, von dem auf jeder Etage die Zimmer abgehen. Wir lebten auf zwei Stockwerken und hatten auch ein Gästezimmer. Unter uns im Souterrain gab es eine Wohnung. Und über uns eine weitere, die sich auch über zwei Etagen streckte. Alle Leute mussten an unseren Zimmern vorbeigehen, wenn sie nach oben wollten. Da mussten wir schon sicher sein, wer ins Haus passte. Andererseits würde niemand eingezogen sein, der oder die sich das mit uns nicht hätte vorstellen können. Zimmertüren wurden nie abgeschlossen, nur die Haustür. Die sollte uns schützen und auf die waren alle eingeschworen.
Erinnerst du dich, dass die Türkin von oben immer darauf bedacht war, nicht ohne ihr Kopftuch an dir vorbei zu laufen? Dabei hättest du ihre Schönheit gerne mal sehen wollen. Sie war wunderschön.
Anders war es bei der Polin, die Angst hatte, erwischt zu werden, weil sie illegal in Bremen lebte. Sie sprach damals noch kaum Deutsch und konnte zunächst sowohl unsere familiären als auch die örtlichen Verhältnisse schlecht einschätzen.
So erging es auch der Flüchtlingsfrau aus Zaire, die nach ihrer Verfolgung und Inhaftierung, Vergewaltigung und Folter, und nach dem Freikauf durch das Geld ihrer Familie, das diese wiederum in den Hunger trieb, und nach der Flucht, eine Zeit lang bei uns lebte. Sie war nicht die einzige Flüchtlingsfrau in unserem Haus und bald stellten wir fest, wie nomadisch und flexibel diese Menschen und zum Teil schon lange unterwegs waren. Sie hatten bereits zu Hause durch Wetterveränderungen und politischen Unruhen gelernt, mit neuen Lebensverhältnissen umzugehen und auf dem Weg von einem Land zum anderen sich den örtlichen Lebensweisen und Sprachen anzupassen.
Unsere Nachbarn staunten immer wieder über die Menschen, die bei uns lebten und vielmals anders aussahen, als sie selbst und sich anders verhielten. Eine Afrikanerin fiel sofort auf, denn sie kehrte täglich vor dem Haus, so wie sie es zu Hause gelernt hatte.
Heute ist ein Tag, an dem sich die Erinnerungen überschlagen. Ich kann sie kaum bewältigen, vielleicht, weil ich sie nicht mit dir teilen kann. Ich vermisse dich sehr. Wie schön wäre es, wir könnten uns gemeinsam erinnern und darüber sinnieren und unseren Emotionen freien Lauf lassen. Aber ich bin allein und muss jetzt erst einmal mit dem inneren Gespräch mit dir pausieren.
In der dritten Maiwoche 2010 hattest du plötzlich eine Nierenkolik und musstest umgehend ins Krankenhaus gebracht werden. Während in der linken Niere Ablagerungen gefunden wurden, die die Schmerzen verursachten, erkannten die Ärzte im CT in der rechten Niere auch einen Befund.
„So groß wie eine kleine Mandarine“,
sagte der Radiologe, die als ein Karzinom diagnostiziert wurde.
„Machen sie sich keine Sorgen, mit einer Niere kann man gut leben.“
„Niere raus, Krebs raus“,
hatte dann der Nephrologe gemeint, als ob es eine Lappalie wäre.
Als vertrauensbildende Maßnahme zeigte er uns seine große Narbe nach einer Nierenresektion.
Die Sedimente in der linken Niere und die ganze rechte wurden beseitigt und nach ein paar Wochen ging es dir zunächst erstaunlich gut, bis die Zweifel überhand nahmen.
Das war die Zeit, in der wir die kleine Eigentumswohnung zum Vermieten kauften. Das mag nach dem Hausverkauf unlogisch klingen, aber du hattest während des Krankenhausaufenthaltes die Wohnung in der Zeitung gefunden. Du wolltest immer auch eine Garage und die gehörte nun zur Wohnung. Oder andersrum. Ich spürte einen Zusammenhang mit deiner Erkrankung, die so plötzlich eine unsichere Lebenssituation provoziert hatte.
Du warst derjenige, der ein viel größeres Bedürfnis nach Sicherheit hatte. Und oft warst du in den entscheidenden Dingen zögerlich, aber jetzt entschieden.
„Für alle Fälle, man kann nie wissen“, hattest du gesagt.
Wir hatten die Wohnung grundlegend und geschmackvoll renoviert, waren uns immer einer Meinung, wie sie aussehen sollte. Wir wollten aber nie selbst darin leben und waren zum Jahreswechsel 2013/2014 doch eingezogen. Jetzt lebe ich in dieser Wohnung allein und aus allen Ecken kommen die Erinnerungen, Gedanken und Fragen.
Einen großen Teil unserer Möbel und des Geschirrs landete damals im Keller und in der Garage. Aus großzügigen Wohnverhältnissen kommend, passten sie nicht in die viel kleinere Wohnung. Wir planten sie während der jahrelangen Reise, die stattfinden sollte, möbliert zu vermieten und hatten schnell einen Geschäftsmann aus Stuttgart gefunden, der sie für eine längere Zeit übernehmen wollte.
Du warst froh, dass man dir die ganze Niere und somit, so hofftest du, den Krebs entfernt hatte. Regelmäßig gingst du zu den Nachuntersuchungen und es hieß immer: Alles ist gut und nichts zu befürchten. Ich begleitete dich, um den neuen Befund zu hören. Schließlich war ich mal Krankenschwester gewesen und wusste um die direkten und indirekten Beschreibungen der Ärzte, wenn sie negative Nachrichten zu vermitteln hatten. Und dennoch, du warst ein Krebspatient mit schleichender Verunsicherung für uns beide. Zum ersten Mal musstest du dich ernsthaft um deinen Körper kümmern: um gesundes Essen, ausreichend Flüssigkeit, um die Ausscheidungen. Und um deine Gefühle, um die Ängste, die Fragen an den Sinn des Lebens, an deine Herkunftsfamilie, an deine Entscheidungswege, an mich, an uns.
„Werde ich daran mal sterben“,
hattest du mich wiederholt gefragt und ich wusste, dass die Angst Raum eingenommen hatte.
Dein Körper war krank geworden, dein Geist bedrückt und die Seele verwundet. Oder geschah es in anderer Reihenfolge? Die Seele war beängstigt, der Geist bedrückt, der Körper erkrankt?
So muss es wohl gewesen sein. Aber warum?
Macht es denn Sinn, diese Frage zu stellen?
Nein.
Der Umbruch ins Rentenleben war anvisiert und wir wollten noch oft reisen. Wir hatten uns darauf gefreut, das Haus war schon verkauft, um finanziell unabhängig zu sein. Wir hatten gespart und wie oft hattest du mir gesagt, ich sei eine genügsame Ehefrau, die nie große Wünsche hatte. Wir haben unser Geld immer in Reisen ausgegeben.
Entsetzen über den Karzinombefund kam oft wieder hoch und Trauer machte sich breit. Es hatte dich getroffen und du, schon immer eher am Leben zweifelnd, hattest unter dem Wissen der Endlichkeit deines Daseins den Mut verloren und bist in Schwermut versunken. Die Leichtigkeit, die du sowieso oft kaum besessen hattest, wurde im Sommer 2010 weiter gebremst, geplante Reisen abgesagt, das Leben erst einmal infrage gestellt.
Wie trügerisch: Äußerlich merkte man dir wenig an, aber innerlich warst du verwundet. Dein Vater bemerkte es und bedankte sich bei mir, dass ich dir so uneingeschränkt zur Seite stand. Deine Mutter war wie immer mit sich selbst beschäftigt und hatte weder nach deinem Befinden und den Gefühlen noch nach meinen gefragt, vor deinen Geschwistern hattest du dich wohl eher stark und zuversichtlich gezeigt. Das war deine Rolle als ältestes Geschwisterkind. Nur mit mir konntest du über deine Ängste reden und den Tränen freien Lauf lassen. Ich hielt uns öfter an den Händen und wir umarmen uns intensiver.
Wir benötigten viel Zeit miteinander, trafen uns mit Freunden. Manchen fiel deine schleichende Bedrückung auf. Wir hatten viele Gespräche um den Sinn des Lebens, denn deine Schwermut hatte auch Tiefgang. Du warst im Grunde schon immer ein in sich gekehrter Mensch, der in eher gedämpfter Stimmung war und auch seine deprimierten Phasen hatte, während ich tatkräftig dich immer wieder motivieren konnte, aus Lethargiephasen herauszufinden. Oft war ich ungeduldig. Kannst du dir vorstellen, wie schwierig das war, dich aufzurütteln, zu beflügeln? Mit Reiseplänen ging es meistens.
Glaub bitte nicht, dass diese Zeit an mir spurlos vorbei ging. Das Umgehen mit deinen Zweifeln und Ängsten brachte auch mein Leben durcheinander. Die Nächte wurden unruhiger, unsere Gespräche kreisten um Krankheit, Sterben und Tod. Der Zauber im Vertrauten ließ dies zu. Dann wiederum hatten wir sprachlose Zeiten. Doch jeder Arztbesuch war von Angst begleitet. Ich war immer dabei, denn vier Ohren konnten die Aussagen der Ärzte besser einschätzen.