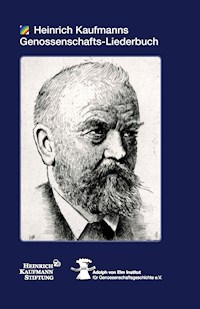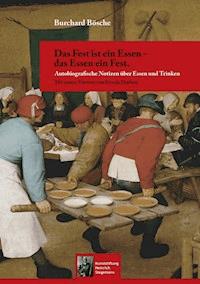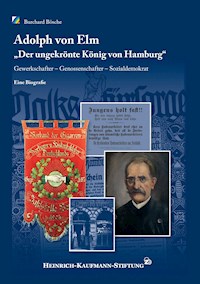
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Adolph von Elm war Tabakarbeiter, Gewerkschaftsvorsitzender, Genossenschaftsgründer, SPD-Reichstagsabgeordneter, Führer des Hamburger Hafenarbeiterstreiks 1896-97 und Generaldirektor der 'Volksfürsorge'-Lebensversicherung. Er war Mitbegründer der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands, Vorläufer des heutigen DGB. „Sein Name ist unaustilgbar mit der Geschichte der deut-schen Gewerkschaften und Genossenschaften wie der Partei verknüpft.“ schrieb das Correspondenzblatt der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands anlässlich seines Todes 1916. Und der langjährige Vorsitzender dieser Generalkommission, Carl Legien, schrieb in seinem Nachruf auf von Elm: „Die gewerkschaftliche Bewegung Deutschlands und auch die internationale Gewerkschaftsbewegung hat sich nach den Grundsätzen, die er für sie aufgestellt hatte, entwickelt. Es klingt sonderbar, dass ein einzelner Mann einer gewaltigen Kulturbewegung die Richtschnur gegeben haben soll. Und doch ist es historische Wahrheit."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 195
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Sohn eines Zigarrenhausarbeiters
Vorleser in der Zigarrenmacherbude
„Der Junge wird keine dreißig“
Hilfe bei Arbeitseinstellungen
Das eherne Lohngesetz
Die Genossenschaft für den „vollen Arbeitsertrag“
Strike-Cigarren
Auswanderung in die USA
Lebensgefährtin Helma Steinbach
Streit um die Arbeitslosenversicherung
Der Kampf um den 1. Mai
Die Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands
Die Tabakarbeitergenossenschaft – oder: Der edle Egoismus
Schriftsteller und Literat
Wahl in den Reichstag
Die Großeinkaufsgesellschaft Deutscher Consumvereine (GEG
)
Der Hamburger Hafenarbeiterstreik
Der Konsum-, Bau- und Sparverein ‚Produktion’
Der Hamburger Akkordmaurerstreit und die Massenstreikdebatte
Der Zentralverband deutscher Konsumvereine
Flächentarifverträge für den Konsum
Eigenproduktion und Volksversicherung
Konsumgenossenschaften im Ersten Weltkrieg
Der ungekrönte König von Hamburg. Die Nachrufe
Literaturliste
Abkürzungsverzeichnis
Vorwort
Wie kommt man dazu, eine Biografie über einen vor fast 100 Jahren gestorbenen Tabakarbeiter zu schreiben? Bei meiner früheren Arbeit für die Gewerkschaft Nahrung – Genuss – Gaststätten war mir der Name Adolph von Elm bereits begegnet. Als wir beim Zentralverband deutscher Konsumgenossenschaften e.V. daran gingen, zum 2003 anstehenden 100jährigen Jubiläum des Verbandes eine Konsumgenossenschaftschronik zu schreiben, stieß ich immer wieder auf ihn. An vielen wesentlichen Weichenstellungen war von Elm beteiligt, nicht nur bei den Genossenschaften, auch bei den Gewerkschaften und innerhalb der SPD. Ich fand etliche Kurzbiografien, aber keine Darstellung, die sein Leben, seine Arbeit auf allen drei Feldern der Arbeiterbewegung würdigte.
Nach Adolf von Elm sind in Hamburg vier Straßen benannt.1 Niemand bringt es in dieser Stadt auf mehr Nennungen. Im ehemals hamburgischen Cuxhaven gibt es einen von-Elm-Weg. Auch in Berlin gab es eine von-Elm-Straße, allerdings wurde der Name in der NS-Zeit ausgelöscht und nach 1945 nicht wieder hergestellt.2 Ein großer Wohnungskomplex im Hamburger Stadtteil Barmbek trägt seinen Namen: Adolph von Elm Hof. In der Straße Adolf-von-Elm-Hof im vordem hannöverschen Stadtteil Eißendorf steht ein großes von-Elm-Denkmal. Und als von Elm einst zu Grabe getragen wurde, sprach man von der Beerdigung des „ungekrönten Königs von Hamburg“3. Heute ist er in seiner Vaterstadt, der er mit der Volksfürsorge eine der größten deutschen Lebensversicherungsgesellschaften hinterlassen hat, so gut wie unbekannt. Weil das ungerecht ist, wurde diese Biographie geschrieben. Aber auch, weil sein Lebenslauf eine kaum glaubliche Geschichte darstellt, in der sich eine bewegte Epoche deutscher und hamburgischer Geschichte spiegelt.
Man hat mich vor dem Schreiben der Biografie, vor dem damit verbundenen Arbeitsaufwand gewarnt. Zu Recht. 12 Jahre hat mich der Text neben meiner sonstigen Arbeit beschäftigt. Wenn man so lange an der Biografie eines Menschen sitzt, dann wird dieser fast zu einem Familienmitglied. Die Arbeit hat mich nie gelangweilt, weil ich, je länger je mehr, an vielen Stellen eine politische Übereinstimmung mit meinem literarischen Objekt entdeckte. Ich habe schließlich Adolph von Elm zu meinem politischen Adoptiv-Urgroßvater erklärt. Und eine Entdeckung war von Elms Lebensgefährtin Helma Steinbach, eine großartige Frau, über die eine Biografie noch aussteht.
Dank für vielfältige Zuarbeit schulde ich Mari Manea, Dagmar Blunck, Birgit Wulf und Oliver Cabrera.
Hamburg, Mai 2015
Burchard Bösche
1 Von-Elm-Weg, Elm-Stieg, Elm-Twiete, Adolf-von-Elm-Hof
2 Sie wurde zur Ypern-Straße und später zur Trachtenbrodtstraße.
3 Ein halbes Jahrhundert Volksfürsorge, S. 114
Sohn eines Zigarrenhausarbeiters
„Meine Schulhefte lagen inmitten von Tabakblättern“, so beschrieb Adolph von Elm in seiner großen Rede zur Tabaksteuer im Reichstag4 seine Kinderzeit als Sohn eines Zigarren-Heimarbeiters. 1857 wurde er in Hamburg geboren. Er war einen Monat jünger als Albert Ballin, der legendäre Vorstand der Hamburg-Amerika-Linie, und drei Jahre älter als Carl Legien, den man als Begründer des Deutschen Gewerkschaftsbundes ansehen kann. Von Elm lernte das Handwerk des Zigarrensortierers und wurde bereits als Kind in der jungen Sozialdemokratie aktiv. Er war schon im Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein (ADAV) politisch tätig, also vor der Vereinigung der beiden sozialdemokratischen Parteien im Jahr 1875.5 Über sein Elternhaus, seine Familie wissen wir wenig, was bei den Führern der Arbeiterschaft aus damaliger Zeit nicht ungewöhnlich ist. Zwei Schwestern werden 1916 als Teilnehmerinnen seiner Beerdigung erwähnt. Autobiografische Aufzeichnungen sind nicht bekannt. Trotzdem lässt sich gut beschreiben, wie es zuhause zugegangen sein muss, denn über die Zigarrenheimarbeiter und deren armselige Existenz wurde viel diskutiert und geschrieben.
Er entstammte dem adeligen Geschlecht der Herren von Bederkesa im Erzbistum Bremen, galt aber wegen ausgestorbenen Mannesstammes nicht als adelig. Die Familie hatte einst ihren Sitz im nahe bei Bederkesa gelegenen Elmlohe, woher der Name rührt.6
Alt ist er nicht geworden. Geboren 1857 starb er 59jährig im September 1916 an einem Herzschlag, nachdem er noch am selben Tage seinem Vorstandskollegen von der schwedischen Volksversicherungsgesellschaft Folkett stolz die Einrichtungen der Hamburger Konsumgenossenschaft Produktion sowie der Volksfürsorge gezeigt hatte, die er 1912 mitgegründet hatte und deren erster Vorstand er war.7
Er war ein Mann der Arbeiterbewegung, wie man es von kaum einem anderen sagen kann. Er stammte aus der ärmlichen Familie eines Zigarrenhausarbeiters. Er wurde Gewerkschaftsvorsitzender, sozialdemokratischer Reichtagsabgeordneter und Geschäftsleiter der Tabakarbeitergenossenschaft, und war das alles gleichzeitig. In seiner Person brachte er die drei Säulen der Arbeiterbewegung zusammen, wie man sie damals nannte: Die Gewerkschaften, die SPD und die Genossenschaften.
Der fast gleichaltrige, aus Ottensen stammende Julius Bruhns, dessen Vater ebenfalls Zigarrenhausarbeiter war, hat eine Haftzeit unter dem Sozialistengesetz dazu genutzt, seine Kindheitserlebnisse zu beschreiben und dieses Manuskript viele Jahre später veröffentlicht unter dem Titel: „Es klingt im Sturm ein altes Lied.“8 Dieser Text gibt einen Eindruck von den Lebensverhältnissen der Kinder aus den Hausindustriellen-Familien der Tabakbranche.
Buchtitel Bruhns, Es klingt im Sturm ein altes Lied. (HKS)
„War doch Schmalhans immer Küchenmeister in unserer ärmlichen Behausung. Mein Vater war ‚Hausarbeiter‘, d.h. er holte sich von einem Fabrikanten den Rohtabak und machte daraus zu Hause Zigarren. Da er selbst infolge seiner Lähmung sehr langsam war, brachte er täglich nur wenige Zigarren fertig. Er nahm daher mehrere Gehilfen an, die ihm die Zigarren machten, während er sich darauf beschränkte, das Rohmaterial zuzurichten. Das brachte allerdings etwas mehr, aber immer noch so wenig, dass meine Mutter gezwungen war, ebenfalls auf Erwerb auszugehen. Sie wusch und plättete für die Bekannten und Kollegen meines Vaters und stand, wenn ihre Arbeitskraft nicht vom Hausstand und der Pflege ihrer drei Kinder in Anspruch genommen war, vom ersten bis zum letzten Tag der Woche, von früh bis spät am Waschfass oder am Bügelbrett. Trotzdem gelang es nur schwer, das zum Leben Notwendige zu erringen, und oft mussten wir Kinder trockenes Brot essen, wenn es nicht möglich geworden war, noch ein paar Pfennige für Schweineschmalz oder Sirup aufzuwenden.
Solche Entbehrung trägt ein harmlos fröhliches Kindergemüt gar leicht. Viel schlimmer war es, dass ich gar bald all die bitteren Leiden kennen lernen musste, die die fluchwürdige “Heimarbeit” den davon betroffenen Proletarierkindern zu bescheren pflegt. Wohl gibt es auch heute noch Leute genug, die aus “sittlichen und pädagogischen Gründen” eine möglichst frühzeitige gewerbliche Beschäftigung der Kinder – natürlich nur der Arbeiterkinder! – wünschen. Manche Leute schwärmen gar beim Anblick einer Familie, die, alt und jung in einem engen Stübchen “traulich” vereint, fleißig bei der Arbeit ist und die Früchte vereinter Anstrengung in Gestalt hübscher Waren werden und wachsen sieht. Es sieht freilich anders aus, wenn man in diesem reizenden Familienbilde selbst eine Rolle mitspielt. Das habe ich gar bitter erfahren. Ich war noch nicht fünf Jahre alt, da musste ich schon in der Arbeitsstube meines Vaters fleißig mit zugreifen. Tag für Tag musste ich Tabak zurichten, d.h. mit den kleinen Fingern die feuchten zusammengefalteten Tabakblätter auseinander breiten, die dicken Stängel entfernen und Blatt auf Blatt legen. Und das musste bald rasch gehen, denn die Zigarrenmacher warteten auf den so hergerichteten Tabak und spornten mich durch Zurufe, oft auch durch Scheltworte zu größerer Eile an. Der Mutter blutete wohl das Herz, wenn sie ihren Liebling so gequält sah, aber was sollte sie tun? So habe ich den größten Teil der “goldenen Jugendzeit” in den staubigen, dunstigen Räumen der Zigarrenfabrik verbringen müssen, immer zwischen Erwachsenen lebend und schaffend, während meine glücklicheren Jugendgenossen sich draußen im hellen Sonnenschein auf Straßen und Plätzen tummelten. […]
Wir wohnten bis zu meinem zwölften Lebensjahre in einem ‚Gang‘ in der Königstraße in Altona, „Harms Hof“ genannt. Ein schmaler, schmutziger, überdeckter Gang zwischen zwei an der Straße stehenden Häusern führte zu einer Reihe kleiner einstöckiger Häuschen, “Buden” genannt, deren wir eine zur Wohnung hatten. Die Buden – sie sind jetzt längst vom Erdboden verschwunden – standen noch aus älterer Zeit, sie waren wenigstes 100 Jahre alt und von äußerster Einfachheit. Über eine zwei Fuß hohe Schwelle – die Haustür war, wie in vielen Bauernhäusern, in zwei Hälften, eine Obere und eine Untere, geteilt – kam man auf einen schmalen, ziegelsteingepflasterten Flur, von welchem links eine fast dunkle, ebenfalls ziegelgepflasterte Kammer, rechts eine gedielte zweifenstrige Stube abging, die zur Zigarrenmacherei verwendet wurde. Hinter dieser Stube war eine Abzweigung des Flurs mit einem Ziegelsteinherd versehen, die wir als “Küche” ansprachen, während links eine leiterähnliche, steil gelegene Bodentreppe zu einem kleinen einfenstrigen Dachstübchen und dem dazugehörigem Bodenraum führte. Hinter dem Häuschen lag in der Länge desselben ein etwa sechs Meter breiter Hofplatz, den an den Schmalseiten ein Bretterzaun von den Hofplätzen der beiden benachbarten Häuschen, an der Längsseite ein höherer Bretterzaun von einem dahinter liegenden größeren Garten trennte. Nur eine hoch gewachsene Akazie streckte einige blätterreiche Zweige Schatten spendend über unseren “Garten” aus, dessen einzige Zier einige an der Planke sich empor ringelnde Bohnenranken und hohe Winden waren.
Heimarbeit im Familienkreis (NGG)
Vorleser in der Zigarrenmacherbude (NGG)
Meine Gewandtheit im Lesen verschaffte mir aber bald eine andere, für meine frühzeitige Entwicklung bedeutsame Arbeit: ich musste in der Arbeitsstube den Zigarrenmachern vorlesen. Und was? Sozialistische Schriften und Zeitungen!
Damals, es war im Jahre 1868, war die sozialistische Bewegung noch in ihren Anfängen. In Hamburg-Altona allerdings hatte sie unter den Arbeitern schon viele Anhänger. Am Stärksten verbreitet aber war die Bewegung unter den Zigarrenmachern, die lange Jahre hindurch in meiner Heimat die treibende Kraft und die Leitung der sozialdemokratischen Partei bilden. Das hatte seine Ursache in den besonderen Arbeits- und Lebensverhältnissen der Zigarrenmacher.
In der Zigarrenindustrie blühte die Heimarbeit. Die Fabrikanten gaben das Rohmaterial den einzelnen Zigarrenmachern, Hausarbeiter genannt, mit nach Hause, sparten so eigene Arbeitsräume und deren Beleuchtung und Heizung, auch die Werkmeister usw., und konnten auch auf die Löhne viel besser drücken, als wenn sie selbst in großen Fabrikräumen arbeiten ließen. Die “Hausarbeiter” suchten sich selbst wieder Gehilfen, deren Zahl abhing von der Masse des Rohmaterials, das der Fabrikant hergegeben hatte, auch von der Größe der zur Verfügung stehenden Arbeitsräume usw. Im größeren Stil betrieben die Hausarbeit naturgemäß nur wenige; die meisten hausten mit einem, höchstes zwei oder drei Gehilfen in einem der elendsten Löcher, in Dachstuben, auf Böden, in Kellerräumen oder wie mein Vater, in alten, verfallenen, feuchten Buden. Wöchentlich einmal wurde gewöhnlich abgeliefert, auf einer zweirädrigen schottischen Karre die fertige Ware zum Fabrikanten gefahren und neues Rohmaterial zurückgebracht. Der Fabrikant, der es nicht mit einer größeren Zahl bei ihm selbst beschäftigter Arbeiter zu tun hatte, die infolge des Zusammenarbeitens in enger Verbindung miteinander standen und geschlossen jeder Lohnkürzung oder Drangsalierung Widerstand leisten konnten, sondern mit lauter kleinen, voneinander abgesonderten oft einander nicht einmal bekannten Hausgewerbetreibenden, spielte geschickt immer einen gegen den anderen aus und verstand so, von jedem möglichst gute Ware für möglichst schlechten Lohn und aus möglichst schlecht zu verarbeitendem Rohmaterial zu erhalten.
Diese Zustände in der Zigarrenindustrie brachten für die Angehörigen derselben natürlich die denkbar schlechtesten Arbeitsverhältnisse, völlig unsichere, unkontrollierbare, immer mehr weichende Lohnsätze bei ganz ungeregelter Arbeitszeit in denkbar schlechtesten und ungesunden Arbeitsräumen. Von irgendeinem gesetzlichen Arbeiterschutz, wenn auch nur für Frauen und Kinder, war damals gar nicht die Rede. Vom frühen Morgen bis zum späten Abend arbeiteten in den mit Staub und Rauch und Dunst gefüllten Räumen, die meist nicht nur zum Arbeiten sonder auch zum Wohnen, Schlafen, Kochen usw. benutzt wurden, im bunten Durcheinander jung und alt, Männer, Frauen und Kinder. Dass sich gegen solche entwürdigenden Zustände besonders die Besseren, die denkenden
Titel „Offenes Antwortschreiben“ (HKS)
Elemente zu wehren suchten, ist selbstverständlich. Und so fielen denn Lassalles Lehren, niedergelegt in seinen herrlichen Agitationsschriften “Offenes Antwortschreiben”, “Arbeiterprogramm”, “Arbeiterlesebuch” usw., bei vielen Hamburg-Altonaer Zigarrenmachern auf denkbar furchtbarsten Boden. Von Mitte der sechziger Jahre ab wurden viele hunderte Zigarrenmacher Lassalleaner, sie wurden die Kerntruppe der später so starken und stolzen sozialdemokratischen Partei in Hamburg-Altona.
Die eigenartigen Arbeitsverhältnisse der Zigarrenmacher boten noch nach einer anderen Richtung hin besondere Gelegenheit zur Ausbreitung und Festigung der sozialdemokratischen Anschauungen. Hier zeigte sich gewissermaßen eine gute Seite jener sonst so bedauernswerten Verhältnisse. Hatten nämlich die Zigarrenmacher keine großen Fabriken mit hellen, gesunden Arbeitsräumen, geregelter Arbeitszeit und sicheren Löhnen, so hatten sie aber auch keine strengen Arbeitsordnungen, keine Aufpasser. Sie waren in gewissem Sinne frei, konnten in ihren Arbeitsstuben tun und reden, was sie wollten. Und von dieser Freiheit machten damals die Zigarrenmacher in meiner Heimatstadt ausgiebigen Gebrauch, begünstigt noch durch den Umstand, dass das Mechanische ihrer Handfertigung ihrem Geist gewisse Bewegungsmöglichkeiten gab, die manch anderer Beruf seinen Angehörigen nicht bietet. Da wurde den ganzen Tag über debattiert und politisiert, gewiss viel Unsinn geredet, aber auch manch guter, gesunder Gedanke gesprochen. Und mancher tüchtige Führer der Sozialdemokratie hat den Grund zu seinem späteren Können gelegt in diesem eifrigen Disputieren über sozialistische Bestrebungen und Theorien mit seinen Kollegen in den Zigarrenmacherstuben.
Sozialdemokratische Traditionsfahne (HKS)
Vor diesem Auditorium nun hatte ich vorzulesen: Lassallesche Schriften, den “Volksstaat”, den “Sozialdemokrat”, die Hafen-Schriften, die “Sozialpolitischen Blätter”, die Reden der wenigen, noch dazu in zwei Fraktiönchen gespaltenen sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten u.a.m. Und nachher, wenn ich wieder beim Tabakzurichten saß, hörte ich den Debatten zu, die sich an das Vorgelesene knüpften und oft sehr heftig waren. Die Sozialdemokratie trug damals noch den Charakter der Sekte, mit deren Vorzügen wie Nachteilen. Unsere Gegner, die an der Sozialdemokratie heute noch das lediglich “Negierende” tadeln, hätten nur die sozialdemokratischen Zigarrenmacher Ende der sechziger und Anfang der siebziger Jahre hören sollen. An allen Übeln der Welt war nur der Kapitalismus und sein verruchter Träger, die verrottete Bourgeoisie, schuld, mochte es sein, was es wollte, Arbeiterelend, Überschwemmung, Krieg, Seuchen, Unwetter oder irgendeine andere Kalamität, die irgendwo auf dem Erdenrund entstanden war. Die furchtbaren Zustände, die wirklich dem Kapitalismus auf das Schuldkonto zu schreiben waren, und der Eifer, diese schwere Schuld nachzuweisen, sie denjenigen sowohl, die Teil hatten an der Schuld, wie jenen, die unter dieser Schuld zu leiden hatten, überhaupt erst zum Bewusstsein zu bringen, mögen die Übertreibung und starre Einseitigkeit, mit der damals die Sozialdemokratie ihre rücksichtslose Kritik an den herrschenden Zuständen übte, wohl erklärlich, ja notwenig erscheinen lassen. Und der Hohn und Spott der Gegner, besonders der in den Städten dominierenden Liberalen, die zunächst gar nicht daran dachten, uns ernst zu nehmen, goss Öl ins Feuer, ließ die sozialdemokratische Kritik werden, wie sie war.
„Der Botschafter“ (NGG)
Oft spielten in den Debatten der Zigarrenmacher auch die hässlichen, tief gehenden Feindseligkeiten zwischen den beiden sozialdemokratischen Gruppen, den Mitgliedern des Allgemeinen deutschen Arbeitervereins oder Lassalleanern und den Eisenachern oder “Ehrlichen”, wie sie spottweise von den feindlichen Brüdern genannt wurden, eine erhebliche Rolle. In Hamburg-Altona waren die Lassalleaner überwiegend, und ein auftauchender “Ehrlicher” hatte es gerade nicht leicht unter seinen Gesinnungsgenossen von der anderen Fraktion. Mich berührten diese Streitigkeiten gar nicht, die Lektüre der sozialdemokratischen Schriften und Zeitungen aber hatte mich bald zu einem begeisterten Anhänger der sozialdemokratischen Ideen gemacht. Mit dem ganzen Überschwang des fantasievollen schwärmerischen Knaben fasste ich die herrlichen Gedanken von Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit auf, ergriff mich die Lust am großen heiligen Kampf gegen Unterdrückung, Ausbeutung, Lüge und Heuchelei. Bald warf ich die Ungeheuer und Riesen, die Indianer und anderen Feinde über Bord und die Ritter und Helden der Faust ihnen nach und träumte nur noch davon, ein Führer des Volkes zu werden, in packenden Artikeln und flammenden Reden für die Sache des Volkes gegen seine Feinde zu kämpfen. Sozialdemokratischer Reichstagsabgeordneter und nach einer siegreichen Revolution Leiter, Minister, ja Präsident einer sozialdemokratischen Republik zu werden, das schien mir der Inbegriff alles Großen, das einzige würdige Ziel meines Strebens zu sein. […]
Friedrich Wilhelm Fritzsche, Mitglied des Reichtages (HKS)
Von Elms Lebensweg in seinen Kinderjahren wird ziemlich genau der Beschreibung von Bruhns entsprochen haben, nur dass er in Wandsbek aufwuchs und nicht in Altona; beide waren preußische Städte am Rande Hamburgs.
In der Tabaksteuerdebatte im Reichstag beschrieb von Elm seine Kindheit: „Ich bin der Sohn eines Heimarbeiters, und es ist vielleicht keiner im Reichstage, der es so sehr am eigenen Leibe gespürt hat, was Heimarbeit bedeutet. Ich weiß, wie schwer es mir geworden ist, die geringen Kenntnisse, die ich besitze, mir anzueignen. Ich habe mit den Händen als Kind arbeiten müssen vom frühen Morgen bis spät in die Nacht, mit den Augen habe ich gelernt, zwischen dem Tabak lagen die Bücher, und wenn ich nicht Eifer besessen hätte, zu lernen, wäre es ausgeschlossen gewesen, dass ich überhaupt etwas gelernt hätte. Aber was mich das an der Gesundheit geschädigt hat, das ist eine andere Frage, und wenn ich später nicht in andere Verhältnisse gekommen wäre, dann wäre ich vielleicht den Weg gegangen, den so viele meiner Kollegen gegangen sind: Ich würde an der Schwindsucht frühzeitig ins Grab gesunken sein. Im Andenken an die vielen Kollegen, die ich gekannt habe, die alle infolge der schädlichen Wirkung der Heimindustrie zugrunde gegangen sind, trete ich mit so großer Entschiedenheit und Wärme für das vollständige Verbot der Heimarbeit ein. Wer die Dinge kennen gelernt hat, wird mit mir sagen müssen: Eine Wendung zum Besseren in der Tabakindustrie wird nur eintreten, wenn die Heimarbeit vollständig verboten wird“ (Bravo! bei den Sozialdemokraten).9
Auch von Elms Vater verdiente den Lebensunterhalt für die Familie mit dem Betrieb einer Zigarrenarbeiterbude. Zu seinen Aufgaben gehörten die Beschaffung des Rohtabaks bei dem Verleger, die Ablieferung der fertigen Zigarren bei diesem und die Abrechnung mit den in seiner Bude beschäftigten Arbeitern. Es muss ihm dabei gelungen sein, einen gewissen Wohlstand für die Familie zu erarbeiten, was daran deutlich wird, dass Adolph von Elm zumindest zeitweilig auf eine schulgeldpflichtige Bürgerschule geschickt wurde, die der späteren Mittelschule entsprach.10 Für seine berufliche und politische Entwicklung war dabei wichtig, dass an dieser Schule Englisch gelehrt wurde.
4 RT-Protokoll 5. Mai 1906, S. 2960
5 Correspondenzblatt 1916, S. 406
6 telefonische Auskunft Kurt von Elm, Oldenburg, am 18.4.2013
7 Kasch, KR, 1916, S. 667 f.
8 Bruhns, S. 8 ff.; das Leben in einer Ottenser Tabakarbeiterfamilie wird zudem authentisch beschrieben in dem Roman von Otto Ernst, Asmus Sempers Jugendland, Roman einer Kindheit, 1. Auflage Leipzig 1905
Vorleser in der Zigarrenmacherbude
Auch von Elm hat während seiner Schulzeit als Vorleser in der Zigarrenmacherbude gedient und auch für ihn war der von Bruhns „hochgeschätzte Botschafter“11 sicher einer der wichtigsten Texte. Der Botschafter mit dem Untertitel Organ der deutschen Cigarrenarbeiter wurde von Friedrich Wilhelm Fritzsche redigiert, dem Präsidenten des 1865 gegründeten Allgemeinen Deutschen Cigarrenarbeiter-Vereins, der damals größten aller deutschen Gewerkschaften.12
Man kann davon ausgehen, dass der Botschafter, das Organ des Zigarrenarbeiterverbandes, in den meisten Zigarrenbuden vorlag und gelesen wurde. Friedrich Wilhelm Fritzsche, der Präsident der Zigarrenarbeiter, war neben Julius Vahlteich und Ferdinand Lassalle einer der Gründer des Allgemeinen
Jakob Audorf d.J., Dichter der Arbeitermarseillaise (HKS)
Deutschen Arbeitervereines (ADAV), des Vorläufers der Sozialdemokratischen Partei.13 Dessen Leitung gehörte er nach wie vor an. Wenn von Elm als Vorleser tätig war, so ist er damit von Beginn seiner geistigen Entwicklung mit sozialdemokratischem Gedankengut in Verbindung gekommen, denn 1867, als der Botschafter erstmals erschien, war er neun Jahre alt. Der Botschafter war einerseits gewerkschaftliches Fachorgan und berichtete insofern getreulich über die Entwicklung der gewerkschaftlichen Angelegenheiten. In einer Zeit jedoch, in der die Sozialdemokratie einerseits und die Gewerkschaften andererseits erst dabei waren, ihre Rollen zu definieren und ihren Platz in der Gesellschaft zu finden, war der von der Zeitschrift vermittelte Horizont viel weiter als auf die engen berufsfachlichen Angelegenheiten beschränkt.
Alle großen Fragen der Arbeiterbewegung wurden hier angesprochen und die wichtigsten Autoren kamen hier zu Wort.14
Es gab auch Buden, in denen gesungen wurde, manchmal vollständige Opern, und bei denen die Einstellung von Tabakarbeitern sich danach richtete, ob ein Tenor, Bariton oder Bass fehlte.15 Als der Botschafter 1869 den Text von Jakob Audorfs später sehr populären Arbeitermarseillaise veröffentlichte, tat er dies „auf vielfache Aufforderungen“.16
Der Allgemeine Deutsche Cigarrenarbeiter-Verein, die älteste deutsche Gewerkschaft, Vorläufer der heutigen Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, wurde zwar erst Weihnachten 1865 gegründet, die gewerkschaftlichen Traditionen der Tabakarbeiter reichen jedoch in die Zeit vor der Märzrevolution von 1848 zurück.17
Bereits 1823 schufen jüdische Tabakarbeiter in Hamburg eine Krankenkasse und 1848 wurde hier ein überkonfessioneller Cigarren-Arbeiter-Verein gegründet, der unter seinem jüdischen Vorsitzenden Sally Joseph Eschwegeals eine der wenigen Arbeiterorganisationen die Reaktionszeit nach der Märzrevolution überstand und noch bis 1890 existierte.18 1865 gehörten dem Verein über 600 Mitglieder an.
‚Colosseum‘ in Leipzig (später ‚Pantheon‘), Gründungsort des Allgemeinen Deutschen Cigarrenarbeiter-Vereins (NGG)
Alle reaktionäre Unterdrückung und alle Organisationsverbote hatten es auch sonst nicht vermocht, das gewerkschaftliche Bewusstsein in den Reihen der Tabakarbeiter auszulöschen. Einen Beleg dafür bietet ein Aufruf englischer Tabakarbeiter während eines Streiks in England, der Mitte der 1850er Jahre an die Tabakarbeiter in Deutschland gerichtet wurde, nicht als Streikbrecher nach England zu gehen.19 Die Engländer kannten offenbar die Adressen, u.a. in Frankfurt am Main, an die sie einen solchen Aufruf schicken mussten, und das heißt, sie wussten von der in der Illegalität der Reaktionsära nach wie vor bestehenden Organisation der Tabakarbeiter. Hinzu kommt, dass nicht alle Arbeiterorganisationen überall mit gleicher Intensität verfolgt wurden, und so hat auch der in Hamburg bereits 1853 gegründete ‚Freundschaftsclub’ der Zigarrensortierer die Jahrzehnte überdauert.20
Statuten Hamburger Cigarren-Arbeiter-Verein (Möller)
Adolph von Elm hat zwar die Bürgerschule besucht, sie jedoch nicht abgeschlossen. 1872 im Alter von 14 Jahren begann er eine Lehre als Zigarrensortierer. Die Sortierer bildeten innerhalb der Tabakarbeiterschaft eine zahlenmäßig kleine Elite, man schätzte, dass auf 10 Zigarrenmacher ein Sortierer kam.21 Sie waren die einzige Berufsgruppe unter den Tabakarbeitern, die eine Lehre absolvieren musste22 und gutes Geld verdiente. Die Anforderungen waren hoch, insbesondere an die Fähigkeiten zur Farberkennung, da von der richtigen Sortierung nicht zuletzt der für die Zigarren erzielbare Preis abhing. Es mussten bei den Zigarren bis zu 72 Unterscheidungen nach Farben und Schattierungen vorgenommen werden.23 Ihren besonderen fachlichen Status, der gelegentlich auch mit Vorgesetztenfunktionen verbunden war, demonstrierten sie nicht selten dadurch, dass sie bei der Arbeit eine Krawatte trugen.24
Der Botschafter erweist sich als ergiebig sprudelnde Quelle, wenn man sich eine Vorstellung davon machen will, was damals in den engen und düsteren Zigarrenmacherbuden diskutiert worden ist. Die Hausarbeit als einer der schlimmsten Geißeln der Zigarrenmacher wurde immer wieder angesprochen. Ihre Beseitigung blieb eines der zentralen politischen Anliegen, die von Elm während seines ganzen politischen Lebens verfolgt hat.25 Seine Nähe zu den Konsumgenossenschaften hatte sicher damit zu tun, dass es hier möglich war, Zigarren aus Hausarbeit zu verdrängen und durch solche aus geordneter Fabrikarbeit, am liebsten aus der eigenen Tabakarbeitergenossenschaft, zu ersetzen.
Fahne der Sortierer in Verden (Sackmann)
Der Botschafter wird tiefen Eindruck auf den Schuljungen Adolph von Elm gemacht haben, denn was er daraus vorlas, stimmte weitgehend mit dem überein, was er in dem armseligen Wandsbeker Elternhaus erlebte und was er von den dort tätigen Tabakarbeitern erfuhr. Manche seiner späteren Handlungen und Charakterzüge kann man auf den Botschafter zurückführen, der uns heute für die Jahre 1867 bis 1871 als ein Reprint der Gewerkschaft Nahrung – Genuss – Gaststätten zugänglich ist.26
Todesanzeigen aus demBotschafter
9 RT-Protokoll 5. Mai 1906, S. 2960
10 Meyers Konversationslexikon, Leipzig und Wien, Vierte Auflage, 1885-1892, Stichwort: Bürgerschule
11