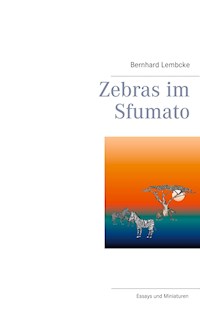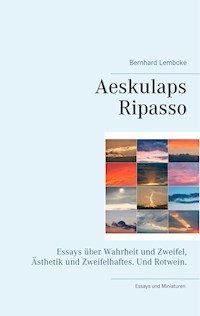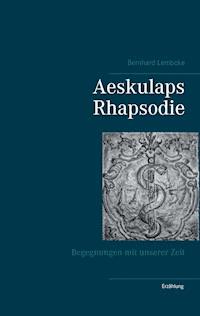
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Aeskulaps Rhapsodie wendet sich an Menschen, die sich für gesellschaftliche Aspekte der Medizin interessieren, also medicoaffine Laien ebenso wie beruflich Interessierte. Die z.T. augenzwinkernde Erzählung beschreibt verständlich, erzählerisch und mit erfrischender Natürlichkeit und Empathie, wie ärztliche Haltung entstehen kann. Köstlich, aber nicht immer leicht verdaulich. Ein autobiographischer Bogen von Erfahrungen und Ereignissen, kleinen Geschichten, die mit besonderer Leichtigkeit wie melodisch daherkommen und damit vielfach im Kontrast zu Inhalten und tieferer Bedeutung der Schilderungen und Sachverhalte stehen, ergänzt sich mit situativem Erleben von Zeitgeschehen in einer ärztlich geprägten Wahrnehmung. Diese Sichtachsen und Gedankenlieder entführen in Einschätzungen kontemporärer Entwicklungen, Zusammenhänge und Deutungen gesellschaftlicher Themen, die abwechselnd erhellend wie bizarr erscheinen mögen, wobei sich der Autor bekennend an Aphorismen dieser und vergangener Zeit bedient, teils als Résumée, teils als Schranken, die der Leser gedanklich zu überwinden gefordert ist, nicht selten vermittelnd: "es war alles schon mal da". Amüsantes im Auge einer ernsten Lage.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für
Christiane
Alexander Constantin
Julia-Kristina Elisabeth mit Tibari,
Ilias und Jonas
Christian Frederik
Franziska Katharina
Inhalt
Intro
Arzt – ein Traumberuf, der keine Träumer verträgt
Auf dem Sprung ins Studium
Leila
Göttingen igitur – ohne gaudeamus
Mediküsse für einen jungen Assistenten
Klinisches Können
Flüchtlinge, Teil I – Von Frischlingen und Flüchtlingen
Wie ich zum Ultraschall kam
Graz
Dichotome Irrationalitäten
Jeder hat das Recht, seine Meinung….
Der Bauch der Medizin – Allergien
Fruktose – die Story einer industriell induzierten Unverträglichkeitsproblematik
Gluten-Unverträglichkeit, Krankheit oder Hype und Flop?
Der Nahe Osten – unverblümt privilegierte Landschaften; Zank statt Dank
Nach der Wende
Wahr und Wahrnehmung
Die richtigen Worte
Als Bewahrer gescheitert?
Problem Bildung
Wissenschaft zwischen Steilpass und Tikitaka
Zufriedenheit
Individualität und Anonymität
Politisches vor dem Frühstück
Zwischen den Welten – Religion und Region
Das Schöne ist schwer
Variationen von Lob
Letzte Visite
Medizin im Wandel - einmal anders
Zeit
Der kleine Friedhof und andere Leiden der Ärzte
Ursache und Wirkung
Permissivismus
Der Preis der Teilhabe
Zu Risiken und Nebenwirkungen… fragen Sie bitte Ihren Arzt…
Es gibt keine Gesunden, es gibt nur unzureichend untersuchte Kranke
Flüchtlinge, 2. Teil
Ärzte
Von Menschen und Ratten
Borkum
Schattierungen unseres Bemühens
Schatten werfen keine Schatten - Einführung in das Positive des Schwarz
Die Schwerkraft vorgefasster Gedanken
Letzte Kurve
Intro
Zuhören ist schwieriger als Reden, eine Erfahrung, die Medizinstudenten meist erst noch machen müssen, um gute Ärzte zu werden, während Ehemänner bereits wissen, wovon die Rede ist. Zu den Ärzten kommen wir noch, die Ehemänner bleiben hier außen vor. Den eigenen Mund können wir zuklappen, unsere Ohren nicht. Allein das unterstreicht schon die Bedeutung, die die Natur dem Hören, nicht dem Sagen und auch nicht dem Hörensagen beimisst. Und was ist mit dem Lesen? Auch unsere Augen können wir bewusst schließen, einzeln oder zusammen, und das Buch sowieso. Hat Lesen also gar keine natürliche Bedeutung? Oder ist der Zugang zum Lesen wertvollem Schmuck ähnlich, Schatzes gleich durch einen doppelten Verschluss gesichert, Garant bewusster, freundlicher, situativ passender und würdiger Zuwendung?
Als Autor wünsche ich mir letzteres, sicher ohne damit Verwunderung auszulösen.
Zuhören ist heute ein dünnes Eis. Buchstabiere ich meinen Namen an der Hotelrezeption, wird in 75% ein Buchstabe zu wenig notiert. Berichte ich einem Gutachter telefonisch, Temperaturschwankungen beim Duschen seien inakzeptabel und vermutlich auf ein Druckproblem zurückzuführen, bekomme ich einen Kostenvoranschlag für ein Gutachten, das eine Druck- nicht aber eine Temperaturüberprüfung zum Inhalt hat. Und weil das vielfach im Medizinbetrieb auch nicht anders abläuft, entsteht Betroffenheit. Persönliche Betroffenheit, sei sie nun positiv oder negativ, ist ein Charakteristikum der Medizin. Medizin war zudem immer ein Vorreiter großer gesellschaftlicher und ethischer Themen wie Fortschritt, Ökonomisierung oder „was darf Forschung?“; derzeit ist sie u.a. Vorreiter eines gesellschaftlichen babylonischen Surrealismus. Gründe genug, einerseits einen medizinisch wie persönlich gefärbten Blick auf Facetten des Gegenwartsgeschehens zu werfen, andererseits Beweggründe ärztlicher Denke und Handlungen, sozusagen ein „Making of“ dessen kennenzulernen, was ärztliche Haltung formt.
Schwieriger noch folgende Situation. Auf einem Kindergeburtstag hatte der ältere Bruder des Geburtstagskindes als frischgebackener Pädagogikstudent für uns ein Geschicklichkeits-, Rate- und Wissensspiel vorbereitet. Dabei zeigte er uns für eine Minute das Bild »Der Sonntagsspaziergang« von Carl Spitzweg und nannte den Titel, um im Anschluss nach Inhalten (Anzahl Personen, Kinder) zu fragen. Eine Frage lautete: »Wo steht in dem Bild die Sonne?« Meine Antwort war: »links«. Er gab mir keinen Punkt; auf dem Bild sei gar keine Sonne. Damit mochte ich mich nicht zufriedengeben. Zwar hatte ich keine bewusste Erinnerung an eine malerisch abgebildete Sonne, aber es gab Schatten. Und die von mir unbewusst realisierten Schatten wiesen in meiner Erinnerung nach rechts. Zudem hielten sich alle abgebildeten Familienmitglieder im Bild nach links einen Schirm oder Hut vor das Gesicht. Also stand die Sonne links. Ich erhielt neben einem erstaunten Blick einen halben Punkt. Unter dem Aspekt ärztlich qualifizierender Wahrnehmung hätte ich zwei Punkte erhalten müssen. Für Spurenlesen.
Derart subjektive Wahrnehmung in und zwischen den Zeilen wünsche ich mir für dieses Büchlein. Aber wer liest heute noch Bücher? Es lohnt sich auch gewiss nicht, ein Buch zu schreiben. Songs dagegen erreichen ein breites Publikum offenbar ständig aufnahmebereiter Rezipienten, sei es als CD oder über Downloads. Ich sollte also kein Buch schreiben, eher einige Gedankenlieder aus meiner Lebens-LP auskoppeln. Allerdings: Musikgenuss, auch wenn er nicht nebenbei stattfindet, ist in erster Linie Konsum; Musik lesen mit den Ohren, das können nur wenige. Manche Titel werden überdies im Radio so lange gespielt, bis der Hörer des dadurch zur Beliebigkeit überdrehten Stücks überdrüssig ist.
Das spricht für das wohldosierte Buch. Lesen ist und geschieht mit Zuneigung und Leidenschaft.
Arzt – ein Traumberuf, der keine Träumer verträgt
Es ist nicht untypisch für Ärzte, dass ihre Kinder auch Arzt werden. Viele hausärztliche Praxen haben diesen dynastischen Charakter. Für Klinikärzte scheint das etwas weniger zu gelten, aber auch hier spielt die familiäre „Infektion“ mit dem Medizin-Virus eine große Rolle, wobei ein Wechsel der Fachdisziplin nach meinem Eindruck eher die Regel als die Ausnahme ist. Für mich traf weder das Eine noch das Andere zu. Ärzte gab es unter meinen Vorfahren gar nicht und so schien mein Vater nicht wenig überrascht, als ich mein Ansinnen mit etwa 16 Jahren erstmals vortrug. Er, der nach dem Abitur in Mecklenburg seine obligatorische Wehrdienstzeit um einen ganzen Krieg nebst Gefangenschaft hatte verlängern müssen und sich dann auf sich allein gestellt diesseits des Eisernen Vorhangs als mittelloser Student in Hamburg wiederfand, während die potentiell fürsorglichen Eltern nebst Heimat und Kindheit in eine andere Welt entschwanden, er hatte mich nie gefragt, was ich mir denn vorstellen könne, nie einen Vorschlag unterbreitet oder mich gar in eine ihm genehme Vorstellung gedrängt. Vater wusste aus eigenem Erleben, dass es nicht ausreicht, einen Berufswunsch zu haben (er fand es als Vorkriegs-Abiturient chic, später Modezeichner zu werden und fand sich als Ex-Oberleutnant und Nachkriegs-Student bei Mathematik, Physik, Chemie, Pädagogik und Philosophie wieder), dieser muss auch den Anforderungen der Zeit entsprechen, so wie der Eleve den Anforderungen des Berufes entsprechen muss. Es war wohl auch eher dieser letztgenannte Aspekt, der sein Erstaunen rechtfertigte, kannte er mich doch als einen schnell aufgeschossenen Teenager von leptosomem Habitus, der regelhaft schlappmachte, wenn eine Impfung anstand, eine Kanüle nebst Spritze auf ihn zukam oder echtes Blut auftauchte.
Mit diesen Dellen in einem ersehnten medizinischen Horizont – konnte das gutgehen? Mein Vater holte sich Rat beim Chefarzt der chirurgischen Abteilung unseres Krankenhauses, Dr. Wolfgang Wietstruk. Dieser bot an, dass ich als Praktikant in den Ferien zu ihm kommen sollte, damit er sich selbst ein Bild von meinen Ambitionen machen könne. Und so begann meine Reise in das Meer / Mehr der Medizin.
6:30 Uhr Dienstbeginn mit den Schwestern auf der Station – das hieß zu aller erst einmal in den Ferien nicht später, sondern früher als gewohnt aufzustehen. Die Stationsleitung, Schwester Anni, führte ein strenges aber freundlichbestimmtes Regiment. Ich bewundere heute noch ihre Fähigkeit, am Stationsarbeitsplatz zu sitzen, Kurven (Krankenblätter) sorgfältig zu bearbeiten und dabei –ohne Sichtkontaktjederzeit genau zu wissen, wo ihre Schwestern gerade tätig sind und wie sie jeweils im Zeitplan liegen. Mir oblag die Hilfestellung für die Schwestern beim Betten, Essen austeilen, dann aber auch dem Richten der Infusionen und als besondere Aufgabe: das Aufwickeln gewaschener zarter Baumwoll-Mullverbände sowie das mechanische Vorreinigen von Kanülen, die anschließend in die Sterilisation kamen. Beide letztgenannten Tätigkeiten (heute durch Einmalartikel nicht mehr existent) fanden im hintersten Raum der Station statt, was mir den Eindruck einer selbstverantwortlichen Tätigkeit vermitteln mochte. Alle Pflegekräfte waren aber redlich bemüht, mir auch interessantere Aufgaben zu zeigen, seien es Verbandwechsel, spezielle Wundversorgungsmaßnahmen (es gab in dieser Zeit vielfältige Lösungen und Salben, auf die heute viel weniger Wert gelegt wird) oder die Durchführung einer Magenspülung. Obwohl ich später Gastroenterologe wurde und neben Magenspiegelungen vielerlei Magenspülungen (bei Tablettenvergiftungen) wie auch sog. Magenausheberungen zur Magensäureanalytik noch selbst durchgeführt habe, ist mir die Art und Weise, in der Schwester Anni zur Magenspülung schritt, bis heute unvergessen geblieben.
Schwester Anni war eine stattliche, große Frau mit Rundungen und Verve; glänzend-glattes schwarzes Haar unter der weißen Haube, makellos, und mit laser-genauem Mittelscheitel. Als Diakonisse wirkte sie dabei stets strenger als es wohl ihrer Persönlichkeit entsprach. Für die Magenspülung positionierte sie den Patienten auf einen Holzhocker, sorgte für eine feuchtigkeitstaugliche Abdeckung von Bauch und Beinen, und setzte sich dann selbst auf einen Stuhl dicht hinter den Patienten. Dieser wurde aufgefordert, den Kopf nach hinten zu neigen, was Schwester Anni dahingehend unterstützte, dass dieser eine ebenso stabile wie komfortable Position inmitten ihres Busens fand, - weich und fest, dabei ohne jede Chance des Entkommens. Dermaßen kontrolliert führte sie nun den Magenschlauch ein, was für den zweifellos über beide Ohren betörend abgelenkten Patienten kaum jemals Anlass zu heftigem Würgen oder Widerstand anderer Art gab. Unnachahmlich.
Die pflegerische Tätigkeit bot Gleichmäßigkeit und Abwechselung gleichermaßen. So nebenbei erkannte ich, dass Lernstoff in der Schule praktische Konsequenzen hatte, z.B. wurden die Blumen der Patienten nachts vor die Tür gestellt, da Pflanzen nachts Sauerstoff aufnehmen und dieser in den Patientenzimmern voll und ganz den Patienten für ihre Rekonvaleszenz zur Verfügung stehen sollte. Natürlich oblag es mir auch, Patienten nach dem Stuhlgang ihre Sauberkeit wiederzugeben, die Bettpfannen für den Stuhlgang zu verteilen, zu entleeren und maschinell zu spülen. Philosophisch-pflegerische niedersächsische Empirie begleitete dabei mein Tun (Zitat eines nicht näher genannten formidablen Pflegers: »...derMorgenschiss, der kommt gewiss, und wenn es spät am Abend is..«).
Meine Krankenhaus-Praktika in den Sommer- und Herbstferien, aber auch eine gelegentliche Mitwirkung an Wochenenden wurden in den letzten 2-3 Schuljahren zu einer regelmäßigen Selbstverständlichkeit, die mir angenehme Aufgabe, Neuland, aber trotz ungewohnter körperlicher Inanspruchnahme keine Last war. Inhaltlich bekam ich Gelegenheit, Injektionen zu erlernen, zunächst in Form einer Anleitung durch Dr. Yüksel Tenekecioglu, den türkischen Stationsarzt, der dann eines Tages unvermittelt seinen Ärmel aufkrempelte und sagte: »so, und nun nimmst Du bei mir Blut ab«. Nachdem die Prozedur kritiklos durchgeführt und der Proband weiter bei guter Gesundheit war, kam die nächste Überraschung: »und jetzt nimmst Du bei allen Patienten am Wochenende Blut ab, dann kann ich länger schlafen. Wenn Du Probleme hast, kannst Du mich ja rufen«. So versah ich am Wochenende die Blutentnahmen, und ich habe das sehr ordentlich gemacht.
Relativ zügig hatte mich der Chefarzt auch in den OP mitgenommen und in das kleine 1x1 chirurgischer Verhaltensregeln eingeführt. Ich lernte, meine Hände und Unterarme hygienisch einwandfrei zu desinfizieren, erfuhr, dass Fingernägel kurzgeschnitten und natürlich sauber zu sein haben, lernte mit der Bürste gleichmäßig und rational zu schrubben und wie ich sachgerecht sterile Kittel, Kopfhaube und Mundschutz anlege bevor abschließend die sterilen Handschuhe übergestreift werden. Und ich lernte, wer im OP das Sagen hatte. Das war Schwester Erna, die leitende OP-Schwester. Eine Diakonisse mit silberweißem Haar, gütigem Gesicht, in das sich so viele Falten eingegraben hatten, dass es Jahresringe sein mochten. Ich habe heute noch keine Vorstellung davon, wie alt sie wirklich war, wohl Ende 60. Schwester Erna war kompetent, vorausschauend und ziemlich ausgebufft. Ihre Anweisungen zur Nahrungsaufnahme in Form filetierter Apfelsinenscheiben, Apfelspalten oder Bananenstückchen zwischen den Operationen blieben stets unwidersprochen, selbst dann, wenn der Chef deutlich in Zeitdruck war. Es waren diese Zeiten, die eben auch zur Reinigung des Operationssaals und zur Aufbereitung der Bestecke für den übernächsten Eingriff erforderlich waren. Für mich waren die Pausen mit Obst und einem Glas Milch unschätzbare Lehrstunden, in denen ich meine Lektionen über Sinn und Strategie der anstehenden oder erfolgten Eingriffe erhielt, aber auch Rückkopplung, wie ich mich angestellt hatte. Jawohl, angestellt, denn mir wurde nicht etwa nur manches gezeigt und erläutert, ich erhielt vielmehr kleine Detailaufgaben zugeteilt, beginnend mit dem Abschneiden der Fäden beim Bauchdeckenverschluss. »11 mm!«, -die sonorimperative Anweisung habe ich heute noch im Ohr (und -obwohl nur eine Metapher- stets beherzigt). Wenn man gezeigt und erklärt bekommt, wie Haken zu halten sind und warum etwas besser so und nicht anders gemacht wird, wie kleinere Blutungen gestillt werden und warum jeder einzelne Schritt so und nicht anders erfolgt, dann ist die Operation eigentlich keine Kunst, sondern ein gediegenes Handwerk.
Das Kunsthandwerk besteht darin, „Material und Oberflächen“ gefühlvoll, schonend und gewebespezifisch respektvoll zu behandeln, und nicht wie die Axt im Walde oder einfach nur formal korrekt zu agieren. Die Tabaksbeutelnaht zur Versenkung des Blinddarmstumpfes wird der talentierte OP-Eleve denn auch kreisförmig anlegen und explizit rechte Winkel vermeiden, die beim Zusammenziehen Gewebseinrisse zur Folge haben könnten und damit zum Ausgangspunkt verstärkter Infektionsraten oder auch innerer Narbenbildungen würden. Die Fasziennaht der Bauchdecke sollte demgegenüber vor allem eine erkennbare (gleichmäßige) Festigkeit aufweisen, sie gewährleistet den mechanischen Widerstand gegenüber einem Bruch. Ich kann sagen, dass ich in meiner ganzen medizinischen Laufbahn niemals eine so gute, feingliedrige und erläuternde Anleitung bekommen habe, wie seinerzeit vis-à-vis durch den Chef für alle einzelnen Schritte der Blinddarm-Operation. Aneinandergereiht beinhalteten sie eines Tages meine erste vollends eigene Blinddarm-Operation - noch vor Beginn meines Medizinstudiums.
Schwester Erna war auch der Hauptdarsteller in einer unvergessenen Szene, deren Realität jede slapstick-Einstellung zu toppen vermochte. Der Chefarzt operierte, ihm gegenüber stand als erster Assistent Dr. K.G., ein großer, gut aussehender, athletischer Mann türkischer Provenienz, dem die kräftige schwarze Brustbehaarung noch aus dem V-Ausschnitt seines OP-Kasacks lugte, bevor der OP-Kittel für völlige Bedeckung bis zum Hals sorgte; als 2. Assistent stand ich an der Seite des Operateurs. Abgesehen von einem Käppi besteht die OP-Kleidung am Körper über der eigenen Unterwäsche aus einer (meist nur ungefähr passenden) Hose, die mit einem Bändchen zugebunden wird, dem kurzärmeligen Kasack mit V-Ausschnitt und -nach der Desinfektionsprozedur- dem Überziehen eines sterilisierten OP-Kittels, der dann durch sterilen Mundschutz und sterile Handschuhe ergänzt wird.
K.G. war offenbar etwas nachlässig beim Zubinden seiner Hose gewesen, sie rutschte. Zunächst war er nur etwas unaufmerksam, was sowohl dem Operateur wie Schwester Erna sofort auffiel, aber nur letztere erspähte auch die Ursache. Schließlich landete die Hose unterhalb der Knie und gab den Blick auf 20cm gut geformte Männerbeine frei, ein Anblick, der Schwester Erna zu unverzüglichem Handeln bewog. Sie bewegte sich langsam hinter den Assistenten, beugte sich lautlos wie geschmeidig hinab, wohl in der Hoffnung, der Chef würde sich nicht irritieren lassen, und begann ruckelnd, dem diesbezüglich ahnungslosen Doc die Hose unter seinem sterilen Kittel hochzuziehen. Da auch der Kittel in Taillenhöhe fest verschnürt ist, gelang das Manöver -vorhersehbar- nur bis in den unteren Beckenbereich, gleichwohl nahm die Unruhe bei Schwester Erna und dem derart Heimgesuchten deutlich zu. Dr. Wietstruk war rein gar nichts entgangen, sah aber jetzt seinerseits Handlungsbedarf. Den Blick streng auf Schwester Erna gerichtet kam ein knappes: »Erna, was musst Du dem Kerl an die Wäsche gehen?« »Die Hose, die Hose ist gerutscht!« »Ja, und? Lass das! Mit den Beinen operiert er ja nicht!«. Damit war nicht nur die Situation gerettet, die Atmosphäre im Rest der Operation war auch noch deutlich gelöster als sonst. Nur Schwester Erna wahrte eine aus ihrer Sicht gebotene Strenge.
Was mich beeindruckte, war die Vielseitigkeit der chirurgischen Tätigkeit. In einem kleineren Krankenhaus und um 1970 war eine Aufteilung in Allgemein-, Abdominal-, Unfall- oder Gefäßchirurgie nicht vorgesehen und auch operative Nebendisziplinen wie die Urologie waren nicht vor Ort. So reichte das Spektrum denn von der Warze und dem eingewachsenen Fußnagel über Einrenkungen, Platzwunden, Blinddarmentzündungen und Leistenbruch, Gallen-, großen Magen- und Darmoperationen, Schilddrüsenoperationen und Milzentfernung, Knochenverplattung oder –Nagelung, sowie Phimosen- und Kryptorchismus-Operationen bis zur Sympathektomie und Nierenresektion. Hier, und nicht primär im Studium, habe ich die grundlegenden ärztlichen Werte erfahren und aufgesogen: Demut vor der Schöpfung, der menschlichen Anatomie und Funktion, Sorgfalt und Präzision, Hingabe und Empathie bei der Arbeit an und für Patienten sowie die Balance zwischen Kenntnissen und Fähigkeiten einerseits und selbstbewusster Einschätzung derselben andererseits. Ein Abweichen hiervon vermag ich auch heute nicht zu akzeptieren, eine Einstellung, die ich den Studenten in der Vorlesungsreihe zur »Berufsfelderkundung« am ersten Tag ihres Studiums stets als meine verbale Richtschnur mit auf den beruflichen Weg gebe:
»Die einzige Form von lässig, die Medizin toleriert, ist zuverlässig«.
Nonverbal hat sich diese Einstellung auch auf meine Mitarbeiter übertragen, die heute entsprechend Vertrauen verdienen und genießen. Sie haben das durchweg positiv erlebt, mitunter vielleicht auch als atmosphärischen Druck, und diejenigen, die sich diese Einstellung nicht zu eigen machen mochten, sind entsprechend gegangen. Ich konnte das akzeptieren, wie auch die in diesen Rahmen passende Äußerung einer jungen Ärztin, der zauberhaften Ehefrau eines guten Freundes, »Bernhard,…es ist schön, Dich als Freund zu haben, aber als Chef würde ich Dich nicht haben wollen«.
Kompromisse sind im Alltag mitunter unvermeidlich und können Bestandteil einer bestmöglichen Lösung sein; sie sind strategische Handlung, aber definitiv nicht Teil ärztlicher Grundeinstellungen. Inkonsequenz kann hier folgenreich sein.
Den Dominoeffekt erkannte bereits Platon: »Duldet ein Volk die Untreue von Richtern und Ärzten, so ist es dekadent und steht vor der Auflösung«.
Ein Samstag, an dem ich wieder zur Blutentnahme in dem kleinen Krankenhaus war, zeigt, wie urplötzlich Anforderungen, Verantwortung und Extremsituationen auftreten und ärztliche Tätigkeit nicht mit normalen Maßstäben messbar oder gar beurteilbar wird. Es war ein schöner Samstag, meine Spritzenrunde war erledigt und ich saß dem Medizinalassistenten Dr. P. beim Mittagessen in der Kantine gegenüber. Er hatte Präsenzdienst in der Chirurgie und ich als angehender Student fragte ihn, den jungen Mediziner mit abgeschlossenem Studium, aber noch vor der Vollapprobation (Medizinalassistenten waren so etwas wie Referendare) nach seinen Erfahrungen mit Studium und Beruf. Wir hatten Zeit zum Plaudern. Noch vor dem Nachtisch kam jedoch der Anruf von der Pforte: Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten. Der diensthabende chirurgische Oberarzt war bereits von der Pforte alarmiert worden und unterwegs.
Ich hätte eigentlich nach dem Mittagessen nach Haus gehen sollen, wollte aber aus Interesse bleiben. Dr. P. nahm mir die Entscheidung ab: ich müsse bleiben, Polytrauma bei mehreren Personen, da werden alle Kräfte gebraucht, zumal der Chefarzt der Anästhesie nicht da sei; dieser holte die Ehefrau unseres diensthaben (einzigen) chirurgischen Oberarztes, der den verreisten Chef vertreten musste, von einer onkologischen Therapie aus Bremen ab.
Wir eilten beide zügig zur Notfallanfahrt und trafen dort auf die zuständigen Pflegekräfte und den unmittelbar vor dem Krankenwagen soeben eintreffenden Oberarzt. Dieser übernahm unverzüglich die Führung, indem er die hinteren Türen des Rettungswagens noch vor dem Aussteigen der Fahrer öffnete. Was folgte war eine grausige Situation, an Dramatik kaum zu überbieten, ein unvergleichlicher Aufschrei. Blutüberströmt lagen da unser Chefarzt der Anästhesie (sein bester Freund), -und die eigene Ehefrau. Während wir uns alle schockiert aber behände um sichere venöse Zugänge, das Kreuzen von Blut und Infusionen kümmerten, war es an ihm, seine Ehefrau und den Freund zu intubieren, da der rufdiensthabende Anästhesist einen längeren Anfahrtsweg als er gehabt hatte. Eine Intubation unter Verzweiflung, Blut und Tränen.
Schnitt. Um von Ende anzufangen: beide Patienten sind an ihren schwersten Verletzungen im Laufe des Tages verstorben. Für den heutigen Leser erscheinen die personellen Rahmenbedingungen sogleich als ein gravierender Missstand. Dass Medizinalassistenten Dienst tun, war aber sowohl inhaltlich wie rechtlich in Ordnung und absolut üblich; für operative Eingriffe hatte der Oberarzt als Facharzt Rufbereitschaft. Um dieser gerecht zu werden, hat er seinen Freund die Ehefrau abholen lassen. Dass kein Anästhesist Anwesenheitsdienst versah, war ebenfalls üblich, das Fach war als eigenständige Disziplin noch im Aufbau und es gab daher zu dieser Zeit sogar noch Bereitschaftsdienste durch speziell qualifizierte Anästhesiepfleger/-schwestern, die selbst Narkosen durchführen durften (und zumeist hervorragende Arbeit leisteten). Mit der Notwendigkeit zu einer weiteren Narkose konnte der fachärztliche Anästhesie-Dienst zeitgerecht einbestellt werden. Unser Anästhesie-Chefarzt hatte eine solche Hintergrundfunktion, die eine längere Vorlaufstrecke durchaus vorsah. Derartige, heutzutage liebevoll gepflegte, vermeintlich kritische wie vermeintlich berechtigte Überlegungen verlieren etwas Anderes aus dem Blick: die Qualität medizinischen Handelns, die sich hier darin ausdrückt, dass es dem Oberarzt ungeachtet der zerreißenden Umstände gelang, die beiden Schwerverletzten zu intubieren. So etwas geht nur bei sehr guter, breiter Ausbildung und einer samtweichen Ausübung ärztlicher Inhalte. Wer hier „kritisch“ sein zu sollen glaubt, sollte sich einfach fragen, ob er nach einem aufwühlenden Telefonanruf noch in der Lage wäre, einen Nagel gerade in die Wand zu schlagen. »Medizin ist die Kunst des Machbaren« habe ich aus meinem Studium mitgenommen. Ich habe Medizin so kennengelernt, dass alle Akteure unter allen Umständen ihr Bestes geben. Das ist sehr viel, und diese Realität überwiegt alle klugscheissenden, oft winkeladvokativen Erwägungen; Virtute statt Virtualität! Medizin als Spagat zwischen Schöpfung und Erschöpfung. Es ist die hehre Motivation nahezu aller Medizinstudenten und jungen Ärzte, Menschen in Schwierigkeiten zu helfen. Das überdauert im Kern, wird aber im Alltag zunehmend verunreinigt durch schwierige Menschen und schließlich auch Menschen, die auf Schwierigkeiten aus sind. Solche, allerdings, kannten wir 1972 nicht. Weder als Patienten, noch als Angehörige oder Juristen.
Bereitschaftsdienst ist ein anspruchsvolles, durchweg verkanntes Wort. Verkommen zu einem buchhalterischen Verfügbarkeitsversprechen mit unzureichender Vergütung, ein sich Bereithalten ohne Reflektion auf Inhalte. Vom Arzt als Instanz zum instant-Arzt. Dabei beinhaltet das Wort einen Dienst, der die Bereitschaft verlangt, bereit zu sein für alles, was da kommt: das pralle Leben, in allen Schattierungen. Dialog am späten Abend auf der Notaufnahme: »Was fehlt Ihnen denn?« »Ich glaube, ich bin einfach überarbeitet.« »So? Was arbeiten Sie denn?« »Ich bin Nutte«.
Romantisch bisweilen, in der Retrospektive wirkt manches auch museal. Menschen und Methoden. Zu den Möglichkeiten meiner Praktikums- und Hospitationseinsätze gehörte auch, der nach dem Tod des bisherigen Chefs neu berufenen Chefärztin für Anästhesie bei Narkosen im HNO-OP zu assistieren. Der HNO-Arzt hatte einen vorzüglichen Ruf, gerade auch in Bezug auf die Entfernung der Gaumen- oder Rachenmandeln (Tonsillektomie, Adenektomie). Allerdings lehnte er Intubationsnarkosen ab, da ein Tubus das Gesichtsfeld und seinen instrumentellen Bewegungsspielraum im Rachen deutlich einengt. Er bestand auf weiterer Durchführung der traditionellen Äthernarkose mittels Schimmelbuschmaske (was früher immer durch Schwestern / Pflegern erfolgte). Andererseits bestand die Anästhesistin (zu Recht) darauf, dass sie für alle Narkoseeingriffe zuständig sei, und es war ihr durchaus zuwider, sich auf das medizinhistorische Niveau der Äthernarkose zu begeben. Die Lösung bestand darin, dass die Pensionierung des HNO-Arztes in relativ kurzer Zeit anstand, so dass er sich nicht umgewöhnen musste, sie auf ärztlicher Durchführung der Narkose bestand und zudem ihre Vorstellungen nach dem Ausscheiden des Operateurs umsetzen konnte. Auch hierzu eine Anmerkung: unbedarft ist durchaus zu hinterfragen, warum überkommene Methoden in der Medizin überhaupt partiell weitergeführt werden / werden dürfen. Bei näherer Betrachtung wird aber auch hier der Aspekt Sicherheit deutlich: eine Umstellung auf Intubationsnarkose war dem altgedienten HNO-Arzt nicht einfach unbequem, vielmehr hätte sie dazu geführt, dass er sich trotz langjährig positiver Erfahrung unsicher gefühlt hätte. Vorgehensweise und Resultate wären gänzlich anders, vergleichbar einer Top-Fußballmannschaft, die plötzlich in der Halle spielt,- noch Fußball, aber eben ein anderes Spiel.
Für mich hatte diese Schnittstelle zwischen althergebrachter Narkose und moderner Anästhesie den Vorteil, dass ich nicht nur eine Schimmelbuschmaske kannte (die uns im Studium dann nur wenige Jahre später als medizinhistorisches Exponat gezeigt wurde), ich kannte auch die verschiedenen Stadien einer Narkose, die nämlich primär 1937 von Arthur Earnest Guedel (1883-1956) an der Äthernarkose beschrieben worden waren. Diese Einteilung in 4 Stadien umfasste das Stadium der Analgesie, das Exzitationsstadium, das Toleranzstadium und das Stadium der Asphyxie; sie wird heutigen Bedingungen einer modernen Narkose nicht mehr gerecht und ist daher inzwischen so nicht mehr gebräuchlich. Meine Aufgabe bestand darin, auf einem Stuhl sitzend, die kleinen Patienten von hinten umarmend auf meinem Schoß festzuhalten, so dass keine plötzlichen Armbewegungen erfolgten und gleichzeitig ihrem Kopf auf meiner linken Schulter eine Ablage zu bieten.
Der Narkosearzt stand oder saß dahinter und träufelte Äther auf die Mull-bespannte Maske, die Nase und Mund des Kindes bedeckte. Dass ich dabei auch meinen Teil Ätherdampf abbekam, war zwar aromatisch, aber für mich eher unproblematisch. Schwieriger war das Exzitationsstadium. Hier kommt es zu unwillkürlichen Bewegungen des Kindes, die dazu verleiten könnten, den umschlingenden Griff der haltenden Person fester werden zu lassen. Dies engt jedoch die Atmung des Kindes ein und hat deshalb zu unterbleiben. Mit Beginn des Toleranzstadiums ist dann die Durchführung des Eingriffs unter Narkose möglich, ein Abgleiten in das Stadium der Asphyxie (Atemlähmung) darf es dabei keinesfalls geben. Verträglichkeit und therapeutische Breite (das ist der Abstand zwischen erwünschter Wirkung und dem Eintritt unerwünschter Wirkungen) sind bei heutigen Narkoseformen deutlich günstiger. Für die Patienten ist der unmittelbare Fortschritt in der Medizin bis zum Ende des 20. Jahrhunderts nur auf wenigen Gebieten so spürbar gewesen, wie durch die Einführung schonender Methoden für die Narkose, die Diagnostik und die Operationen. Wir sollten uns dieser Entwicklung gern öfter in Dankbarkeit erinnern.
Eines Tages hatte das Krankenhaus einen Pathologen aus Oldenburg angefordert, um bei einem Patienten eine Sektion zur Feststellung der Todesursache durchführen zu lassen. Die tieferen Beweggründe hierfür sind mir nicht mehr erinnerlich, aber es war ein sehr seltenes Ereignis und allein deshalb für den angehenden Studenten und Arzt hoch interessant. Die Sektion sollte nicht im Krankenhaus, sondern in der Kapelle des Friedhofs stattfinden.
Auf dem Weg dahin traf ich meine Vorkehrungen: Limettendrops. Ich war mir klar darüber, dass es einen unangenehmen, fauligen Geruch geben würde und kaufte eine Tüte im -wie es seinerzeit hieß- Kolonialwarenladen unterwegs. Der Pathologe, erfreut, einen angehenden Studenten vorzufinden, dozierte freundlich und verständlich für mich und tauschte mit dem ebenfalls anwesenden Arzt der Klinik fachliche Begriffe und Blicke gegenseitigen Verständnisses aus, während ich respektvoll gegenüber der Sektion und Szenerie, aber gewiss auch respektlos gegenüber dem Toten, einigermaßen kontinuierlich dem Vorrat der mitgebrachten Limettendrops zusprach. Die Todesursache des Patienten war eine Lungenembolie gewesen.
Den Thrombus in die Hand nehmend triumphierte der Pathologe mir zugewandt: »ein guter Pathologe hat immer einen Thrombus in der Tasche..«; er hatte die exakte Todesursache klären können.
Friedhofsluft ist frisch und klar. Aber als ich die Kapelle verließ, hatte ich nur eine Melange aus Leichengeruch, Gestank, Respekt und Limette im Hals und diese unerquickliche Mischung sollte mich noch den ganzen Tag begleiten. Limettendrops habe ich seither nicht mehr gelutscht.
Auf dem Sprung ins Studium
Der Gedanke an ein Medizinstudium war also in der Welt, es sprach nichts dagegen, der Numerus clausus beinhaltete kein Problem und ich hatte bekräftigende Unterstützung und Förderung erfahren. Vor dem Abitur machten meine Eltern mit mir einen Ausflug nach Münster, wollten sie doch sehen, wie
ein Studentenleben Anfang der 70er Jahre so aussehen würde, schließlich waren die 68iger noch aktiv präsent und die Überantwortung eines ältesten Sohnes in solche terra incognita aus elterlicher Sicht durchaus eine potentiell heikle Zäsur.
Münster gefiel uns ausnehmend gut. Obschon Landeshauptstadt, kam Hannover als noch sehr neue Medizinische Hochschule aus Vaters Sicht nicht infrage, sei es, weil er sie im Status einer Fachhochschule und nicht einer vollwertigen Universität ansiedelte, sei es, weil ihm der Schritt in die Großstadt für den Filius dann doch zu groß war. Inhaltlich unbegründet, aber emotional tief verankert hatte er allerdings das Gefühl, dass die Zuerkennung eines Studienplatzes für den Sohn eines niedersächsischen Landesbeamten im Zweifelsfall in Niedersachen sicherer sei als im westfälischen Münster. Ganz gewiss bin ich damals durch elterliche Fürsorge stark beeinflusst und gelenkt worden, -ohne es selbst im Geringsten zu merken. So kam es, dass „unsere“ Wahl auf Göttingen fiel; niedersächsisch, ländlich und klein genug, um Störungen eines intensiven Studiums zu umgehen, und eine alteingesessene, angesehene Universität obendrein. Tatsächlich erwies sich Göttingen für mich denn auch als ein idealer Place to be, sowohl im Studium wie auch in den Jahren danach.
Wie schon erwähnt, gab es keine Ärzte in meinem familiären Umfeld und naheliegende Vorbilder ebenso wenig. Woher also kam mein Interesse für Medizin? Die Wurzeln liegen im Biologieunterricht, den ich bei Frau Erika Stille und Freifrau Ilse Speck von Sternburg, genannt Leila, genossen habe.
Beide haben es verstanden, wenngleich mit unterschiedlichen Themen und gewiss unterschiedlichem didaktischem Zugang, Begeisterung für biologische Morphologie und Funktionen, die lebendige Tierwelt, Schutzwürdigkeit von Lebewesen, aber auch biochemische Zusammenhänge und die Biologie des Menschen zu wecken und über Jahre zu entwickeln. Als ein gefühlsstarker Impuls kam jedoch zum richtigen Zeitpunkt die Lektüre von John Steinbecks „Die Straße der Ölsardinen“ im Englischunterricht hinzu, in der mich die Figur des Doc, gleichzeitig Meeresbiologe, Forscher, Arzt und chaotischer Vielleicht-Gutmensch mit realen Fehlern nicht wirklich als Vorbild, aber atmosphärisch, wie ein personifiziertes Lebensgefühl faszinierend angesprochen und irgendwie inspiriert hat. Meeresbiologe, das klang gut. Aber die See war weit weg.
Die Realität lag näher an der Medizin. Nachdem ich diese Überzeugung gewonnen hatte und nur einige Praktika später erkrankte mein Vater, der schon immer mit Magenproblemen zu kämpfen hatte, schwer. Aufgrund einer Magenperforation wurde er in Hamburg notfallmäßig operiert und war einige Tage nicht bei Bewusstsein. Trotz ungestörten Heilungsverlaufs in der Folge verwehrte ihm der Amtsarzt die Wiederaufnahme seiner beruflichen Tätigkeit als Oberstudiendirektor, was für ihn wie auch die gesamte Familie zu einem erheblichen Einschnitt wurde.
Ich denke, dass auch dies wegweisend dafür war, dass ich mich später für eine Doktorarbeit und dann die fachliche Spezialisierung im Bereich der Gastroenterologie entschieden habe.
Und überhaupt: »Die Heilkunst ist in der Hauptsache nichts anderes als die Kenntnis der Liebesregungen des Leibes in Bezug auf Füllung und Leerung.«
(Platon, 427-347 v. Chr., Das Gastmahl 12., Eryximachos).
Leila
Die grandiose Besonderheit ihrer Person sowie die Bedeutung Ihres Wirkens gebieten es, Freifrau Ilse Speck von Sternburg einen eigenen Abschnitt in meiner Erzählung zu widmen. Ich kannte sie als Oberstudienrätin und meine Biologielehrerin in der Unter- und Mittelstufe, aber auch als gelegentlichen Kaffeebesuch bei uns zu Haus. Frau von Sternburg hatte einen ausgeprägten sächsischen Akzent, von dem sie stets charmant Gebrauch machte. Sie war eine drollig wirkende, aber in sich ausgesprochen ernsthafte Person, die nur schwer adäquat zu beschreiben ist.
Sulingen, liegt zwischen dem Dümmer See und dem Steinhuder Meer. Nicht eben alpines Gelände, nur eben. Skilauf gehörte entsprechend wenig in das Gesamtbild unserer Winter, aber das focht Frau von Sternburg nicht an. Wenn der zögerlich fallende Schnee eine geschlossene Decke auf den Boden zauberte, wappnete sie sich mit ihrem schon etwas in die Jahre gekommenen Vorkriegs-Ozelotmantel, schnallte sich Skier aus dem gleichen Zeitraum unter solide Winterstiefel und lief den Weg zum Gymnasium in Langlauf-ähnlicher Manier. Dort angekommen deponierte sie das Sportgerät im Fahrradständer. Zum Problem wurde der Ausflug, wenn (und das war klimatisch meistens so vorgegeben) es nach der letzten Schulstunde längst derart getaut hatte, dass kein Schnee mehr für den Heimweg zur Verfügung stand, aber auch das nahm sie gleichmütig in Kauf.
Im Sommer erschien sie tatendurstig und frohgemut im dezenten Plissee-Langrock auf dem Tennisplatz, ihren historischen Schläger (der Schlägerkopf am Ende breiter als zum Griff) mit Längskerben im Griffteil anstatt einer Lederumwicklung sowie ein uraltes Netz mit inzwischen völlig filzlosen Bällen im Gepäck. Chapeau!
Frau von Sternburg stand gewaltig unter der Fuchtel ihrer Mutter. Dennoch denke ich nicht, dass diese die Ursache für ihre kleinkindhaft-verniedlichende und zugleich respektlosrelativierend großzügige Art war, durch die sie die Welt betrachtete. Ich bin sicher, dass sie bei Kriegsende keine einfache Zeit nach dem Einmarsch russischer Soldaten erlebt hat und ihr kleines Maß an vermeintlicher Verrücktheit den Weg darstellte, mit dieser großen Last weiterleben zu können. Leila pflegte ihre kleinen wie auch die großen Schüler mit „mein Hase“ bzw. „meine Häsin“ anzusprechen. Ertappte sie einen Schüler, der durch Körperhaltung und Blickrichtung verriet, dass seinerseits kein kenntnisreicher Beitrag zu ihrer Frage erwartet werden konnte, so sprach sie ihn meistens direkt an: »Nu, mein guter Hase, was duckst Du Dich so in Deine Furche, weißt Du etwa die Antwort nicht..?«
Eines Tages war im Lehrerzimmer deutlich disputative Ungemach entstanden, weil ein Schüler, der der kommunistischen Partei nahestand, als solidarische Meinungsäußerung (aus seiner Sicht) und empfundene Provokation (aus der Sicht des Kollegiums) eine relativ große Anstecknadel mit dem Konterfei Che Guevaras auf der rot-blauen Fahne des Vietkong am Pullover trug. Die Diskussion betraf die Frage, ob das in der Schule akzeptabel sei und unabhängig von den jeweiligen sachlichen Standpunkten war die Aufregung groß. Frau von Sternburg sah das gänzlich gelassen. »Ja, wenn Sie die Nadel so aufregt, dann nehmen Sie sie ihm doch einfach ab«.
Ein solches Ansinnen konnte schon damals im Kreise eines aufgeklärten Lehrerkollegiums nicht durchgehen; die Aufregung indessen wurde dadurch befördert. Am folgenden Tag kam Leila in einer Pause ins Lehrerzimmer, das Corpus delicti in der Hand, ein Lächeln im Gesicht. Sie war schnurstracks zu besagtem Schüler gegangen und mit den Worten »Nu, Arno, mein Hase, was haben Sie denn da für eine hübsche Brosche, - die werden Sie mir doch gewiss mal borgen…« hatte sie ihm den Sticker flugs vom Pullover gelöst und sich von dannen gemacht.
Das Maß, das Frau von Sternburg als Grundlage ihrer Welt an die Ereignisse des Alltags legte war das der Biologie und Evolution. Kurzfristige Wendungen, und sei es von der Dauer eines Menschenlebens, spielten für sie keine große Rolle. Sie war überzeugt, dass die Natur alle wesentliche Dinge regelt. So, wie sie es immer in der Geschichte der Menschheit getan hatte. Das hieß allerdings nicht, dass sie sich nicht kümmerte. Als Mercedes-Benz eine Teststrecke für PKW im Sulinger Bruch in Erwägung gezogen hatte und entsprechende Planungen der strukturschwachen Region (einige wenige) Arbeitsplätze quasi als Wurst vor die Nase hielten, agierte sie umgehend und geräuschlos. Unter Einsatz ihrer privaten Mittel erwarb sie mehrere kleine Parzellen, flickenteppichartig im Bruch verteilt und vereitelte dergestalt jede großflächige Nutzung. Soweit ich gehört habe, hat sie diese Grundstücke nach ihrem Tod an eine Naturschutzorganisation vererbt und damit dauerhaft im Sinne ihrer Bestimmung als Naturlandschaft gesichert, als Refugium für Flora und Fauna, für Moorpflanzen und Auerhahn. Danke auch dafür.
Alleinstehend und weltoffen, um nicht zu sagen: richtig neugierig und putzagil, nutzte sie ihre Möglichkeiten, die Welt zu erkunden. Das betraf seltene Tiere in Afrika ebenso wie Reisen nach Asien und Amerika. Als die Concorde einen Sprung über den Atlantik in Überschallgeschwindigkeit und wenigen Stunden ermöglichte, - Frau von Sternburg war dabei. Für mich bedeuteten diese Reisen, dass ich exotische Briefmarken durch ihre Urlaubsgrüße bekam, -für meine Eltern hingegen waren die Umtriebigkeit, die Weite dieser weiten Welt an sich schon exotisch. Verstörend kam hinzu, dass es zu Flugzeugentführungen kam, ein Phänomen, das bis dahin unbekannt war und auch Abstürze verstärkt realisiert wurden. Auf ein mögliches Risiko angesprochen sagte Frau von Sternburg zu meiner besorgten Mutter nur »Ach, Frau Lembcke, gehen Sie nicht ins Bett, da sterben die meisten Leute.« Sie war eine mutige Frau.
Dieser, ihrer Eigenschaft verdankt die Nachwelt auch den Erhalt der Kunstsammlung Speck von Sternburg in Leipzig.
Als ich mich 1999 anlässlich der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten in Leipzig aufhielt und am späten Nachmittag den Tagungsort auf mich einwirken lassend einige Schritte in die Fußgängerzone unternahm, traf ich unvermittelt auf ein Banner, das die gesamte Straßenbreite überspannte und stolz auf die Ausstellung der Sammlung Speck von Sternburg im örtlichen Kunstmuseum hinwies. Leider war es schon zu spät für einen Besuch des Museums, aber für den Erwerb des Katalogs reichte meine Zeit. Es war in der Tat die Sammlung, von der „meine“ Frau von Sternburg fast neutral, bescheiden und irgendwie distanziert einmal gesprochen hatte, deren Erhalt ihr persönlich zu danken ist, und bei der mir keineswegs klar ist, was an der abenteuerlichen Geschichte, in die sie die Rettung der Kunstwerke eingewoben hatte, Fakt war -und was amelioratives Erinnern mit Kokoonisierung unerträglicher Ereignisse. Übertreibung und Dichtung jedenfalls waren ihr ungeachtet einer sehr feinen Nuancierung, die beim Zuhören ungewöhnliche Bilder generierte, nicht zu eigen, eher das Gegenteil.
Mit dem Einmarsch russischer Bodentruppen nach Sachsen wurde auch das von Sternburgsche Anwesen erobert. Details habe ich nie erfahren, nur so viel: Ilse Freifrau von Sternburg war als verwitwete junge Frau, deren Mann im Krieg fiel, vor Ort geblieben. Ein russischer Offizier begutachtete die (schon damals außerordentlich bedeutsame) Bildersammlung, in der einige wichtige Exponate fehlten, um ihr dann mitzuteilen, dass selbstverständlich alle diese Schätze nach Russland verbracht würden, um sie der sozialistischen Allgemeinheit zu überantworten, indem sie dort in Museen ausgestellt würden. Frau von Sternburg hat darauf entgegnet, dass sie dieses Ansinnen keineswegs überrasche, sei man doch seit Wochen auf den russischen Einmarsch vorbereitet und habe auch bereits mit Beginn des Krieges Vorsorge getroffen, die wertvolle Sammlung zu erhalten. Daher würden auch einige Bilder fehlen, die nach England verbracht worden seien, während die jetzt hängenden Werke bereits als Replikate während des Krieges zurückgekommen seien. Sie befürchte allerdings, dass er sich als sicher kenntnisreicher Offizier blamieren, wahrscheinlich auch in Gefahr bringen würde, wenn er diese Kopien als vermeintliche Originale an Museen in Russland weitergeben würde. Sie muss sehr überzeugend gewesen sein. Die Bilder blieben, der Offizier ging. Einige wertvolle Exponate hatte sie einem mit der Familie befreundeten Professor der Kunsthochschule mitgegeben, der diese versteckt hielt, wobei auch die Rede von den Kasematten der Festung Königsstein war. Wenn ich es richtig erinnere, sind einige Bilder erst nach der Wende wieder aufgetaucht; die vollständige Sammlung wurde später dem Freistaat Sachsen übergeben, wobei drei Gemälde veräußert werden konnten, um Ansprüche der verbliebenen Eigentümer finanziell auszugleichen.
»Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende.«
(Demokrit)
Die unverstandene Skurrilität der Dame wurde unmerklich, aber für jeden erkennbar, von einer netten Form der Altersdemenz abgelöst. Ich weiß nicht mehr, wann Frau von Sternburg aufgehört hat, selbständig Auto zu fahren, - in jedem Fall hätte es Jahre früher sein dürfen. Wann immer ein bei jedem Schaltvorgang ruckelnder grüner Opel auf den Straßen Sulingens gesichtet wurde, war es Zeit für die übrigen Verkehrsteilnehmer, sicheres Ambiente aufzusuchen. Einen Unfall hat sie dabei gleichwohl nie verursacht.
Anlässlich des 80. Geburtstags meiner Mutter war Frau von Sternburg der einzige Besuch, der nicht aus der Familie stammte. Infolge ihrer Altersdemenz haderte sie von der Begrüßung bis zur Verabschiedung mit der Zuordnung der (ihr nicht bekannten) Ehefrauen zu uns (ihr bekannten) drei Söhnen der Familie. »Also, Bernie, das ist also Ihre Frau? Nein, das ist meine Schwägerin. Also, dann gehören Sie zum Markus? Nein, ich gehöre zum Adi. Ach so. Also, dann sind Sie doch die Christiane! Nein, ich bin die Gabi…«. Sie blieb alle Versuche hindurch frohen Mutes und unverdrossen, in einer Situation, die andere schlicht zur Verzweiflung gebracht hätte.
Zuletzt habe ich meine ehemalige Oberstudienrätin im Altenheim Haus Suletal getroffen, als sie, bereits einhundert Jahre alt, im Rollstuhl an der gleichen Weihnachtsfeier teilnahm, zu der ich unsere Mutter begleitete. Sie hatte mich bei meiner Begrüßung erkannt, ein, zwei kurze konkrete Fragen gestellt, und war danach wieder in der ihr eigenen Welt. Ein Unikum im Universum, ernsthaft.
Göttingen igitur – ohne gaudeamus
Das Studium der Medizin in Göttingen begann für mich im Wintersemester 1972. Nach der Studienplatzzusage hatten meine Eltern eine Annonce im Göttinger Tageblatt aufgegeben und sich mit mir auf „Budensuche“ (Feuerzangenbowle) begeben. Eine sehr ernüchternde Angelegenheit. Wir merkten sehr rasch, dass es eine spezifische, womöglich romantische Kultur der Zimmervermietung für Studenten nicht gab, vielmehr neokapitalistische Regeln, Angebot und Nachfrage betreffend. In dem einen oder anderen Fall traten regelrecht Zorneswallungen bei meinem Vater zu Tage, da so manches Kellerloch als Wohnstatt zu Höchstpreisen angeboten wurde, das weder in der Substanz noch preislich mit guten Sitten vereinbar schien. Das Phänomen ist auch als „Willie-Sutton-Effekt“ bekannt; Willie Sutton war ein amerikanischer Bankräuber, der, gefragt, warum er denn Banken überfalle antwortete: »weil da das Geld ist«.
Am Ende landete ich bei Herrn Christoph R., der in einer 4-Zimmer-Mietwohnung auf dem Leineberg mit Mutter, Tochter und Sohn lebte und der nach dem Auszug der Tochter ein bezahlbares Zimmer, quasi mit Familienanschluss in Form der Bad- und Küchenbenutzung, für mich bereithielt. Das war durchaus kein „typisches“ Studentenzimmer, bot mir aber einen festen Rahmen und wir kamen gut zurecht. Gelegentlich brachte er relativ große Forellen aus einem Versuchsteich (!) der Universität mit, fragte, ob ich Forelle „blau“ möge, und dann gab es - gebratene Forelle. Einziges Manko: Herr R. war ein hartnäckiger wie ausdauernder Leserbriefschreiber in Richtung des Göttinger Tageblatts mit sehr eigenen Ansichten und es blieb nicht aus, dass er manch einen kruden Inhalt mit mir diskutieren mochte. Kurz vor meinem Physikum hatte seine Tochter ihre Rückkehr angekündigt, so dass er gern über mein Zimmer verfügt hätte. Um meine Prüfungsvorbereitungen wissend, besaß er die Sensibilität, diesbezüglich zunächst meine Eltern anzurufen, um zu klären, ob mir ein Wohnungswechsel zu diesem Zeitpunkt zumutbar sein. Das war es. Ich fand eine neue, größere Bleibe, wieder auf gleicher Etage wie die Familie, diesmal in der schönen Wohngegend der Merkelstraße, wo ich bis zu meinem 2. Staatsexamen blieb. Krude Diskussionen übrigens inbegriffen.
Aus der Studienzeit gibt es wenig zu berichten. Ich studierte. Eifrig, und nach bestem Vermögen. Das war ich mir, aber auch meinen Eltern schuldig, die durch Vaters Frühpensionierung in einer Zeit, in der die Kreditzinsen für Häuslebauer bei über 8% lagen, in finanzielle Bedrängnis geraten waren. Entsprechend musste mein Budget knapp ausfallen. Während der Bafög-Satz bei 400,-DM lag, konnte ich nur 300,-DM von meinen Eltern bekommen; ein Drittel davon entfiel auf die Zimmermiete. Gleichwohl, ich konnte mit 200,-DM auskommen; ich besaß ein Fahrrad, nahm selbstgekochte Marmelade von zu Haus mit, streckte den Klacks Butter, den Mutter mir am Sonntagabend „für morgen früh“ mitgab über die ganze Woche, aß mittags das Standardessen zum Preis von 1,20DM, kaufte ein Pfund Brot für die ganze Woche, geschnitten, aber mit 12-13 Scheiben (normal waren 10-11), leistete mir eine Brühe oder sogar eine Tütensuppe für 68 oder 72 Pfennige und verbrauchte viel Petersilie für etwas Geschmack. Am Wochenende nahm mich der eine oder andere Klassenkamerad, der ebenfalls in Göttingen studierte und einen VW-Käfer besaß, mit nach Hause, wobei 5 DM auf die Benzinkostenbeteiligung entfielen. Diese Lebensumstände sowie mein Respekt vor dem Physikpraktikum waren die Basis einer Gewichtsabnahme von 81 auf 72kg nach dem ersten Semester (bei 1,97m Größe). Fuhr ich mal nicht am Wochenende nach Haus, dominierten zwei Eindrücke: intensivste Arbeit und eine traurige Melange aus gefühlter Kälte, Leere und Verlorensein. Dieses Gefühl wurde umso größer, wenn die Tütensuppe im Winter nicht lange vorhielt und ich einen langen, forschen Stadtspaziergang in die Stadt zur sinneswandelnden Betäubung unternahm. Das warme Licht hinter den Fassaden schöner alter Häuser traf mich sehnsüchtig, vermochte mich jedoch nicht zu wärmen. Diese innere Kälte ist bis heute mit dem Gefühl von Hunger verbunden geblieben.
Das Physikpraktikum war heftig. Ich kam aus einem neusprachlichen Gymnasium und hatte vom Vater naturwissenschaftliches Interesse, implizit für Physik, weit weniger mitbekommen als z.B. Begeisterung für die bildende Kunst. Physik für Mediziner wurde am IV. Lehrstuhl für Physik (Prof. Harten) gelehrt. Eigentlich zuvorderst in die Lehrerausbildung involviert, widmete sich das Institut dieser Aufgabe in exzellenter Weise. Prof. Harten hatte eine Befragung unter den Lehrstuhlinhabern der Medizin gestartet, um genau zu erfahren, was diese sich an Physikkenntnissen bei ihren Studenten wünschten. Das Ergebnis: in der Summe und Diversität deutlich mehr als ein Diplomstudium der Physik. So ging es also nicht. Im nächsten Schritt befragte er die Physiologen und Biochemiker. Mit den so erhaltenen Lernzielen wurde mit den Assistenten und verschiedenen Diplomanden am Lehrstuhl ein Lehrbuch für Mediziner erarbeitet sowie eine Vorlesungs- und Praktikumsbegleitende didaktisch geprägte Evaluation, die multiple, respekteinflößende Prüfungen für den Erwerb des „Scheins“ einschloss. Da musste ich durch. Am Ende war ich unter den oberen 20%, empfand dies aber eher im Lichte meines Substanzverlusts; ich war ausgezehrt.
Auch in der Retrospektive war mein Studium vor allem eins: anstrengend.
Neben den Inhalten des vorklinischen Studiums bestand eine weitere Schwierigkeit im ständigen Ortswechsel. Wir mussten kreuz und quer durch Göttingen fahren, immer unter dem Druck, die nächste Vorlesung pünktlich zu erreichen. Das Fahrrad war dabei das übliche und beste Fortbewegungsmittel. Da einige Kommilitonen über ein eigenes Auto verfügten, bot sich allerdings auch gelegentlich die bequemere Lösung einer Mitfahrgelegenheit an. So kam ich zu dem Vergnügen, in einem unnachahmlich engen wie schnittigen Opel GT von Dirk S., heute Professor für pädiatrische Onkologie in Frankfurt, mitgenommen zu werden. Dirk stammte aus einer offenbar wohlhabenden Arztfamilie und fiel neben dem orange-gelben Hingucker-Auto durch seine cool-schlaksige, unbekümmert großzügige Art und seine Vorliebe für auffallend bunte, mal sehr enge, mal weite Hemden auf. »Doktor Dirk of Waikiki-Beach« nannten ihn denn auch manche Kommilitonen. Neben riskanten Hemden neigte Dirk zu einem riskanten Manöver: an der Ampel Ecke Kreuzbergring / Goßlerstraße mussten wir links abbiegen. In pole position war es ihm stets eine vergnügliche Herausforderung, noch vor dem Geradeausverkehr GT-like durchzustarten, wobei mein Puls diese Beschleunigung zumeist übertraf, denn ich saß rechts und wäre als erster von den losfahrenden PKW der Gegenfahrbahn (mit oft wütendem Fahrer) erfasst worden. Fahrrad war denn so schlecht auch nicht.