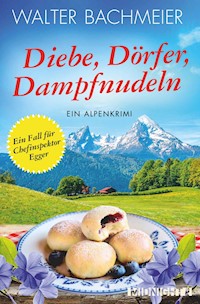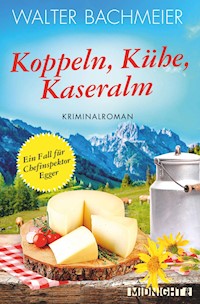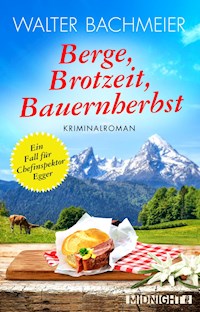3,99 €
Mehr erfahren.
Ein neuer Ermittler im Salzburger Land Nachdem seine Frau bei einer Wanderung in den Alpen ums Leben gekommen ist, muss sich Chefinspektor Egger erst einmal wieder fangen. Um sich von der Trauer abzulenken, stürzt sich der nun alleinerziehende Vater zweier Söhne in seinen neuen Fall. In einem Bergbach nahe der Enzianhütte wurde die Leiche der Studentin Leni gefunden. Die hübsche junge Frau hatte gemeinsam mit ihrem Geliebten, einem Professor, ein paar Tage in der idyllischen Berglandschaft verbringen wollen. Als Egger nachforscht, wird schnell klar: Leni hatte viele Feinde und auch der Professor spielt nicht mit offenen Karten. Ein Fall, der selbst den gestandenen Ermittler an seine Grenzen bringt … Von Walter Bachmeier sind bei Midnight by Ullstein erschienen: Mord in der Schickeria (Ein-Tina-Gründlich-Krimi 1) Mord an der Salzach (Ein-Tina-Gründlich-Krimi 2) Mord in der Alpenvilla (Ein-Tina-Gründlich-Krimi 3) Mord im Pinzgau (Ein-Tina-Gründlich-Krimi 4) Mord in der Berghütte (Ein-Tina-Gründlich-Krimi 5) Mord am Wildkogel (Ein-Tina-Gründlich-Krimi 6) Affären, Alpen, Apfelstrudel (Chefinspektor Egger Fall 1) Berge, Brotzeit, Bauernherbst (Chefinspektor Egger Fall 2) Koppeln, Kühe, Kaseralm (Chefinspektor Egger Fall 3) Morde, Matsch, Marillenknödel (Chefinspektor Egger Fall 4) Diebe, Dörfer, Dampfnudeln (Chefinspektor Egger Fall 5) Gauner, Glühwein, Geigenklänge (Chefinspektor Egger Fall 6)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Der AutorWalter Bachmeier, geboren 1957 in Karlsruhe, wuchs in Münchsmünster in der Hallertau auf. Nach seiner Ausbildung zum Koch begann er unter dem Pseudonym zu schreiben. Sein erstes Werk war ein Kochbuch, das sehr erfolgreich verkauft wurde. Dies gab ihm den Ansporn, seinen Beruf aufzugeben und weiter zu schreiben. Im Laufe der Jahre entstanden so mehrere Erzählungen, Kinderbücher und Artikel in verschiedenen Tageszeitungen. Seit etwa 2012 widmet er sich voll und ganz der Literatur. Immer wieder finden in seinen Büchern auch Erlebnisse aus seinem Leben Platz.
Das Buch
Ein neuer Ermittler im Salzburger LandNachdem seine Frau bei einer Wanderung in den Alpen ums Leben gekommen ist, muss sich Chefinspektor Egger erst einmal wieder fangen. Um sich von der Trauer abzulenken, stürzt sich der nun alleinerziehende Vater zweier Söhne in seinen neuen Fall. In einem Bergbach nahe der Enzianhütte wurde die Leiche der Studentin Leni gefunden. Die hübsche junge Frau hatte gemeinsam mit ihrem Geliebten, einem Professor, ein paar Tage in der idyllischen Berglandschaft verbringen wollen. Als Egger nachforscht, wird schnell klar: Leni hatte viele Feinde und auch der Professor spielt nicht mit offenen Karten. Ein Fall, der selbst den gestandenen Ermittler an seine Grenzen bringt …Von Walter Bachmeier sind bei Midnight erschienen:Mord in der Schickeria (Ein-Tina-Gründlich-Krimi 1)Mord an der Salzach (Ein-Tina-Gründlich-Krimi 2)Affären, Alpen, Apfelstrudel (Chefinspektor Egger Fall 1)
Walter Bachmeier
Affären, Alpen, Apfelstrudel - Der erste Fall für Chefinspektor Egger
Ein Alpenkrimi
Midnight by Ullsteinmidnight.ullstein.de
Originalausgabe bei MidnightMidnight ist ein Digitalverlag der Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinNovember 2016 (1) © Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2016Umschlaggestaltung:zero-media.net, MünchenTitelabbildung: © FinePic®Autorenfoto: © privat ISBN 978-3-95819-096-2 Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Prolog
Ein lauter, markerschütternder Schrei weckte ihn. Ein Schrei, den man nicht genau definieren konnte. Martin schreckte hoch und blickte um sich. Es war dunkel in seinem Zimmer und nur der Lichtschein des Mondes schimmerte unter den Vorhängen durch, die Leni, seine Frau, aufgehängt hatte. Müde und erschöpft saß er aufrecht im Bett und spürte die Feuchtigkeit seines durchgeschwitzten Schlafanzugs. Auch die Decke war vollkommen durchnässt. Aber Leni würde das schon richten. Sie würde den Schlafanzug waschen und die Bettdecke zum Trocknen draußen aufhängen.
Leni? Er griff hinüber nach rechts zur anderen Bettseite. Leer! Nein, Leni würde das nicht machen! Sie würde das nie mehr machen! Nie wieder würde sie seine Wäsche waschen, für ihn und die beiden Buben kochen! Nie wieder würde sie für ihn da sein! Nie wieder …! Langsam kam die Erinnerung. Die Erinnerung an den Schrei. Er hatte geschrien. Er war es selbst gewesen, der diesen Schrei ausstieß. Es war der Schmerzensschrei eines zutiefst verwundeten Mannes, dem man alles genommen hatte, was er liebte. Leni. Seine Leni. Damals, ja damals war die Welt noch in Ordnung gewesen. Damals, als Leni in seine Welt getreten war, wie ein Wesen aus einer anderen Welt. Wie ein Engel war sie da. Plötzlich, wie aus heiterem Himmel war sie in sein Leben getreten und bei ihm geblieben. Sie war eine Schönheit, wie sie sonst nur in seinen Träumen vorkam. Sie war das Mädchen, auf das er gewartet hatte. Die Erinnerung an sie ließ ihn leise lächeln. Blonde Haare hatte sie gehabt, lange, blonde, gelockte Haare, beinahe wie ein Rauschgoldengel. Blaue Augen, tief wie der tiefste See, und ihr Gesicht schien aus Porzellan zu sein, fein gezeichnet, ebenmäßig und doch ausdruckskräftig.
Ihr Mund, zart wie eine Rose und ihre Stimme, als wäre sie ein Engel in einem himmlischen Chor. Klein war sie, klein und zierlich. Beinahe fürchtete er um sie, wenn er sie anfasste, so klein und zerbrechlich, wie eine kostbare Vase. Musik hatte sie studiert und spielte Geige. Immer, wenn sie zu Hause übte und spielte, war ihm, als trügen ihn die feinen Klänge der Geige hinweg in eine andere Welt. Ihre Finger tanzten dann auf den Saiten einen eigenwilligen Tanz und ihre Augen, die sie dabei geschlossen hatte, blickten ihn hin und wieder an, als würde sie ihn locken: »Komm, spiel mit mir. Tanz mit mir.« Am liebsten spielte sie Mozart und Strauß. Der Klang ihrer Geige schwebte durch den Raum und umhüllte die Zuhörer wie eine flauschige Decke, um dann gleich in einem heftigen Stakkato über die Köpfe hinwegzufliegen. Manchmal kamen sogar die Nachbarn herüber, um ihrem Spiel zu lauschen. Da war die dicke Frau Obermeier, die mit ihrem spindeldürren Mann meist als Erste kam, um sich den Platz ganz in der Nähe Lenis zu sichern. Martin stellte die Stühle der beiden aber absichtlich so, dass sie möglichst weit entfernt von den anderen saßen. Sie bemerkten dies aber nicht, sondern fühlten sich, als ob sie in einer Loge säßen.
Der Grund dafür war der Gestank, der von Frau Obermeier ausging. Sie schwitzte stark und offenbar litt sie nicht nur unter Diabetes, sondern auch noch unter einer Inkontinenz.
Herr Holziger. Von Beruf war er Fachlehrer für Physik an der Zeller Volksschule. Am liebsten saß er in Martins altem Fauteuil. Stocksteif mit gestärktem Hemd und einer Fliege. Zwischen den Beinen, die Hände auf den silbernen Knauf gestützt, hielt er seinen Spazierstock wie eine Gehhilfe. Inzwischen pensioniert, machte er immer den Eindruck, als würde er mit seinem strengen Blick, den er ständig auf sie richtete, Leni durchbohren. Seine stahlgrauen Augen bewegten sich hinter seiner runden Nickelbrille ständig hin und her, so als ob er seine Augen wie gebannt auf Lenis Hand, die den Bogen hielt, richten würde. Wobei sein Kopf sich nicht einen Millimeter bewegte. Leni fühlte sich in seiner Anwesenheit sehr unwohl, was sie auch dazu veranlasste, schwierige Stücke nicht zu spielen, wenn er dabei war. Noch immer machte er den Eindruck, als ob er jeden Streich Lenis auf der Geige aufs Peinlichste genau analysieren und bewerten würde.
Allerdings steckte er bei jedem Besuch einen ansehnlichen Geldschein in die Spendenbüchse, die Martin herumreichte.
Die augenscheinlich schwerreiche alte Frau Professor Lackner, die in ihrer Villa unten am Ende der Straße lebte und der ehemalige Oberpostrat Schweiger, der mit seiner Frau das kleine Häuschen gleich neben ihnen bewohnte. Oft kamen sie ungeladen und erwarteten doch, dass sie auch bewirtet wurden – der Herr Chefinspektor hats ja. Der ist Beamter und bekommt sicher ein gutes Salär.
Manchmal, nach Martins Meinung dennoch zu oft, gab Leni ein Konzert für wohltätige Zwecke. Das Geld, das eingesammelt wurde, kam einem Waisenhaus in Salzburg zugute. Martin musste lachen, als er an die säuerliche Miene von Frau Lackner dachte. Immer, wenn er ihr die Spendenbüchse hinhielt und sie eine Münze oder einen Schein hineinwerfen sollte, was sie dann auch gezwungenermaßen tat, benahm sie sich, als wäre sie eine arme, alte Frau. Einmal gab Leni zusammen mit Kollegen ein Konzert mit Kammermusik im Porsche Kongresszentrum, das sich gleich neben der Polizeistation an der Brucker Bundesstraße in Zell am See befindet.
Als die Nachbarn davon hörten, kamen sie natürlich angerannt. »Frau Egger, gibts vielleicht Freikarten? Mein Mann und ich möchten so gern in Ihr Konzert gehen. Wir lieben doch die klassische Musik. Ich hab Ihnen auch ein Stück Jausenspeck mitgebracht«, bat Frau Obermeier. Die geizige Frau Lackner gab Leni gar ein Kuvert: »Hier, noch eine kleine Spende für ihr Waisenhaus.« Als Leni es später öffnete, kam ein Geldschein zum Vorschein, der geradezu lächerlich war. Der Eintritt hätte das Dreifache gekostet. Irgendwann waren natürlich auch alle Freikarten weg und so musste der Herr Oberpostrat mit Frau zu Hause bleiben oder aber den vollen Eintritt bezahlen. Erfreut waren sie natürlich nicht darüber, aber sie versprachen immerhin, beim nächsten Konzert, das Leni gab, auch anwesend zu sein und eine ordentliche Spende abzuliefern. Martins Aufgabe war es, bei jeder Vorführung genügend Stühle zu besorgen, damit auch ja jeder einen Sitzplatz bekam. Diese holte er beim Italiener um die Ecke, bei dem Leni, sozusagen als kleines Dankeschön, auch ab und zu eine kostenlose Aufführung mit Kompositionen von Paganini, Vivaldi und Rossini gab.
Obwohl Martin mit klassischer Musik vor seiner Bekanntschaft mit Leni wenig am Hut gehabt hatte, hörte er ihr nun mit wachsender Begeisterung zu, wenn sie spielte. Auch auf dem Klavier, das immer noch im Wohnzimmer stand, spielte sie virtuos. Allerdings meist Chopin. Oft war er mit ihr in einem Konzert gewesen. Immer dann, wenn sie spielfrei hatte und er keinen Dienst. Am faszinierendsten war für ihn der Besuch der Salzburger Festspiele, wenn »Jedermann« aufgeführt wurde. Er bekam die begehrten und selten zu habenden Karten von seinem Vorgesetzten Herrn Hofrat Gmeiner. Leni war auch bei seinen Freunden und Kollegen beliebt, da sie immer ein nettes Wort und ein offenes Ohr für sie hatte, wenn sie mal ein Problem mit sich herumtrugen. Natürlich hatte auch Leni ihren eigenen Freundeskreis, der hauptsächlich aus Musikern bestand. Bei ihrer Hochzeit spielte eine Gruppe von ihnen den Hochzeitsmarsch von Felix Mendelsson Bartholdy.
Ein Mitglied dieser Musikgruppe machte für Leni dann auch den Trauzeugen. Für Martin übernahm das Josef Faltermeier, einer seiner Kollegen, mit dem ihn eine langjährige Freundschaft verband. Die Hochzeit selbst wurde in der Kirche von Adnet abgehalten, da Leni von dort stammte und ihre Eltern bei Adnet einen großen Bauernhof besaßen. Die Feier war eine Veranstaltung, die sicher noch lange in den Köpfen der Adneter Bauern blieb. Nicht nur, weil die Musik vom Mozarteumorchester gestaltet wurde. Es mutete auch irgendwie seltsam an, als die Studienkollegen Lenis in Frack und Ballkleid erschienen. Neben den Bauern in ihren Festtagstrachten sahen sie aus, wie von einem anderen Stern. Trotz allem war die Hochzeit, wie der Pfarrer betonte, eine der schönsten, die je in Adnet abgehalten wurden. Zunächst war Martin als Schwiegersohn nicht sehr willkommen, denn Lenis Eltern hatten sich einen Schwiegersohn erhofft, der etwas von Ackerbau und Viehzucht verstand. Leni war ihr einziges Kind und so war es nur verständlich, dass sie diesen Wunsch hegten. Schließlich sollte der Hof ja in ihrem Sinne weitergeführt werden, und das konnte ihrer Meinung nach nur einer, der sein Leben lang mit dieser Arbeit zu tun hatte. Kein Beamter, nein ein Bauer sollte er sein. Mit der Zeit aber fanden sie sich mit Martin ab, denn er entwickelte sich dann doch noch zu einem Wunschpartner für ihre Tochter. Als Leni dann noch schwanger wurde und Zwillinge bekam, war der Familienfrieden perfekt.
Die Schwiegereltern waren, genau wie Leni, tiefgläubige Katholiken und beharrten darauf, dass Leni und Martin ein Versprechen abgeben sollten, damit die Kinder gesund zur Welt kämen. Leni und Martin gelobten also vor der Muttergottes, dass sie einmal jährlich am Geburtstag der Kinder von Maria Alm nach St. Bartholomä pilgern würden, wenn bei der Geburt alles gutginge. Diese Wallfahrt, die alljährlich abgehalten wird, gibt es bereits seit sechszehnhundertfünfunddreißig. Natürlich war Leni und Martin bewusst, dass sie an dem traditionell vorgesehenen Termin nicht mitgehen konnten. Schließlich wollten sie ja am Geburtstag ihrer Kinder wallfahren. Als die Kinder, zwei Buben, inzwischen neun Jahre alt, zur Welt kamen, verlief alles planmäßig. Die Buben waren gesund und so lösten Leni und Martin alljährlich ihr Versprechen ein. Auch die Taufpaten, zwei Geiger aus Lenis Orchester, und die Trauzeugen gingen jedes Mal mit ihnen. Beim letzten Mal, vor drei Jahren, musste Martin arbeiten. Es war ein dringender Fall, der nicht von einem x-beliebigen Inspektor übernommen werden durfte.
Hochrangige Politiker waren involviert und nur Martin besaß, nach Meinung seines Vorgesetzten, das dafür nötige Fingerspitzengefühl. Martin wollte die Wallfahrt verschieben, aber Leni bestand darauf, dass sie an diesem Tag gehen mussten, denn schließlich hatten sie es ja so gelobt. Nur nach langem Zureden gab Martin nach und ließ sie gehen. Da die Wallfahrt jedes Mal zwei Tage dauerte, ging Martin an diesem Abend alleine ins Bett. Er schlief schon, als die Haustürglocke schellte. Müde und verschlafen ging er zur Tür und öffnete. Vor ihm standen die Freunde, die mit Leni gegangen waren. Mit starrem Blick hörte er zu, als einer von ihnen sagte: »Martin, wir müssen dir was sagen. Leni – wir sind …, am Steinernen Meer, weißt du, wo es runter geht zum Funtensee, da ist die Leni gestolpert und wir …, wir haben ihr nicht mehr helfen können. Sie ist mit dem Kopf auf einen Stein gefallen …«
Für Martin brach die ganze Welt zusammen und er schrie sie an: »Verschwinds! Hauts ab! Ihr lügts mich an! Wo ist Leni? Was habt ihr mit ihr gmacht?« Betroffen und ohne ein weiteres Wort drehten sich die vier um und gingen weg. Lediglich einer von ihnen, Josef, Martins Freund und Kollege, drehte sich noch einmal um und ging zu ihm. Er legte eine Hand auf Martins Schulter und sagte leise: »Es tut mir leid, Martin. Es tut mir unsäglich leid.«
Martin schob ihn weg: »Geh weg! Hau ab! Lass mich in Ruhe!«
Am nächsten Tag musste Martin nach Salzburg reisen, um Leni zu identifizieren. Eigentlich wollte er nicht, es wäre ihm lieber gewesen, ihre Eltern hätten das übernommen. Aber da auch die beiden ablehnten, blieb ihm nichts anderes übrig, als selbst dorthin zu fahren. Als er die Pathologie betrat, empfing ihn Karl, der Gerichtsmediziner, den Martin schon lange kannte. Karl kam auf ihn zu, fasste ihn wortlos an der Schulter und schob ihn zu einer Bahre, auf der augenscheinlich Leni lag. Er hob das Tuch, das sie bedeckte, und da erblickte Martin seine Leni, seine über alles geliebte Leni, auf dieser hässlichen Edelstahlbahre.
Man hätte meinen können, sie schliefe nur. Nichts zeigte an, dass sie tot war. Martin ging zu ihr hin und strich ihr übers Gesicht. »Leni. Leni, wach auf. Du musst doch … Du musst doch noch … Die Wallfahrt. Wir gehen sie miteinander«, flüsterte er. Dann stieß er einen markerschütternden Schrei aus und sank zu Boden.
Als er erwachte, lag er in einem Bett auf einer Station in der Salzburger Klinik. Ein Arzt stand neben ihm und fühlte seinen Puls. Martins erste Frage war: »Wo ist meine Frau?«
Der Arzt warf ihm einen mitleidigen Blick zu und bat die Schwester, die neben ihm stand: »Noch eine Ampulle Beruhigungsmittel, bitte.« Die Schwester gab dem Arzt eine Spritze, mit der er das Medikament in die Infusionsflasche füllte.
Als der Arzt und die Schwester gegangen waren, klopfte es zaghaft an der Türe. »Herein«, bat Martin. Die Türe öffnete sich und die vier Freunde, die Leni begleitet hatten, kamen herein.
In Martins Kopf wurde ein Schalter umgelegt. Aus seiner Kehle kam ein Laut, wie von einem tödlich getroffenen Raubtier. Er schrie: »Raus! Alle raus! Ich will keinen von euch mehr sehen! Raus! Ihr seid schuld, dass Leni tot ist! Ihr habt sie in den Tod geführt! Warum habt ihr ihr das nicht ausgredt?! Wenn ich dabei gwesen wär, würd sie noch leben! Ihr Saubande! Raus mit euch!«
Die vier drehten sich wortlos um und verließen das Zimmer.
Zwei Tage später wurde Martin aus der Klinik entlassen, denn es ging ihm besser und die Beerdigung sollte bald stattfinden. Um die notwendigen Formalitäten hatten sich Lenis Eltern gekümmert. Als die Trauerfeier in der Kirche begann, kamen auch die drei Freunde Lenis, die bei ihrem Tod dabei gewesen waren. Augenscheinlich wollten sie und noch ein paar andere aus Lenis Orchester zur Trauerfeier die Musik beitragen.
Als Martin bemerkte, wie sie sich am Altar aufstellten, sprang er von seinem Platz hoch, rannte zu ihnen, riss dem Ersten, der ihm gegenüberstand, sein Instrument, eine Bratsche, aus der Hand, und zerschmetterte sie auf dem Altar. »Hauts ab! Verschwinds! Lassts euch nimmer blicken! Ihr Mörder, ihr Pack, ihr daherglaufenes!«, schrie er dabei. Die Musiker sahen sich wortlos an, packten ihre Instrumente ein und verließen die Kirche. Lediglich der eine, dessen Bratsche Martin zertrümmert hatte, blieb stehen. Martin wurde wütend: »Was ist? Willst ned auch abhaun? Da oben habts ihr mei Leni auch im Stich glassn! Verschwind!« Der Musiker blieb ruhig: »Du kannst mich schon rausschmeißn. Ich bleib aber trotzdem da. Ich bin wegen der Leni kommen und ned wegen dir.« Rot vor Zorn wandte sich Martin ab und ging zu seinem Platz zurück. Der Musiker setzte sich weiter hinten in eine Bank und hörte der Andacht still zu. Beim Totenmahl betrank sich Martin dermaßen, dass ihn seine Schwiegereltern nach Hause bringen ließen, weil er wie ein heulendes Elend unter dem Tisch saß.
Als Martin tags darauf zur Arbeit erschien, wurde er ins Büro seines Vorgesetzten zitiert: »Herr Egger. Sie sollten erst mal Urlaub machen und dann zu unserem Psychologen gehen. Sie leiden vermutlich an einer posttraumatischen Störung. Die gehört unbedingt behandelt.«
Martin lehnte dies kategorisch ab: »Ich bin doch ned deppert! Ich hab mei Frau verlorn, sunst goar nichts! Psychologen! So ein Schmarrn!«
Nach wie vor ging er am Geburtstag seiner Kinder die Wallfahrt und nahm die beiden auch mit. An der Stelle, an der Leni verunglückt war, stand ein schmiedeeisernes Kreuz mit ihrem Namen, an dem er jedes Mal einen Strauß roter Rosen ablegte.
Kapitel 1
Es war wieder einmal ein heißer Tag. Deshalb zog Martin ein loses Sommerhemd, eine dünne Stoffhose und eine leichte Jacke darüber an. Er war groß und schlank, hatte breite Schultern und das schmale Gesicht, aus dem zwei braune Augen leuchteten, war sonnengegerbt. Die Haare gelockt und schwarz. Nur an einigen Stellen schimmerten bereits ein paar silberne Fäden durch. Er verließ sein alpenländisches Holzhaus in Zell am See, das er nach einem schrecklichen Lawinenunfall von seinen Eltern geerbt hatte.
Die Einrichtung hatte noch Leni ausgesucht und nach ihrem Tod hatte er alles so belassen, wie es war. Ihre und seine Geschmacksrichtungen in dieser Hinsicht waren ohnehin dieselben, denn auch er war stark konservativ eingestellt. Selbst ihr Klavier, das er ihr gekauft hatte, stand noch an derselben Stelle im Wohnzimmer. Ihre Geige, ein wertvolles, handgearbeitetes Stück von einem Geigenbauer in Mittenwald gebaut, hing neben ihrem großen Foto im Wohnzimmer an der Wand.
Er stieg in seinen Wagen und fuhr nach Mittersill, wo er ihn am Parkplatz bei der Kirche abstellte.
Die Sonne brannte vom Himmel und ein leichter Hauch nach Apfelstrudel und Vanille zog über den Platz, als sich Martin unter einen Sonnenschirm auf dem Stadtplatz von Mittersill setzte. »Hamma heut dienstfrei, Herr Chefinspektor oder sans wieder auf Kontrollfahrt?«, fragte Joschi, der Kellner, der an Martins Tisch kam. Auf Joschis Frage nickte Martin nur. Joschi trug heute wieder seine Uniform, wie er seine Berufskleidung gerne nannte. Eine schwarze Hose, schwarze Schuhe, dazu ein weißes Hemd, über das er ein weinrotes Gelee angezogen hatte. Die schwarze Schleife tat ein Übriges, um ihn sofort als Kellner identifizieren zu können. Joschi hatte einmal in einem persönlichen Gespräch, als ihn Martin danach fragte, warum er denn Kellner geworden sei, gesagt: »Wissens, Herr Chefinspektor? Eigentlich wollt ich zur Gendarmerie, weils da so schöne Uniformen gibt. Aber bei der Rekrutierung hams gmeint, dass ich dafür wohl ein bisserl zu klein wär. No, dann bin ich halt Kellner gwordn.« Martin lachte damals über den Vergleich. »Wos derfs denn sein?«, fragte der Kellner jetzt. »Einen Verlängerten bittschön«, bestellte Martin. »Derfs auch wos Süßes sein? Unser Sachertorte ist heut wieder ein Traum«, schwärmte Joschi, der Kellner. »Gut, dann bringens mir ein Stück.«
»Mit oder ohne Schlag?«
»Mit bittschön.«
»Sehr wohl der Herr. Einmal Sacher mit Schlag.«
Martin lehnte sich in dem Korbsessel zurück, auf dem er vor dem Café Il Cento in Mittersill unweit des viereckigen Springbrunnens, den eine steinerne Figur ziert, saß. Das Wasser plätscherte beruhigend aus dem oberen Topf in die untere Wanne. Das Café befand sich am Marktplatz von Mittersill direkt zwischen dem Rathaus und dem Gasthof Rohrerwirt. Er war hier Stammgast und bei den Kellnern und Bedienungen sehr beliebt, da er immer ein großzügiges Trinkgeld gab. Nur zwei- oder dreimal im Monat führte ihn sein Weg von Zell am See hierher, weil er, wie er seinen Vorgesetzten sagte, »immer mal wieder nach dem Rechten sehen«, musste. Auf die Beamten hier in Mittersill sowie im nahe gelegenen Neukirchen am Großvenediger konnte er sich zwar blind verlassen, aber er musste dennoch ab und zu hier erscheinen, falls es doch einmal ein Problem gab.
Die Männer und Frauen hier waren etwas eigen, wenn es um ihre Dienstbezeichnung ging. So wäre es ihnen am liebsten gewesen, wenn statt der Aufschrift »Polizei« immer noch »Gendarmerie« auf ihren Fahrzeugen gestanden hätte. Offiziell trauten sie es sich zwar nicht zu sagen, aber Martin war sich dessen ganz sicher.
Martin hing seiner Lieblingsbeschäftigung nach. Er beobachtete Leute, also alle Passanten, die an ihm vorbei und somit über den Stadtplatz liefen. Es war eine alte, lieb gewonnene Spinnerei, die ihm aber unbändige Freude bereitete. So versuchte er manchmal zu erraten, welchen Beruf der eine oder andere vielleicht hatte. Da waren Männer, die in feinem Anzug noch schnell in das Café rannten, da die Mittagspause bald vorüber war. Wahrscheinlich hatten sie sich irgendwo verplaudert, einen Kunden getroffen oder waren ohnehin zu spät in die Mittagspause gegangen. Diese Art Männer gehörten wahrscheinlich zu der Sparkasse, die ganz in der Nähe lag. Ober aber sie waren in der Geschäftsleitung eines Skisportausrüsters, der seine Produktionsstätten unweit von hier in der Nähe der Klinik hatte. Nun kam einer, der bei Martin ein Schmunzeln auslöste. Sicher ein Deutscher, dachte er. T-Shirt, kurze beige Hose, nackte, blasse Beine, die in weißen Tennissocken in offenen Sandalen steckten. Dazu trug der Mann eine Plastiktüte, in der er vermutlich irgendwelche Souvenirs hatte, die er bei einem der kleinen Händler in der Stadt erworben hatte.
Der Mann hatte es augenscheinlich eilig, denn ohne auf den Verkehr zu achten, lief er über den Zebrastreifen, der vom Stadtplatz hinüber auf die andere Straßenseite führte. Martin beobachtete den Mann noch eine Weile. Schließlich verschwand er im Eingang der Mellinger Taverne, schräg gegenüber der Buchhandlung Ellmauer in der Kirchgasse. Vielleicht hatte er Hunger oder Durst? Vielleicht auch beides oder er musste dringend zur Toilette? »So, Herr Chefinspektor«, unterbrach Joschi seine Gedanken. »Einmal Verlängerter, eine Sacher mit Schlag. Haben Sie sonst noch Wünsche?«, fragte Joschi überflüssigerweise. Aber dies war eine Angewohnheit von ihm, die ihm in Fleisch und Blut übergegangen war. Er wartete trotzdem auf eine Antwort, die er von anderen Gästen nur selten bekam. Martin aber sagte: »Danke, Joschi. Das wäre alles.«
»Gerne, Herr Chefinspektor«, sagte Joschi, verbeugte sich leicht und eilte von dannen.
Martin gab etwas Milch in seinen Kaffee, auf Zucker verzichtete er gänzlich, denn er war bereits in einem Alter, so meinte er, in dem man auf sein Gewicht achten musste. Eigentlich trieb er ausreichend Sport und in seiner Freizeit ging er oft wandern. Hier in der Wildkogel-Arena gab es hunderte Möglichkeiten, durch die Natur zu laufen und die Schönheiten zu genießen. Sein Blick schweifte am Kirchturm vorbei hinüber zum Zwölferkogel, zu dessen Füßen er damals, als Kind noch, das Skifahren lernen durfte. Auf den Wildkogel, der ihn zwar immer sehr reizte, ließen ihn seine Eltern nicht, da es für ihn damals noch viel zu steil und gefährlich war. Später dann, als er älter wurde, war der Wildkogel nicht mehr das, was er als Herausforderung sah. Nein, er fuhr lieber hinüber nach Kitzbühel, wo er auf der berühmt-berüchtigten Streif sein Abenteuer suchte. Jetzt lag kein Schnee dort droben und nur kleine Wölkchen wie Wattebäuschchen zogen am Gipfel vorüber. Der Wald schmiegte sich wie ein grüner Mantel an die Berge. Sicher war es jetzt angenehm kühl dort oben und vor allem ruhig. Demnächst werde ich mal wieder eine kleine Wanderung mit den Kindern machen, dachte er sich.
Gedankenverloren rührte Martin in seiner Kaffeetasse, die er nun in einer Hand hielt. Er ließ seinen Blick wieder über den Stadtplatz wandern, um ein neues Opfer zu suchen, bei dem er sein Rätselraten fortsetzen konnte. Zu seinem Bedauern gab es im Moment niemanden, den er in sein Hobby einflechten konnte. Niemanden? Was war das? Ruckartig richtete er sich auf und schaute zu dem Fahrzeug, das sich schräg gegenüber auf dem Parkplatz vor der Drogerie befand. Da saßen zwei Männer drin, die sich in seinen Augen äußerst verdächtig benahmen. Sie beobachteten eindringlich die Straße und vor allem die Kreuzung, über die auch der Zebrastreifen führte
Martin beobachtete sie weiter. Da! Einer, der Fahrer, hielt ein Handy oder Ähnliches in der Hand und redete hinein. Was, zum Teufel, beobachten die?, fragte sich Martin und behielt das Fahrzeug weiter im Auge. Was haben die vor? In letzter Zeit hörte man ja so vieles, was Banküberfälle, Raubüberfälle auf Geldtransporter und Ähnliches betraf. Unweit von seinem Standort befand sich die Sparkasse von Mittersill und nur ein paar Hundert Meter weiter jenseits der Salzach die Raiffeisenbank. Selbst Anschläge wie in Frankreich oder anderswo waren im Gespräch. Eine Terrorwarnung war zwar nicht herausgegeben worden, aber man konnte ja nie wissen. Da! Jetzt zeigte einer zur Kreuzung. Was gab es da Wichtiges zu sehen? Ein Auto. Nur ein Auto? Was hatte es mit diesem Auto auf sich? Warum beobachteten die beiden dieses Auto? »Stimmt etwas nicht, Herr Chefinspektor?«, riss ihn die Stimme Joschis aus seinen Gedanken. »Wie? Was? Was soll nicht stimmen?« Joschi zeigte auf die Torte: »Na die Sacher. Ist etwas damit? Schmeckt sie nicht?« Martin senkte den Kopf zu der Torte und es fiel ihm wie Schuppen von den Augen: »Ach ja. Die Torte. Ich weiß nicht, ob sie schmeckt oder nicht. Ich bin noch gar nicht dazu gekommen, sie zu probieren.«
»Ah ja, ich verstehe. Sie machen wieder Ihre Studien?«, lächelte Joschi verständnisvoll.
Martin lächelte zurück und nickte: »Ja, Sie wissen doch …«
»Unser Herrgott hat einen großen Tiergarten«, ergänzte Joschi. Martin beugte sich nach vorne, stellte seine Tasse ab und nahm die Kuchengabel. Joschi blieb neben ihm stehen und blickte ihn erwartungsvoll an. Martin stach ein Stück vom Kuchen ab und schob es in den Mund. »Ausgezeichnet, Joschi. Der ist wirklich ausgezeichnet«, lobte er mit vollem Mund. »Das freut mich, Herr Chefinspektor«, lächelte Joschi wieder und ging zum nächsten Tisch.
Martin beobachtete wieder das Auto und versuchte, die beiden da drin mit dem Straßenverkehr gleichzeitig im Auge zu behalten. Nun fiel es ihm auf. Die beiden erfassten die Autofahrer, die ohne anzuhalten, über den Zebrastreifen fuhren. Selbst wenn ein Fußgänger wartete, blieben manche nicht stehen. Sofort gaben die beiden offenbar eine Meldung weiter. Die Kollegen der hiesigen Polizei, deren Revier sich unweit von hier an der Bundesstraße befindet, fischten die Fahrer sicher sofort heraus und verpassten ihnen ein Bußgeld.
Erleichtert schnaufte Martin durch. Gott sei Dank hab ich mich geirrt. Sein Blick schweifte weiter über den Platz und sofort fiel ihm ein junges Mädchen auf, das sich nervös umsah. Wen die wohl hier sucht? Ihren Mann? Ihren Freund oder einen anderen Begleiter?, überlegte er. Er wollte schon aufstehen, um sie zu fragen, ob er ihr helfen konnte. Bei so einem hübschen Mädchen fiel ihm das immer leicht. Er stützte sich auf den Lehnen ab und stand schon halb, als er bemerkte, wie ein junger Mann auf sie zukam, sie umarmte und ihr einen kleinen Kuss auf die Wange gab. Er sagte irgendetwas zu ihr, hakte sich bei ihr unter und ging mit ihr weg. Die Turmuhr der nahen Kirche schlug zuerst viermal, dann zwölfmal. Mittag. Es ist Mittag. Mal sehen, wie es heute ist. Er guckte auf den Kirchturm und wartete, bis das Zwölfuhrläuten begann. Es faszinierte ihn immer wieder, wenn er dieses Schauspiel beobachten konnte. Sobald sich die Glocken im Innern des Turms bewegten, schwang der Turm im selben Takt hin und her. Beinahe konnte man meinen, dass der Turm einfiele, so stark wankte er.
Als die Glocken dann ihren vollen Klang in das Tal hinaus schickten, schwankte der Turm immer stärker. Martin wartete gespannt darauf, ob der Turm es wohl diesmal aushalten würde, denn die Spitze bewegte sich sicher einen halben Meter hin und her. Dazu hörte man das Knarren des Glockenstuhls. Erstaunlich, was die Baumeister der damaligen Zeit schon über Statik wussten, dachte er. Langsam aß er seinen Kuchen mit dem Schlag auf und trank seinen Kaffee leer. Er zog seine Geldbörse heraus, entnahm ihr einen Zehneuroschein und legte ihn auf den Tisch. Er wusste, was der Kaffee und der Kuchen hier kosteten und auch, dass er mit diesem Schein wieder einmal reichlich Trinkgeld gab.
Joschi hatte dies augenscheinlich bemerkt und kam an den Tisch: »Sie wolln schon gehen?«
»Ja, leider. Ich muss. Die Arbeit ruft.« Joschi nahm den Schein und steckte ihn in seinen Geldbeutel. »Dankschön, Herr Chefinspektor. Beehrn Sie uns bald wieder!«, rief er Martin nach, der bereits ein paar Schritte gegangen war.
Kapitel 2
Plötzlich klingelte sein Handy. Er zog es aus der Tasche seiner Jacke und nahm den Anruf an: »Egger.«
»Servus Martin«, meldete sich ein Kollege aus Zell. »Was gibts?« »Einen Mord oder einen tödlichen Unfall. Wir wissen es noch nicht genau. Fahr mal rüber nach Bramberg zum Smaragdweg. Die Kollegen warten dort auf dich.«
»Was heißt das? Ihr wisst es nicht?«
»Die Leich liegt im Wasser und konnte noch nicht geborgen werden.«
»Gut, ich fahr rüber.« Martin legte auf und lief zu seinem Auto. Er öffnete die Tür, stieg ein und fuhr los. Da er sich in einer Einbahnstraße befand, musste er nun wohl oder übel in die andere Richtung über die Hintergasse fahren. Kurz darauf kam er an der Abzweigung an, auf der man nach rechts Richtung stadtauswärts fahren kann. Er musste aber nach links abbiegen, was ihn Zeit kostete, da dort der Verkehr um diese Zeit sehr dicht war. Schließlich schaffte er es dann doch, nach links abzubiegen und fuhr auf der Bundesstraße weiter vorbei am Stadtplatz, wo er zuvor noch saß. Am Zebrastreifen hielt er wieder an, da das junge Pärchen, das ihm vorhin aufgefallen war, die Straße überqueren wollte.
Als die beiden die andere Straßenseite erreicht hatten, fuhr er mit hohem Tempo, aber nur so schnell, wie es der fließende Verkehr erlaubte, weiter. Die Polizeistation, der er noch einen Besuch abstatten wollte, ließ er rechts liegen. Schmunzelnd schaute er auf den Aspiranten, der ein Fahrzeug aus dem Verkehr winkte. Vermutlich war dies das Ergebnis der Beobachtung der Kollegen am Stadtplatz. Am Tauernzentrum vorbei fuhr er weiter an Hollersbach und Mühlbach vorüber, bis er bei Weyer abbog und zum Parkplatz am Smaragdweg kam. Das Erste, das ihm auffiel, war die grellgelbe Absperrung, die am Eingangsportal zum Smaragdweg angebracht war. Davor standen einige heftig gestikulierende Leute, die pausenlos auf einen jungen uniformierten Beamten einredeten. Martin lief zu dem Streifenwagen, vor dem der Gruppeninspektor Wimmer stand. Auf der anderen Seite des Fahrzeugs lehnte, scheinbar gelangweilt, der Revierinspektor Moser. Er rauchte eine Zigarette, die er aber sofort wegwarf, als Martin auf sie zukam. Wimmer hielt ihm die hintere Türe auf. Mit den Worten »Bittschön, Herr Chefinspektor«, bat er ihn in den Wagen. Martin setzte sich hinein und sowohl Moser als auch Wimmer, der den Wagen lenkte, stiegen ein. Als sie die Schranke, die normalerweise geschlossen war, passierten, fiel Martin auf, dass auch hier, entlang des gekiesten Weges, diese Absperrbänder angebracht waren. »Wer hat diese Absperrung angeordnet?«, fragte Martin. »Das waren die Kollegen von der Spurensicherung«, bekam er von Wimmer die Antwort.
Wimmer fuhr zügig nach oben und überholte dabei einige Radfahrer, die hinter ihm herschimpften, da es gewaltig staubte. Auch ein paar Fußgänger, die sie überholten, ballten die Fäuste und riefen ihnen irgendwelche Schimpfworte hinterher. Martin beobachtete genau, wie Wimmer fuhr, denn er kannte die Unvernunft mancher Fußgänger und Radfahrer, die gerade dann nicht zur Seite fuhren, wenn man es eilig hatte. »Schalten Sie bitte das Signal ein«, bat er deshalb Wimmer, der sofort den Schalter dafür betätigte. Als Martin ein Stück weiter oben eine Frau mit einem Kinderwagen auffiel, bat er: »Bleiben Sie bitte bei der Frau stehen.« Wimmer bremste sofort ab und blieb kurz hinter der Frau, die sich erschrocken umdrehte, stehen. Martin sprang aus dem Wagen und rannte zu ihr. Sie blickte ihn ängstlich an: »Was wollen Sie von mir? Ich hab nichts angestellt.«
»Das weiß ich. Kommen Sie, steigen Sie in den Wagen, wir bringen Sie nach oben.« Wimmer, der die Szene beobachtete, stieg aus und rief ihm zu: »Herr Chefinspektor. Wir habens pressant. Lassen Sie doch die Frau.« Da die Frau sich weigerte, in den Wagen zu steigen, ließ Martin sie stehen und rannte zum Fahrzeug zurück.
Als er eingestiegen war, meinte Wimmer: »Also Ihre Einstellung möchte ich haben. Da passiert ein Mord und Sie kümmern sich um eine Frau, die einen Kinderwagen schiebt.«
»Haben Sie denn nicht gsehen, wie die sich plagt? Ich wollt ihr bloß helfen!« Wimmer sagte nichts weiter, sondern fuhr in hohem Tempo nach oben. In den engen Kurven schlingerte der Wagen etwas, so dass sich Martin genötigt fühlte, einzuschreiten: »Fahrns doch ein wenig langsamer. Wenn da ein Radler von oben kommt, ist er tot.«
»Da kommt keiner. Da oben ist alles abgesperrt«, grinste ihn Wimmer durch den Rückspiegel an. Martin schwieg dazu, denn wahrscheinlich hatte der Mann recht. Er blickte zum rechten Seitenfenster raus und nahm die Flechtenbärte wahr, die von den steilen Felsen rechts der Straße herunterhingen wie die lange Bärte von Riesen. Aus den Flechten tropfte Wasser unablässig auf die Straße, so dass es hier, wo sie jetzt waren, nicht mehr staubte. Martin versuchte, durch die linke Seitenscheibe hinunterzublicken, wo sich der eigentliche Smaragdweg befand. Aber er bemerkte nur hie und da einen hellen Fleck, der erahnen ließ, dass der Weg dort verlief.
Das gelbe Band zog sich sogar über die kleinen Wirtschaftswege über die die Waldbesitzer in ihr Gehölz kamen. Ein paar große Holzstapel zeigten, dass man hier sehr rege mit der Bewirtschaftung des Waldes beschäftigt war. »Ja Herrschaftszeiten no amal!«, schimpfte Wimmer, der einen Radfahrer überholte, der mitten auf der Straße fuhr. »Is denn unser Horn ned laut gnua?!«, schimpfte er weiter. Bald kamen sie an der Brücke an, die über den Habach führte. Von hier ab war das gelbe Band auf der rechten Seite weiter gezogen. Nun war der Hang aufwärts auf der linken Seite. Schon beim Quellenreich, in dem Hunderte von Quellen aus dem Hang sprudelten und den Habach speisten, war die Straße quer mit dem Band abgesperrt. Davor standen, wie konnte es auch anders sein, etliche Radfahrer und Fußgänger, die neugierig die Straße hoch blickten. Wimmer fuhr bis an das Band heran, wobei es sich nicht vermeiden ließ, dass er den einen oder anderen Fußgänger mit dem Wagen leicht touchierte.
Einer von denen hieb mit der Faust auf das Fahrzeugdach, so dass es laut dröhnte. Martin verstand den Unmut der Wanderer, wollten sie doch möglichst bald an ihr Ziel kommen, das von hier aus in etwa einer halben Stunde zu erreichen war. Ein Mann in grauem Zwillichanzug hob das Band hoch und ließ Wimmer durchfahren. »Augenscheinlich ist auch die Feuerwehr hier oben?«, fragte Martin.
»Ja und die Bergwacht auch. Der Rotkreuzwagen ist auch vorhin rauf gefahren.«
»Der Rotkreuzwagen?«, fragte Martin verwundert. »Ich denke, da ist ein Toter? Wozu braucht man den Rotkreuz?«
»Ob die Person im Bach tot ist, kann man noch nicht sagen. Erst mal muss die Bergwacht sie rausholen.« Kurz darauf kamen sie dort an, wo ein kleiner Weg nach rechts unten führt. Wimmer hielt den Wagen direkt hinter dem Fahrzeug der Bergwacht an und zog die Handbremse. Martin stieg aus und rannte dorthin, wo er drei Männer in weißen Hosen und mit leuchtfarbenen Jacken erspähte.
Offenbar handelte es sich dabei um das Team aus dem Rotkreuzfahrzeug, denn sie trugen auch eine Bahre mit sich. Einer von ihnen beugte sich über ein Bündel, das augenscheinlich ein Mensch, ein Mädchen, war. Er riss das Hemd auf und klebte ein paar Kabel auf die Brust. Danach schloss er ein Gerät an, bei dem es sich offensichtlich um ein Herzfrequenzmessgerät handelte. Schon von weitem glaubte Martin, das Mädchen zu kennen. »Leni!«, rief er und rannte los. Als er bei dem Rettungsteam ankam, stand der Mann mit dem Gerät auf und schüttelte den Kopf. Martin riss ihn zur Seite und beugte sich zu dem Bündel hinunter. Er hatte sich nicht getäuscht. Vor ihm lag ein junges Mädchen, mit goldenen, langen, lockigen Haaren. Die Augen geschlossen und der Mund schmal und blass. Ihr Gesicht war wie das eines Engels. Eines kleinen, unschuldigen Engels, der direkt vom Himmel gefallen war. Ebenmäßig und schön. Sie rührte sich nicht, aber Martin packte sie an den Schultern und schüttelte sie: »Leni! Leni, wach auf! Ich bins! Dein Martin! Leni, bitte wach auf! Du kannst doch nicht einfach gehen!« Er bemerkte nicht, dass er im nassen Gras kniete und die Hose feucht wurde. Er rief immer wieder: »Leni! Leni! Bitte komm zurück!«
Er ließ seinen Kopf auf ihre Brust sinken und weinte: »Leni, bitte tu mir das nicht an! Leni!« Schließlich packte ihn jemand an der Schulter und zog ihn weg. Er schüttelte die Hand ab und schrie den Notarzt, um den es sich dabei handelte, an: »Lassen Sie mich los! Lassen sie mich!« Dann lehnte er seinen Kopf an die Schulter des Arztes und weinte und schrie immer wieder: »Leni! Leni! Meine Leni!«
Der Notarzt gab den Sanitätern einen Wink. Sie nickten, nahmen Martin in ihre Mitte und führten ihn zu ihrem Fahrzeug. Der Arzt ging hinter ihnen her.
Wimmer, der das Ganze beobachtet hatte, kam dazu und fragte: »Was ist mit ihm?«
»Vermutlich ein psychischer Schock. Kannte er die junge Frau?«, antwortete der Arzt. Er ließ sich eine Spritze geben und schob den Ärmel von Martins Jacke hoch. Langsam injizierte er das Medikament in die Armvene.
Wimmer wunderte sich: »Psychischer Schock? Was heißt das?«
»Vermutlich kannte er die Tote und es hat ihn sehr getroffen.«
»Ich glaube nicht, dass er sie kannte«, gab Wimmer von sich. »Dann weiß ich auch nicht, warum er so reagiert«, sagte der Arzt nachdenklich.
»Müssen Sie ihn jetzt mitnehmen? Wir brauchen ihn nämlich hier. Er ist der ermittelnde Beamte.«
»Eigentlich sollte er mit in die Klinik. Aber wir warten einfach noch ein wenig. Vielleicht beruhigt er sich. Ich hab ihm ein entsprechendes Medikament gegeben. Er muss auf jeden Fall in psychologische Behandlung. Sorgen Sie bitte dafür, dass er das auch tut, wenn er hier fertig ist.«
Martin, der mit herabgesunkenem Kopf vor ihnen saß, hörte die Worte des Arztes: »Psychologe? Ich bin doch nicht verrückt! Ich geh zu keinem Psychologen!«
»Dann muss ich Sie bitten, in den Wagen zu steigen. Sie müssen mit uns kommen.«
Martin schüttelte den Kopf. »Nein! Das kommt auf keinen Fall in Frage! Ich komm nicht mit Ihnen mit! Ich hab hier zu arbeiten!«
Karl, der Pathologe, war ebenfalls anwesend und kam zu ihnen. »Herr Kollege, Herr Egger ist in einem Ausnahmezustand. Ich bürge für ihn. Lassen Sie ihn hier und seine Arbeit machen. Ich erkläre Ihnen die Situation. Kommen Sie bitte.« Karl nahm den Arzt beiseite und ging mit ihm ein Stück den Weg hinauf. Er erklärte ihm den Sachverhalt, und dass Martin augenscheinlich meinte, er habe seine verstorbene Frau vor sich.
Der Notarzt verstand und verabschiedete sich. »Sie übernehmen die Verantwortung für Herrn Egger?«
Karl nickte: »Ja, das mach ich.«
Der Notarzt stieg mit seinen Assistenten wieder in den Wagen. Einer der beiden Sanitäter lenkte ihn. Vorsichtig rangierte er den Wagen hin und her, bis er in der richtigen Richtung stand.
Karl ging zu Martin: »Da hast du dir aber was Schönes eingebrockt«, sagte er zu ihm. Martin, bei dem das Medikament offenbar zu wirken begann, flüsterte beinahe unhörbar: »Ja, ich weiß.«
Gemeinsam gingen sie den schmalen Weg hinunter, an dessen Fuß das Mädchen lag. Martin zeigte auf sie: »Was glaubst du? Wie lange ist sie schon tot?« Karl beugte sich hinunter und hob eines ihrer Augenlider.
Er zuckte mit den Schultern: »Also hier kann ich das nicht mit Sicherheit feststellen. Es kann durchaus sein, dass sie noch gelebt hat, als man sie fand.«
»Du meinst, sie hat alles mitbekommen?«
»So würde ich das nicht unterschreiben. Vermutlich war sie bewusstlos.« Neben ihnen zog ein Mann seinen Neoprenanzug aus. Offenbar war er derjenige, der sie aus dem Wasser gezogen hatte. Martin fragte ihn: »Was meinen Sie? Hat sie noch gelebt, als sie sie rausholten?« Der Mann zuckte mit den Schultern: »Das kann ich Ihnen nicht sagen. Sie war jedenfalls leblos wie eine Puppe.«
»Wer hat sie gefunden?« Der Mann zeigte nach oben zum Weg: »Dort oben. Ein kleiner Junge. Wahrscheinlich hat man ihn schon weggebracht. Der war fix und fertig.«
»Hat man einen Rucksack oder Ähnliches gefunden?«
»Bisher nicht«, antwortete der Mann, »Aber Ihre Leute von der Spurensicherung suchen bereits das Gelände flussaufwärts ab.«
»Könnten Sie mir bitte zeigen, wo das Mädchen im Wasser war?«
»Ja gerne, kommen Sie.«
Der Mann ging Martin voraus auf die Kanzel, die auf einem Stein mitten im Bach gebaut war. Er zeigte nach unten, wo das Wasser durch eine Enge in den Felsen rauschend und dröhnend unter der Kanzel durchschoss. »Da unten. Sehen Sie? Der Felsvorsprung. Da ist sie hängengeblieben.«
»Sie kann also nicht von hier oben …?«
»Nein, auf keinen Fall. Da hätte sie ja bachaufwärts treiben müssen. Das ist unmöglich.« Martin nickte ihm zu: »Danke für die Auskunft – und danke, dass Sie sie rausgeholt haben.«
»Keine Ursache«, meinte der Mann und ließ ihn stehen. Martin hielt sich noch eine Weile am Geländer fest und spürte, wie die Vibrationen, die der Bach am Felsen durch seine Kraft verursachte, durch seinen Körper flossen.
Er dachte nach. Ja, hier war es. Hier hab ich meiner Leni den Heiratsantrag gemacht. Er lächelte still. Hier hab ich sie gefragt, ob sie meine Frau werden will. Wie gestern scheint es mir. Genauso, als wäre es gestern gewesen. Und nun liegt dieses kleine, zarte Wesen da drüben im Gras und wartet darauf, dass Karl …, er stockte und rannte hinüber, wo die Leiche des Mädchens gerade in einen Transportsarg gelegt wurde. Er packte Karl am Arm und drehte ihn zu sich: »Karl! Versprich mir eins. Bitte, versprich es mir!«
»Was?«, Karl verstand offenbar nicht gleich. »Was soll ich dir versprechen?« Martin zeigte auf den Sarg: »Versprich mir, dass du sie nicht verschandelst. Behandle sie nicht so, wie die anderen. Bitte zerstückel sie nicht. Lass ihr das kleine Stück Menschenwürde, das sie noch hat. Versprichst du mir das?« Karl zuckte mit den Schultern: »Ich weiß zwar, was du meinst, aber ich muss meine Arbeit tun.« Martin flehte ihn beinahe an: »Bitte Karl. Sie ist doch noch so ein junges Mädchen. Sie ist ein Engel. Hast du das nicht gesehen?« Karl drehte sich wieder um und sagte über die Schultern: »Wie du meinst. Aber ich muss tun, was zu tun ist.«