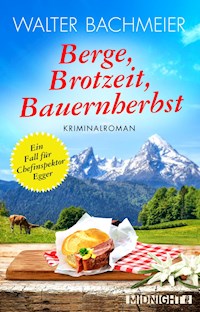
3,99 €
Mehr erfahren.
Chefinspektor Egger ermittelt wieder Es ist Bauernherbst im Salzburger Land, und die Krimmler Bevölkerung feiert ihre bäuerlichen Traditionen mit einem großen Straßenfest. Doch die Idylle trügt. Während der Feierlichkeiten wird ein Attentat auf den Bürgermeister von Krimml verübt. Chefinspektor Egger, der mit seiner Familie ebenfalls das Fest besucht, ist sofort zur Stelle und übernimmt den neuen Mordfall. Der Bürgermeister hatte in seiner Stadt nicht viele Freunde. Als jedoch ein weiterer Toter gefunden wird, überschlagen sich die Ereignisse. Gleich zwei Morde zwingen Egger zum Handeln … Von Walter Bachmeier sind bei Midnight by Ullstein erschienen: Mord in der Schickeria (Ein-Tina-Gründlich-Krimi 1) Mord an der Salzach (Ein-Tina-Gründlich-Krimi 2) Mord in der Alpenvilla (Ein-Tina-Gründlich-Krimi 3) Mord im Pinzgau (Ein-Tina-Gründlich-Krimi 4) Mord in der Berghütte (Ein-Tina-Gründlich-Krimi 5) Mord am Wildkogel (Ein-Tina-Gründlich-Krimi 6) Affären, Alpen, Apfelstrudel (Chefinspektor Egger Fall 1) Berge, Brotzeit, Bauernherbst (Chefinspektor Egger Fall 2) Koppeln, Kühe, Kaseralm (Chefinspektor Egger Fall 3) Morde, Matsch, Marillenknödel (Chefinspektor Egger Fall 4) Diebe, Dörfer, Dampfnudeln (Chefinspektor Egger Fall 5) Gauner, Glühwein, Geigenklänge (Chefinspektor Egger Fall 6)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Der AutorWalter Bachmeier, geboren 1957 in Karlsruhe, wuchs in Münchsmünster in der Hallertau auf. Nach seiner Ausbildung zum Koch begann er unter dem Pseudonym zu schreiben. Sein erstes Werk war ein Kochbuch, das sehr erfolgreich verkauft wurde. Dies gab ihm den Ansporn, seinen Beruf aufzugeben und weiter zu schreiben. Im Laufe der Jahre entstanden so mehrere Erzählungen, Kinderbücher und Artikel in verschiedenen Tageszeitungen. Seit etwa 2012 widmet er sich voll und ganz der Literatur. Immer wieder finden in seinen Büchern auch Erlebnisse aus seinem Leben Platz.
Das Buch
Chefinspektor Egger ermittelt wiederEs ist Bauernherbst im Salzburger Land, und die Krimmler Bevölkerung feiert ihre bäuerlichen Traditionen mit einem großen Straßenfest. Doch die Idylle trügt. Während der Feierlichkeiten wird ein Attentat auf den Bürgermeister von Krimml verübt. Chefinspektor Egger, der mit seiner Familie ebenfalls das Fest besucht, ist sofort zur Stelle und übernimmt den neuen Mordfall. Der Bürgermeister hatte in seiner Stadt nicht viele Freunde. Als jedoch ein weiterer Toter gefunden wird, überschlagen sich die Ereignisse. Gleich zwei Morde zwingen Egger zum Handeln …
Walter Bachmeier
Berge, Brotzeit, Bauernherbst
Kriminalroman
Midnight by Ullsteinmidnight.ullstein.de
Originalausgabe bei Midnight Midnight ist ein Digitalverlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin April 2017 (1) © Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2017 Umschlaggestaltung: zero-media.net, München Titelabbildung: © FinePic® Autorenfoto: © privat ISBN 978-3-95819-111-2 Hinweis zu Urheberrechten Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben. In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Kapitel 1
Langsam schob sich der Lauf eines Gewehrs zwischen zwei Bretter des Schalllochs im Turm der Krimmler Kirche. Niemand sah das dünne schwarze Rohr, auf dem sich das Korn befand. Das Rohr schwankte nur leicht und schien auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet zu sein. Noch tat sich nichts. Der Schütze wartete ab, bis er ein bestimmtes Zeichen bekam. Wieder zog er den Lauf der Flinte zurück. Der Kapellmeister, der sich vor der Blaskapelle aufgestellt hatte, hob seinen Tambourstab und gab ein kurzes Kommando, das oben nicht zu hören war.
Erneut schob sich der Lauf zwischen den Brettern hindurch und wurde auf ein imaginäres Ziel ausgerichtet. Der Schütze wartete. Er war ungeduldig. Der Lauf der Waffe schwankte leicht hin und her. So als ob er ein Ziel verfolgte. Er beobachtete den Kapellmeister genau, als dieser seinen Tambourstab in die Höhe hielt. Er atmete langsam, ganz bewusst und tief. Nur die Ruhe bewahren! Der erste Schuss muss sitzen. Nur ja keinen Fehlschuss!
Der Kapellmeister hob seinen Fuß, und ehe er den ersten Schritt machte, senkte er den Stab. Schnell, so schnell, dass ihm kein Auge folgen konnte. Der Schütze im Turm behielt die Ruhe. Einatmen – ausatmen – gaanz langsam. Die Musik begann zu spielen. Der Finger am Abzug krümmte sich leicht. Noch nicht! Jetzt noch nicht! Das wäre zu früh. Wieder justierte der Schütze sein Gewehr auf das Ziel. Einatmen – ausatmen – einatmen. Noch nicht! Jetzt noch nicht schießen! Er besann sich auf das Gewehr. Eine Waffe aus den Beständen der deutschen Bundeswehr. Niemand konnte es ihm zuordnen. Auch wenn er die Waffe hier liegen ließe. Die Nummer würde zwar zu einer Liste führen, die angelegt worden war, als die Waffe zusammen mit etlichen anderen aus den Beständen verschwunden war. Aber niemand wusste, dass er jetzt diese Waffe in den Händen hielt, um damit zu schießen. Geladen mit einer speziellen Patrone. Das Geschoss würde sich in tausend kleine Teile zerlegen, wenn es auf das Ziel traf. Die Patrone hatte er selbst hergestellt. Dadurch konnte auch keiner herausfinden, wer sie wann und wo gekauft hatte.
Er beobachtete die Szenerie, die sich da gute hundert Meter unter seinen Füßen abspielte. Der Standartenträger saß stolz aufgerichtet auf seinem Pferd und hielt die Fahnenstange kerzengerade hoch. Dahinter die Blasmusiker und gleich danach das hübscheste Mädchen aus dem ganzen Pinzgau. Die Tochter des Bürgermeisters. Wie stolz sie doch aussah, auf ihrer Fuchsstute. Stolz wie eine Gräfin. Das Haar geflochten, die Haut … Ihm wurde der Kragen eng, als er sie sah. Wie gerne wäre er in ihrer Nähe gewesen. Wie gerne hätte er sie auf dieses Fest begleitet. Aber … Nein. Das ging nicht! Er hatte hier und jetzt etwas zu erledigen. Der Wagen des Bürgermeisters und seiner Frau kam in Sicht. Zwei stolze Noriker zogen den Wagen, der, so geschmückt, fast einem Kaiser würdig gewesen wäre. Gleich dahinter kamen drei Reiter auf Pferden. Ebenfalls Noriker, wie die meisten auf diesem Umzug. Die Reiter in Tiroler Tracht hielten lange Peitschen in den Händen und schienen auf ein Kommando zu warten. Genauso wie er. Es konnte nicht mehr allzu lange dauern, deshalb richtete er sein Zielfernrohr noch einmal neu aus. Über die Visierlinie sah er ganz deutlich sein Opfer.
Es war heiß da oben. Sehr heiß. Der Schweiß lief in Strömen über seine Stirn und in seine Augen. Wie Feuer brannte es. Schließlich wischte er sich mit dem Arm über sein Gesicht, was zur Folge hatte, dass er sein Ziel nicht mehr über die Visierung hinweg sah. Erneut richtete er die Waffe aus, und ein zufriedenes Lächeln huschte über sein Gesicht, als er den Kopf seines Opfers im Visier hatte. Der Knall der Peitschen, die die Goaßlschnoizer schwangen, übertönte den Schuss.
Wieder einmal hatten sie Glück mit dem Wetter gehabt. Es schien, als ob Petrus diesen kleinen Fleck Erde besonders schätzen würde. Obwohl schon Ende September war, wartete Petrus mit Temperaturen von über zwanzig Grad auf. Aus der Ferne war das Donnern der Krimmler Wasserfälle zu hören, die schon seit Millionen von Jahren ihr Wasser vom Krimmlerkees bezogen und in drei Fällen unterschiedlicher Höhe ins Tal brachten. Bis in den Ort hinein sah man die Gischt aufsteigen, die sich wie ein feiner Nebel wieder in das Tal legte. Eifrig bauten die Handwerker und Bauern ihre Stände auf, da der große Bauernherbst, der alljährlich im Herbst zum Almabtrieb stattfand, auch heuer wieder ein Erfolg werden sollte. Nur wenige Touristen flanierten an den eifrig arbeitenden Männern und Frauen vorbei, in der Hoffnung, schon jetzt ein besonderes Schnäppchen oder ein Mitbringsel für die Daheimgebliebenen zu ergattern. Zu ihrem Bedauern verkauften weder die Fieranten noch die Bauern und Handwerker schon jetzt ihre selbst hergestellten Artikel, da sie untereinander die Vereinbarung hatten, nichts zu verkaufen, ehe der offizielle Startschuss gegeben wurde. Es wäre auch durchaus nicht fair den anderen gegenüber gewesen, wenn ein Stand geöffnet hätte und seine Waren verkaufte, während die anderen noch beim Aufbau waren.
Aufgeregt rannte der Touristikchef Walter Stiegler durch die Straße und feuerte die Leute an, doch schneller zu arbeiten, da nur noch wenig Zeit verblieb, bis der Umzug beginnen sollte. Aus den einzelnen Biergärten waren die Musikkapellen zu hören, die sich bereits jetzt einspielten. Weit hinter der Kirche stellten sich die einzelnen Themenwägen auf, die das Brauchtum und das Handwerk im Pinzgau beschrieben. Die schwarzen Noriker, die die Wägen ziehen sollten, schnaubten und scharrten mit den Hufen. Auch hier spielten sich ein paar Musikkapellen ein. Bei den Rössern standen ein paar Touristen und diskutierten mit den Besitzern der Pferde. Offenbar waren dies fachkundige Leute, denn die Bauern, denen die Pferde augenscheinlich gehörten, nickten häufig zustimmend. Nur ab und zu schienen sie dem Gesagten etwas entgegenzusetzen, denn sie redeten eindringlich mit ihren Gesprächspartnern.
Ein Mann lief geschäftig zwischen den Wägen umher und hatte beinahe bei jedem etwas zu sagen oder auszusetzen. Er trug einen hellgrauen Trachtenanzug mit etlichen Abzeichen am Revers und einem ortsüblichem Filzhut auf dem Kopf, an dem eine Feder, eine Spielhahnfeder, bei jeder Kopfbewegung nickte. Darunter sahen graue, mit ein paar Resten schwarzer Strähnen durchzogene gelockte Haare hervor. Er war groß und eine stattliche Erscheinung. Sein grauer Schnäuzer war sauber gestutzt, und aus seinen graublauen Augen blitzte ein gefährliches Glitzern. Der Mann war sicher gute fünfzig Jahre alt.
In seiner Begleitung befand sich ein junges Mädchen, etwa zwanzig Jahre alt, kastanienbraune, lange Haare, auf dem Kopf eine Krone aus ebendiesen Haaren geflochten. In dieser Krone steckten kleine Blümchen. Eines rot, das nächste weiß, wie die Farben Österreichs. Ein Gesicht wie eine Madonna, fein und ebenmäßig gezeichnet. Grüne Augen, die funkelten wie Edelsteine, und ein Mund zartrosa, frisch aufgeblüht wie eine junge Rose. Zwischen den Lippen blitzten zwei blendend weiße Zahnreihen hervor, während sie lächelte. Ihre Haut war feinweiß und scheinbar durchsichtig wie chinesisches Porzellan. Um den Hals trug sie eine augenscheinlich echte silberne Kropfkette, die mit grünen Smaragden und roten Steinen, wahrscheinlich Rubinen, besetzt war. Sie trug ein schweres Dirndl aus grünem Brokat, unter dem die weißen Spitzen eines Unterrocks hervorlugten. An den Füßen, die klein und zierlich waren, trug sie schwarze Schnallenschuhe mit silbernen Schnallen, die so sauber poliert waren, dass sie in der Sonne blitzten. Eine weinrote Schürze rundete das Gesamtbild ab. Das Mädchen führte eine rotbraune Fuchsstute mit sich, die geduldig hinter ihm herlief.
Einige der Bauern, an denen der Mann vorbeiging, zogen grüßend und devot den Hut. Andere wiederum hatten nur ein verächtliches Grinsen im Gesicht und wandten sich ab, als er in ihre Nähe kam. Er drehte sich um, als er jemanden rufen hörte: »Buagamoasta! Buagamoasta! Herrschaftszeiten Anderl! Iatz bleib hoit amoi steh!«
Erwartungsvoll blickte der Mann, der offenbar der Bürgermeister von Krimml war, dem Mann entgegen, der ihm kurz darauf atemlos gegenüberstand. »Ja? Wos wüst?«, fragte Anderl herablassend und steckte seine Finger in die kleinen Taschen seines Gilets.
»Des Bier! Des wo du mitbrocht host!«
»Ja? Wos is damit?«
»Des langt heier nit!«
»Worum soy des nit langa? Des is grod sovü wia olle Joahr!«
»Mia hamma aba heier a poar Wang mehra!«, erklärte der Mann, der augenscheinlich zum Inventar des Umzugs gehörte. Er trug wie viele andere auch eine kurze Lederhose, graue Wadlstrümpfe und über einem rot-weiß karierten Hemd ein blaues Gilet. Auf eine Jacke hatte er wahrscheinlich der Wärme wegen verzichtet. Er war gut einen Kopf kleiner als der Bürgermeister, hatte halblange, strähnige blonde Haare, denen eine Wäsche nicht geschadet hätte. Das Gesicht war schmal, und seine wasserblauen Augen blickten unstet hin und her. Es war ganz offensichtlich, dass er den Bürgermeister scheute, ja vielleicht sogar Angst vor ihm hatte.
Vielleicht nicht ganz zu unrecht, da ihn dieser anfauchte: »Wenns Bier nit langt, nacha miaßts hoit oans nochkaffn!«
»Aba …«, versuchte der Mann einen Widerspruch, den der Bürgermeister sofort abblockte:
»I kon nit füa olle as Bier zoihn! Es miaßts do scho aa a bisserl wos beisteiern! Es langt des scho, wos i sunst oiwei zoih!«
Er drehte sich um und ging weiter. Er lächelte alle an, an denen er vorbeiging. Aber sobald ihn niemand sah, verschwand das Lächeln aus seinem Gesicht, und er raunte seiner Begleiterin zu: »Schaus da guat o, de Deppn! Zreissn se do füa a poar Euro. Grod neydig ham ses.«
Das Mädchen lächelte nur schwach, während es antwortete: »Ja, Papa, i siechs.« Sie ließ sich ein wenig zurückfallen, als ihr ein junger Bursche zuwinkte.
Prompt kam er angelaufen und flüsterte ihr zu: »Wia schauts aus, Kathi? Heit auf d’ Nocht? Um neine? Kimmst in Stodel?«
Sie flüsterte zurück: »Ja, wann da Papa nit do is!« Anderl drehte sich um und sah gerade noch, wie der Bursche wieder verschwand.
Zornig rief er seiner Tochter zu: »Du soist di doch nit mit dem Gschwerl obgem! Des hob i dia scho tausendmoi gsogg!«
»Ja, Papa!«, antwortete sie und schloss wieder zu ihm auf.
Nun war er es, der sich ein wenig zurückfallen ließ, aber nur, damit er seine Tochter besser im Auge behalten konnte. Er war ein strenger, ja sogar sehr strenger Vater. Bis sie achtzehn wurde, durfte sie sich weder die Fingernägel lackieren, noch durfte sie Kleider und Dirndl tragen, die oberhalb der Knie endeten. Schminke war absolut tabu. Er begründete dies mit den Worten: »Mia sand doch nit bei de Indiana! A gscheids Maderl braucht nit den Baatz im Gsicht!« Sonntags in die Kirche zu gehen war absolute Pflicht, und abends musste sie spätestens um zehn Uhr daheim sein. Einen festen Freund zu haben wäre für ihn schon ein Grund gewesen, sie windelweich zu schlagen.
So gingen sie die Straße weiter entlang, und er wurde nicht müde darin, ständig nach allen Seiten zu winken und zu grüßen. Manchmal war eine Bäuerin zu hören, die sagte: »Schaun dia on, den oidn Gockel! Wiara do stoiziert! So ois dadat eahm de ganze Gmoa alloanig ghörn!«
Eine andere wieder sagte: »Heit is ea aba wieda fesch beinand! Fia wen ea des woih mocht?«
»Host as no nit ghert? Er hot se iatz de junge Hoferin ins Bett ghoit!«, antwortete eine weitere darauf.
»Naa! Wost nit sogst? Ebba de, wo da Mo vurigs Joahr gsturm is?«
»Ja, und an Haufn Göd hot ea ihra hintalossn. A ganze Million Lemsvosicherung hoasts!«
»Aa na! Des mecht ea ihra woih obnehma?«
»Jo scho! Des is ja an Haufn, wos ma do foisch mochn kon! Und do mecht ea ihra höfn, des Göd richi ozleng.«
»I glaab, do im Durf gibt’s kaam aane, de wo dea sich no nit ins Bett ghoit hot!«
»Wos? Di ebba aa?«, fragte eine entsetzt.
Worauf die andere antwortete: »Vielleicht? Aba des geht di nix on!«
So und so ähnlich verliefen die Gespräche, während Anderl Eisenriegler an den Leuten vorbeiging. Immer seine Tochter im Blick und darauf achtend, dass ihr keiner der jungen Burschen, die ihnen in den Weg kamen, zu nahe kam.
»Do bist ja!«, rief ihm Stiegler, der Touristikchef, von einem Stand aus, den er soeben kontrollierte, zu. »I suach di scho a ganze Weil!«
»Wos mechst nacha vo mia?«
»As Bier is zweng! Hot dia des no kaaner gsogg?«
»Jo scho! Aba wos geht des mi on?«
»Du bsorgst doch oiwei des Bier fia de Leit. Heier is zweng! Mia braucha no a Fassl!«
»Nacha hoits eich hoit oans!«
»Und wer zoihts?«, fragte Stiegler und rieb Daumen und Zeigefinger gegeneinander.
»Dea wos sauft, dea zoihts aa!«, meinte Eisenriegler lapidar.
»Es dadat aba nit schodn, wenn de Gmoa aa a bisserl wos beisteiern dat!«, antwortete Stiegler darauf.
»Is recht! Nacha hoist hoit a Fassl. Lass auf Gmoa schreim. I zoihs nacha scho!« Stiegler eilte davon. Endlich kam Eisenriegler am Ende der Straße an und blickte zufrieden zurück. »Iatz kon de Gaudi onfanga! Geh nauf zu de andan! Aba lass di nit vo oam vo de Sauburschn olanga! Host ghert?«, sagte er zu Kathi.
»Ja, Papa!«, antwortete diese und ging mit ihrem Pferd am Zügel zurück.
Eisenriegler schob die Hände in die Hosentaschen und ging fröhlich pfeifend hinter Kathi her. Die Schaulustigen wurden immer mehr, und schon bald drängelten sich etliche Hundert Leute auf der Straße, um dem Geschehen beizuwohnen. »Ma soidat direkt a Kassa aufstön«, murmelte Eisenriegler vor sich hin. »Vielleicht nachsts Joahr?«
Als er endlich bei den anderen ankam, die schon ungeduldig warteten, stieg er in eine Kutsche, in der seine Frau schon saß. Sie war eine ausgesprochene Schönheit, und so mancher rätselte, woher sie wohl gekommen sein mochte. Jung war sie. Kaum älter als seine Tochter, die nun grade mal zwanzig Lenze zählte. »Geh Oide! Ruck auf d’ Seitn!«, befahl er, als er sich setzte. Seine Frau war inzwischen die dritte, die er in den Ehestand geholt hatte. Von den beiden anderen Frauen war die erste bei Kathis Geburt verstorben, die andere hatte er mit Schimpf und Schande aus dem Haus gejagt, weil sie sich mit einem anderen eingelassen hatte.
Er selbst, so wurde zumindest gemunkelt, nahm es mit der ehelichen Treue auch nicht so genau. Als er saß, sah er seiner Tochter zu, wie sie auf ihren Fuchs aufstieg. Sie musste dieses Jahr einen Damensattel benutzen, da ihr Vater dies so wünschte. Ein normaler Sattel wäre ihr lieber gewesen, aber das ging nun einmal nicht. Da sie sich dabei etwas schwertat, kam der junge Mann herbei, der zuvor mit ihr geredet hatte, und hielt ihr den Steigbügel. Dabei flüsterte er ihr wieder zu: »Heit auf d’ Nocht? Kimmst gwieß? Losst mi nit woartn?«
»Nimm gfälligst deine dreckign Pratzn durt weg!«, rief Eisenriegler, der die Szene beobachtet hatte.
Kathi tat, als ob sie dies nicht gehört hätte, und flüsterte zurück: »Jo Beppi, ganz gwieß kumm i. Um neine host gsogg?«
»Ja, um neine im Stodel!«, antwortete er.
Eisenriegler stand auf und wollte zornesentbrannt hinaus. Seine Frau hielt ihn aber zurück und sagte nur: »Lass sie doch. Er will ihr eh nichts.« Die Frau des Bürgermeisters sprach nur Hochdeutsch. Sie gab sich nicht mal die Mühe, den örtlichen Dialekt zu lernen.
Stiegler kam zu Eisenriegler an die Kutsche. »Mia warns dann! Kenna ma onfanga?«
»Jo, meinetweng. Es laaft eh wia olle Joahr?«
»Jo, da Standartenträger voraus, nacha kimmt de Blosmusi, dann dei Tochta und dann du. Hinta dia de Goaßlschnoiza und …«
»Hör auf! Es langt scho!«, sagte Eisenriegler unwillig.
Stiegler hob die Schultern und ging zum Standartenträger, der auf seinem schwarzen Norikerhengst saß. Er wechselte ein paar Worte mit ihm, worauf sich der Reiter umdrehte und den anderen ein Zeichen gab.
Kapitel 2
Martin hörte seine beiden Zwillinge leise miteinander tuscheln.
»Frag du ihn!«, flüsterte Moritz.
»Nein du!«, antwortete Max.
»Ach komm schon. Frag du ihn. Du kriegst ihn doch immer leichter rum.«
»Ich will aber nicht! Frag du ihn!«
»Was jetzt? Brauchst du das Geld oder nicht?«
»Du doch auch. Also frag ihn!«
»Nein, ich frag ihn nicht. Warum soll ich mich wieder dumm anreden lassen?«
»Du bist der Ältere von uns zwei. Wenns um andere Sachen geht, bist du doch auch immer vorne dran!«
Moritz war tatsächlich der ältere der beiden Zwillinge. Zwar nur um ein paar Minuten, aber immerhin. Schließlich nahm er allen Mut zusammen und ging zu Martin, ihrem Vater. »Papa? Kriegen wir einen Vorschuss auf unser Taschengeld vom nächsten Monat? Der Erste is doch eh bald«, fragte Moritz seinen Vater Martin Egger.
»Bitte Papa«, sagte nun auch Max und sah Martin mit dem sehnsüchtigsten Blick, den er auf Lager hatte, an.
Martin schnaufte tief durch, zog seinen Geldbeutel aus der Tasche und fragte: »Wie groß soll denn der Vorschuss sein?« Martin und Julia versuchten, wann immer es ging, mit den Jungs Schriftdeutsch zu reden. Ihr Lehrer hatte darum gebeten, da er der Meinung war, dass sie sich dann bei schriftlichen Arbeiten in der Schule leichter täten. Was im Endeffekt ja auch stimmte. Die beiden hatten immer gute Noten, und selbst im Zeugnis standen meist eine Eins oder mindestens eine Zwei. Im Dienst sprach Martin ebenfalls Schriftdeutsch, um zu vermeiden, dass ihn jemand nicht verstand. Nur unter Freunden und langjährigen Kollegen vernachlässigte er dies.
»Noja, das ganze, wenns dir nichts ausmacht?«, meinte Moritz unbescheiden.
»Habt ihr denn von diesem Monat nichts mehr übrig? Habt ihr alles schon ausgegeben?«, staunte Martin.
»Ein bisserl was haben wir schon noch. Aber das reicht nicht für den Bauernherbst. Wir wollen uns doch Krapfen und Wetzsteine kaufen«, gestand Max.
»Ja und vielleicht noch eine oder zwei Bratwurstsemmeln dazu!«, ergänzte Moritz.
Martin griff in seinen Beutel und holte einen Fünfzigeuroschein heraus. Dabei sagte er: »Hier, ich habs nicht kleiner. Ihr müsst euch das eben wechseln lassen und dann gerecht teilen.«
Moritz, der überall der Gewieftere und Schnellere war, griff sofort nach dem Schein und ließ ihn in seiner Hosentasche verschwinden. Sie flitzten aus der Küche, und Martin blieb nur noch, ihnen nachzurufen: »Zieht euch bitte gleich um. Wir wollen doch pünktlich in Mittersill sein!«
»Ja Papa!«, riefen sie unisono zurück.
»Wos de bloß oiwei mit eahnam Göd mochn? Fünfazwang Euro im Monat? Oafach so ausgem?«, wunderte sich Tante Helga, die die kleine Leni auf dem Arm hielt.
»Noja, as Lem is teier!«, antwortete Julia, Martins Frau.
»Vur oim de siassn Sochn! De Gummibärn und as Eis im Summa«, meinte Martin entschuldigend.
»Oiso zu meiner Zeit …«, wollte Helga beginnen.
Doch Martin unterbrach sie: »Zu unserer Zeit hots no koane Gummibärn nit gem, und a Eis host höchstens untn am See kriagg.«
»Jojo, i maan ja bloß«, antwortete ihm Helga.
Martin sah an sich hinunter und meinte zufrieden: »Oiso i waar gschickt. Meinetweng kenna mia foahn!« Er hatte eine kurze, schwarze Hirschlederne an, graue Wadlstrümpfe und Haferlschuhe. Dazu ein weißes Hemd und eine leichte Strickjacke, die ihm Julia während ihrer letzten Schwangerschaftswochen gestrickt hatte. Sie hatte dazu die Zeit gehabt, da Martin ihr sämtliche schweren Arbeiten im Haus abgenommen hatte. Dazu gehörte natürlich auch das Waschen und Bügeln. Helga wäre zwar auch bereit gewesen, dies zu übernehmen, aber Martin ließ sich das nicht ausreden. Das Holz für den Kachelofen, den Martin hatte einbauen lassen, brachten die Zwillinge bei Bedarf ins Haus. Dies war auch eine der Tätigkeiten, für die sie ihr Taschengeld bekamen. Martin war nämlich der Meinung: »Keine Leistung ohne Gegenleistung.« So waren sie auch für andere Arbeiten zuständig, über die sie manchmal maulten. »Muss das jetzt sein? Ich hab doch was vor.« Martin aber setzte sich durch, indem er sagte: »Keine Arbeit, kein Lohn.«
»Ich brauch noch mein Halstuch, dann bin ich auch fertig«, sagte Julia und ging ins Schlafzimmer, um sich das Tuch zu holen. Sie trug heute ihr nagelneues Dirndl, das Martin ihr erst vor kurzem gekauft hatte. Dies war notwendig geworden, nachdem sie etliche Kilo abgespeckt hatte, da sie regelmäßig ins Fitnessstudio ging.
Als Julia wieder aus dem Schlafzimmer kam, hatte sie das seidene Tuch bereits umgelegt und sah Martin auffordernd an. Er reagierte sofort, indem er die Treppe hinaufrief: »Was ist jetzt mit euch beiden? Seid ihr endlich fertig?«
»Ja, ja, wir kommen schon!«, kam die Antwort von oben, und prompt rannten die Jungen die Treppe herab.
»Wie seht ihr denn aus?«, fragte Julia und packte Moritz an den Hosenträgern. »Steckt euer Hemd ordentlich in die Hosen! Deine Schuhe sind auch nicht geputzt!« Moritz entwand sich ihrem Griff und ging zur Anrichte, auf der eine Rolle Küchenkrepp stand. Er riss sich ein Blatt herunter, knüllte es zusammen und spuckte darauf. Dann polierte er die Schuhe damit. Julia sah ihm kopfschüttelnd zu. »So geht das aber nicht! Ich möchte, dass du deine Schuhe immer dann putzt, wenn du sie ausziehst!«, befahl sie.
»Manno! Das geht aber nicht immer!«, maulte Moritz.
»Wenn man will, geht alles!«, sagte Martin zu ihm. Man merkte den beiden Buben durchaus an, dass sie langsam, aber sicher in die Flegeljahre kamen. Die Pubertät machte sich bemerkbar, was aber Martin und Julia irgendwie nicht wahrhaben wollten.
Julia betrachtete die beiden von oben bis unten. Moritz meinte gekränkt: »Schau uns nicht so an! Wir haben uns gekämmt, die Nase geputzt, und unsere Taschentücher haben wir auch im Sack!«
Martin klopfte auf seine Hosentasche und meinte: »Meine Autoschlüssel? Hab ich! Geldbeutel? Hab ich! Handy? Das bleibt daheim!« Martin hatte in der Dienststelle extra Bescheid gegeben, dass er an diesem Wochenende nicht zur Verfügung stünde. Deshalb ließ er auch sein Handy zu Hause, damit ihn nur ja keiner anrufen und ihn zu irgendeiner Örtlichkeit schicken konnte. Dieses Wochenende sollte ihm und seiner Familie gehören.
Das Wochenende war wie ein Ritual eingezogen, schon als Martins Frau Leni, die Mutter seiner beiden Buben, noch gelebt hatte. Es war das einzige Wochenende im Jahr, an dem ihn niemand, aber auch gar niemand anrufen durfte. Früher, als Leni schon nicht mehr bei ihnen gewesen war, kam es hin und wieder vor, dass er trotzdem angerufen und zu einem Einsatz geschickt wurde. Aber jetzt war alles anders. Er hatte wieder eine Familie, und die ging ihm vor alles. Nichts und niemand konnte ihn dazu bringen, etwas zu tun, was seiner Familie zum Nachteil reichen würde. So auch auf diesem Bauernherbst – glaubte er.
Als sie das Haus verließen, blieb Helga mit der kleinen Leni alleine zurück. Sie hatte sich dazu entschieden, obwohl auch sie gerne auf den großen Markt gegangen wäre. Aber da war nun mal die Kleine, und der konnte man den Lärm der Blasmusik, das Peitschenknallen und die vielen Leute noch nicht zumuten. Das hätte sie überfordert. Als Martin, Julia und die Buben zum Auto gingen, stand Helga mit Leni an der Türe und winkte ihnen.
Kapitel 3
Plötzlich klingelte das Telefon. Schnell eilte Helga zurück in den Flur und nahm den Anruf an. Sie hörte nur kurz zu, nickte und rannte mit dem Mobilteil aus dem Haus. Dabei rief sie: »Martin! Martin! Noch nicht wegfahren! Hier ist ein Anruf für dich!«
Martin, der soeben einsteigen wollte, schaute zu ihr hinüber und rief: »Ich bin für niemanden zu sprechen! Sag, dass ich schon weg bin!« Leider war es da schon zu spät. Auch Martin fiel auf, dass der Anrufer ihn gehört haben musste, und ging deshalb zu Helga. Er nahm das Telefon und meldete sich: »Egger?«
»Entschuldigen Sie, Herr Egger«, sagte der Anrufer.
»Ja, was wollen Sie?«, fragte Martin ungehalten.
»Hier ist die Dienststelle Zell. Wir haben einen dringenden Fall. Vermutlich ein politisches Attentat.«
»Und was hab ich damit zu tun?«
»Sie sind doch zuständig für die Region und damit auch für Krimml?«
»Ja, bin ich. Na und?«
»In Krimml wurde der Bürgermeister erschossen! Sie müssen sofort dahin und den Fall übernehmen.«
»Das geht nicht! Ich habe doch …«
»Das muss gehen! Herr Egger, das ist ein persönlicher Befehl von Hofrat Gmeiner! Sie müssen den Fall übernehmen!«
»Das ist doch …«, wollte Martin widersprechen, besann sich dann aber doch eines Besseren. Schließlich war er dann und wann auf das Wohlwollen von Hofrat Gmeiner angewiesen und wollte ihn deshalb nicht vor den Kopf stoßen. »Na gut, ich übernehme«, sagte er schließlich widerwillig. Er steckte das Mobilteil zurück in die Ladestation und ging wieder hinaus.
Julia, die neben dem Auto stand, sah ihm sofort an, dass etwas nicht stimmte. »Du hast einen Einsatz?«, fragte sie besorgt.
»Ja, der Bürgermeister von Krimml ist erschossen worden und ich muss den Fall übernehmen«, antwortete er mit rauer Stimme.
»Aber du hast doch …«
»Ja, hab ich. Aber das ist ein Befehl vom Hofrat, und dem kann ich mich nicht widersetzen.«
»Na, dann fahr ich mit den Buben allein nach Mittersill, ich nehm Helgas Auto …«
In Martins Kopf schrillte eine Alarmglocke. Das war doch dieselbe Situation wie damals! Damals, als Leni … Auch damals hatte er einen Einsatz gehabt, bei dem es um Politik ging! Auch damals hieß es, er müsse den Fall übernehmen, obwohl er … Damals! Damals war Leni gestorben! Gestorben, weil er nicht bei ihr gewesen war! Diese Meinung hatte und vertrat er. Allerdings war es so, dass er den Tod seiner Frau nicht hätte verhindern können, als sie bei der Wallfahrt von Maria Alm nach St. Bartholomä am Königssee unglücklich stürzte und starb.
»Nein!«, rief er deshalb lauter, als er eigentlich wollte. »Nein! Ihr bleibt hier! Ihr bleibt auf jeden Fall hier! Ihr geht nirgendwohin ohne mich!«
»Aber warum denn?«, fragte Julia, betroffen über Martins Reaktion.
»Weil mir das zu gefährlich ist. Ich hab schon einmal eine Frau verloren, weil ich nicht dabei war«, erwiderte Martin.
»Aber das ist doch der Bauernherbst. Da kann doch nichts passieren. Hier kann keiner abstürzen oder stolpern«, widersprach Julia.
»Und wenn da so ein Verrückter rumrennt und die Leute abknallt? Was dann?«
»Dann könntest du das auch nicht ändern!«
»Nein, aber ich könnt was dagegen tun.«
»Was denn? Willst du dich vor uns hinstellen und dir eine Kugel einfangen? Willst du deinen Kindern das antun?«
Langsam steigerte sich die Unterhaltung zu einer lebhaften Diskussion, bis Martin schließlich nachgab. »Na gut, meinetwegen. Ich fahr euch hin und hol euch wieder ab.«
Martin fuhr sie nach Mittersill, ließ sie dort aussteigen und machte sich dan auf den Weg nach Krimml. Schon als er an Wald im Pinzgau vorbeikam, fielen ihm die vielen Autos auf, die ihm entgegenkamen. Seine Befürchtung bestätigte sich, als er in die erste Einfahrt nach Krimml einbog. Dort, wo normalerweise die Wiesen und Weiden mit Autos vollgeparkt waren, befanden sich nur noch wenige Fahrzeuge. Im Vorbeifahren konnte er auch beobachten, wie Leute in Autos einstiegen und wegfuhren. Nirgends war ein Polizist zu sehen, der die Leute aufgehalten hätte. Martin fuhr bis nach oben und stellte sein Auto am Fremdenverkehrsbüro ab. Den Rest des Weges ging er zu Fuß. Immer wieder kamen ihm Menschen, offenbar Touristen, entgegen, die sich angeregt unterhielten. Er schnappte dabei einige Sätze auf. »Eine furchtbare Sache das! Da erschießt einer den Bürgermeister! Ja, die Frage ist nur, warum?« Er ging weiter bis nach oben und wandte sich dann nach links am Pfarramt vorbei, um dann die Hauptstraße entlangzugehen. Dort traf er auf einen uniformierten Kollegen.
»Grüß Gott, Herr Chefinspektor!«, begrüßte ihn dieser.
»Grüß Sie Gott, Herr Wallner!«, grüßte Martin ihn und ging auf ihn zu. »Wer ist denn hier der verantwortliche Beamte?«
»Das ist heut der Herr Fuirer!«, erklärte ihm Wallner.
»Aha? Wo finde ich den?«
»Der ist am Tatort, bei der Kutsche.«
»Kutsche? Wieso das denn?«
»Der Bürgermeister wurde in seiner Kutsche erschossen«, klärte ihn Wallner auf.
»Und wo steht diese Kutsche?«
Wallner zeigte die Straße hoch und sagte: »Gehns nur da rauf. Nach zweihundert Metern sehen Sie sie.«
»Danke, Herr Wallner«, antwortete Martin und ging weiter an der Kirche und am Friedhof vorbei.
Schon von weitem sah er die Menschenansammlung vor dem Gasthof Zur Post. Offenbar war dort die Kutsche, von der Wallner gesprochen hatte. Ein paar uniformierte Beamte versuchten die Neugierigen zurückzudrängen, was ihnen nur schwer gelang. Bis zu sich her hörte er sie rufen: »Iatz gengts doch amoi do weg! Do gibt’s nix zu sehng! Herrschaftszeitn no amoi! Vaschwinds do!« Martin erkannte auch, dass sich einige Beamte größte Mühe gaben, die Sicht zur Kutsche mit weißen Tüchern zu verdecken, die sie mannshoch hielten. Hin und wieder löste sich einer der Touristen aus dem Pulk und kam Martin entgegen.
Schließlich war er an der Kutsche angelangt. Martin hatte alle Mühe, sich durch die Ansammlung von Neugierigen zu kämpfen. Schließlich wurde es ihm zu dumm, und er benutzte seinen Ellbogen, um die Leute beiseite zu drängen. Hin und wieder wurde er beschimpft, bis er endlich seinen Ausweis aus der Tasche zog und rief: »Kriminalpolizei Zell! Bitte lassen Sie mich durch!«
Als er endlich an den Tüchern ankam, hielt einer der Beamten, der ihn offenbar kannte, das Tuch so, dass er hindurchschlüpfen konnte. Martin bedanke sich kurz und schaute auf die Kutsche. Die Pferde waren bereits abgeschirrt und weggebracht worden, da die Gefahr bestand, dass sie aufgrund des Tumults durchgehen konnten. Karl, der Gerichtsmediziner, machte sich soeben an dem Körper, der immer noch auf seinem Platz saß, zu schaffen.
»Was hast du, Karl?«, fragte Martin ihn.
»Noch nicht viel. Den Todeszeitpunkt brauch ich ja nicht unbedingt feststellen. Die Todesursache eigentlich auch nicht. Ich hab nur auf dich gwartet, bis ich die Leiche wegbringen lassen kann.« Martin stieg zu ihm auf die Kutsche und besah sich den Leichnam.
»Appetitlich schaut der aber nicht mehr aus«, meinte Martin nach einem kurzen Blick.
»Ja, das kannst du laut sagen. So richtig grauenhaft«, antwortete der Arzt.
»Die Todesursache siehst du ja«, fuhr Karl fort. »Der Schuss muss von hinten gekommen sein. Vermutlich vom Kirchturm da oben«, sagte er und zeigte zur Kirche. »Das hat ihm das Gesicht weggefetzt. Es muss ein Jagdgeschoss gwesn sein. Weißt, eines, das sich beim Aufprall zerlegt«, erklärte er weiter.
»Wo ist der Kutscher?«, fragte Martin.
»Der ist mitsamt der Frau des Bürgermeisters in die Klinik gebracht worden. Seine Jacke hat die SpuSi.«
»Wieso das denn?«, fragte Martin überrascht.
»Du kannst dir sicher vorstellen, dass der Kutscher auch was abbekommen hat. Knochensplitter und eventuell Projektilteile haben ihn in den Rücken getroffen. Der sieht aus, als hätte er Schrot im Rücken.« Der Arzt zeigte auch auf die mit Leder bespannte Bank gegenüber der, auf der der Bürgermeister saß, und sagte: »Da schau. Da ist auch alles voller Blut und Knochensplitter. So schaut auch der Rücken des Kutschers aus.«
Nachdenklich stieg Martin von der Kutsche und fragte einen der Beamten: »Wo finde ich Herrn Fuirer?«
Der Beamte zeigte auf die andere Straßenseite. »Dort drüben, Herr Chefinspektor«, antwortete er.
Martin blickte hinüber und sah einen unformierten Beamten, der mit jemandem eine heftige Diskussion führte. Martin ging hinüber und lauschte kurz. Er hörte den Beamten sagen: »Was jetzt mit eurem Fest ist, interessiert mich nicht im Geringsten! Wir haben andere Sorgen!«
»Worum geht’s denn?«, fragte Martin interessiert.
»Das geht Sie nichts an!«, fuhr ihn der Kollege an.
»Ich denke doch!«, antwortete Martin im selben Ton und zeigte dem Beamten seinen Ausweis. »Und wer sind Sie?«
»Dienstgruppenleiter Fuirer!«, bekam er die schroffe Antwort.
»Das ist gut«, lächelte Martin ihn an. »Ich such Sie nämlich.«
»Ja? Worum geht’s?« Der Mann, der soeben noch mit Fuirer diskutiert hatte, ging weg.
»Wie sieht es mit den Zeugenaussagen aus? Haben Sie da schon welche?«
»Da müssen Sie die Kollegen fragen. Die sind drüben in der Post«, antwortete Fuirer und zeigte auf das große Gasthaus.
»Warum wurden eigentlich die Zuschauer alle weggelassen?«
»Wir konnten nicht alle aufhalten. Bis wir da waren, waren die meisten schon weg.«
Martin zeigte hinüber zum Eingang des Gasthofs, wo sich eine Schlange Menschen gebildet hatte, und fragte: »Dann ist das da drüben wohl der kärgliche Rest?«
»So könnte man sagen, ja«, antwortete Fuirer nickend.
»Herr Fuirer. Bitte sorgen Sie dafür, dass alle Fotos und Filmaufnahmen, die die Leute gemacht haben, uns übergeben werden. Es könnt ja sein, dass jemand zufällig den Täter fotografiert oder gefilmt hat.«
»Das hab ich bereits veranlasst, Herr Chefinspektor.«
»Gut, Herr Fuirer. Dann sorgen Sie bitte auch dafür, dass die Aufnahmen möglichst zeitnah zur Spurensicherung kommen.«
»Mach ich, Herr Chefinspektor«, bestätigte Fuirer.
Martin grüßte kurz und ging weg. Er lief bis zum Friedhof, wo ihm ein paar Männer entgegenkamen, die er flüchtig kannte.
»Herr Chefinspektor! Wir haben was gefunden!«, rief ihm einer von ihnen zu. Interessiert blieb Martin stehen und wartete, bis sie bei ihm ankamen.
»Und? Was habt ihr?«, fragte er.
Einer von ihnen hielt ihm ein kleines durchsichtiges Tütchen hin und sagte: »Hier, die Hülse. Wir haben eine Hülse gefunden.«
»Sonst nichts?«, meinte Martin enttäuscht.
»Doch, die Kollegen sind noch dabei, Fußspuren zu sichern. Im Schallloch sind an einem der Bretter Abriebspuren zu sehen. Das Brett nehmen wir mit.«
»Die Kutsche? Was macht ihr mit der Kutsche? Die kann hier nicht stehen bleiben.«
»Die nehmen wir natürlich auch mit. Ein Hänger zum Abtransport ist bereits angefordert.« Martin nickte wortlos und ging weiter.
Bald traf er auf einen Mann, der mit den Händen wichtig herumfuchtelte und dabei Kommandos gab. »Iatz schauts amoi, dass weidakemmts! De Feierwehr muss de Stroß obspritzn! Dea Stand durt hinten! Iatz machts amoi zuawe! Naa, nit du! I maan den ondern!«
Martin ging auf ihn zu und klopfte ihm von hinten auf die Schulter. »Sie, Herr …«
Der Mann drehte sich um und schaute Martin fragend an. »Wos woins? As Heisl is glei durt hinten untam Supermoarkt!«, erklärte er ungefragt und zeigte auf den Supermarkt, der sich neben dem Kriegerdenkmal befand.
»Ich will nicht aufs Klo!«, antwortete Martin.
»So? Wos woins nacha?«
»Erst einmal Ihren Namen und Ihre Funktion hier!«
»Wos geht eahna des o?«, fragte der Mann.
Martin zückte seinen Ausweis und hielt ihn dem Mann hin. Dabei sagte er: »Chefinspektor Egger. Kripo Zell.« Der Mann nahm den Ausweis und studierte ihn sorgfältig, ehe er ihn Martin zurückgab.
»I bin da Stiegler Walter und i bin da Touristikchef und da zwoate Burgamaaster vo Krimml!«, antwortete er missmutig. »Oiso? Wos woins vo mia?«
»Die Straße – Sie wollen sie von der Feuerwehr reinigen lassen?«
»Muaß i ja woih! Schauns eahna de Stroß amoi on. Ois voschissn vo de Roß und de Goaßn. Des muaß ma wegmochn, zweng de Touristen, dass de nit do neisteing!«
»Die Straße wird nicht gereinigt! Die bleibt erst mal so, wie sie ist«, ordnete Martin an.
»Wiaso nacha des?«, fragte Stiegler mit hochgezogenen Augenbrauen.
»Weil erst die Spurensicherung kontrollieren muss, ob es Geschossteile auf der Straße gibt«, erklärte ihm Martin.
»Und wia lang soy des nacha dauern? De Feierwehrler hom nit ewig Zeit!«
»Es dauert so lange, wie es eben dauert.« Stiegler murmelte etwas vor sich hin, das Martin nur halb verstand. Es hörte sich an wie: »So a Schmoarrn! Nit wegspritzn! Geschossteile! So a Krampf! Ois wia wenn ma do no wos finna kannt!«
Martin rief ihm nach: »Herr Stiegler! Bleiben Sie mal stehen!«
Stiegler blieb stehen und wandte sich Martin zu. Gereizt fragte er: »Wos woins denn no?«
Martin ging auf ihn zu und erteilte die Order: »Rufen Sie alle Gemeinderäte zusammen. Sie sollen ins Gemeindeamt kommen. Ich hab da ein paar Fragen an sie.«
»De wos? Ja sands iatz gonz narrisch wurn? Wo soy i denn de iatz hernehma? De sand olle do aufm Fest untawegs! De meistn vo dene hom jo seyba an Stand do!«
»Das ist mir egal! Rufen Sie sie zusammen! In einer halben Stunde will ich sie im Gemeindeamt sehen! Wo ist das überhaupt?«
Stiegler zeigte in Richtung Kirche und erklärte: »Gengans do hintre, gleich hinta da Kiacha is des Omt!«
»Danke!«, antwortete Martin und ging in die angezeigte Richtung.
Während er die Straße entlanglief, hörte er plötzlich das laute Geknatter eines Hubschraubers. Neugierig sah er nach oben und bemerkte, dass ein Polizeihubschrauber soeben zur Landung auf einer Wiese unweit der Ortseinfahrt ansetzte. Martin ließ das Gemeindeamt rechts liegen und lief weiter auf die Stelle zu, an der der Hubschrauber bereits stand und ein paar Leute ausstiegen. Schon von weitem erkannte er einen von ihnen. Es war der bereits zum Oberst beförderte Kollege Anton Feiler, mit dem er vor ein paar Jahren einen Lehrgang gemacht hatte.
»Sers Toni! Was macht denn das LKA hier?«, begrüßte er ihn, als er vor ihm stand.
Toni hob die Schultern und antwortete: »Na ja, es hieß, dass es vermutlich ein politisch motivierter Mord ist. Da sind wir zuständig. Vielleicht ein Terroranschlag? Kannst du mir schon etwas sagen?«
»Nein, leider nicht. Wir sind auch erst am Anfang der Ermittlungen.«
»Und das Projektil? Was ist mit dem?«
»Das war ein Jagdgeschoss. Das zerlegt sich …«
»Jaja, ich weiß. Die neuen Dinger. Da ist ein Rückschluss auf die Waffe nur noch schwer bis überhaupt nicht mehr möglich«, ergänzte Toni.
»Aber an der Hülse. Der Schlagbolzenabdruck hilft uns da auch schon ein wenig weiter.«
»Wenn wir die haben?«
»Haben wir! Die SpuSi hat sie bereits gefunden.«
»Dann brauchen wir nur noch die dazugehörige Waffe?«
»Ja, aber die zu finden …«
»Dürfte nicht allzu schwer sein. Offenbar handelt es sich dabei um einen Jäger.«
»Wenns ein Jäger ist, dann bist du völlig umsonst hier.«
Toni grinste Martin an und meinte: »Das heißt noch lange nichts! Auch ein Jäger kann politische Motive haben.«
Martin zeigte zum Gemeindehaus und sagte: »Ich hab die Gemeinderäte vorgeladen. Ich möchte ein bisserl mehr über den Bürgermeister erfahren. Vielleicht ergibt sich ja ein Motiv. Kommst mit?«
»Ja gern«, antwortete Toni und folgte Martin.
Kapitel 4
Vor dem Gemeindehaus hatte sich bereits eine kleine Gruppe Menschen gebildet, die sich unterhielten. »Wos dea ebba vo uns wü? Mia ham eh nix gsechn«, hörte Martin beim Näherkommen.
Unter den Leuten befand sich auch Stiegler, der geschäftig tat: »Oiso Leit! Mia miassn uns wos eifoin lossn! Iatz wo da Anderl dot ist, bin i da Buagamoasta! Es muass weidageh.«
»Grüß Gott, Herr Stiegler! Na? Sind Sie schon am Organisieren?«, fragte Martin leutselig.
»Wia moanans iatz des?«, fragte Stiegler misstrauisch.
»Na ja, ich seh doch, dass Sie Ihre künftige Aufgabe sehr ernst nehmen«, sagte Martin und zeigte auf die Türe. »Wenn Sie mal aufsperren würden?«, fragte er überaus höflich.
Stiegler zog einen Schlüsselbund aus der Tasche und sperrte auf. »Kemmans mit!«, sagte er in befehlsmäßigem Ton.
»Wohin solls denn gehen?«
»In Sitzungssoi natürli. Se woin doch mit uns redn.«
»Ja natürlich. Aber mir wärs lieber, wir könnten in die Amtsstube gehen.«
Stiegler sah Martin mit hochgezogenen Augenbrauen an und fragte ihn: »In die Amtsstubn? Wiaso nacha des?«
»Weil ich mit jedem einzeln reden will.«
»Aha?«, war die kurze Antwort.
Stiegler ging voraus, Martin und Toni folgten ihm bis zu einer Türe. Stiegler sperrte auf und zeigte hinein. »Do warn mer.«
Die anderen Gemeinderäte, die ihnen gefolgt waren, standen hinter Martin und Toni im Flur. Martin drehte sich um und sah sie der Reihe nach an: »Also ich bitte darum, dass alle nacheinander zu mir in die Stube kommen und mir ein paar Fragen beantworten«, sagte er ruhig.
»Wia lang soy des nacha dauern? Mia ham no an Haufn Oabat dahaam!«, rief einer.
»So lang wie es eben dauert«, antwortete Toni für Martin.
Toni und Martin betraten die Amtsstube, hielten dabei aber Stiegler mit einem sanften Druck gegen seine Brust davon ab, ihnen zu folgen. »Ein wenig müssens schon noch warten. Sie können ja einstweilen mit Ihren Kollegen die Reihenfolge absprechen.« Stiegler wollte noch etwas sagen, aber Martin drückte ihm die Türe vor der Nase zu.
Zielgerichtet setzte sich Martin auf den wuchtigen Eichenstuhl, der mit rotem Samt bespannt war. Toni holte sich einen weiteren Stuhl, den er neben Martin stellte, und setzte sich ebenfalls. »Wie gehen wir jetzt vor? Ich hab mein Handy nicht dabei und kann die Befragung deshalb nicht aufnehmen.«
»Schad, dann bleibt wohl nichts anderes übrig, als mitzuschreiben«, antwortete Toni.
Martin stand auf und ging zur Türe. Er öffnete sie und rief hinaus: »Der Erste bitte!«
Stiegler kam herein, und Martin hörte die anderen draußen rufen: »He! Stiegler! Du glaubst woih, wei du iatz da Buagamoasta bist, konnst dia ois erlaum? Mia sand aa no do!«
Martin zeigte auf den Stuhl auf der anderen Seite des wuchtigen Eichentisches: »Setzen Sie sich, Herr Stiegler.« Missmutig und offenbar schlecht gelaunt rückte sich Stiegler den Stuhl zurecht und setzte sich. Martin zog einen Schreibblock, der auf dem Tisch lag, zu sich heran. Er zog einen Kugelschreiber aus der Tasche und schaute Stiegler erwartungsvoll an. »So, Herr Stiegler. Nun brauche ich Ihre persönlichen Daten. Vorname, Name, Ihre Adresse, Geburtsdatum und so weiter.« Stiegler nannte die gewünschten Daten und wartete ab. Martin schrieb mit. »Nun erzählen Sie mal, Herr Stiegler. Was haben Sie gehört und gesehen?«, begann Martin.
»Nix hob i gsechn! Nix ghört und nix gsechn!«
»Gut, Herr Stiegler. Nun möchte ich noch von Ihnen wissen, wie Herr Eisenriegler denn so war. Rein menschlich, verstehen Sie?«
Stiegler wurde zusehends unruhig und rutschte auf dem Stuhl hin und her, ehe er begann: »Ja, wissens, ma soy ja über Dote nit schlecht redn. Aba a Gauner woar ea schon, der Anderl. Dea hot oan untam Bscheissn no amoi bschissn.«
»Wie darf ich das verstehen?«
»Noja, schauns, dea hots doch glatt firte brocht, dass ea am Keandlbauan a Wiesn obkafft hot. Saubillig hot eas kafft. Weis a nosse Wiesn woa. Da Keandlbaua woar frou, dass eas loskhob hot. Wei do is ea oiwei mit seim Buidog steckabliem, vostehst? Ois Fuada hot des Gros aa nit fui daugt, und im Fruahjoar is owei as Wossa drin gstandn. Vom Boch, vostehst?«
»Jaja, ich verstehe«, antwortete Martin und nickte.
»Und wie ist es dann weitergegangen? Sie sagten doch, dass Herr Eisenriegler während des Betrügens die Leute noch einmal betrogen hat. Wie ist das vor sich gegangen?«, fragte Toni nach.
»Noja, ois Buagamoasta hot ea doch gwisst, wenn ebbat a Grundstückl braucht hot. A Firma oda so. Do is ea nacha herganga und hot des Stückl Wiesn teier weidavokafft. Meistns as Vier- oda Fünffache vo dem, wo ea zoiht hot.«
»Das heißt also, er wusste vor dem Kauf, den er getätigt hatte, bereits, dass es einen anderen Interessenten dafür gab?«
»Ja freili. Sunst hätt ea des doch goa nit kafft.«
»Hat er das öfter gemacht?«
»Ja oiwei wieda. Dea hot oan solong eigredt, bis ma frouh woar, dass ma wos vokaffa hot kenna.«
»Ja und haben sich das alle gefallen lassen? Hat da keiner protestiert? Hat da niemand geklagt deswegen?«
»Wos hätt ma denn klong soyn? Vokafft is vokafft! Do gibt’s nix zum klong!«
»Also vom Attentat haben Sie nichts gehört oder gesehen?«, fragte Toni noch einmal nach.
»Naa! Des hob i doch scho gsogg! I hob nix ghört oda gsechn!«
»Wie ist das eigentlich mit Kontakten woandershin? Ins Ausland oder so? Hatt er da welche?«
»Ins Ausland? Naa, nit dass i wüsst.«
»Sonst irgendwo Feinde oder Menschen, die ihm nichts Gutes wollten?«
Stiegler lachte kurz auf und meinte: »Do frongs mi? Freili hot ea de khob! So wia dea de Leit bschissn hot?«
»Wie ist das mit seiner Familie? Frau, Bruder, Schwester, Kinder? Gab es da irgendwelchen Ärger?«





























