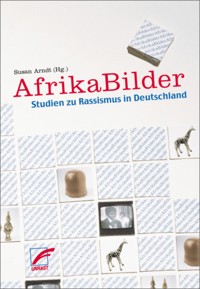
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unrast
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Rechtsextremismus ist nur die Spitze des rassistischen Eisberges, der ohne Rückhalt in der Gesellschaft schmelzen würde. Die bundesdeutsche Gesellschaft ist im rassistischen Diskurs verstrickt. Rassistische Denkmuster und Verhaltensweisen sind ebenso verinnerlicht wie patriarchalische Geschlechterrollen. Dies manifestiert sich besonders deutlich in den dominanten Afrikabildern der bundesdeutschen Gesellschaft, in denen koloniale Perspektiven auf Afrika und Afrikaner/innen bis heute nahezu ungebrochen fortwirken. Politik, Medien, visuelle Kultur, Bildungswesen und Sprache tragen dafür maßgeblich Verantwortung. Der Sammelband bereichert die aktuelle Diskussion über Rechtsextremismus um dieses Thema: Theoretische Erörterungen historischer Hintergründe und aktueller Erscheinungsbilder von Rassismus werden durch Analysen von Afrikabildern in Medien, Filmen, Wissenschaft, Belletristik, Museen und Schulen ergänzt. Politische Akteure und Wissenschaftler/innen geben Einblick in Afrika betreffende Politikansätze. Der Band vereint grundlegende Beiträge für die politische Bildungsarbeit und wendet sich an Schulen, Medien und Wissenschaft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 739
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Susan Arndt (Hg.)AfrikaBilder
Susan Arndt, geb 1967 in Magdeburg; 2 Kinder: 1986 Abitur, 1986 - 1990 Studium der Anglistik und Germanistik an der Humboldt Universität zu Berlin, 1991/92 Studium der Afrikawissenschaften an der Londoner School of Oriental and African Studies, 1992 - 1997 Promotion zur afrikanischen Literatur an der Humboldt-Universität zu Berlin, 1997 - 1998 Fellow am St. Anthony’s College (Oxford University), seit 1998 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Seminar für Afrikawissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin. Publikationen zur Oralliteratur in Nigeria, zur afrikanischen Frauenliteratur und zum afrikanischen Feminismus; Autorin von: African Women’s Literature, Orality and Intertextuality. Igbo Oral Narratives as Nigerian Women Writers’ Models and Objects of Writing Back (Bayreuth 1998). Im UNRAST Verlag erschien von der Autorin: Feminismus im Widerstreit. Afrikanischer Feminismus in Gesellschaft und Literatur (2000). The Dynamics of Feminsm. Defining and Classifying African feminist Literatures. Trenton, N.J. 2001.
Susan Arndt (Hg.)
AfrikaBilder
Studien zu Rassismus in Deutschland
herausgegeben unter der Mitarbeit von
Heiko Thierl und Ralf Walther
UNRAST
Susan Arndt (Hg.) - AfrikaBilderGesamtausgabeebook UNRAST Verlag, März 2012ISBN 978-3-95405-001
© UNRAST Verlag, Münster 2001Postfach 8020, 48043 Münster | Tel. (0251) 66 62 [email protected] | www.unrast-verlag.de
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme vervielfältigt oder verbreitet werden.
Mitglied in der assoziation Linker Verlage (aLiVe)Umschlag: Martin Klindtworth, LeipzigSatz: UNRAST-Verlag, Münster
Inhalt
Vorbemerkung
Susan ArndtImpressionen. Rassismus und der deutsche Afrikadiskurs
I. Menatlitätsgeschichte und Manifestationen von Rassismus und Rechtsextremismus in Deutschland
May AyimDie afro-deutsche Minderheit
Ursula WachendorferWeiß-Sein in Deutschland. Zur Unsichtbarkeit einer herrschenden Normalität
Christoph ButterweggeRassismus und Rechtsextremismus im Zeichen der Globalisierung
Siegfried JägerRassismus und Rechtsextremismus in der deutschen Sprache. Einige Überlegungen zur Berichterstattung über Rassismus und Rechtsextremismus aus diskursanalytischer Sicht
Ralf KochMedien, »Minderheiten« und Rassismus Erfahrungen und Beobachtungen von Journalisten
Bernd WagnerZu rechtsextremen Entwicklungen in den neuen Bundesländern
Patrice G. Poutrus, Jan C. Behrends, Dennis KuckFremd-Sein in der staatsozialistischen Diktatur Zu historischen Ursachen von Fremdenfeindlichkeit und rassistischer Gewalt in den Neuen Bundesländern
Michael MoreitzJudenfeindschaft in der deutschen Geschichte Über den Antisemitismus im deutschen Nationalbewusstsein
II. Rassismus und Afrikabilder in Gesellschaft, Kunst und Wissenschaft
Alain Patrice NganangDer koloniale Sehnsuchtsfilm Vom lieben »Afrikaner« deutscher Filme in der NS-Zeit
Martin BaerVon Heinz Rühmann bis zum Traumschiff Bilder von Afrika im deutschen Film
Peter G. BräunleinVon Peter Moor zu Kariuki. Afrika, Afrikaner und Afrikanerinnen in der deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur
János RieszDie »unterbrochene Lektion« Deutsche Schwierigkeiten im Umgang mit afrikanischer Literatur
Peter RipkenWer hat Angst vor afrikanischer Literatur? Zur Rezeption afrikanischer Literatur in Deutschland
Paola IvanovAneignung. Der museale Blick als Spiegel der europäischen Begegnung mit Afrika
AG gegen »Rassenkunde«Herrschaftsbiologie. Am Beispiel des Instituts für Humanbiologie der Universität Hamburg
III. Afrika im Spiegel bundesdeutscher Politik und NGOs
Gerhard LeoTausende Ausländer/innen in Abschiebehaft Gedanken zu einem Gefängnis besonderer Art in Berlin
Anke ZwinkVom alltäglichen Umgang mit Rassismus Erfahrungen der Gruppe Eltern Schwarzer Kinder
Annelie BuntenbachBlicke auf Asylpolitik und Antidiskriminierungsgesetz – was tun gegen Rechtsextremismus und Rassismus
Barbara John, John Röhe… zwischen den Stühlen. Von der »Mutter der Migrant/innen« zur »Integrationsmanagerin« – Der Spagat der Ausländerbeauftragten
Gerd PoppeMenschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe in Afrika
Cord JakobeitEntwicklungshilfe-Politik in Afrika: Welche Hilfe zu welcher Entwicklung?
Autorinnen und Autoren
Den Opfern rassistischer Gewalt in Deutschland
Vorbemerkung
Im Sommer- und Wintersemester 2000/2001 fanden am Seminar für Afrikawissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin Veranstaltungen statt, die unter andermen auch von der Fachschaft organisiert wurden. Ziel der Vorlesungsreihe war es, der allgemeinen Tendenz, von Rassismus zu reden und Rechtsextremismus in den Neuen Ländern zu meinen, entgegenzuwirken. Rechtsextremismus ist nur die Spitze des rassistischen Eisberges, der ohne Rückhalt in der Gesellschaft schmelzen müsste. Die bundesdeutsche Gesellschaft ist im rassistischen Diskurs verstrickt, der – u.a. durch Politik, Medien, Kultur, Bildungswesen und Sprache – beständig reproduziert wird. Rassistische Denkmuster und Verhaltensweisen sind ebenso verinnerlicht wie patriarchalische Geschlechterrollen. Dies manifestiert sich besonders deutlich in den dominanten Afrikabildern der bundesdeutschen Gesellschaft, in denen koloniale Perspektiven auf Afrika und Afrikaner/innen bis heute nahezu ungebrochen fortwirken.
Die Vorlesungsreihe setzte sich zum Ziel, den rassistisch fundierten Afrikadiskurs nachzuzeichnen, wobei aktuelle Erscheinungen historisch und gesamtgesellschaftlich verortet werden sollten. Uns kam es insbesondere darauf an, tradierte Bilder zu problematisieren, Diskursformen zu analysieren, politische Konzepte zu diskutieren und konkrete politische Handlungsstrategien vorzustellen. Dafür erschien es uns sinnvoll, den Blick auf verschiedene Bereiche der Gesellschaft zu richten und auch unterschiedliche Perspektiven kennen zu lernen. Protagonist/innen des öffentlichen Diskurses (Journalisten, Politiker/innen, Filmemacher) kamen ebenso zu Wort wie Analytiker/innen dieser Metiers. Unsere erklärte Absicht war es, theoretische Überlegungen und praktische Handlungsformen nicht nur zusammen zu besprechen, sondern auch einander näher zu bringen. Dabei lag es von vornherein in unserem Kalkül, nicht nur solche Überlegungen und Konzepte vorzustellen und zu diskutieren, die uns politisch »genehm« waren oder unseren eigenen Überzeugungen entsprechen. Vielmehr wollten wir ganz bewusst auch Positionen von jenen debattieren, die den öffentlichen Diskurs bestimmen und unter anderem auch die aktuelle Politik und Medienkultur entscheidend prägen.
Dies erschien uns auch deswegen sinnvoll zu sein, weil eine Diskussion allein unter Gleichgesinnten keine gesellschaftlichen Veränderungen bewirken kann. Da Rassismus in der bundesdeutschen Gesellschaft fest verwurzelt ist, kann eine Debatte darüber eben auch nur unter Einbeziehung der gesamten Gesellschaft wirksam geführt werden, wobei allerdings extremistischen Positionen kein Forum geboten werden sollte. So wie der Feminismus auch ein Umdenken von Männern bewirken muss, wenn Gleichberechtigung dauerhaft hergestellt werden soll, stellen Nischen keine wirkliche Alternative zu Rassismus dar. Wer etwas verändern will, muss den Elfenbeinturm verlassen und sich mit einem breiten Spektrum von Positionen vertraut machen, um sie hinterfragen zu können. Das Wissen um Innenperspektiven von Protagonist/innen des Diskurses kann dabei von Nutzen sein.
Der vorliegende Band enthält nur eine Auswahl der gehaltenen Vorträge und wurde um andere Texte ergänzt. Übernommen wurde jedoch auch der Ansatz, einige Innenperspektiven von Akteuren zuzulassen, in denen Positionen zum Tragen kommen, die nicht in jedem Fall von Herausgeberin und Verlag geteilt werden.
Im ersten Teil des Buches fragen Theoretiker/innen des Rassismus nach geistesgeschichtlichen Wurzeln, ideologischen Grundfesten und Mechanismen von Rassismus und Rechtsextremismus. Im zweiten Komplex diskutieren Filmemacher/innen und Journalist/innen ebenso wie Film-, Medien-, Literatur, Human- und Museumswissenschaftler/innen Afrikabilder, die in ihren Metiers produziert werden. Sie zeigen, wie Stereotype geschaffen werden und diskutieren deren Verantwortung für den alltäglichen Rassismus. Im dritten Block wird von Politiker/innen und Wissenschaftler/innen die deutsche Außen- und Entwicklungshilfepolitik ebenso beleuchtet wie wichtige innenpolitische Aspekte (Asylgesetzgebung, Abschiebehaft, Einwanderungsgesetz, Antidiskriminierungsgesetz). Auch stellen sich Initiativen vor, die Strategien entwickelt haben, dem Rassismus in einzelnen Bereichen der deutschen Gesellschaft entgegenzuwirken
Werden verinnerlichte Denkmuster in Frage gestellt und Stereotypen reflektiert, können rassistische Einstellungen und Handlungen überwunden werden. Der Sammelband will aus dem Blickwinkel ganz verschiedener Perspektiven zu diesen Reflexionen anregen.
Susan Arndt
Impressionen.Rassismus und der deutsche Afrikadiskurs
Im August 1998 verhandelte die 1. Große Strafkammer des Berliner Landgerichts einen Überfall auf Larry M. aus Ghana: Ein Maurer und ein Transportarbeiter misshandelten den 31jährigen Mann, raubten ihn aus und beschimpften ihn als »Scheiß-Neger«. Obwohl der diskriminierende Charakter des Wortes seit längerem unumstritten ist, fiel er wiederholt in der Gerichtsverhandlung. Dutzende Male gebrauchte ihn allein der Vorsitzende Richter Rainer Pannek. Er fragte die Angeklagten: »Wieso haben Sie den Neger angemacht?« oder: »Haben Sie sich mit dem Neger geprügelt?« Nicht etwa: »Wieso haben Sie Herrn M. angemacht?« Für ihn sei das Wort kein Problem, sagte Richter Pannek zwei anwesenden Journalisten. »Weil ein Schwarzer ein Neger ist.« Außerdem müsse er sich als Richter so verständlich machen, »dass mich die Angeklagten verstehen«. Das Opfer des rassistischen Überfalls hat jedoch mit dieser Bezeichnung ein Problem. »Ich empfinde das als beleidigend«, sagte der Ghanaer. »Aber ich höre es fast jeden Tag. Ich bemühe mich, es zu ignorieren.« Theoretisch hätte die Staatsanwältin die Fragen des Richters beanstanden müssen. Aber sie schwieg. Ebenso wie die beiden Verteidiger.
Auch wenn die Verwendung des rassistischen Wortes in Deutschland strafrechtlich (noch) nicht relevant ist, darf man, laut eines Urteils des Amtsgerichts Schwäbisch Hall, jemanden, der einen Schwarzen als »Neger« bezeichnet, einen Rassisten titulieren.1 In diesem Sinne bewertete auch der Vorsitzende der Berliner Strafverteidigervereinigung die Äußerungen seines Kollegen: »Entsetzlich, ich bin geschockt«, sagte er. »Weil sich für mich damit eine rassistische Grundhaltung verbindet.«
Doch Richter Pannek ist kein Ausnahmebeispiel. Sein Verhalten zeigt exemplarisch, dass Rassismus in der bundesdeutschen Gesellschaft allgegenwärtig, strukturell verankert und tradiert ist. Diese mentale Kontinuität präsentiert sich allerorten, zuweilen wird sie gar wie ein Banner vor sich hergetragen. So auch in jener Wohngegend im ehemaligen Westen Berlins, genauer im nördlichen Wedding, die als »afrikanisches Viertel« bekannt ist.
Es trägt diesen Namen nicht etwa, weil hier besonders viele Afrikaner/innen leben würden. Der Hintergrund für die Bezeichnung enthüllt sich bei einem Blick auf die Straßenschilder. Neben der Vielzahl von europäischen Orten, die deutschen Straßen und Plätzen anderswo ihre Namen geben, wird hier einmal Afrika repräsentiert: um die Afrikanische Straße reihen sich u.a. die Togostraße, Ghanastraße, Kongostraße, Kameruner Straße, Dualastraße, Sansibarstraße, Mohasistraße, Tangastraße, Windhuker Straße, Swakopmunder Straße, Damarastraße und Sambesistraße. Es drängt sich freilich die Frage auf, warum sich die hier repräsentierten Orte vorrangig in den ehemaligen deutschen Kolonien befinden oder es dort zumindest einmal – wie im Fall der Festung Großfriedrichsburg (17./18. Jahrhundert) im heutigen Ghana – deutsche Standorte gab. Man kann sich kaum des Gefühls erwehren, dass hier nicht Afrika, sondern das ehemalige deutsche Kolonialreich (1884-1914/15), dass sich vor allem auf den Gebieten des heutigen Togo, Kamerun, Namibia und Tansania erstreckte, repräsentiert wird. Wer hier noch hofft, dass im »Afrikanischen Viertel« die deutsche Kolonialschuld, die Verbrechen der deutschen Kolonialherrschaft zur Sprache gebracht werden, der oder die wird wenige Schritte später desillusioniert. Hier trifft man auf die Petersallee, die Lüderitzstraße und den Nachtigallplatz. Einige Kilometer entfernt befinden sich die Woermannkehre und zwei Wissmannstraßen.
Diese Straßen wurden nach den »Pionieren« des deutschen Kolonialismus benannt, nach Rassisten, nach ehrgeizigen, gewissenlosen Abenteurern, Karrieristen und Kaufleuten, die mit äußerster Brutalität und unter massiven Menschenrechtsverletzungen die Kolonisierung Afrikas beförderten. Vor allem Carl Peters hat sich als militanter Propagandist der Kolonialidee hervorgetan. Er schürte eine koloniale Sehnsucht, die Kaiser Wilhelm I. in den markanten Ruf nach dem »Platz an der Sonne« presste. Ein »Platz an der Sonne« sollte es für die Deutschen sein, für Hunderttausende Afrikaner und Afrikanerinnen wurde es ein Platz in der Weißen Hölle.
Als Vorreiter der kolonialen Idee schlossen Peters, Adolf Lüderitz, Gustav Nachtigal und Adolf Woermann mit oder ohne Reichsauftrag so genannte »Schutzverträge mit Deutschland« in Südwestafrika, Togo, Kamerun und Ostafrika ab. Später waren sie Führungspersönlichkeiten der Kolonialmacht und der so genannten »Schutztruppen«, die – um das Vokabular des Brockhaus‹ zu bemühen – »Aufstände« der einheimischen Bevölkerungen »niederschlugen«.2 Sie stehen für eine Politik, die auf Passmarken, »Rassen«gesetzen, Prügelstrafen, Vergewaltigungen, Vertreibungen und Völkermorden aufbaute. Peters kolonialer Ehrgeiz wurde beispielsweise damit belohnt, dass er »kaiserlicher Kommissar« für das Kilimandscharo-Gebiet wurde. Aus persönlichen Motiven ließ er 1891 eine Afrikanerin und einen Afrikaner hinrichten. Dabei handelte es sich um Jagodjo – eine Frau, die Peters zu seiner »persönlichen Verfügung« (was Vergewaltigung selbstverständlich einschloss) bereit stehen musste – und Mabruk, zu dem sie sich emotional hingezogen fühlte.3 Peters wurde darauf hin aus dem Reichsdienst entlassen.4 Nicht etwa, dass die Berliner an Peters menschenverachtendem Umgang mit Afrikaner/innen Anstoß nahmen; als Affront empfanden sie sein Verhalten, weil es ihre Machthoheit ignorierte. An den Menschenrechtsverletzungen der Kolonialbeamten an Afrikaner/innen haben sie sich nie gestört, diese haben sie vielmehr im Gegenteil politisch zu verantworten. Exemplarisch zeigen dies die Völkermorde zu Beginn des 20. Jahrhunderts, mit denen Deutschland auf den Widerstand von Afrikanern und Afrikanerinnen gegen die Errichtung und blutige Praxis der deutschen Kolonialmacht reagierte.
Aus Protest gegen die massiven Menschenrechtsverletzungen in Südwestafrika sowie gegen die soziale und politische Diskriminierung der Afrikaner/innen durch den deutschen Staat entbrannte im Januar 1904 ein Befreiungskrieg der Herero, dem sich einige Monate später auch die Nama anschlossen. Als General Lothar von Trotha, der durch seine Teilnahme an den mörderischen Feldzügen gegen die Hehe und die Chinesen bereits »bestens ausgewiesen« war, kurz nach Ausbruch der Unruhen das Kommando übernahm, richtete er eine Proklamation an »das Volk der Herero«, in der es heißt:
»Ich, der große General der deutschen Soldaten, sende diesen Brief an das Volk der Herero. Herero sind nicht mehr deutsche Untertanen … Das Volk der Herero muß jetzt das Land verlassen. Wenn das Volk dies nicht tut, so werde ich mit dem großen Rohr es dazu zwingen. Innerhalb der deutschen Grenze wird jeder Herero, mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh, erschossen.«5
In knapp 20 Jahren brachten die Deutschen auf der Grundlage dieses Völkermordbefehls zwischen 75 und 80 Prozent der Herero um – die anderen wurden von ihrem Land vertrieben, das als »deutsches Land« deklariert wurde. Ähnlich erging es den Nama, von denen nur knapp die Hälfte die deutsche Aggression überlebte. Nahezu weitere 100.000 Tote forderten der Maji-Maji Aufstand und der Hehe-Krieg in Deutsch-Ostafrika.
Im Zuge des Ersten Weltkrieges verlor Deutschland seine Kolonien, nicht aber seine Sehnsucht nach ihnen. In der zweiten Hälfte der 1930er Jahre nahm sie wieder konkrete politische Gestalt an. Neben der Wiederbelebung der »kolonialen Frage« griff der Nationalsozialismus u.a. auch auf die Mentalität (Rassismus)6 und Methoden (Passmarken, »Rassengesetze« und Völkermorde) des deutschen Kolonialismus und Rassismus zurück,7 wobei er diese technisch allerdings derart perfide »perfektionierte«, dass an der Singularität des Holocaust kein Zweifel bestehen kann. In logischer Konsequenz der Kontinuität von Kolonialismus und Nationalsozialismus stilisierten die Nationalsozialisten die Pioniere des deutschen Kolonialismus zu Nationalhelden. Insbesondere in Carl Peters sahen sie das national-heroische Vorbild eines Herrenmenschen. So wurde u.a. 1940 ein Film namens »Carl Peters« mit dem Kinostar Hans Albers in der Titelrolle gedreht, in dem Peters als aufrechter, gerechter Kolonialisator erscheint. Obwohl der Film militant nach einem deutschen Kolonialreich verlangt und zudem noch antisemitisch und antibritisch ist, wurde er noch 1980 im Sender Freies Berlin (SFB), einer ARD-Anstalt, ausgestrahlt. Mittlerweile ist es verboten, mehr als zehn Minuten dieses Machwerks öffentlich zu zeigen.
Das Berliner »Afrikanische Viertel« symbolisiert exemplarisch, dass es aber offenbar nicht verboten ist, Peters und seine kolonialen Mitstreiter, sprich notorische Verbrecher, Rassisten und Volksverhetzer zu ehren. Auch in anderen bundesdeutschen Städten tragen Straßen und Plätze die Namen dieser Kolonialisten. Insbesondere an Carl Peters wird gern erinnert. Wie unverantwortlich deutsche Politiker/innen mit solchen Zeichen umgehen, zeigt sich exemplarisch an der gescheiterten Umbenennungsinitiative der Bremer Lüderitzstraße: CDU und FDP stimmten dagegen, die SPD enthielt sich und nur die Grünen stimmten dafür. Ein anderes Beispiel für die Weigerung, politische Zeichen zu setzen, ist der von der CDU/FDP-Mehrheit vereitelte Versuch des Münsteraner Arbeitskreises Afrika (AKAFRIK) und der GAL, anlässlich des 100. Jahrestages des Beginns der deutschen Kolonial-expansion am 24. April 1884 eine Mahntafel neben dem Train-Denkmal, an dem sich Kolonialkrieger-Gedenktafeln befinden, anzubringen. Obwohl die GAL mittlerweile selbst an der Regierung beteiligt war, ist weder die Mahntafel angebracht worden, noch wurden die Sockelpodeste mit den Gedenktafeln abmontiert. Auch in anderen bundesdeutschen Orten finden sich Kolonialdenkmale.8 Eines davon ist das Bad Lauterberger Denkmal für Herrmann von Wißmann, das zahlreichen Postkarten als Motiv dient und zusammen mit der Hauptdurchgangsstraße namens Wissmann und dem »Wissmann-Haus« ein kolonialrevanchistisches Ambiente bildet – eine Konstellation, die den Traditionsverband ehemaliger Schutz- und Überseetruppen/Freunde der früheren deutschen Schutzgebiete (TSÜ) Bad Lauterberg als Standort ihrer Jahreshauptversammlungen wählen lässt.9
An Orten wie diesen werden Protagonisten des deutschen Kolonialismus geehrt, als wüsste man nicht, dass der Kolonialismus ohne Rassismus nicht denkbar gewesen wäre, der in direkter Linie zu Nationalsozialismus, Holocaust und rechtsextremistischer Gewalt in der Bundesrepublik Deutschland führt. Die Ehrung von Personen wie Lüderitz, Nachtigall, Woermann, Wissmann und Peters ist nicht einfach nur politische Naivität, die in der Bundesrepublik gern entschuldigt wird. Sie bedeutet eine Verhöhnung der Millionen Opfer des Kolonialismus – letztlich eine Verhöhnung aller Opfer jeglicher Willkürherrschaft und Diktaturen.
Man stelle sich vor, andere Straßen wären nach Staatsverbrechern, nach Verbrechern, die im Auftrage einer Staatsidee handelten, benannt. Oder man würde diese Personen und ihre Taten mit Denkmälern ehren. Undenkbar. Und zu Recht! Aber hier handelt es sich ja »nur« um Repräsentanten des deutschen Kolonialismus. Der deutsche Kolonialismus ist ebenso aus dem historischen und öffentlichen Bewusstsein getilgt worden wie überhaupt die afrikanische Geschichte und die Gegenwart Afrikas, dem größten Kontinent der Erde, dem in der deutschen Öffentlichkeit in etwa jene Bedeutung zukommt, mit der in den USA die harten Kämpfe um die Skatmeisterschaft in Schweinfurt, Trinwillershagen, Peine oder einer anderen deutschen Stadt zur Kenntnis genommen werden. Es fehlt in Deutschland nicht nur am öffentlichen Interesse für die Kolonialgeschichte, zugleich wird diese auch verherrlicht und verharmlost.
Viele verstecken sich auch, wie der ehemalige Münsteraner Oberbürgermeister Pierchalla (CDU), hinter der Auffassung, dass diese Straßennamen und Denkmäler »selbst historische Zeugnisse aus vergangener Zeit sind«, die sich »unverändert dem Urteil der Geschichte stellen« sollen.10 Hier stellt sich die Frage, warum dieses Kapitel deutscher Geschichte, von dem hier die Rede ist, unbedingt unkritisch dokumentiert werden sollte. Zumindest würde diese Art von Erinnerungspolitik eine Aufarbeitung der kolonialien Vergangenheit voraussetzen. Dies jedoch ist in Deutschland nie geschehen. Dies zeigt sich u.a. auch in der Weigerung, Entschädigungszahlungen für die Opfer des deutschen Kolonialismus zu leisten, politisch eindeutige Gesten der Entschuldigung zu zeigen und dieses Kapitel deutscher und europäischer Geschichte historisch aufzuarbeiten – eine Forderung, die von afrikanischen Intellektuellen immer wieder erhoben wird, wie etwa jüngst von dem nigerianischen Schriftsteller, Dramatiker und Nobelpreisträger Wole Soyinka.11
In einem Land, in dem jede offensive Erinnerungspolitik und Auseinandersetzung mit kolonialer Schuld fehlt und weite Teile der deutschen Bevölkerung gar nicht wissen, dass Deutschland Kolonien in Afrika hatte, ist es fatal zu glauben, Straßennamen und Denkmäler könnten von sich aus ihre politische Stoßrichtung ins Gegenteil verkehren. Dokumentationen können hier schnell zu Reproduktionen gerieren. Tatsächlich spricht für das Festhalten an kolonialen Straßennamen und Denkmalen, dass man dieses Kapitel deutscher Geschichte nicht einfach ausradiert, sondern dokumentiert. Doch wo man eine bewusste politische Entscheidung für diesen Schritt fällt, kann man auf das Anbringen von Tafeln nicht verzichten, die über die koloniale Vergangenheit aufklären und eine unmissverständliche Distanzierung von den hier repräsentierten Personen und Ereignissen beinhalten. Nun muss diese Praxis freilich nicht allerorten angewendet werden. Es spricht zumindest ebenso viel dafür, eine öffentliche Auseinandersetzung über die koloniale Vergangenheit zu führen und vor diesem Hintergrund Straßen umzubenennen und Denkmale zu demontieren. Hannover setzte diesbezüblich einen wichtigen Akzent, als die Stadt kurz nach der ideologischen Umfunktionierung des Peters-Denkmals auch den Standort des Denkmals, den Karl-Peters-Platz, umbenannte.
Bei Umbenennungsinitiativen ist es aus meiner Sicht immer wichtig, die Straßen nicht beliebig umzubenennen, sondern nach Opfern von Kolonialismus und Rassismus, von denen es leider viele Millionen gibt. Sie alle haben einen Namen. Wird er genannt, erhält das durch Deutsche verursachte anonyme Leiden von Afrikaner/innen ein Gesicht. Eine antirassistische NGO hat sich etwa nach dem Angolaner benannt, der am 24. November 1990 das erste Opfer rechtsextremer Gewalt im wiedervereinigten Deutschland wurde: die Amadeu-Antonio-Stiftung. Warum tun sich offizielle Stellen so schwer damit, Vergleichbares zu tun?
Eine Straße aber gibt es in Berlin, die nach Afrikanern, die ein Stück deutscher – genauer: preußischer – Kolonialpolitik repräsentieren, benannt wurde. Diese Straße wurde nach den Afrikanern benannt, die vom preußischen König Friedrich Wilhelm I. in dieser Straße einquartiert und den preußischen Regimentern als Militärmusiker zugeteilt wurden. Vermutlich handelt es sich dabei um jene 12 Afrikaner, die Friedrich Wilhelm I. erhielt, als er 1721 alle preußischen Überseebesitzungen an die Niederländisch-Westindische Kompanie verkaufte und zusätzlich zur Kaufsumme 12 Afrikaner verlangte, »von denen sechs mit goldenen Ketten geschmückt sein sollten«12. Die Afrikaner, die der Mohrenstraße ihren Namen gaben, waren also nicht freiwillig nach Berlin gekommen, sondern »Gegenstände« eines europäischen Kaufvertrages. Obgleich die Straße also nach Zwangsarbeitern benannt wurde, trägt sie nicht das Potential in sich, ein Ort des Gedenkens zu sein, sondern ist eher ein Manifest der fehlenden Erinnerungs- und Aufarbeitungsarbeit. Denn sie trägt nicht den Namen eines dieser Afrikaner, sondern heißt nach der damals üblichen Kollektivbezeichnung für Schwarze, die im Kontext von Sklaverei und dem sich formierenden Rassismus entstand und welche folgerichtig eine klar rassistische Konnotation beinhaltet: »Mohrenstraße«.
Kaum jemand stört sich an dieser Bezeichnung. Vielen ist die Etymologie des Straßennamens ebenso unbekannt wie die Tatsache, dass »Mohr« eine abwertende Bezeichnung ist; andere sehen in dem Namen ein historisches Dokument und stehen aus diesem Grund einer möglichen Umbenennung ablehnend gegenüber. Doch wieder muss man sich fragen: warum ist eine unkommentierte Dokumentation dieses Kapitels deutscher Geschichte einem politisch-symbolischen Bruch mit ihm vorzuziehen? Warum muss diese Straße eine Bezeichnung tragen, mit der vor allem eines assoziiert und transportiert wird: das Bild des demütigen Dieners aus Afrika. Ob als Logo der »Mohren«apotheken, als Holzfigur des »stummen Dieners« oder als verkaufsträchtiges Symbol in der Süßwarenproduktion, der allgegenwärtige »Mohr« tritt in demutsvoller und dienender Pose auf. Und hier schließt sich der Sarkasmus, der diesem Straßennamen inne wohnt: Benannt nach Dienern, reproduziert der Straßenname »Mohrenstraße«13 heute bei allen Vorbeieilenden und Verweilenden das im Kolonialismus geborene Stereotyp eines willfährigen Afrikas, das Weißen stets zu Diensten ist, ja, sein will.
Am Beispiel des hier reproduzierten Stereotyps von Afrika zeigt sich die enge Vernetzung von Kolonialismus, Rassismus und Afrikabildern und dass diese nur vor dem Hintergrund des kolonialen und rassistischen Diskurses zu verstehen sind. Deswegen ist es unerlässlich, in einem Buch über Afrikabilder in der Bundesrepublik Deutschland der Auseinandersetzung mit Rassismus Platz einzuräumen. Dies erklärt das Anliegen des ersten Blockes dieses Buches, in dem die Autorinnen und Autoren die Theoreme, Ideologeme und Metiers des Rassismus und Rechtsextremismus beleuchten.
I. Rassismus in Gesellschaft und Sprache
Ein Freund von mir klagte nach einer Nigeria-Reise darüber, dass er dort Rassismus ausgesetzt gewesen sei; er meinte damit, dass man ihn oft angestarrt und ihm onye oche [Igbo: weißer Mensch] hinterher gerufen habe. Auf dem Markt in Onitsha sei es ihm dann gar passiert, dass ihn Hunderte für einen berühmten italienischen Fußballspieler hielten und »Baggio, Baggio« gerufen und um Autogramme gebeten haben – »bloß weil er auch einen Zopf hat wie ich«. »Für die«, so lautete der Schluss des Afrikareisenden, »sehen alle Europäer gleich aus«. Diese Erfahrung war ohne Frage unangenehm. Da sie aber nicht im Kontext einer systematischen strukturellen und individuellen Ausgrenzung und Diskriminierung steht, war es auch kein Rassismus. Die Frage ist sogar, ob es sich überhaupt um Diskriminierung handelte.
Rassismus bezeichnet Einstellungen (Gefühle, Vorurteile, Vorstellungen) und Handlungen, die darauf beruhen, dass aus einer Vielzahl von körperlichen Merkmalen einige wenige selektiert und unzulässig zu »Rassenmerkmalen« gebündelt werden. Auf diese Weise werden »Rassen« konstruiert, wobei den körperlichen Merkmalen bestimmte soziale, kulturelle und religiöse Eigenschaften und Verhaltensmuster zugeschrieben werden. Dabei kann sich die Konstruktion auch gänzlich von einer Instrumentalisierung der Biologie lösen. Nach Albert Memmi werden die imaginären oder real existierenden Unterschiede verallgemeinert, verabsolutiert und gewertet. Dies dient der Begründung unterschiedlicher Macht- und Lebenschancen einzelner Menschen oder ganzer Gruppen. Aggressionen und Privilegien – tatsächliche wie mögliche – werden legitimiert.14
Die Formierung des Rassismus wird allgemein in der Aufklärung verortet, als man einer Rechtfertigungsideologie für die europäischen und nordamerikanischen Eroberungen, Menschenrechtsverletzungen und Diskriminierungen in Übersee bedurfte, die im Widerspruch zu dem offiziell proklamierten Ideal von der Gleichheit aller Menschen standen. Diese Rechtfertigungsideologie fand man in der Erfindung menschlicher »Rassen« und der Entwicklung von »Rassentheorien«, die einen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit erhoben, sich mentalitätsgeschichtlich an den Antijudaismus und Antisemitismus anlehnten und sich durch alle deutschen Gesellschaften zog.15 Ohne jemals an Gefährlichkeit einzubüßen, hat sich der Rassismus dem Gesicht ganz unterschiedlicher Gesellschaften angepasst.
Erstmalig wurde der für die Klassifizierung von Tieren und Pflanzen übliche Begriff von François Bernier 1684 auf die Menschheit übertragen, und schon bald ging die Klassifizierung von Menschen mit Verallgemeinerungen, Verabsolutierungen, Wertungen und Hierarchisierungen einher. Der Arzt Carl von Linné ordnete den »Rassen« moralische Werte zu – positive den Weißen, negative den Schwarzen. David Hume sprach davon, dass Schwarze den Weißen von Natur aus unterlegen und ohne Zivilisation seien – eine Auffassung, die von Voltaire und Rousseau geteilt wurde, wobei Voltaire auch offen antisemitische Argumente vertrat.
Nach Deutschland kam der Begriff »Rasse« durch Immanuel Kant. Die rassistische Hierarchisierung der »Rassen« nahm in Deutschland ihren Anfang mit dem Anthropologen Johann Friedrich Blumenbach (1775) und dem Philosophen Christoph Meiners (1785). Ihre Theorien wurden von Arthur de Gobineau, der in Deutschland den stärksten Widerhall erlebte, 1853 zugespitzt. Er sprach davon, dass sich die »höheren Rassen« der »niederen« erwehren müssten und bereitete damit den Weg für »Rassenkriege« und »Rassenhygiene«.
Biolog/innen und Genetiker/innen haben mittlerweile nachgewiesen, dass die für Tiere wissenschaftlich begründbare Klassifizierung in »Rassen« auf Menschen nicht übertragbar ist.16 Doch diese wissenschaftliche Erkenntnis hat die Omnipräsenz des Rassismus bislang nicht erschüttert. Zum einen halten viele unbeirrt an der Überzeugung fest, es gäbe »Rassen« im biologischen Sinne. Selbst in deutschen Schulbüchern und an deutschen Universitäten wird von »Rassen« gesprochen und werden »Merkmale von Rassen« gelehrt.
Zum anderen realisiert sich Rassismus heute auch unabhängig von einer wertenden Konstruktion körperlicher Unterschiede. Der biologische Unterschied, der immer nur ein Mittel zum Zweck war, ist in den Hintergrund getreten bzw. gänzlich als Grundlage des Rassismus verschwunden. Seit den 1970er Jahren zeigt sich Rassismus zunehmend in der Konstruktion angeblich »naturbedingter« und als unvereinbar proklamierter Unterschiede zwischen Kulturen, die an bestimmten Symbolen wie z.B. dem Kopftuch festgemacht werden.
Rassistische Hierarchien werden immer durch verschiedenste gesellschaftliche Differenzen bestimmt, die wiederum miteinander verknüpft sind: Geschlechterdifferenz, soziale Differenzen etc. Dies bringt mit sich, dass Manifestationen des Rassismus oft mit anderen Formen von Diskriminierung vernetzt sind. Dass rassistische Hierarchien beispielsweise mit Hilfe der Geschlechterdifferenz konstruiert und aufrechterhalten werden, hat zur Folge, dass Frauen oftmals andere konkrete Formen des Rassismus erfahren als Männer. Ein Beispiel dafür ist die Reduzierung von Afrikanerinnen auf Sexualobjekte; auf die Zuschreibung »sexuelle Verfügbarkeit«. Diese Konstruktion ist tradiert und nicht zu verstehen ohne die Geschichte von Sklaverei und Kolonialismus, als Männer wie Carl Peters es als ihr »Recht« ansahen, Afrikanerinnen zu vergewaltigen. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts, als schon ein Blick auf das Knie einer Weißen Frau als unanständig galt, erwachte die so genannte Ethnopornographie: Fotos von afrikanischen Frauen in aufreizenden Posen fanden Verbreitung. »Durch diese Art der Fotografie wurde ein Aspekt des Lebens der Afrikanerin – hier die nackten Brüste der Frau – isoliert dargestellt und durch die für uns eindeutige (gestellte) Pose sexualisiert.«17 Ein anderes Beispiel ist die vor allem in den prüden 1950er Jahren boomende Präsentation nackter Afrikanerinnen. Während die Deutschen aufschrieen, weil Hildegard Knef nackt auf der Leinwand zu sehen war, standen barbusige Gipsafrikanerinnen als Aschenbecher oder Erdnussschale auf Fernsehern in den sonst so spießig-prüden deutschen Wohnzimmern. Unter dem Mantel angeblicher »Realität« wird hier eine voyeuristische Sehnsucht nach Nacktheit befriedigt.
Doch der Rassismus äußert sich nicht allein in der Sexualisierung der Afrikanerin. Auch weil die Nacktheit Schwarzer Frauen anders rezipiert wird als die Weißer Frauen und Weiße und Schwarze mit zweierlei Maß gemessen werden, handelt es sich um Rassismus. Wenn Weiße Frauenkörper tabu sind, Schwarze aber nicht, verbirgt sich dahinter die rassistische Position, Afrikanerinnen seien nicht ebenbürtig – eine Meinung, die heute bei rechtsextremen Mördern wieder auftaucht, die meinen, sie hätten keinen Mord begangen, weil sie ja keinen Menschen erschlagen hätten.
Während Afrikanerinnen in der öffentlichen Wahrnehmung bis heute als willfährige Sexualobjekte wahrgenommen werden, reicht die Konstruktion des Afrikaners von kindlich/asexuell/harmlos (z.B. der »noble Wilde«) bis hin zu männlich/sexuell/bedrohlich. Ein wichtiges Glied in dieser Kette ist seine »unerschöpfliche Potenz« und »die Größe seines Penis«. Frantz Fanon schreibt dazu:
»Die durchschnittliche Länge des Penis des Schwarzen18, sagt Dr. Palès, übersteigt selten hundertzwanzig Millimeter. In seinem Traité d’anatomié humaine nennt Testut dieselbe Zahl für den Europäer. Aber dies sind Fakten, die niemanden überzeugen. Für den Weißen ist der Schwarze ein Tier; wenn nicht die Länge seines Penis, dann ist es die sexuelle Potenz, die ihn bestürzt. Und gegen diesen ›Unterschied zu ihm‹ muß er sich zur Wehr setzen. Das heißt, den Anderen charakterisieren. Der andere wird zum Träger seiner Gedanken und Wünsche.«19
Der Mythos, wonach der Afrikaner eine – gemessen an den Weißen – überdurchschnittliche Potenz und Penisgröße habe, wurde mehr als einmal in der Geschichte dazu verwendet, den Schwarzen Mann als gefährlich zu charakterisieren und auszugrenzen. So bot er den Boden für die Hysterie, die zu Kolonialzeiten wie nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg geschürt wurde, wonach sich Weiße Frauen vor dem Schwarzen Mann hüten müssten, weil er einzig von dem Gedanken beseelt sei, sie zu vergewaltigen. Fanon polemisierte: »[W]er Vergewaltigung sagt, sagt Schwarzer.«20 Doch er bietet auch eine Erklärung für diesen Mythos: In freier Anlehnung an Freud unterstellt Fanon, der als Psychiater während des Algerischen Befreiungskrieges Weiße und Schwarze, Folterer und Gefolterte, behandelte, dem Weißen Mann »Penisneid«.
Tatsächlich ist die Angst des Weißen Mannes, den Schwarzen Mann als Konkurrenten dulden zu müssen, das ideologische Herzstück dieser Hysterie. Dabei geht es aber nur bedingt um den Schwarzen als potentiellen Nebenbuhler. Die Weiße Frau, ihr Körper, wird für Weiße Männer zu einem politischen Raum, den sie glauben, verteidigen zu müssen. Analog dazu zeigt Fanon, das Schwarze, die die rassistische Mentalität verinnerlicht und gegen sich gerichtet haben, sich über Weiße Frauen aufzuwerten versuchen. Bei aller Zustimmung zu diesem Analyseansatz muss Fanon aus feministischer Perspektive jedoch vorgeworfen werden, dass Weiße wie auch Schwarze Frauen in seinen Analysen einzig und allein als Terrain fungieren, »auf dem Männer sich bewegen und ihre Kämpfe austragen.«21 Es ist allerdings nicht als feministischer Ansatz oder Emanzipation von diesem Denken zu interpretieren, wie gelegentlich gemutmaßt wird, dass Leni Riefenstahl ihre Kamera immer wieder auf einen Penis eines Nuba richtet, der mit Weißen Streifen bemalt oder gänzlich mit weißer Asche bedeckt ist. Vielmehr bewegt auch sie sich mitten im rassistischen Diskurs und reproduziert den Mythos vom »potenten Afrikaner«, dem sie zudem exotisierend eine Einheit mit der Natur zuschreibt.
Jüngstes Beispiel für diesen Mythos ist die Kinowerbung zu Langenscheidts Wörterbüchern: Hier sind zwei nackte Männer – ein Weißer und ein Schwarzer – zu sehen. Der Weiße sucht verschämt nach einer Möglichkeit, seinen Penis zu verbergen. Plötzlich erblickt er, und mit ihm das Publikum, einen nackten Schwarzen, der sich selbstbewusst mit einem Wörterbuch vor zudringlichen Blicken schützt. Darauf erklingt eine Stimme, die meint: »Langenscheidts Wörterbücher – in allen Größen«: Nun ist zu sehen, wie der Weiße ein Taschenwörterbuch vor seinen Penis hält, das zugleich das Wörterbuch des im Hintergrund stehenden Schwarzen als »riesig« erscheinen lässt.
Verschiedene Autor/innen haben immer wieder ausgeführt, dass die Gleichsetzung von Rassismus mit »Fremdenhass« oder »Ausländerfeindlichkeit« irreführend ist:23 »Fremde« oder »Ausländer« sind nicht unweigerlich rassistischen Übergriffen ausgesetzt. Dafür sehen sich Schwarze Deutsche alltäglich mit Rassismus konfrontiert. Rassismus nur mit Feindlichkeit oder Hass zu verbinden, bagatellisiert zudem die Gefährlichkeit des verklärenden Rassismus, der beispielsweise Afrikaner/innen pauschal unterstellt, sie könnten gut tanzen und trommeln.
Rechtsextremismus ist nur die Spitze des rassistischen Eisberges, die ohne Rückhalt in der Gesellschaft schmelzen müsste. Deswegen ist es gefährlich, wenn die deutsche Politik und Gesellschaft Rassismus sagt und allein rechtsextremistische Jugendliche in den Neuen Bundesländern meint.
Siegfried Jäger hat nachgewiesen, dass breite Teile der Bevölkerung im rassistischen Diskurs verstrickt sind, der – u.a. durch Politik, Medien, Kultur, Bildungswesen und Sprache – beständig reproduziert wird.24 Dabei geht es nicht um individuelle Schuldzuweisungen, sondern darum, eine Gesellschaft zu dekonstruieren. Wenn alle Deutschen im rassistischen Diskurs verstrickt sind, bedeutet das nicht, dass alle Deutschen erklärte Rassist/innen sind. Während es zum einen Rassist/innen sowie gewollte und bewusste rassistische Handlungen gibt, betrifft Weiße zum anderen auch ein internalisierter und oftmals nicht intendierter Rassismus, der aber weder entschuldbar noch harmlos ist, sondern rassistisch und gefährlich bleibt. Auch erklärte Anti-Rassist/innen sind davon keineswegs ausgenommen. Vielmehr ist gerade die Ansicht jener, die sich für Links halten und deswegen oft genug der Meinung sind, sie seien alles andere als rassistisch, weil sie »ja Schwarze mögen würden«, »mit einem Afrikaner oder einer Afrikanerin verheiratet seien«, »gern nach Afrika reisten«, »afrikanische Trommelklänge liebten« oder »Afrikawissenschaften studierten« mit höchster Vorsicht zu genießen. Wer seit frühester Kindheit mit rassistischen Bildern konfrontiert wird – meist ohne sie als solche wahrzunehmen –, muss schon sehr ausdauernd gegen den Strom schwimmen können und dann am Ende auch noch das Kunststück vollbringen, sich am eigenen Haarschopf aus dem Wasser ziehen, um von sich behaupten zu können, sich vom rasistischen Diskurs emanipiert zu haben. Rassismus ist an gesellschaftliche Gegebenheiten geknüpft, die sehr widerstandsfähig und resistent, vielleicht sogar irreparabel sind. Kein individuelles Problem, ist er auch nicht individuell bewältigbar. Dies zu (anzu)erkennen ist ein wichtiger Schritt im Kampf gegen Rassismus.
Dazu gehört auch, sich bewusst zu machen, dass durch die Omnipräsenz des Rassismus in Vergangenheit und Gegenwart sozialpolitische Identitäten gewachsen sind – dass das Herzstück des Rassismus die Konstruktion und Hierarchisierung von »Schwarzen« und »Weißen« ist. In der vom Rassismus geprägten Sozialisation wurden diese Konstrukte vermittelt und globalen Macht- und Herrschaftsverhältnissen zugrunde gelegt. Eine Realität soziopolitischer Identitäten wurde geschaffen. Wir werden nicht als Schwarze oder Weiße geboren, sondern zu diesen gemacht. Dies macht es erforderlich, Schwarze und Weiße Erfahrungen und Perspektiven wahrzunehmen und zu repräsentieren. Wo dies ignoriert wird, kann Rassismus nicht überwunden werden.
Deswegen ist es trotz der Erkenntnis, dass es keine »Menschenrassen« gibt, im emanzipatorisch politischen Sinne fatal, Schwarze nicht in ihrem Schwarz-Sein und Weiße nicht in ihrem Weiß-Sein wahrzunehmen. Ebenso fatal ist es wiederum, Schwarze beständig nur über ihr Schwarz-Sein wahrzunehmen. Oberflächlich betrachtet ein Widerspruch, der im Rahmen eines emanzipatorischen Lernprozesses ausgehalten werden muss. Damit soll nicht suggeriert werden, dass es die, oder nur eine, Schwarze Identität gäbe. In der Selbstdarstellungsbroschüre der Initiative Schwarzer Deutscher heißt es dazu:
»Mit Begriffen wie ›Schwarze Deutsche‹ und ›Afro-Deutsche‹ als Ausdruck unserer ›multikulturellen‹ Herkunft bestimmen wir uns selbst, statt bestimmt zu werden … Natürlich sind wir auch sehr verschieden, durch unsere Sozialisation, unsere Charaktere, unser Alter, unsere Interessen, durch unsere Erfahrungen in Familie und Beruf, als hetero- und homosexuelle Frauen und Männer und in unseren Bezügen zum außereuropäischen Teil unserer Herkunft.«
Analog dazu ist es wichtig, dass Weiße lernen, sich mit dem eigenen Weiß-Sein auseinander zu setzen: »Weiß-Sein« ist eine Grundlage dafür, dass Menschen, die nicht der durch Weiße westliche Gesellschaften gesetzten körperlichen Norm (z.B. Hautfarbe) und/oder kulturellen Norm entsprechen, diskriminiert werden. Will man dem Rassismus entgegentreten, so genügt es nicht, Schwarzen zu versichern, dass »wir ja alle gleich« seien. Der Rassismus hat eine Realität der Ungleichheit geschaffen. Jeder Versuch eines oder einer Weißen, Rassismus zu begegnen, muss daher mit einer offensiven Auseinandersetzung mit dem eigenen »Weiß-Sein« und den daran geknüpften Privilegien und rassistischen Grundmustern beginnen. Wie die Psychologin Ursula Wachendorfer zeigt, fassen Weiße Weiß-Sein gemeinhin als Normalität auf. Das hat zur Folge, dass sie die damit verbundenen Privilegien und Vorteile nicht reflektieren. Kaum ein Weißer und kaum eine Weiße macht sich bewusst, dass sie im deutschen Alltag den Schutz der Anonymität genießen, dass ihnen der allgegenwärtige Druck feindseliger oder auch nur »neugieriger« Blicke erspart bleibt, dass sie das Privileg haben, ohne Angst vor rassistischen Gewalttätern das Haus zu verlassen, und letztlich auch bei der Wohnungs- und Arbeitssuche privilegiert sind und nicht über ihr »Weiß-Sein« nachdenken müssen. Wenn Weiße sich beschreiben, nennen sie Dinge wie Beruf, Alter, Geschlecht – aber fast nie ihr Weiß-Sein. Dieses wird von Weißen gemeinhin nicht als wichtige Komponente ihres Seins wahrgenommen.25 Interessanterweise kann man aber gelegentlich sehr wohl zumindest einer Identifikation mit Weißen begegnen – wie etwa, wenn es um Übergriffe von Schwarzen auf Weiße in Simbabwe oder Südafrika geht. Schnell identifiziert man sich mit den »Weißen Opfern« (die historische Täterschaft der Weißen wird dabei ausgeblendet). Sätze wie »ich würde jetzt auf keinen Fall nach Simbabwe reisen«, zeigen, dass eine Innenperspektive des Weiß-Seins abrufbar bereit liegt, sobald es um den Status eines potentiellen Opfers, niemals aber um den des/der Täter/in, geht.
Wenn weite Teile der bundesdeutschen Gesellschaft im rassistischen Diskurs verstrickt sind und kein Bruch mit der deutschen Kolonialgeschichte nie aufgearbeitet wurde und folglich mit kolonialen Traditionen nie gebrochen wurde, liegt die Vermutung nahe, dass sich dies auch in der deutschen Sprache manifestiert. In Fernsehen und Wissenschaft, Schulbüchern und Filmen, Redewendungen und Liedern, Tageszeitungen, Ortsnamen und Bezeichnungen von Produkten begegnen wir tagtäglich rassistischen Wörtern wie »Neger«, »Mohr«, »Eingeborene«, »Stämme«, »Häuptling«, »Hottentotten«, »Buschmänner«, »Mischlinge« oder »Mulatten«. Die deutsche Gesellschaft hütet sie wie Schätze. Es gibt vier Hauptmuster, mit denen auf den Hinweis reagiert wird, dass diese Begriffe ob ihres rassistischen Gehalts besser vermieden werden sollten. Oft folgt der Vorwurf, dass dies haarspalterische »political correctness« sei, die eine schwerfällige Sprache erzwinge. Einige wissen auch zu entgegnen, dass sie einen Schwarzen kennen, der nichts gegen das Wort habe oder aber, dass Schwarze sich doch selbst so bezeichnen würden. Dabei wird schnell vergessen, dass es einen Unterschied bildet, ob ich im Stil der »Kannak-Attack« oder der Schwarzen Rapper versuche, rassistische Begriffe ironisierend aufzubrechen, oder ob Türk/innen oder Schwarze von Weißen so bezeichnet werden. Auch wird entgegnet, man hätte nicht gewusst, dass das Wort abwertend sei, es sei ja schon immer so verwendet worden. Schließlich, und das schließt sich an das zuvor genannte Argument an, wird argumentiert, man würde das Wort ja nicht rassistisch meinen.
Da Sprache durch historische, gesellschaftliche, soziale und kulturelle Zusammenhänge geprägt ist, kann es nicht zum Kriterium erhoben werden, ob ein Wort schon immer benutzt wurde oder wie man es meint. Vielmehr geht es darum, wie ein bestimmtes Wort in der deutschen Sprache generell konnotiert, benutzt und verstanden wird. Die symbiotische Verknüpfung von Sprache mit Denken und Handeln macht eine Reflexion sprachlicher Bedeutungsinhalte erforderlich.
In seiner Analyse der Sprache des Nationalsozialismus schreibt Victor Klemperer: »Worte können sein wie winzige Arsendosen: sie werden unbemerkt verschluckt, sie scheinen keine Wirkung zu tun, und nach einiger Zeit ist die Giftwirkung doch da.«26 Heute ist es in der deutschen Gesellschaft meist selbstverständlich, dass ideologisch geprägte Wörter aus der Zeit des Nationalsozialismus keine Verwendung finden. So ist beispielsweise der Vorname »Adolf« in Deutschland fast ausgestorben. Doch Begriffe, die von Kolonialisten geprägt und in der Kolonialzeit gebraucht wurden, werden heute noch immer in Medien, Filmen und Literatur – vom Internet ganz zu schweigen27 – unkritisch oder sogar bewusst verwendet. Dabei ist Klemperers Befund doch von allgemeiner Relevanz: Worte sind niemals unschuldig. Wenn Afrikaner und Afrikanerinnen lange genug als »Eingeborene«, »Wilde« und »Neger« bezeichnet werden, die »Stammeskonflikte« austragen, verfestigt sich der fatale Irrglaube von der Primitivität und Unterlegenheit von Afrikaner/innen immer tiefer im deutschen Bewusstsein. Allerdings beschreibt Klemperers eindringliche Metapher nur eine Seite der Medaille. Denn Wörter vergiften nicht einfach nur Sprache und Gesellschaft, sondern die Werte, Normen und Denkauffassungen einer Gesellschaft prägen auch den Sprachgebrauch. Folglich verrät dieser auch viel über gesellschaftliche Machtverhältnisse und die soziale Benachteiligung und Diskriminierung von Gruppen. Zudem lässt der individuelle Sprachgebrauch Rückschlüsse auf das Denken, die Einstellungen und das Bewusstsein Einzelner zu. Denn obgleich jede Gesellschaft sprachliche Standards setzt, kann jedes Individuum vor dem Hintergrund individueller Prägungen und Anschauungen seinen eigenen Sprachgebrauch individuell definieren und beständig korrigieren und verändern. Dadurch kann er oder sie dann auch auf die Sprache(n) der Gesellschaft zurückwirken. Dies macht nicht nur deutlich, dass Sprache ein dynamischer Prozess ist, sondern auch, dass dem individuellen Sprachgebrauch eine große Verantwortung für die Sprache einer Gesellschaft zukommt.
Doch woran lässt sich festmachen, ob ein Wort rassistisch ist oder nicht? In Anlehnung an Memmi ist ein Wort rassistisch, wenn bestehende Unterschiede unzulässig mit fiktiven vernetzt werden und die so konstruierten oder aber die realen Unterschiede bewertet, verallgemeinert und verabsolutiert sowie Menschen herabgesetzt, ausgegrenzt und verletzt werden. Viele rassistische Begriffe sind im 16. Jahrhundert entstanden, als europäische Seefahrer Afrika für ihre Zwecke entdeckten und begannen, die Infrastruktur für das anbrechende Zeitalter des transatlantischen Sklavenhandels umzugestalten. Dazu gehörte auch die Erfindung einer abwertenden Sprache, die dann im Zeitalter von Sklaverei und Kolonialismus Konjunktur hatte. Sie sollte den Kolonialismus »legitimieren«. Sprache fungierte als wichtiges Mittel der Macht- und Gewaltausübung. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Um eine abwertende Bedeutung von Wörtern zu erkennen, ist es in der Regel sinnvoll, sich die etymologische Wurzel oder den Bedeutungsgehalt der Wörter bewusst zu machen. Oftmals ist es aber auch hilfreich, nach Assoziationen zu fragen, die man mit einem Begriff verbindet, sich lexikalische Verbindungen ins Gedächtnis zu rufen, in denen dieses Wort auftaucht, und zu testen, wie sich der Begriff als Eigenbezeichnung anfühlen würde.
Der Begriff »Eingeborene« hat beispielsweise die Konnotation »primitiv« was sich zweifelsfrei an dem Bild erkennen lässt, das man unweigerlich mit diesem Begriff assoziiert. Um die europäischen Menschenrechtsverletzungen in Übersee zu rechtfertigen, musste man die dort Lebenden abwerten. In verallgemeinernder und verabsoluterender Manier galt im Kolonialismus jeder Afrikaner und jede Afrikanerin als »Eingeborene«. Während Weiße niemals »Eingeborene«, sondern Einheimische sind, werden Schwarze Menschen in nicht-westlichen Ländern bis heute von vielen Deutschen als »Eingeborene« bezeichnet.
Analog dazu lässt sich auch die rassistische Dimension des Wortes »Neger« belegen. Es geht auf das lateinische und romanische Wort für »schwarz« zurück (lat: »niger«; span. und port.: »negro«; frz.: »nègre«.) In der Zeit des Sklavenhandels wurde es von spanischen und portugiesischen Sklavenhändlern auf Menschen übertragen. Indem der Begriff auf die Hautfarbe von Menschen rekurriert, ist er zum einen biologistisch angelegt. »Die Denkweise, die diesem Etikett zugrunde liegt, versuchte körperliche und geistig-kulturelle Eigenschaften miteinander zu verbinden.«28 Als Wortschöpfung von Sklavenhändlern beinhaltet es zum anderen von Beginn an die Abwertung, mit der Weiße Sklaven begegneten. »Nègre« bzw. »negro« war schon im 15./16. Jahrhundert kein »neutrales Wort«.
In Deutschland taucht der analoge Begriff »Neger« Anfang des 17. Jahrhundert, parallel zum Begriff »Rasse«, erstmalig auf und bürgerte sich im 18. Jahrhundert, zur Zeit der Formierung des Rassismus, ein. In Ergänzung und Ablösung der Bezeichnung »Mohr« wurde er nur zur Beschreibung der Menschen südlich der Sahara verwandt. Diese neue Bezeichnung implizierte die ideologische Trennung Afrikas »in einen weißen und einen schwarzen Teil.«29 Dieser Ansatz wohnt auch dem Begriff »Schwarzafrika« inne, der sich trotz aller Kritik im aktiven Wortschatz der Deutschen hält. Frantz Fanon weist auf den Bedeutungsgehalt dieser Begrifflichkeiten hin:
»Auf der einen Seite versichert man, daß das Weiße Afrika die Tradition einer tausendjährigen Kultur habe, daß es mediterran sei und Europa fortsetze, daß es an der abendländischen Kultur teilhabe. Das Schwarze Afrika bezeichnet man als eine träge, brutale, unzivilisierte – eine wilde Gegend.«30
Wörter wie »Negerkuss« oder »Negerpuppe« verleihen dem rassistischen Wort hingegen fälschlicherweise einen Nimbus von Wertneutralität. Zudem werden Schwarze, indem sie auf ihre Hautfarbe reduziert werden, unzulässig essentialisiert.
Rassistische Wörter sind nur ein Beispiel für Rassismus in der Sprache. Rassistisch ist auch, wenn von »Menschen« die Rede ist, dabei aber nur Weiße gemeint sind und so ein großer Teil der Menschheit ignoriert und ausgeschlossen wird. Zudem gibt es viele Äußerungen, die ohne ein rassistisches Wort auskommen und dennoch rassistisch sind sowie Wörter, die, für sich genommen, nicht rassistisch sind, aber in bestimmten Kontexten eine rassistische Dimension erhalten. So gibt es etliche Begriffe, die bei der Bezeichnung von Phänomenen oder Gegenständen in Afrika abwertend benutzt werden. Beispielsweise redet man für den afrikanischen Kontext von »Hütten«, obwohl es sich um Häuser handelt; oder man redet vom »Busch« und meint nicht nur den Regenwald, die Steppe oder gar die Wüste, sondern auch noch die Dörfer und Städte. Oft wird auch von »Dialekten« gesprochen, wenn eigenständige Sprachen gemeint sind. Das bedeutet nicht, dass es keine Hütten, Büsche oder Dialekte in Afrika gäbe. Aber allzu oft werden diese Wörter benutzt, um Häuser, Wohngegenden und Sprachen in Afrika als jenen in Europa nicht ebenbürtig oder unterlegen darzustellen und damit abzuwerten. Hier klingt unmissverständlich an, dass diese als primitiver als die eigene Sprache oder das eigene Lebensumfeld und Haus empfunden werden.
Manchmal vermischen sich auch beide zuletzt genannten Phänomene. Ein Beispiel dafür ist, dass insbesondere in den Medien, durch Politiker/innen und damit auch im öffentlichen Bewusstsein Schlagwörter wie »Asylmissbrauch« oder »Ausländerkriminalität« kursieren, die jeder realen und statistischen Grundlage entbehren. Einzelne Ereignisse werden oft (bewusst oder fahrlässig) falsch interpretiert. Wird ein Weißer Deutscher straffällig, wird niemals auf sein Weiß-Sein rekurriert. Vielmehr heißt es dann etwa: »Arbeitsloser Vater überfiel Bank in Dresden.« Doch sobald ein Afrikaner eine strafrechtlich relevante Tat begeht, wird das markiert: »Ausländer/Afrikaner/Schwarzer überfiel Bank in Pirna.« Ob er etwa Vater oder erwerbslos ist, wird hier nicht erwähnt. Im Kontext des rassistischen Diskurses ist nur sein »Ausländer-Sein« von Interesse. Meist taucht dann nicht unweit der Schlagzeile das Wort »Ausländerkriminalität« auf. Solche Schlagwörter erzielen ein Maximum an politischer Wirkung.35
Doch nicht nur die Medien, auch andere gesellschaftliche Institutionen wie Bildungseinrichtungen und ihre Bücher, Lieder, offizielle Bezeichnungen wie Ortsnamen oder Produktnamen und Wörterbücher prägen den Sprachgebrauch der deutschen Gesellschaft. Ein prägnantes Beispiel bildet ein Liedtext von Marius Müller-Westernhagen. Der erfolgreiche deutsche Rocksänger, der sich selbst seit Jahren gegen Rassismus in Deutschland engagiert, dichtete »gedankenverloren« 1992 das Lied »Neger«:
»Der Präsident/Und die Partei
Das Deutsche Volk
Die Polizei
Großer Jubel
Und wir sind die Neger
Die Schlacht gewonnen
Und kaum Verlust
Der General gibt ’nem kleinen Bub ’nen Kuß
Großer Jubel
Und wir sind die Neger
Negerlein
…
Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens
Ist das Leben dann auch schon vorbei
Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens
Musst Du zahlen, zahlen, zahlen, zahlen…
Neger, Neger, Neger, Neger.«
Die Platte »JaJa«, auf der der Song 1992 erschien, verkaufte sich mehrere Hunderttausend Mal in Deutschland.
Eine ebenso nachhaltige Wirkung wie Liedtexte erfolgreicher Songwriter haben Wörterbücher, denen als Hüter und Autoritäten der Sprache eine große Verantwortung für den Sprachgebrauch einer Gesellschaft zukommt. Sie dokumentieren Sprache nicht nur, sondern haben auch normativen Charakter. Wer beispielsweise für die Verwendung eines rassistischen Wortes kritisiert wird, nimmt nicht selten ein Wörterbuch zur Hand, um sich zu vergewissern, ob diese Bezeichnung tatsächlich rassistisch ist. Trifft er oder sie dann aber auf unkritische Wörterbucheinträge, wird er oder sie sich in seinem/ihrem Sprachgebrauch kaum beirren lassen. So kann sich der Irrglaube halten, dieses Wort könne unbedenklich verwendet werden. Deswegen ist es besonders verheerend, wenn rassistische Wörter hier mit Anspruch auf Wertneutralität gebraucht werden. Dies ist aber leider eher die Regel als die Ausnahme. Und in den wenigen Fällen, in denen darauf verwiesen wird, dass ein Wort diskriminierenden Charakter hat, geschieht dies nur unbestimmt. Das Beispiel des Eintrags »Neger« zeigt das exemplarisch.
Zur Blütezeit des Kolonialismus fanden sich unter dem N-Wort gefährliche biologistische und diskriminierende Ausführungen:
»Neger … Menschenrasse Afrikas, deren Verbreitung über den Kontinent sehr verschieden gedeutet worden ist … Ratzel faßt als N. alle dunklen, wollhaarigen Afrikaner zusammen und schließt nur die hellen Südafrikaner ebenso wie die helleren Nord- und Ostafrikaner aus. Die meisten N. haben hohe und schmale Schädel …; dazu gesellt sich ein Vortreten des Oberkiefers und schiefe Stellung der Zähne … Den der Rasse eigentümlichen Geruch führt Falkenstein auf eine etwas öligere Beschaffenheit des Schweißes zurück, der bei unreinlicher Lebensweise leicht ranzige Säure entwickelt …«36
Ein Wort, das zu seiner Entstehungszeit so konnotiert war, kann nie mehr wertneutral verwendet werden. Doch Autor/innen, Herausgeber/innen und Verleger/innen von Wörterbüchern zeigten und zeigen sich mehrheitlich vom rassistischen Kern des Wortes unbeeindruckt. Im dtv-Wörterbuch der deutschen Sprache von 1978 ist nicht nur keine Rede vom abwertenden Charakter dieses Wortes; hier wird sogar noch rassentheoretisch argumentiert: »Neger 1 dunkelhäutiger, kraushaariger Bewohner des größten Teils von Afrika südlich der Sahara 1.1 Nachkomme der nach Amerika verschleppten Afrikaner.«37 Noch mehr als ein Jahrzehnt später heißt es analog dazu im Deutschen Wörterbuch: »Angehöriger der in Afrika lebenden negriden Rasse; Nachkomme der nach Amerika verschleppten schwarzen Afrikaner; Farbiger; Schwarzer …«38 Im Synonymwörterbuch des Duden ist gar zu lesen:
»1Neger, Schwarzer, Mohr, Nigger, Farbiger afrikanischer: Afrikaner, Aschanti, Ambo, Bantu, Ibo, Ila, Hutu, Fulbe, Kaffer (sic!), Haussa, Mbundu, Massai, Tussi, Suaheli, Sotho, Basotho, Zulu. Ggs. – Weißer. 2Neger: angeben wie zehn nackte N. s. prahlen: das haut den stärksten N. um s. unerhört [sein]).«39
Es ist augenfällig, dass hier auf das grundsätzliche Prinzip von Synonymwörterbüchern, genau zu kommentieren, ob ein Wort etwa salopp, umgangssprachlich, abwertend etc. ist, völlig verzichtet wird. Dies führt dazu, dass das Schimpfwort »Nigger« in einer Reihe mit »Afrikaner« steht. Auch ist zu fragen, was die wahllose Aufzählung einiger afrikanischer Ethnien soll; und wie es passieren kann, dass hier auch eine rassistische Fremdbezeichnung (»Kaffer«) aufgelistet wird. Spätestens durch die hier aufgeführten Redewendungen hätte denen, die diesen Eintrag zu verantworten haben, auffallen müssen, dass dem N-Wort eine negative Konnotation anhängt.
In den späten 1980er Jahren fingen die Autor/innen von Wörterbüchern vereinzelt an, auf die diskriminierende Dimension des Wortes hinzuweisen. Allerdings geschah das sehr zögerlich, etwa mit Formulierungen wie: »auch abwertend«40 oder »oft als diskriminierend empfundene Bezeichnung« 41, womit suggeriert wird, die Abwertung stecke nicht im Wort, sondern wurzele in einer individuellen Empfindung oder »Überempfindlichkeit«. Auch ist das Label »abwertend« letztlich zu euphemistisch, denn es handelt sich um Rassismus. Selbst der aktuelle Duden konnte sich nicht zu mehr durchringen als: »Neger. Schwarzer (wird heute oft als abwertend empfunden).«42
Vor allem aber ist auffällig, dass die Distanzierung von dem N-Wort noch sehr unentschlossen verläuft. Während in dem 1986 in der DDR erschienenen Duden steht »oft als diskriminierend empfundene Bezeichnung«43, erschien im gleichen Jahr beim gleichen Verlag ein Synonymwörterbuch, wo der Ausdruck »Neger« wieder als wertneutral dargestellt wurde.44 Eine ähnliche Inkonsequenz lässt sich für den Brockhaus von 1991 beschreiben. Hier findet sich unter dem Eintrag »Neger«:
»Neger [frz. Nègre, über span. von lat. Negro ›schwarz‹], Anfang des 17. Jahrhunderts aus dem Frz. übernommen, seit dem 18. Jh. in Dtl. eingebürgerte Bez. für die Angehörigen des negriden Formenkreises (s. Negride). Ausgehend von dem im Amerikanisch gewordenen Gebrauch des Wortes ›Nigger‹, gilt die Bez. ›N.‹ seit Ende des 19. Jh. zunehmend als diskriminierend und ist heute durch ›Schwarze‹, ›Schwarzafrikaner‹, ›Afrikaner‹, ›Afroamerikaner‹ o.ä. ersetzt.«45
Hier wird – wenn auch viel zu vorsichtig – die diskriminierende Dimension des Wortes angesprochen, gleichzeitig aber biologistisch und in Ignoranz der Tatsache, dass es keine »Rassen« gibt, argumentiert. Zudem wird hier in der Reihe der Alternativvorschläge mit »Schwarzafrikaner« eine Bezeichnung benutzt, die längst überholt ist, weil auch hier auf die Hautfarbe rekurriert wird und eine rassistisch motivierte Teilung Afrikas vermittelt wird.
Wenn dann beim Eintrag »Bimbo« auch noch erklärt wird, das dieses Wort abwertend sei, und man doch besser von »Negern« sprechen solle,47 bestärkt sich der Eindruck, die Mitarbeiter/innen und Verantwortlichen des Brockhaus-Verlages haben den Eintrag im eigenen Band 18 zu Rassismus nicht gelesen, wo sie mit Albert Memmi einen der führenden Rassismusforscher zu Wort kommen lassen.48
Da Wörterbücher den rassistischen Diskurs in der deutschen Gesellschaft maßgeblich mittragen und es gerade hier wichtig wäre, ihn aufzubrechen, muss jeder Versuch, dem Rassismus im deutschen Sprachgebrauch beizukommen, mit einer kritischen Auseinandersetzung mit den Verlagen deutscher Wörterbücher beginnen. Dieser könnte idealer Weise in einen reflektierteren Umgang mit diesen Begriffen in Wörterbüchern und Gesellschaft resultieren.
Es nützt nicht viel, Sprache juristisch zu normieren. Die rassistische Mentalität bleibt davon unbehelligt. Durch das Vermeiden rassistischer Wörter und das Zurückgreifen auf nicht-rassistische Alternativen allein lassen sich mentale Konzepte nicht ändern. Doch es leistet einen wichtigen Beitrag dazu. Sprache spiegelt das Bewusstsein nicht nur, sie formt es auch: Insofern ist der bewusste Verzicht auf rassistische Wörter und das Verwenden alternativer Begriffe wie etwa »Schwarzer Deutscher« und »Schokokuss« für ein bestimmtes Süßwarenprodukt ein wichtiger und unerlässlicher Schritt, um Reflexionen anzuregen, rassistische Denkvorstellungen zu überwinden und Handlungen zu beeinflussen: »Sprachliche Irritationen … enthalten die Möglichkeit, das Bewußtsein zu schärfen, sie geben mir die Chance zu signalisieren, daß ich den Verletzungen anderer Beachtung schenken will und daß die Geschichte des Rassismus nicht spurlos an mir vorbei gegangen ist.«49 Es geht nicht nur um ein bewusstes und reflektiertes Vermeiden rassistischer Begriffe, sondern auch um Repräsentation und darum, bestehenden Machtkonstellationen Rechnung tragen. Letztlich ist es keine Lösung, Begriffe wie »Mischling« oder »Mulatte« einfach durch »Mensch« zu ersetzen. Diese Begriffe müssen ob ihres rassistischen Charakters überwunden werden, gleichzeitig ist es aber wichtig, sprachlich auszudrücken, dass es viele Menschen in Deutschland und anderswo gibt, die Opfer eines alltäglichen Rassismus werden und dass diese Erfahrung Identitäten nachhaltig prägt. Dieser Gedanke wohnt beispielsweise dem Begriff »Schwarze Deutsche« inne, der die soziopolitische Identität von Deutschen mit mindestens einem Schwarzen Elternteil manifestiert. Im Unterschied zu »dunkelhäutiger Deutscher« oder »Mensch mit schwarzer Hautfarbe« wird »Schwarz« auch in adjektivischer Verwendung groß geschrieben, um zu unterstreichen, dass hier nicht körperliche und geistig-kulturelle Eigenschaften miteinander verbunden werden, sondern eine soziopolitische Identität bezeichnet wird, die maßgeblich durch das Erfahren von Rassismus bestimmt wird. Wie weiter oben schon diskutiert wurde, ist analog dazu auch Weiß-Sein eine soziopolitisch geprägte und im globalen und deutschen Machtgefüge konnotierte Identität. Unabhängig davon, ob den Weißen dies bewusst ist oder nicht, verlangt dies ebenso nach einer sprachlichen Manifestation. Diese realisiert sich in einer grundsätzlichen Großschreibung von »Weiß«, sobald es um die Weiße Sozialisation geht. Der den westlichen Sprachen immanente Rassismus ist nur eine Manifestation des rassistischen Diskurses. Deutsche Wahrnehmungen des afrikanischen Kontinents und von Afrikaner/innen werden ebenfalls von diesem Diskurs getragen. Das machen die Beiträge im zweiten Block dieses Buches deutlich. Mit den folgenden einleitenden Überlegungen wird beabsichtigt, aufzuzeigen, wie sich die in den einzelnen Fallstudien zu Tage geförderten Bilder als Mosaiksteine ins Netz des rassistischen Diskurses einpassen.
II. Rassismus und Afrikabilder
Vor einiger Zeit holte ich einen Freund aus Ghana vom Flughafen in Berlin ab. Auf dem Flug nach Deutschland hatte er ausgiebig in einem Reiseführer über Berlin gelesen. Auf meine Frage, was er denn in Berlin alles so sehen möchte, antwortete er: »Als erstes möchte ich in den Tierpark. Ich würde endlich gern einmal Elefanten, Löwen, Giraffen und Nashörner sehen.«
Als wir durch den Tierpark schlenderten und vor den entsprechenden Gehegen standen, sah ich immer wieder, wie verwunderte Besucher/innen auf meinen Freund schielten und amüsiert den Kopf schüttelten. Ein Afrikaner als Besucher eines deutschen Zoos, das schien vielen unverständlich. Schließlich gilt Afrika ja als Kontinent der gefährlichen großen und kleinen Tiere, der Schlangen, Löwen und Elefanten (manche dichten gar den Tiger nach Afrika) – und die Afrikaner leben, glaubt man den US-amerikanischen Elsa-Filmen und Grzimeks Streifen – und man tut es –, mitten unter ihnen. In diesen Kontext ist die im Juli 2001 im Magdeburger Zoo veranstaltete »Afrikanacht« einzuordnen: Trommelnde und tanzende Afrikaner/innen vor »Lehmhütten« – daran stießen sich die Zoobesucher/innen offenbar nicht.50
Am Beispiel des Zoobesuchs meines Freundes zeigt sich exemplarisch, wie wenig Deutsche über Afrika wissen. Nicht vielen ist bekannt, dass Westafrikaner/innen in einen ostafrikanischen Safaripark oder einen europäischen Zoo fahren müssen, um einen Elefanten oder Löwen zu sehen, weil Europäer auf ihren »Spaßjagden« Löwen und Elefanten quasi ausgerottet haben, und dass überhaupt nur die wenigsten Afrikaner/innen Löwen und Elefanten aus eigener Anschauung kennen. Doch kaum jemand macht sich wirklich bewusst, wie wenig er oder sie über Afrika weiß. In einer Studie über Österreich zeigt Harald Pichlhöfer, dass Wissen über Afrika, das für Europa und Nordamerika als Standardwissen gilt, bei Studierenden der Universität in Wien nicht abrufbar war. Dem steht die Tatsache gegenüber, dass »[w]enn wir auf der Straße beliebig viele Leute fragen, was Afrika für sie bedeutet« es wohl niemanden gibt, »der keine Vorstellung dazu hätte. Auch alle, die nichts genaues darüber zu sagen wissen, haben ein Bild davon, das sie mehr oder weniger präzise verbalisieren können.«51 Eigene Untersuchungen lassen den Schluss zu, dass seine Befunde auch auf die deutsche Gesellschaft übertragen werden können.
Die fehlende Sensibilisierung für das Nicht-Wissen sowie die Unwissenheit selbst lassen sich am ehesten mit einem stark ausgeprägten gesellschaftlichen und individuellen Desinteresse am afrikanischen Kontinent erklären, der den Deutschen so fremd zu sein scheint wie kein zweiter. Desinteresse ist jedoch, und hier schließt sich der Teufelskreislauf, die beste Garantie dafür, dass Unwissenheit auch bestehen bleibt. Das ist vor allem deswegen fatal, weil sie eine Vorbedingung für das Entstehen und die diskursive Macht von Vorurteilen und Stereotypen ist.52
Die Summe dieser Stereotypen konstituiert »das Afrikabild der Deutschen«. Dieser Begriff ist freilich nicht mehr als ein methodisches Konstrukt. Natürlich gibt es kein homogenes deutsches Afrikabild, aber diskursanalytisch kann davon ausgegangen werden, dass es dominante Stereotypen gibt, die ein mentales Grundmuster formieren, das in der Sozialisation vermittelt wird. Deswegen ist es begrifflich eindeutiger, vom Afrikadiskurs der deutschen Gesellschaft bzw. von dominanten Afrikabildern zu sprechen.
Die dominanten Afrikabilder werden vornehmlich über die Massenmedien, Schulbücher und Spielfilme, sodann über zwischenmenschliche Kontakte, Werbung, Kinder-, Jugend- und Erwachsenenliteratur, Comics sowie Reisemagazine vermittelt. Auch historische Reiseberichte und die kolonialistische belletristische Literatur sind noch immer wichtige Reproduzent/innen von Afrikabildern.
In den letzten drei Jahrzehnten sind eine Reihe von Studien erschienen, die diese institutionalisierten Einflussfaktoren diskursanalytisch untersucht haben. Das Interesse an diesem Thema hatte in den 1970er und 1980er Jahren Konjunktur,53 ließ aber in den 1990er Jahren wieder nach.54 Diese Studien trugen zu einem tiefgehenderen Verständnis des deutschen Afrikadiskurses bei. Sie machen deutlich, dass der deutsche Afrikadiskurs sich aus Stereotypen speist, die so gar nichts mit den Realitäten dieses Kontinentes zu tun haben.
Die Realitätsferne ist Stereotypen freilich prinzipiell wesenseigen. Stereotype sind teilweise oder gänzlich tatsachenwidrige Urteile, die, meist negativen Inhalts, veränderungsresistent bleiben. Das erklärt sich vor allem aus ihrer Funktion, irrationale Triebe und Bedürfnisse zu rationalisieren.55 Nach Quasthoff bestimmen sich Stereotype aus Intergruppenbeziehungen, die von folgendem Verhalten von Individuen getragen werden. 1. Geschichte der Beziehungen beider Gruppen, 2. aktuelles Verhältnis zueinander, 3. ökonomische Situation der Eigen- und Fremdgruppe und 4. psychische Disposition des Einzelnen.56
Das Beispiel, dass Deutsche beim Anblick eines afrikanischen Zoobesuchers eher den Kopf schütteln, als eigene Stereotypen zu hinterfragen, unterstreicht die Veränderungsresistenz von Stereotypen: Die Deutschen halten an ihren Stereotypen von Afrika fest, so als wollte man ihnen ein Spielzeug wegnehmen. Aber wie Quasthoffs Definition zeigt, handelt es sich bei Stereotypen nicht um ein Spiel, sondern um die Widerspiegelung und Reproduktion von Machtverhältnissen und Unterdrückungsmechanismen. Wenn sich also die Machtverhältnisse und Hierarchien der historischen, aktuellen und ökonomischen Beziehungen zwischen Afrika und Europa in den Stereotypen niederschlagen, können stereotype Afrikabilder weder unschuldig sein, noch dürfen sie unbedarft reproduziert werden.
In einer rassistisch strukturierten Welt potenzieren sie zwangsläufig die rassistische Mentalität, die Berührungsängste und Aversionen, Überlegenheitsgefühle und fehlenden Respekt vor Afrikaner/innen und anderen Schwarzen befördert.
Die Realitätsferne der und das Festhalten an rassistischen Stereotypen ist kein irrationaler Prozess, sondern ein funktionaler. Zum einen kommt ihnen eine Legitimations-, Entlastungs- und Verschleierungsfunktion zu, ohne die weder Sklaverei und Kolonialismus noch die aktuelle globale Situation denkbar (gewesen) wäre. Zusätzlich zu dieser legitimierenden Funktion diente und dient Afrika den Europäer/innen als Projektionsfläche und Ventil. Seiten, die man in sich selbst verachtet, Ängste und Wünsche werden auf den afrikanischen Kontinent übertragen – ein Prozess, der sich oft unbewusst realisiert.
»Das Moment des Fremden ist … entscheidender Bestandteil einer stereotypen Darstellung. AfrikanerInnen werden von uns grundsätzlich als fremd erfahren und werden somit zu Vertretern von Eigenschaften, die in der eigenen Gesellschaft tabu sind … Der Entwurf vom Fremden stellt in der Regel das genaue Negativbild der eigenen Kultur dar … Das Fremde ist einerseits reizvoll, weil es das ausmacht, was wir nicht haben, und andererseits bedroht es durch seine Existenz die integralen Werte der eigenen Gesellschaft … Die Projektionen von Wunsch und Furcht, welchen wir bei der Verbalisierung der Bilder von Afrika





























