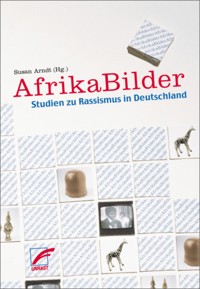12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unrast Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
May Ayim versammelte in diesem zuerst 1997 veröffentlichten Werk ihre wichtigsten Aufsätze, Interviews und Reden und schuf so eine Bestandsaufnahme der rassistischen Zustände im wiedervereinigten Deutschland. Wissenschaftliche Arbeiten zu Geschichte, Erziehung und Therapie verbindet die Autorin mit autobiografischen Erinnerungen und der ganz persönlichen Auseinandersetzung mit ihrer Geschichte und Realität als Schwarze Deutsche. Ihre Texte über den »Stressfaktor Rassismus« oder »Ethnozentrismus und Geschlechterrollenstereotype« sind bis heute wegweisend und die »Gespräche« mit anderen afrodeutschen Frauen berühren noch genauso wie vor 35 Jahren. Einen Einblick in das Leben von May Ayim bietet der biografische Essay der Journalistin Silke Mertins, die mit Menschen gesprochen hat, die May Ayim noch gekannt, mit ihr gearbeitet und gelebt haben. Ihre Eindrücke, Gefühle und Erfahrungen hat sie zu einem höchst lesenswerten Portrait verdichtet. Kurz gesagt: »Grenzenlos und unverschämt« ist ein ›Klassiker‹ der afro-deutschen Kultur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 253
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
May Ayim in Belo Horizonte, Brasilien 1990 © D. Schultz
May Ayim
Grenzenlos und unverschämt
Mit einem aktuellen Vorwort von Josephine Aprakuund einem biografischen Essay von Silke Mertins
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar
May Ayim:
Grenzenlos und unverschämt
1. Auflage, August 2021
eBook UNRAST Verlag, Januar 2022
ISBN 978-3-95405-097-0
Zuerst veröffentlicht 1997 im Orlanda Frauenverlag GmbH, Berlin
© UNRAST Verlag, Münster
www.unrast-verlag.de| [email protected]
Mitglied in der assoziation Linker Verlage (aLiVe)
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung
sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner
Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter
Verwendung elektronischer Systeme vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag: Patricia Ann Elcock, Berlin
Satz: Andreas Hollender, Köln
Leider war es uns nicht möglich, alle Fotograf_innen der in diesem Buch
abgebildeten Fotos zu ermitteln. Sollten Sie hierfür Hinweise haben, melden
Sie sich bitte beim Verlag.
Inhalt
Josephine AprakuVorwort
Ein Brief aus Münster
Aufbruch
Drei afro-deutsche Frauen im Gespräch
Wir wollen aus der Isolation heraus
Eistorte à Ia HildegardFür ein kleines Fest oder einfach so
Eine der anderen
Ethnozentrismus und GeschlechterroIlenstereotype in der Logopädie
Hanni und Nanni in der LehranstaltDie Ausbildung in einem Frauenberuf
Das Jahr 1990Heimat und Einheit aus afro-deutscher Perspektive
Die Wut der Schwarzen Frauen sollte auch die Empörung der weißen Frauen sein – Ein Gespräch
Weißer Stress und Schwarze NervenStressfaktor Rassismus
Rassismus und Verdrängung im vereinten Deutschland
Die afro-deutsche Minderheit
Silke MertinsBlues in Schwarzweiß: May Ayim (1960–1996)
May Ayim: Ein Lebenslauf
Bibliografie
Anmerkungen
Vorwort
Ich schreibe diese Zeilen am 3. Mai 2021, dem Geburtstag von May Ayim – es hätte der 61. werden können, werden sollen. Der Tag ist zwiespältig: Zärtliches Frühlingsgrün an einigen Zweigen, an anderen lustvolle fast angeberische Blüten. Es ist insgesamt ein ungewöhnlich kühler Frühling. Damit meine ich nicht nur das Wetter, sondern auch die Stimmung nach mehr als einem Jahr Pandemie: Wie ein Brennglas offenbarte dieses Jahr einmal mehr die vielen Formen der sozialen Ungleichheit in unserer Gesellschaft mit all ihrer Entmenschlichung.
An diesem trüben Tag gleicht es einer Heimkehr, den Band Grenzenlos und unverschämt aufzuschlagen. Ruhe kehrt ein. Ich darf ankommen und die Rüstung, die ich als Schwarzer Mensch in Deutschland tragen muss, wie das routinierte Ausblenden weißer Blicke, die meinen Körper durchbohren, ablegen und weich werden. In diesem Moment des Loslassens entspinnt sich eine Unterhaltung zwischen May und mir. In »Eine der anderen« berichtet sie mir von ihrer Reise nach Ghana im Jahr 1986 – meinem Geburtsjahr. Sie beschreibt darin die beständige Heimatlosigkeit hier wie da, die mich auch heute mal mehr, mal weniger begleitet.
In den sozialen Medien sehe ich heute Menschen, die an May Ayim und ihre wichtige Arbeit erinnern. Einige posten Videos von ihr, in denen sie Gedichte vorträgt, andere teilen Zitate aus ihren Veröffentlichungen. Wieder andere bedanken sich für die Arbeit, die sie für Gleichberechtigung und gegen Rassismus geleistet hat. Vielleicht erscheint mir das durch die Tristesse des gefühlt ewig währenden Lockdowns an Mays 61. Geburtstag bedeutsamer als in anderen Jahren: Die Schönheit des Kampfes, das lehrt mich die Präsenz von May, die bis in die Gegenwart reicht, ist Kollaboration, ist Gemeinsamkeit trotz und wegen unserer Unterschiede, ist Verbindung, die wir als Schwarze Menschen schaffen, wo unsere Gesellschaft keine will.
Was mich von der May Ayim, wie ich sie in Grenzenlos und unverschämt kennenlernen darf, trennt, ist die Zeit: Die Erfahrungen und Perspektiven, die hier zusammengetragen sind, sind die meinen und sie sind es auch nicht. Obwohl ich mich in dem Geschilderten wiederfinde, bemerke ich, dass Mays Erlebnisse auch in der Zeit verhaftet sind, in der sie sie dokumentiert. Und so befinde ich mich beim Lesen von »Weißer Stress und Schwarze Nerven – Stressfaktor Rassismus« in einem beständigen Zwiespalt aus »all das Grundlegende, dass sie aufzeigt, muss ich immer noch erklären« und »schön zu sehen, dass wir uns hinsichtlich sexismuskritischer Sprache weiterbewegt haben«. Der Stress, über den sie spricht, des sich ständig beweisen Müssens und doch nie gut genug zu sein, begleitet mich ständig.
Wenn ich, mit wem auch immer, über May Ayim spreche, verliere ich nur wenige Worte: bei denjenigen in meinem Leben, die sie persönlich kannten – besonders wenige Worte! Und es gibt diejenigen, die wie ich mit ihr aufgewachsen sind, ohne sie zu kennen, als wäre sie eine entfernt lebende Tante, die eine seltene, aber willkommene Besucherin ist – ebenfalls wenige Worte. Schwarze Menschen, insbesondere in Deutschland, aber auch darüber hinaus, werden von ihrer aktivistischen Arbeit berührt. Mays Arbeit ist meine, unsere Grundlage im Jetzt. Unsere Arbeit ist Ausgangs- und Anknüpfungspunkt für diejenigen, die nach uns kommen. Und so bleiben wir, wie May, auch wenn wir physisch nicht mehr sind.
May Ayim wurde 1960 geboren und entschied sich im August 1996, aus dem Leben zu gehen.
In der Zeit dazwischen führte sie wichtige Kämpfe, hinterließ Spuren und schuf bedeutende Werke, die bis heute nicht weniger aktuell sind als vor 30 Jahren.
Was ich aus dem Buch mitnehme? Grenzenlos und unverschämt – zu diesem Wortpaar habe ich eine innige Beziehung: Ich will grenzenlos und unverschämt bleiben in meiner Verbundenheit meinen Geschwistern gegenüber, in meinen Bündnissen gegen Diskriminierung. Und wann immer ich das gleichnamige Gedicht lese, weist May mir und allen, die diese Zeilen lesen, einen Weg in diese Zukunft.
Juni 2021, Josephine Apraku
Ein Brief aus Münster
1984 fand der »1. gemeinsame Kongress[1]ausländischer und deutscher Frauen« in Frankfurt am Main statt. Mit der Ausgangsfrage »Sind wir uns denn so fremd?« versammelten sich um die tausend Frauen; aus Münster reiste damals auch eine junge Frau namens May Opitz an. Nach dem Kongress erhielten die Veranstalterinnen folgenden Brief von ihr.
Liebe Frauen der Vorbereitungsgruppe,
das Resümee des Wochenendes in Frankfurt schreibe ich nicht nur für Euch, sondern in erster Linie für mich. Der Frauenkongress als Begegnung und Austausch mit deutschen und ausländischen Frauen ist für mich persönlich zu einem unvorhergesehenen Schlüsselerlebnis geworden: Viele Konflikte in mir sind schlagartig aufgebrochen, die ich bisher oft runterschluckte oder als persönliche Überempfindlichkeit individualisierte und verdrängte.
Zunächst fuhr ich mit ziemlich gemischten Gefühlen nach Frankfurt. Ich war noch nie auf einer Frauenveranstaltung gewesen, hatte mich nie besonders mit Feminismus auseinandergesetzt, auch das genaue Programm des Kongresses kannte ich nicht. Da ich in Münster keine Frauen gefunden hatte, die auch zum Kongress wollten, fuhr ich über die Mitfahrerzentrale, begleitet von der diffusen Angst, in der riesigen Stadt Frankfurt, in der ich noch nie gewesen war, zu stranden. Aber in Frankfurt angekommen, fand ich die Fachhochschule gleich und war unter Dutzenden von Frauen, die auch zum Kongress wollten.
Als ich eintrat, war ich über die große Anzahl Frauen total überrascht! Überall saßen, standen, aßen, sprachen Frauen. Es waren Hunderte! Eine unbeschreiblich bunte, freundliche Atmosphäre. Schlafplätze wurden vermittelt, mehrsprachige Programme zum Ablauf des Kongresses verteilt, Essen und Trinken an Ständen angeboten. Obwohl ich zunächst niemanden kannte, fühlte ich mich sehr geborgen. Es war leicht, Kontakt zu bekommen.
Als eindrucksvoll erlebte ich die Begrüßung in mehreren Sprachen und die Eingangsreferate in ihrer Differenzierung und Selbstbetroffenheit. In jedem der Referate spiegelte sich auch ein Teil meiner eigenen Betroffenheit, Hoffnung und Hilflosigkeit wider. Ich hatte das Gefühl – obwohl ich das Programm noch nicht gelesen hatte und nur der Leitfrage gefolgt war –, hier richtig zu sein und unbewusst schon lange auf die Möglichkeit eines solchen Zusammentreffens gewartet zu haben.
Um das zu erklären, muss ich etwas über mich sagen. Ich bin in Deutschland geboren, mein Vater stammt aus Ghana, meine Mutter ist Deutsche. Zur Mutter bestehen keine Kontakte, mein Vater ist mir oberflächlich bekannt durch gelegentliche Briefe und eine zweimonatige, sehr konfliktträchtige persönliche Begegnung vor zwei Jahren.
Gleich nach der Geburt kam ich ins Säuglingsheim und nach 18 Monaten von dort als Pflegekind in eine deutsche Familie. Rückblickend erkenne ich für mich, dass die Geschichte in dieser Familie in einer Entwicklung gegenseitig wachsender Entfremdung bestand, die auf Unverständnis, mangelnder Aussprache, versteckter und offener Aggression beruht. Sie hat dazu geführt, dass ich nach meinem Schulabschluss 1979 zunächst drei Jahre gar keine Kontakte zu meinen Pflegeeltern und meinen Pflegegeschwistern hatte und Kontakte heute zwar gelegentlich wieder zustande kommen, aber nur sehr oberflächlich.
Diese Zerrissenheit zwischen Dazugehören und Nichtdazugehören zwischen mir und ›meiner‹ Pflegefamilie und mir und ›meiner‹ Familie in Afrika stellte sich für mich zudem auch dar als Widerspruch zwischen einer dunklen Hautfarbe und einem deutschen Pass.
Formalitäten und Äußerlichkeiten brauchten und dürften eigentlich keine Bedeutung haben. Was aber diese nur scheinbare Unvereinbarkeit von Hautfarbe und Nationalität für mich in meiner Identitätsfindung bedeutet, die ich in einer Gesellschaft aufgewachsen bin, in der auf äußerliche Auffälligkeiten so stark geachtet wird, das ist mir vor allem an diesem Wochenende ganz bewusst geworden: Meine Sozialisation war die eines ›deutschen‹ Mädchens inmitten einer deutschen Umwelt (in meiner Familie gab und gibt es keine Kontakte zu Ausländern). Ich habe einen deutschen Namen und ›genieße‹ mit meinem deutschen Pass die Privilegien einer Deutschen als ›Inländerin‹. Ich spreche keine afrikanische Sprache, war noch nie im Geburtsland meines Vaters, kurz, ich bin keine Ausländerin. Ich finde es überflüssig, mein ›Deutschsein‹ hervorzuheben.
Wenn ich aber, wie so oft, nach meiner Herkunft gefragt, sage: »Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen …«, wird das selten angenommen. Dann kommt oft: »Aber Sie sehen doch vollkommen ›anders‹ aus« oder »Wollen Sie nicht trotzdem irgendwann zurück in Ihre Heimat?«, »Das Blut kann man doch nicht verleugnen«, »Meinen Sie nicht, dass Sie in Ghana z.B. viel dringender gebraucht werden, in Deutschland gibt es ja schon so viele Arbeitslose?!« Oder ich muß mich mit Sprüchen auseinandersetzen wie: »Da können Sie aber stolz darauf sein, dass Sie in einer deutschen Familie groß geworden sind« und damit, dass z.B. die Bäckersfrau um die Ecke mit mir immer wieder »Ausländerdeutsch« spricht, obwohl ich mich mit ihr ganz gemäß den Grundsätzen deutscher Grammatik unterhalte.
Und doch, ich kann sie gut verstehen, und auch die anderen Leute mit ihren gutgemeinten Ratschlägen, Bewunderungen und Horrorvorstellungen, die mich fast alle gleichermaßen verletzen. Denn auch ich habe als Kind das Lied von den zehn kleinen N…lein gelernt. Auch ich mochte gerne ›N…küsse‹, auch wenn ich das Wort gehasst habe, weil mich andere Kinder oft so nannten. Auch ich habe das Spiel ›Wer hat Angst vorm schwarzen Mann‹ mitgespielt; und als, was nur einmal passiert ist, mein afrikanischer Vater zu Besuch kam, wäre ich am liebsten, wie es die anderen Kinder taten, auch weggerannt.
Ja, und auch ich benutze die deutsche Sprache mit ihren rassistischen Elementen, die oft gegen mich selbst gerichtet sind, zumeist unreflektiert.
Warum ich das nun alles über mich und dazu noch so persönlich geschrieben habe? Vielleicht, weil sich in der Arbeitsgruppe, an der ich während des Wochenendes teilgenommen habe, wieder zwei Gruppen gegenüberstanden, die Ausländerinnen den deutschen Frauen. Ich hatte vorher das Gefühl, dass ich nicht als selbstständige Frau akzeptiert wurde, vor allem, wenn ich immer wieder gefragt werde: »Fühlst du dich als Deutsche oder als Afrikanerin?« Diese Frage höre ich immer wieder von Deutschen und von Afrikanern, von Männern und Frauen, unabhängig von Bildungsstand und Nationalität. Ich möchte nicht immer gefragt werden: »Hast du einen weißen oder Schwarzen Freund?« Ich möchte von Dir, die Du mir begegnest oder begegnen könntest, nur danach beurteilt werden, was ich Dir mit meinem Frausein zum Ausdruck bringe, und nicht nach meiner Nationalität oder Hautfarbe.
Ich habe diesen Wunsch nicht allein. Das habe ich zum ersten Mal erfahren. Es gibt so viele, die in ihrer Identität unsicher sind, als Opfer von Rassismus und Ausländerfeindlichkeit, und die durch ihre Sonderbehandlung als Frau und Exotin zusätzlich behindert werden in der Entwicklung ihrer weiblichen Fähigkeiten und Stärken.
Ich habe daraus für mich die Erkenntnis gewonnen, dass ich mich nicht zurückziehen darf, sondern sprechen muss. Und ich habe an diesem Wochenende Mut bekommen, eine Arbeit über ›Ausländerfeindlichkeit und Rassismus‹ aus eigener Betroffenheit und der Betroffenheit so vieler anderer Frauen zu schreiben.
Ich möchte mich daher für jedes freundliche Neben- und Miteinander, jeden Zwist mit Euch und inneren Konflikt mit mir bedanken und hoffe auf viele weitere Begegnungen wie bei diesem Kongress.
Aufbruch
1986 erschien »Farbe bekennen«, May Ayims erste Buchveröffentlichung, die auf ihrer gründlichen Recherche zur Präsenz von Menschen afrikanischer Herkunft in Deutschland seit dem 12. Jahrhundert basiert. Im ersten Teil des Buches geht es um eben diese Geschichte, im zweiten kommen afro-deutsche Frauen zu Wort, darunter auch May Ayim mit dem folgenden Text.
An dem Tag, als ich geboren wurde, kamen viele Geschichten meines Lebens zur Welt. Jede trägt ihre eigene Wahrheit und Weisheit. Diejenigen, die im Erleben von Kindheit in meiner Nähe waren, werden vielleicht mit einer völlig anderen Geschichte meiner Kindheit aufwarten als ich. Ich kann nur meine Geschichte erzählen, so wie sie sich mir eingeprägt hat, und wenn die negativen Ereignisse deutlicher in Erinnerung blieben als die positiven, bedarf es dafür keiner Entschuldigung. Es ist einfach so. Ich werde hier also etwas von mir preisgeben. Ohne Anklage oder Verzeihung, ohne Anspruch auf Wirklichkeit und im Erleben von Wahrheit. Und in der Gewissheit, dass jede/r, der oder die meine Geschichte liest, sie anders versteht.
Als ich geboren wurde, war ich nicht Schwarz und nicht weiß. Vor allen Namen, die ich bekam, hieß ich ›Mischlingskind‹. Es ist schwer, ein Kind mit Liebe zu umgeben, wenn die Großeltern der Mutter sagen, dass das Kind fehl am Platze sei. Es ist schwer, wenn das Kind nicht in die Pläne der Mutter passt und wenn kein Geld da ist. Es wird alles noch schwerer, wenn die weiße Mutter nicht möchte, dass ihr Kind in eine Schwarze Welt entführt wird. Auch die Gesetze erlauben nicht, dass der afrikanische Vater das deutsche Töchterchen zu einer afrikanischen Mutter bringt.
Es ist nicht leicht, ein Kind in ein Heim zu geben. Es bleibt dort ein Jahr und sechs Monate.
Über das Radio hörte irgendwo ein Ehepaar von Kindern wie mir: von denen, die keine Eltern finden, weil sie ›Soldatenkinder‹ sind, weil sie behindert sind oder nicht blond genug oder im Gefängnis geboren werden. Ich wurde Wunschkind einer weißen deutschen Familie und vergaß die Heimmonate. Aus jener Zeit blieben nur die Erzählungen meiner Pflegeeltern: »Du konntest nicht einmal stehen. Wegen der einseitigen Ernährung hattest du Rachitis. Der Oberkörper war dick und überernährt, die Beinchen so krumm, dass jeder Arzt glaubte, sie würden niemals halbwegs gerade.«
Es gibt keine ›süßen‹ Babyfotos aus dieser Zeit. Mir fällt eine immer wiederkehrende Warnung meiner Pflegeeltern ein: »Pass auf! Wer als Baby dick ist, wird auch später dick werden. Achte immer darauf, was und wie viel du isst!« Aus dieser Zeit behielt ich die Angst vor dem Alt- und Dickwerden; später noch verstärkt durch das Klischee der ›Schwarzen dicken Mammi‹, die mir in manchen Spielfilmen als Mahnbild des Schreckens vorgeführt wurde.
Kindheit ist, wenn kind sich viele Gedanken macht, und die Wörter, die kind spricht, nicht verstanden werden. Kindheit ist, wenn kind ins Bett macht und die Eltern das Resultat mit Schlägen kommentieren. Kindisch ist, wenn kind alles falsch macht, ungezogen ist, nichts kapiert, zu lahm ist und immer wieder die gleichen Fehler macht.
Kindheit ist, wenn kind immer wieder ins Bett macht und keiner versteht, dass kind das nicht tut, um seine Eltern zu bestrafen. Kindheit ist, mit der Angst vor Schlägen zu leben und damit nicht fertig zu werden. Kindheit ist, jedes Jahr Bronchitis zu bekommen und immer wieder zur Kur geschickt zu werden.
Nach Jahren sagt mir ein Arzt über mein Erstaunen, dass meine chronische Bronchitis seit dem 15. Lebensjahr plötzlich verschwunden ist: »Wissen Sie nicht, dass das wie Bettnässen ein psychosomatisches Leiden ist?«
Angst, die sich beklemmend auf die Atemwege legt? Angst gab es genug. Wahrscheinlich Platzangst. Oder Angst zu platzen. Angst, unter Schlägen und Beschimpfungen zu zergehen und sich nicht mehr wiederfinden zu können. Nicht aufmucken, lieber schlucken. Bis es nicht mehr geht und entweicht: ins Bett oder als brutaler Hustenkrampf, der jeden normal Hörenden zu schlaflosen Nächten und Wutanfällen treibt. So ist das mit der Unterdrückung. Sobald du anfängst zu schlucken, kannst du darauf gefasst sein, dass das Maß irgendwann voll ist. Der Boden zerbricht, oder so einiges läuft oben über. Das ist dann ein ›Sich-Wehren‹, das leider völlig falsch verstanden bzw. überhaupt nicht verstanden wird. Ich höre meine Mutter stöhnen: »Diese ewige Husterei! Das ist ja zum Verrücktwerden!«
Kindheit ist auch Lachen! Im Sandkasten spielen, Rollschuh laufen, Roller fahren und Fahrrad fahren lernen. Tausend Strumpfhosen zerreißen und den mütterlichen Zorn als Preis für den wundervollen Tag in Kauf nehmen. Und Liebe!
Liebe ist, wenn Mama was Leckeres kocht und kind in die Stadt mitgenommen wird. Wenn kind auf der Kirmes ‘ne Zuckerstange bekommt, Weihnachten alles märchenhaft verzaubert wird, und kind mit ins Kino geht. Liebe ist, morgens ganz leise aufzustehen und den Tisch für Mama und Papa zu decken und sich hübsche Geschenke auszudenken. Liebe ist, wenn wir alle gut gelaunt in den Urlaub fahren.
Sehnsucht ist das Bedürfnis, zu spüren, wie jemand sagt: »Na Kleine, fühlst du dich wohl? Wir haben dich lieb. Ob du nun Schwarz oder weiß, dick oder dünn, dumm oder schlau bist, ich liebe dich! Komm auf meine Arme!« Sehnsucht ist, zu wissen, was du hören möchtest, und vergeblich darauf zu warten, dass du es gesagt bekommst. Traurig ist dann, wenn kind sich zu schwarz und zu hässlich findet. Entsetzen, wenn die Mama kind nicht weiß waschen will. Warum nicht? Es wäre doch alles viel einfacher. Auch die anderen Kinder würden nicht ›N…‹ oder ›N…kuss‹ rufen. Kind bräuchte sich nicht mehr zu schämen und besonders ordentlich oder artig zu benehmen. »Benimm dich immer schön anständig. Was man von dir denkt, denkt man von allen anderen Menschen mit deiner Hautfarbe!«
Das Leben ist mir zu schwierig.
1. Diese verfluchte Angst, alles falsch zu machen. Das nächtelange Heulen, wenn ich in der Schule was verloren habe. »Bitte, lieber Gott, mach, dass Mama und Papa mich nicht schlagen, wenn ich es ihnen sage.«
Das ständige Zittern aus Angst, was falsch zu machen und dann vor lauter Zittern doppelt so viel herunterschmeißen wie die anderen Geschwister. »Kein Wunder, dass mich niemand mag.«
2. Die verfluchte Grundschule mit den verdammten Hausaufgaben. Mama überwacht alles mit dem Kochlöffel, besonders die Rechenaufgaben. Wenn kind nicht schnell genug rechnet, kriegt es Schläge auf den Kopf; wenn die Aufgaben nicht sauber genug niedergeschrieben werden, wird die Seite herausgerissen. Bis auf die Pausen und den Sportunterricht mag ich die Schule nicht besonders. Warum darf ich nie jemanden einladen oder besuchen? »Lieber Gott, mach, dass Mama und Papa sterben und wir andere Eltern bekommen. Welche, die nur noch lieb sind.«
3. Meine Eltern sagen so oft, dass ich nichts kann, nichts bin und alles zu langsam mache. Ich nehme heimlich eine Rasierklinge von meinem Vater und verstecke sie unter meinem Kopfkissen. Die Angst und die Sehnsucht nach Selbstmord. – »Das Kind spielt mit Rasierklingen im Bett! Du bist wohl total verhaltensgestört. Weißt du denn nicht, wie gefährlich das ist? Dieses Kind treibt mich noch in den Wahnsinn!«
Einmal beschließe ich, von zu Hause wegzulaufen. Ich sage es meinem kleinen Bruder und verabschiede mich von ihm. Ich bin vielleicht neun und er fünf Jahre alt. Er erkennt den Ernst der Lage, fängt an zu heulen und verpetzt mich bei meinen Eltern. Man ist wieder ein bisschen netter zu mir. – »Lieber Gott, mach, dass ich einschlafe und nie mehr aufwache.«
4. Wer hat meinen Traum zerstört? Der Traum vom ›Weißsein‹ ist am ungenügenden Willen meiner Eltern und der mangelhaften Waschkraft von Seife gescheitert. Selbst Seife essen hat überhaupt nichts bewirkt. Der Traum vom ›Schwarzsein‹ ist an der leibhaftigen Erscheinung meines afrikanischen Vaters gescheitert. Zuvor mein Geheimnis: Wenn ich mal groß bin, gehe ich nach Afrika. Dort sehen alle aus wie ich. Wenn Mama, Papa und meine weißen Geschwister zu Besuch kommen, werden die Leute auf sie zeigen. Ich werde sie trösten und den Leuten sagen: »Tut das nicht!« Und meine Eltern werden verstehen, wie das für mich war in Deutschland.
Und siehe! Das ist mein Vater! Ganz schwarz. »Dagegen bist du weiß.« – »Sehen in Afrika alle Menschen so schwarz aus?« – »Na klar.« Ihr habt meinen Traum zerstört.
Einmal, als mein Vater zu Besuch kam, rannten alle Kinder weg. Dabei hatte er Bonbons für uns alle dabei. Vielleicht haben wir das Spiel ›Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?‹ zu oft gespielt: »Wenn er aber kommt?« – »Dann laufen wir.« Vielleicht saß auch die Impfung gegen die schwarzen Lügen, die schwarzen Sünden und den schwarzen Buhmann zu tief. Mein Bruder und ich wären auch gerne weggerannt, aber wir wussten, dass wir das nicht dürfen. Außerdem gab’s nette Geschenke.
Mein Vater war Onkel E. Er war Onkel E., weil er für meinen weißen Bruder Onkel E. war, und er war Onkel E., weil er für mich nicht mein ›Vater‹ war. Er blieb für mich Onkel E., auch als ich in Briefen an ihn irgendwann anfing, »lieber Vater« zu schreiben. Mein Pflegevater wünschte es so. Er meinte, dass E. sich darüber freuen würde. Da ich wusste, dass er weit weg war und bis auf Alle-paar-Jahre-einmal-Besuche immer weit weg bleiben würde, tat ich den beiden den Gefallen und schrieb: »Lieber Vater!« Ich schrieb vom letzten Urlaub, vom nächsten Urlaub, von Zeugnisnoten und immer vom Wetter. Mein Pflegevater achtete einige Jahre darauf, dass ich es vollständig machte.
Ich habe mich nie gefragt, ob ich auf meinen Vater stolz sein oder ob ich ihn verachten müsse. In all den wenigen Berichterstattungen erschien er als der positive, studierte Mann, der aus irgendwelchen Gründen ein Kind hatte, das er nicht selbst aufziehen konnte. Ich bat einmal um eine Geschichte über die Frau, die mich zur Welt gebracht hat. »Eine Frau? Ein Flittchen war das.« Ich fragte nie wieder.
In dem Gefühl des Ausgeschlossenseins drehte ich mich im Kreis. Besonders die Angst meiner Pflegeeltern, dass ich auf die »schiefe Bahn« geraten könnte, hielt mich gefangen. Die Befürchtung, dass ich schwanger nach Hause kommen könnte, war die Begründung für jedes Ausgehverbot. Ihre Sorgen und Ängste schnürten mir die Kehle zu. Bevor ich von zu Hause wegging, verbrachte ich ein schweigendes Jahr in meiner Familie, das den Bruch besiegelte.
Im Nachhinein weiß ich: Meine Eltern liebten mich. Sie haben mich in Pflege genommen, um den Vorurteilen in dieser Gesellschaft etwas entgegenzusetzen. Um mir die Chance auf ein Familienleben zu geben, das ich im Heim niemals gehabt hätte. Meine Eltern haben mich aus Liebe, Verantwortung und Unwissenheit besonders streng erzogen, geschlagen und gefangen gehalten. Im Wissen um die Vorurteile, die in der weißen deutschen Gesellschaft bestehen, passten sie ihre Erziehung unbeabsichtigt diesen Vorurteilen an. Ich wuchs in dem Gefühl auf, das in ihnen steckte: beweisen zu müssen, dass ein ›Mischling‹, ein ›N…‹, ein ›Heimkind‹ ein vollwertiger Mensch ist. Daneben blieb kaum Zeit und Raum, mein ›Ich‹ zu entdecken.
Es hat lange gebraucht, bis mir bewusst wurde, dass ich aus mir selbst heraus einen Wert habe. In dem Moment, als ich zu mir ›ja‹ sagen konnte, ohne den geheimen Wunsch nach Verwandlung, war die Möglichkeit gegeben, die Brüche in mir und meiner Umgebung zu erkennen, zu verarbeiten und aus ihnen zu lernen. Ich bin nicht an meinen Erfahrungen zerbrochen, sondern habe aus ihnen Stärke und ein besonderes Wissen gewonnen. Der Umstand, nicht untertauchen zu können, hat mich zur aktiven Auseinandersetzung gezwungen, die ich nicht mehr als Belastung, sondern als besondere Herausforderung zur Ehrlichkeit empfinde. Das immer wieder meine Situation Sichten- und Erklärenmüssen hat mir zu mehr Klarheit über mich selbst verholfen, bis zu der Erkenntnis, dass ich niemandem eine Erklärung schuldig bin. Ich hege keinen Groll gegen die, deren Macht und Ohnmacht ich ausgesetzt war und denen ich mich zeitweise unterordnete oder unterordnen musste. Ich habe oft etwas aus mir machen lassen, es liegt nun an mir, etwas aus dem zu machen, was man/frau aus mir gemacht hat.
Ich habe mich auf den Weg begeben.
May Ayim mit Vater Emmanuel Nuwokpor Ayim © privat
Drei afro-deutsche Frauen im Gespräch
Der Entstehung von Farbe bekennen gingen viele Treffen und Gesprächsrunden einer Gruppe von afro-deutschen Frauen voraus. Der folgende Text wurde nach einem solchen Gespräch von Laura Baum, Katharina Oguntoye, May Ayim (und Dagmar Schultz vom Orlanda Frauenverlag) geschrieben.
›Schönsein‹ – was heißt das?
Laura: Ich begegnete neulich zwei besoffenen Typen. Der eine meinte, als ich vorbeilief, zum anderen: »Guck mal!«, der andere: »Kohlenanzünder, hoffentlich brennt er.« Darauf sagte der eine: »Ach, die sieht doch gut aus«, und der andere antwortete: »Die ist doch nicht europäisch.«
Als farbige[2] Frau wirst du meistens als exotisch betrachtet, das entspricht auch dem üblichen Klischeebild, das überall verbreitet wird. Bei Männern ist das, glaube ich, anders.
Katharina: Da wir nicht als europäisch wahrgenommen werden, entsteht bei uns dieses Gefühl, anders zu sein.
Vorhin hast du von deiner Mutter erzählt, die gemeint hat, wenn du dich mehr ins Afrikanische entwickelst, also mehr afrikanisch als europäisch aussiehst, dass du dann weniger gemocht wirst. Ich erinnere mich daran, wie eine Freundin einmal zu mir sagte, ich würde doch bestimmt mehr meinem Vater ähnlich sehen. (Sie kannte weder meinen Vater, noch hatte sie je ein Bild von ihm gesehen.) Ich weigerte mich heftig, das anzunehmen, und war innerlich sehr verwirrt darüber, dass ich mich so dagegen sträubte. Denn ich weiß, dass ich meinem Vater ähnle und auch immer ein bisschen stolz darauf war.
Es war vielleicht so wie in der Situation mit den drei Typen: Ich habe mich dagegen gewehrt, in eine bestimmte Schublade gesteckt zu werden, und gleichzeitig fühlte ich mich schlecht dabei, weil ich mich damit auch von afrikanisch aussehenden Frauen abgegrenzt habe. Afrikanerinnen fallen aus dem europäischen Schönheitsideal raus; für sie gibt es nur die Rolle der exotischen ›Schönheit‹. Und so wollte ich nicht gesehen werden. Richtig in Wut bringt mich dabei, dass es mir in dieser Gesellschaft so schwer gemacht wird, Afrikanerinnen schön zu finden. Es gibt keine Worte, mit denen ich ohne diese ungleich bewerteten Ideale afrikanisches Aussehen bei Afrikanerinnen und auch bei mir beschreiben kann. – Nicht meine braune Haut gilt als schön, sondern meine hellbraune Haut … Mit meiner breiten Nase ging es mir ähnlich: Ich habe sie einerseits abgelehnt, weil sie mich afrikanischer macht, und andererseits hatte ich ein ungutes Gefühl dabei, weil mir breite Nasen bei anderen gefallen.
May: Ich habe lange dieses Bild mit mir rumgetragen, hässlich zu sein, weil ich afrikanisch aussehe. Irgendwann habe ich das glücklicherweise überwunden. Inzwischen würde ich sogar ganz gern ‘ne breitere Nase haben. Ich finde breite Nasen total super.
Allerdings hat es mich sehr bedrückt, als ich in Kenya festgestellt habe, wie unheimlich wichtig es dort ist, mindestens so wichtig wie hier, eine schmale Nase, glatte Haare zu haben und möglichst nicht so dunkel zu sein. Es gibt dort Cremes, um die Hautfarbe aufzuhellen, und für wichtige Feste versuchen die Frauen, mit heißen Kämmen ihre Haare zu glätten.
Zwei Schwestern, die ich kennenlernte, haben sich in Tansania unwohler gefühlt als hier – mehr beobachtet und mehr bewundert, dort eben aufgrund ihrer helleren Hautfarbe.
Katharina: Es muss für sie ganz schön frustrierend gewesen sein, wieder rauszufallen, gerade wenn die beiden geglaubt haben, dass sie in Tansania endlich einmal nicht mehr auffallen …
May: Ja, ihr Vater meinte, sie müssten sich für ein Leben hier in Deutschland oder in Afrika entscheiden, und in Afrika wäre es auf jeden Fall leichter für sie. Die beiden haben widersprochen und meinten, in Tansania hätten sie ständig ungewollt im Mittelpunkt gestanden.
Katharina: Das hat ja dann auch gar nichts mit dir selbst zu tun, sondern nur damit, wie hell oder dunkel deine Hautfarbe ist.
Dagmar: Du hast einmal gesagt, dass du dich jetzt als schöne Frau begreifst und dir das früher nicht so ging. Weißt du, wie und wodurch sich das geändert hat?
Katharina: Ich war ein hässliches Entlein, aber alle wussten, dass ich ein Schwan werde. Ich wusste nicht wie – ich war so klein und fett und hatte einen kurzen Hals, aber alle haben immer gesagt: »Du wirst eine schöne Frau.« War das bei dir anders?
May: Ja, das Dumme dabei war, dass zu der Zeit, als ich es nötig gehabt hätte, niemand zu mir gesagt hat, dass ich schön sei. Ich weiß noch, dass sich das geändert hat, als ich mich Hals über Kopf verliebt habe. Da ging’s mir total gut, und da fand ich mich dann auch schön. Ich weiß noch genau, dass ich mich damals irgendwo in einem Spiegel gesehen habe und mich schön fand. Aber ich glaube, das kam mehr aus einem inneren Gefühl heraus. Es ging mir gut, und die Welt war ziemlich rosarot. Zu der Zeit haben mir zum ersten Mal Leute gesagt, dass ich schön bin, auch Frauen.
Katharina: Es hat auch viel mit dem Gefühl zu dir selbst zu tun, wie häufig du solche Komplimente kriegst.
May: Ja, es ist oft so; wenn ich mich mies fühle und in den Spiegel gucke und denke: »Mein Gott, nee«, dann kommt meistens auch niemand auf die Idee, mir zu sagen, dass ich gut aussehe.
Laura: Von der Pubertät weiß ich von mir, dass ich mich total hässlich gefühlt habe. So hässlich, dass ich richtig Komplexe hatte, mich nicht auf die Straße getraut habe und verkrampft war.
May: Ja, und neulich habe ich mal wieder Bilder aus dieser Zeit, wo ich mich so hässlich gefühlt habe, gesehen. Da fand ich mich echt hübsch und war ganz erstaunt darüber.
Katharina: Bei mir war das eher umgekehrt: Ich finde mich auf den Bildern hässlich und kann überhaupt nicht verstehen, wieso Leute zu mir gesagt haben, dass ich schön sei. Vielleicht lag es auch an meinem sonnigen Gemüt und hatte mit dem Äußeren nicht so viel zu tun.
May: Mir wurde zwar nie gesagt, dass ich hübsch sei, aber ich habe mich dennoch zugehörig gefühlt, spürte, dass die anderen gerne mit mir zusammen waren, mich lustig fanden. Vielleicht spielten da auch mehrere Sachen zusammen. Z.B. haben mir meine Eltern nie erlaubt, Kleidung anzuziehen, die ›in‹ war. Ich musste immer die Sachen von einer entfernten Cousine nachtragen, die dreimal so dick war wie ich. Meine Oma hat kurz oben ein Gummiband reingezogen und fand das dann ›hübsch‹. Ich lief dann mit diesen Bottichen rum. Ich durfte auch keine langen Hosen anziehen und war immer ein bißchen ausgeschlossen, vor allem, weil es zu der Zeit sehr wichtig war, Jeans oder Cordhosen und nicht karierte Faltenröcke anzuziehen.
Laura: