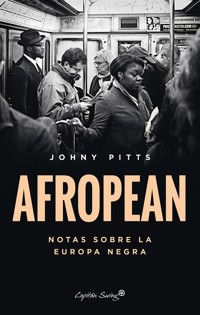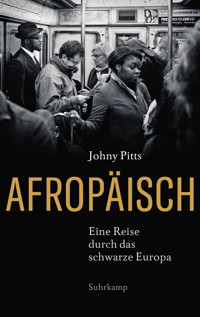
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Johny Pitts ist ein Bricoleur, ein erleuchteter, menschenfreundlicher Bastler im Lévi-Strauss’schen Sinne. Selbst Sohn einer weißen Arbeiterin aus Sheffield und eines schwarzen Soul-Sängers aus New York, dessen Mutter noch auf den Feldern South Carolinas Baumwolle pflückte, lässt er seine nachdenkliche, einfühlsame Reportage auch zu einer Suche nach der eigenen Identität werden.« Aus der Begründung der Jury des Leipziger Buchpreises zur Europäischen Verständigung 2021
Mit wenig Geld und einem Interrail-Ticket bereist Johny Pitts die Metropolen des Kontinents, um jener Lebenserfahrung nachzuspüren, die er als ›afropäisch‹ bezeichnet. In Paris, Berlin, Moskau oder Marseille trifft er Künstler und Aktivistinnen, aber auch Menschen, deren Alltag von Rassismus und Armut geprägt ist. Nicht nur in den französischen Banlieues und den Favelas am Rande Lissabons wird deutlich, dass Europas multikulturelle Gegenwart nach wie vor von seiner kolonialen Vergangenheit gezeichnet ist. Meisterhaft verknüpft Pitts Reportage und literarischen Essay zu einem zeitgenössischen Porträt eines Weltteils auf der Suche nach seiner postkolonialen Identität.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 629
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Titel
Johny Pitts
Afropäisch
Eine Reise durch das schwarze Europa
Aus dem Englischen von Helmut Dierlamm
Suhrkamp
Widmung
Für meine Eltern Richie und Linda und meine Geschwister Richard und Chantal
… Menschen, deren Existenz gewissermaßen von ethnischen, religiösen oder anderweitigen Grenzlinien durchzogen wird. Aufgrund dieser Situation, die ich mich nicht getrauen würde, »privilegiert« zu nennen, fällt ihnen die Rolle zu, Bande zu knüpfen, Missverständnisse auszuräumen, den einen gut zuzureden, andere zu mäßigen, zu schlichten. […] Und eben deshalb ist ihr Dilemma von so großer Tragweite: Wenn sich diese Menschen nicht zu ihren Zugehörigkeiten bekennen dürfen, wenn man unablässig von ihnen fordert, sich für eine Seite zu entscheiden […], dann müssen wir uns mit Recht Sorgen machen über den Zustand der Welt.
Amin Maalouf, Mörderische Identitäten
Übersicht
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Einleitung
Prolog: Sheffield
Paris
Eine Tour durch das schwarze Paris
Ein afropäischer Flaneur
Vier Tage in Clichy-sous-Bois
Brüssel
Matongé
Tervuren unzensiert
Ein Treffen mit Caryl Phillips
Amsterdam
Fight the Power
Berlin
Whitegeißt
Germaika
Stockholm
Lasst die Richtigen rein
Rinkeby-Schwedisch
Moskau
I Worry as I Wander
Fremde in Moskau
Marseille und die Côte d'Azur
Zwischenspiel in Rom
Joseph Mobutus Roquebrune-Cap-Martin
James Baldwins Saint-Paul-de-Vence
Frantz Fanons Toulon
McKays Marseille
Lissabon
Nachtzug nach Lissabon
Eine europäische Favela
Eine afropäische Odyssee
Dank
Fußnoten
Anmerkungen
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Einleitung
Als ich den Ausdruck »afropäisch« zum ersten Mal hörte, regte er mich dazu an, mich selbst als komplett und ohne Bindestrich zu begreifen. Hier war ein Raum, in dem das Schwarzsein an der Gestaltung einer allgemeinen europäischen Identität beteiligt war. Der Begriff eröffnete die Möglichkeit, in und mit mehr als einer Idee zu leben: Afrika und Europa oder, in einem weiteren Sinne, mit dem globalen Süden und dem Westen, ohne gemischt-dies, halb-jenes oder schwarz-anderes. Die Möglichkeit, dass schwarz zu sein in Europa nicht mehr unbedingt bedeutete, ein Immigrant zu sein.
Etiketten sind ausnahmslos problematisch und oft provokativ, aber im besten Fall können sie etwas sichtbar machen. Aus meinem eingeschränkten Blickwinkel – ich wuchs in einem Arbeiterviertel von Sheffield auf, das sowohl durch die externe Kraft der freien Marktwirtschaft verwüstet wurde als auch durch die interne, eigentlich schützende Kraft lokaler Isolation, die in Auseinandersetzungen zwischen den Bewohnern unterschiedlicher Viertel eine verheerende Gestalt annahm – erkannte ich allmählich eine Welt, die für mich zuvor unsichtbar oder wenigstens nicht plausibel gewesen war. In meiner kleinen Ecke von Großbritannien hatte ich das Gefühl gehabt, entweder zu stark gegen die eine Kultur reagieren oder mich zu stark mit der anderen identifizieren zu müssen.
Der Begriff »afropäisch« wurde in den frühen neunziger Jahren von David Byrne, dem ehemaligen Frontmann der New Yorker Band Talking Heads, und Marie Daulne, der belgisch-kongolesischen Frontfrau der Musikgruppe Zap Mama, geprägt und begegnete mir zunächst in den Bereichen Mode und Musik. Eine afropäische Ausstrahlung hatten neben vielen anderen Les Nubians, zwei in Frankreich bekannt gewordene Soul-Sisters aus dem Tschad, Neneh Cherry, deren Wurzeln in Schweden und Sierra Leone liegen, Joy Denalane, eine deutsche Soulsängerin mit südafrikanischen Wurzeln, und das Magazin Trace von Claude Grunitzky. Der Untertitel der Zeitschrift »Transcultural Styles and Ideas« entspricht der afropäischen Identität seines Schöpfers: Er hat mütterlicherseits einen polnischen Großvater, ist in Togo geboren, in Paris aufgewachsen und gründete das Magazin in London. Es war eine sehr attraktive Szene, die ich als afropäisch kennenlernte: schöne, begabte, erfolgreiche schwarze Europäer, die ihre kulturellen Einflüsse mühelos auf eine schlüssige und kreative Art zum Ausdruck brachten. Besonders attraktiv war diese Szene für mich, weil ich das Gefühl hatte, dass sich diese Ausprägung des in Europa existierenden Schwarzseins vermutlich selbst treu bleiben würde und dass sie sich heimatlicher anfühlte als die manchmal erdrückend dominanten afroamerikanischen Kunstformen und umfassender und nuancierter als die schwarze britische Szene, deren Selbstverständnis anfing, altmodisch zu wirken, und oft nur noch als Verkörperung der Windrush-Generation präsentiert wurde.1
Anfangs betrachtete ich den Begriff »afropäisch« als eine Art utopische Alternative zu der pessimistischen Stimmung, die in den letzten Jahren mit dem Bild der Schwarzen in Europa verbunden ist, als einen optimistischen Weg nach vorn. Ich wollte an einem Projekt arbeiten, das die Afropäer als bestimmende Akteure ihrer eigenen Geschichte miteinander verbindet und sie als solche Akteure präsentiert, und mit all diesen wunderbaren afropäischen Vorstellungen im Kopf stellte ich mir vor, dass dabei ein dekorativer Bildband mit Schnipseln von Feel-good-Texten als Erläuterung zu einer Serie schicker fotografischer Porträts herauskommen sollte. Das Buch sollte die »Erfolgsstorys« des schwarzen Europa bebildern: junge Männer und Frauen, deren Street-Style leicht und elegant ein selbstbewusstes schwarzes europäisches Gefühl artikuliert.
Ein Besuch im »Dschungel« von Calais brachte mich dazu, diesen Ansatz zu überdenken. Ich trank einen wohlriechenden arabischen Tee mit Milch bei Hishem, einem jungen Mann aus dem Sudan. Er lebte seit etwa zehn Monaten im Dschungel und betrieb dort eines von mehreren bemerkenswert gut organisierten Cafés. Er erzählte mir, dass er alles verloren hatte: Alle Mitglieder seiner Familie waren tot, ihn plagten leidvolle Erinnerungen an die Vergangenheit und furchterregende Visionen von der Zukunft. Er sei in einem Schwebezustand zwischen Afrika und Europa hängengeblieben – zwischen seiner Heimat (von der er in seinem mit Kissen ausgelegten Café wunderbarerweise ein kleines Stück wiederhergestellt hatte) und dem Unbekannten. Bevor ich seine knarrende Sperrholzbude wieder verließ, sagte er mir, ich solle über seine Geschichte und das Leben im Dschungel schreiben, eine Bitte, die mir großes Unbehagen verursachte. Hishem war intelligent, wortgewandt und gebildet: Wäre es nicht besser, wenn er selbst über den Dschungel schreiben würde? Vielleicht konnte ich Aufmerksamkeit für seine Geschichte wecken und sie auf meiner Website publizieren. Was aber wusste ich selbst darüber, wie es ist, mit ansehen zu müssen, wie die eigenen Freunde massakriert werden, vor einem Krieg zu fliehen und sich in einem Schiffscontainer zu verstecken oder in einem schlecht ausgerüsteten Boot über das Meer zu fahren und schließlich völlig mittellos in einer Siedlung windschiefer Hütten im nordfranzösischen Hinterland anzukommen. Was wusste ich persönlich mehr darüber, als er mir erzählt hatte?
Wir tauschten unsere Kontaktdaten aus, und ich verließ den Dschungel auf meinem Fahrrad. Ich registrierte, dass mir Beamte der Gendarmerie nationale, einer den französischen Streitkräften zugehörigen Polizeitruppe, durch die windgepeitschten Straßen von Calais folgten. Bei dem Versuch, die weißen Tore zum Hafen zu passieren, um mit der Fähre zurück nach England zu fahren, wurde ich noch vor der Passkontrolle gestoppt und durchsucht. Ich musste mich ausweisen, wurde gefragt, wohin ich wolle, woher ich käme und wie lange ich im Ausland gewesen sei und warum. Schließlich, nach weiteren Fragen und misstrauischen Blicken, durfte ich den offiziellen Bereich betreten, zu dem ich andere braunhäutige Menschen meines Alters aus der Entfernung voller Sehnsucht hatte hinüberschauen sehen. Ich war drin, sie waren draußen.
Im Gegensatz zu den Menschen, die ich im Dschungel kennenlernte, lebte ich nicht in einem Schwebezustand, sondern in einem Schwellenzustand. Ich war »drinnen«, weil ich einen Ausweis hatte, und ich hatte einen Ausweis, weil ich in England geboren und aufgewachsen war, eine mit Europa verknüpfte Geschichte besaß und wusste, wie es dort lief. Aber dennoch wurde ich innerhalb dieses geografischen Bereichs, dieser Idee von Europa, häufig daran erinnert, dass ich nicht ganz drinnen war. So hatte ich den Remembrance Day (den Gedenktag für die Gefallenen der Weltkriege in Großbritannien am 11. November) zu fürchten gelernt, weil er oft einen hässlichen Nationalismus zum Vorschein brachte, für dessen Aggressionen ich manchmal als Zielscheibe diente. Einmal an diesem Feiertag traktierte mich ein Mann mittleren Alters, das Gesicht rot vor Wut und Rassismus, wieder einmal mit dem alten Spruch, ich solle »dahin zurück, wo ich herkam«. Meine Hautfarbe hatte mehrere Tatsachen verborgen, unter anderem, dass mein Großvater im Zweiten Weltkrieg hinter den feindlichen Linien gekämpft und dafür einen Orden erhalten hatte. Meine Haut hatte mein Europäischsein verborgen; »europäisch« war immer noch ein Synonym für »weiß«.
Wenn »afropäisch« ein Begriff war, mit dem man diesem Problem beikommen konnte, dann musste ich herausfinden, was sich hinter dem bloßen Markenzeichen »afropäisch« oder jenseits davon verbarg. Ja, es war ein größtenteils von Schwarzen ausgedachtes und geprägtes Markenzeichen, aber mehr auch nicht, eine angenehme Idee, die einem verkauft wurde und etwas mit Werbefirmen, Stilistinnen, Modefotografen und Ausstattung zu tun hatte. In Großbritannien war es diese Vision eines unternehmerischen Multikulturalismus, diese Fassade der Inklusion, mit der Tony Blairs New Labour versucht hatte, das Land international, weltoffen, fortschrittsorientiert und bereit für das Geschäft in der globalisierten Welt erscheinen zu lassen, ohne dabei politische Schritte für eine langfristige Änderung des britischen Umgangs mit den Immigranten in die Wege zu leiten. Fielen unter den Begriff »afropäisch« nur schöne, erfolgreiche (und oft hellhäutige) Schwarze?
»Afropäisch« als Ziel war eine Sache, aber als ich über eine Wechselbeziehung zwischen schwarzen und europäischen Kulturen schrieb, erkannte ich, dass diese utopische Vision einer schwarzen europäischen Erfahrung bedeutet hätte, die Realitäten bewusst auszuklammern, von denen eine Mehrheit der in Europa lebenden schwarzen Menschen betroffen sind: die Nichtbeachtung der verschiedenen Gruppen arbeitsloser schwarzer Männer, die ich auf den Bahnhöfen sah, der afrikanischen Toilettenfrauen und der Communitys von Entrechteten, die im Hinterland der Städte völlig unsichtbar um ihre Existenz rangen. Auch wäre es mir unredlich erschienen, meine eigene kulturell reichhaltige, aber ebenfalls nicht so glamouröse Erfahrung einer Jugend im multiethnischen Großbritannien außer Acht zu lassen oder nicht zu schildern, wie es mir als Mensch, der sich als schwarz identifiziert, bei meiner Reise durch Europa erging. Mir wurde klar, dass ich dem Leser mitteilen musste, wo ich herkam, damit er besser verstehen konnte, wohin ich wollte, nämlich in jene schlecht dokumentierten Regionen Europas, die zu dem von Fremdenverkehrsbüros und Taschenreiseführern geprägten vereinheitlichten Bild oft im Widerspruch stehen. Ich reiste außerdem in einer Zeit, in der ein »Gegenangriff gegen den Multikulturalismus« den Kontinent überrollte, der Menschen wie mich als eine Art gescheitertes befristetes Experiment betrachtete. Deshalb hatte ich das Gefühl, mich neu organisieren und meine eigene Pluralität behaupten zu müssen, mit dem größeren Ziel, zu vermitteln, dass der Multikulturalismus jenseits der reaktionären Presse als der sehr reale Multikulturalismus meiner eigenen Herkunft und der ebenso reale Multikulturalismus in den Straßen europäischer Städte funktionierte. »Afropäisch« musste also, um den Labour-Abgeordneten Jon Cruddas zu paraphrasieren, mehr sein als eine Besessenheit von der Suche nach dem authentischen Selbst und eher ein Beitrag zu einer Gemeinschaft mit allen notwendigen Kompromissen und Abstrichen. Der Begriff musste eine Brücke über den Zaun bauen, der bestimmte, ob man drinnen oder draußen war, und eine Art informelle kulturelle Koalition herstellen.
Ich las eine Menge wertvolle akademische Forschungsberichte und soziologische Abhandlungen, aber allzu viele Schriften verstaubten in den Universitätsbibliotheken, rannten offene Türen ein. Oder sie stammten von besserverdienenden, weißen Wissenschaftlern und nicht von den Menschen, über die geschrieben wurde, und waren in einem hochnäsigen akademischen Jargon verfasst. Offizielle Wissenschaft wird oft mit fremdem Wissen betrieben: Wer autorisiert und formt ihre Sprache? Wessen Wissen wird vermittelt? Wer hat Zugang dazu? Was ist mit dem schwarzen Europa jenseits des universitären Schreibtischs, das in den mehrdeutigen und unordentlichen gelebten Erfahrungen seiner Communitys steckt? Mit dem schwarzen Europa unten auf der Straße?
Ich hatte keine andere Wahl, als einen subjektiven Blick durch die Zwischenräume zu werfen und mich daran zu erinnern, dass ich nicht versuchen wollte, den Begriff »afropäisch«, der gut zu meinen eigenen Erfahrungen passte, irgendwie autoritativ in den Diskurs über racial politics einzuführen. Ich hatte den Eindruck, dass allzu viele »Big-Picture«-Bücher über das Thema race geschrieben wurden, während der alltägliche Dialog im Begriff war, zusammenzubrechen, während es der Interaktion in den sozialen Medien an Humor und gutem Willen fehlte und während Autoren und Blogger sich als unfehlbare Sprecher ihrer jeweiligen Gruppe präsentierten. Dieses Buch ist ein Versuch, die Reisereportage als Möglichkeit zu nutzen, sich vom Druck der Theorie zu befreien und die geheimen Freuden und Vorurteile anderer, aber auch meine eigenen, also das menschliche Selbst, ehrlich zu enthüllen. Ich will durch sie lernen, mit dem eigenen Schwarzsein und der eigenen Unvollkommenheit, wie sie auf dem Papier erscheinen, zufrieden zu sein. Und sie ist ein Versuch, mit dem Persönlichen zu beginnen, um zum Universellen zu gelangen.
In diesem Buch schildere ich viele Begegnungen mit Machern: Künstlern, Denkern, Modeschöpfern, Intellektuellen, Schriftstellern und Akademikern, aber viele der Geschichten, die ich gefunden habe, sind auch denkbar weit entfernt vom Glanz der Coffee-Table-Books. Sie handeln von Süchtigen, Obdachlosen, Dieben, Drogenhändlern und politischen Aktivisten. Und noch etwas ist mir wichtig. In dem Song »Thieves in the Night« rappt Mos Def über die Darstellung Schwarzer in den Medien: »We're either niggas or kings, we're either bitches or queens«. Mir scheint es, dass schwarze Menschen im Europa von heute entweder als überstilisierte Retro-Hipster-Dandys mit dick umrandeten Brillen und irgendeinem Kleidungsstück aus Kente-Stoff oder als gefährliche Kapuzenpullis tragende Ghetto-Kids dargestellt werden. Zwischen diesen Extremen des Schwarzseins liegt vermutlich die wichtigste Inklusion dieses Buchs: Zufallsbegegnungen mit normalen Frauen und Männern, mit Arbeitern, Straßenhändlern, Fremdenführerinnen, Studierenden, Rausschmeißern, Aktivistinnen, Musikerinnen, Jugendarbeitern und anderen Menschen, mit denen ich in Cafés, Gemeinschaftszentren und Hostels ins Gespräch kam und die alle ihre Alltagserfahrungen etwas unterhalb eines erhabenen Narrativs enthüllten: Schönheit in schwarzer Banalität. Da meine Reisen nicht von einer Akademie finanziert waren oder beurteilt wurden und ich die protzigeren Hotels in Europa weitestgehend mied (meiden musste), kam diese Arbeitsweise auch praktischen Erwägungen entgegen. Dieses Buch beruht auf einer durch ein unabhängiges schwarzes Budget finanzierten Reise. Es ist ein Bericht über die unabhängige Reise eines Schwarzen aus der Arbeiterklasse.
Das Bild, das ich am Ende hatte, war eine Art beflecktes Utopia. Ein Ort des Kampfes und der Hoffnung, der großen Dramen und der stillen Nuancen, der Schlussfolgerungen und der Mehrdeutigkeit, der Verbindungen und der Gegensätze. Aber stets gab es Humor und Menschlichkeit in meinen Begegnungen und Wechselbeziehungen. Um Robert Frost zu paraphrasieren: Mein Streit mit dem Kontinent ist der Streit eines Liebenden. Ich bin ausgiebig auf der ganzen Welt gereist, auch nach Westafrika, wo mein Schwarzsein seine Wurzeln hat, und nach Brooklyn, zum Treibhaus jener schwarzen Kultur, die mich unendlich inspiriert hat und wo mein Vater geboren wurde. Dennoch fühle ich mich nirgends so zuhause wie in Europa. Hier habe ich schreiben und lesen gelernt, und auch wenn ich nicht immer den richtigen Lesestoff hatte, spreche ich doch seine Sprachen und pflege einige seiner Bräuche. Und ich erfreue mich an der raffinierten und manchmal verblassten Schönheit seiner alten Architektur, an den gratis zugänglichen Museen und Galerien, die ihre Existenz freilich oft dem Blut und der Mühe verdanken, die schwarze Männer und Frauen ausbeuterischen Imperien opfern mussten. Oder wie es der Dichter und Politiker Aimé Césaire aus Martinique so wunderbar ausgedrückt hat:
Et je me dis Bordeaux et Nantes et Liverpool et New York et San Francisco pas un bout de ce monde qui ne porte mon empreinte digitale et mon calcanéum sur le dos des gratte-ciel et ma crasse dans le scintillement des gemmes!
Und ich sage mir, Bordeaux und Nantes und Liverpool und New York und San Francisco, Kein Zipfel der Welt, der nicht meinen Fingerabdruck trüge und mein Fersenbein auf dem Rücken der Wolkenkratzer und meinen Unrat im Gefunkel der Gemmen!)2
Weil ich zur schwarzen Community Europas gehöre, ist das Europa, von dem ich spreche, auch ein Teil meines Erbes, und es war Zeit für mich, den Kontinent zu bereisen und zu feiern, als ob er mir gehörte. Ein Kontinent, der, um Césaires Protegé Frantz Fanon zu zitieren, »mich aus tausend Details, Anekdoten, Erzählungen gesponnen hatte«.3 Ein Europa, das, wie ich sehen sollte, von ägyptischen Nomaden, sudanesischen Gastronomen, schwedischen Muslimen, schwarzen französischen Aktivisten und belgisch-kongolesischen Malern bevölkert ist. Ein Kontinent mit kapverdischen Favelas, algerischen Flohmärkten, surinamischem Schamanismus, deutschem Reggae und maurischen Burgen. Ja, all das gehört auch zu Europa. Und all diese Bereiche müssen verstanden und einbezogen werden, wenn sich Europa voll funktionsfähiger Gesellschaften erfreuen möchte. Und auch wir schwarzen Europäer mussten Europa verstehen und die Teilnahme an seinen Gesellschaften einfordern, das Recht, unsere eigenen Geschichten zu dokumentieren und zu verbreiten.
Allerdings wird in meinem Buch, womöglich zur Enttäuschung mancher Leser, einiges ausgelassen, das eng mit der Erfahrung der Schwarzen in Europa zusammenhängt. Ein Beispiel ist die Rolle der Kirchen für den Zusammenhalt der Communitys. Als ein Mensch, der zwar ein positives Verhältnis zur Spiritualität hat, aber nicht religiös ist, kam ich zu dem Schluss, dass ein anderer, der eine engere Beziehung zu den von der Religion aufgeworfenen Fragen hat, ein Buch schreiben sollte, das sich allein diesem Thema widmet. Aus ähnlichen Gründen habe ich weniger über den Islam geschrieben, als möglich gewesen wäre; auch dieses Thema schien mir den Rahmen meines Reiseberichts zu sprengen.
Als ein schwarzer Nordengländer, der über das frustriert ist, was ich manchmal als die Brixtonisierung des schwarzen Großbritannien bezeichne, nämlich die Reduzierung der schwarzen britischen Erfahrung auf ein einziges, sauberes an London orientiertes Narrativ, finde ich es bedauerlich, dass ich aus Zeit- und Geldmangel meine Rundreise auf dem Kontinent fast gänzlich auf die größten Städte jedes Landes beschränken musste. So steht in meinem Buch zum Beispiel nichts über die britischen Städte Liverpool, Cardiff, Southampton oder Bristol (Bristol ist vermutlich die Stadt, aus der mein Nachname stammt, nämlich von einem gewissen Robert Pitts aus Bristol, der im heutigen South Carolina, in das ich meine schwarzen amerikanischen Wurzeln zurückverfolgen kann, Sklaven und Plantagen besaß) oder über vergleichbare Städte und Gebiete auf dem europäischen Festland, die viel mit der jahrhundertelangen Präsenz von Schwarzen in Europa zu tun haben. Großstädte sind dynamische Treffpunkte für Menschen jeden Hintergrunds, sie haben oft die ältesten und etabliertesten schwarzen Communitys, und sie passen zur Atmosphäre eines Buches, das sich vorwiegend mit dem schwarzen Europa der zweiten, dritten und heutigen Generation befasst und seinerseits darauf abzielt, eine verbindende Geschichte und Wissensbasis für neuere Ankömmlinge wie Hishem zu schaffen.
Einige große Hauptstädte, insbesondere in Ost- und Südeuropa, wie Wien, Warschau, Rom und Madrid, fehlen ebenfalls oder nehmen viel weniger Raum ein, als ich mir gewünscht hätte. Auch hätte ich mich gern mit der Geschichte der Mauren in Montenegro befasst oder mit der Verbindung, die das damalige Jugoslawien durch die Bewegung der Blockfreien Staaten zu Afrika aufbaute, als es versuchte, durch seine Rolle als Gegengewicht gegen die Hegemonie der Ost- oder Westmächte, transnationale Freundschaften mit anderen Ländern zu stiften. Ich habe mein Bestes versucht, ein faires und ausgewogenes Bild des zeitgenössischen Lebens im schwarzen Europa zu zeichnen, durfte mich jedoch nicht von der, wie James Baldwin es nannte, »Last der Repräsentation« erdrücken lassen.4 Ich kann nur hoffen, dass die Leser das Werk eines schwarzen Autors zu würdigen wissen, das weitgehend unabhängig von offiziellen Organisationen, Gremien oder akademischen Institutionen entstanden ist. Außerdem möchte ich jeden, der über die von mir gelassenen Lücken unglücklich ist, ermutigen, zu der laufenden Debatte auf Afropean.com beizutragen. Wir haben dort Essays von Autorinnen und Autoren mit persönlichen afropäischen Erfahrungen publiziert, die unter anderem in der Slowakei, auf der Isle of Wight, in Barcelona, Genf und Wien sowie auf dem afrikanischen Kontinent aufgewachsen sind. Schließlich könnte man die Frage stellen, wo denn der europäische Teil in afropäisch sei. Dies ist eine ähnliche Frage wie die, warum es in Großbritannien einen Black History Month, aber keinen Monat der weißen Geschichte gibt, was wiederum der Frage gleicht, warum es in London eine Chinatown, aber keine Englandtown gibt. England und die Weißen sind so allgegenwärtig, dass sie unsichtbar sein können. Die weiße Geschichte wird nicht als weiße Geschichte vermittelt, weil sie einfach »die Geschichte« ist – sie dominiert das Fernsehen und die Lehrpläne, und wir sind überall mit ihr konfrontiert. Ich habe in einer europäischen Sprache geschrieben, bin durch die Straßen Europas gereist und habe mich unablässig mit der europäischen Geschichte auseinandergesetzt, obwohl ich weder Anthropologe noch Historiker bin, sondern Schriftsteller und Fotograf. Außerdem bin ich ein schwarzer Staatsbürger, der heute in Europa lebt, und meine Reise war ein Versuch, dem einen Sinn abzugewinnen. Deshalb habe ich mich mit meiner braunen Haut und meinem britischen Pass, der, während ich dies schreibe, immer noch eine Freifahrkarte für das europäische Festland darstellt, an einem kalten Oktobermorgen auf die Suche nach den Afropäern gemacht.
Prolog: Sheffield
Ich wurde im Norden von Margaret Thatchers England als schwarzes Mitglied der Arbeiterklasse geboren.
Firth Park in Sheffield, das Gebiet, in dem ich aufwuchs, ist nach Mark Firth benannt, einem wichtigen Stahlindustriellen während der industriellen Revolution. Seine Familie besaß außerdem einen Teil der einst weltbekannten Besteckfirma Firth Browns, in der Generationen meiner Familie beschäftigt waren. Firth Park wurde in den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts gebaut, damit die Arbeiter mit ihren Familien in der Nähe ihrer Arbeitsstätten wohnen konnten. Die britischen Kolonien hatten zuvor schon Soldaten zur Verstärkung für die britischen Streitkräfte entsandt, und als es Großbritannien nach dem Zweiten Weltkrieg an Arbeitskräften fehlte und das Land einen kostengünstigen Wiederaufbau anstrebte, öffnete es seine Tore für seine kolonialen Untertanen, um mit ihrer Arbeitskraft die Lücken auf dem Arbeitsmarkt zu stopfen. Dabei übersah die britische Nachkriegsregierung allerdings, dass es nicht so leicht sein würde, die angeworbenen Arbeiter wieder zu vertreiben, wenn sie ihren Dienst getan hätten. Großbritannien hatte einen beachtlichen Teil der Welt erobert, und die Kolonialisierung oft damit gerechtfertigt, dass es die Kolonialisierten »zivilisierte«, also »Briten aus ihnen machte«. Angesichts dieser Geschichte waren die Arbeiter aus den Kolonien nicht nur der Ansicht, dass sie sich das Recht zu bleiben verdient hätten, sondern einige dieser ersten Immigranten sahen sich sogar als Briten, die in ihr Heimatland zurückgekehrt waren. Man hatte ihnen beigebracht, englisch zu sprechen, zu handeln und zu denken, und sie in britischer Geschichte unterrichtet. Dagegen waren ihre eigenen Überlieferungen, ihre eigenen Religionen, ihr eigenes Wissen aus ihren Heimatländern und die Erfahrungen ihrer Vorfahren verschüttet und entwertet worden. Als der Krieg vorbei war und das normale Leben langsam wieder begann, stieß die Anwesenheit schwarzer und asiatischer Männer und Frauen in Großbritannien auf Widerstand, und kaum jemand fragte sich, warum diese neuen Communitys überhaupt da waren. Sie waren natürlich da, weil Großbritannien zuerst dort gewesen war.1
Mehrere aufeinanderfolgende britische Regierungen versäumten es, dies ordentlich zu erklären. Die Abgeordneten in Westminster hatten nicht direkt mit den Neuankömmlingen zu tun, mussten nicht mit ihnen zusammenarbeiten und nicht den guten Willen aufbringen, den man braucht, wenn man mit Nachbarn aus einer anderen Kultur Kontakt haben will. Der Bau solcher Brücken oder manchmal auch die Weigerung, sie zu bauen, blieb den Arbeitern überlassen. Oder zynischer ausgedrückt: Die neuen Communitys waren sichtbare Sündenböcke, denen man nach Belieben für jeden gesellschaftlichen Missstand die Schuld in die Schuhe schieben konnte. Macht, Einfluss und Wohlstand Großbritanniens waren nach dem Zweiten Weltkrieg geschrumpft, aber statt nach den wahren Ursachen zu suchen, konnte man für die hohe Arbeitslosigkeit, das sinkende Bildungsniveau und die erschütterte nationale Identität einfach die ein bisschen anders aussehenden und sprechenden Leute vom anderen Ende der Straße verantwortlich machen. Wie es bei Immigranten der ersten Generation oft der Fall ist, zeigten die ersten schwarzen Menschen in Nordengland, die in kleineren Enklaven des Andersseins überleben mussten als ihre Londoner Schicksalsgefährten, generell Wohlverhalten und taten alles, um sich in ihrer neuen Heimat zu integrieren und beliebt zu machen.
Ich erinnere mich, wie ich einmal den weißen Bruder einer ehemaligen Freundin von mir besuchte, der bei einem Friseur in Barnsley arbeitete. Ich zog zwar zunächst ein paar neugierige Blicke auf mich, aber dann konnte ich mich setzen und in Ruhe warten, bis mein Freund mit der Arbeit fertig war, weil die Leute mir, obwohl ich der einzige schwarze Mensch im Raum war, kaum mehr Beachtung schenkten. Etwa eine halbe Stunde nach mir betrat Charlie Williams, der berühmteste schwarze Komiker, den der englische Norden je hervorgebracht hat, den Laden, erspähte mich sofort, zeigte auf mich und brüllte: »Sieh mal an, mein Cousin!«, und alle brachen in Gelächter aus. Er bekam ein Stück Schokolade aus einer offenen Schachtel auf einem Kaffeetisch angeboten und sagte: »Na gut, ich nehm eins, damit ich nicht die Farbe verliere.« Williams nutzte seinen Humor als Entschuldigung für unsere sichtbare Andersartigkeit, weil er fand, dass er den Elefanten im Raum thematisieren musste, bevor sonst jemand Gelegenheit dazu bekam. Das heißt, er machte eigentlich eine ähnliche Aussage wie der Südasiate in Andrea Dunbars Theaterstück Rita, Sue and Bob Too, wenn dieser sagt: »Ich kann nicht anders, als Paki zu sein.«
Ich verspürte niemals das Bedürfnis, mich für meine Anwesenheit zu entschuldigen. Die multikulturelle Struktur von Firth Park, wo ich aufwuchs, umfasste nicht nur eine Community weißer Arbeiter, sondern auch etablierte Communitys von Jemeniten, Jamaikanern, Pakistanern und Indern und später auch Communitys mit wirtschaftlichen und politischen Flüchtlingen neueren Datums aus Syrien, Albanien, dem Kosovo und Somalia. Mein Kinderschlafzimmer war jahrelang eine Art Ehrenloge für das Straßentheater des Viertels. Dort sah ich alles: Feste wie Diwali und Eid, Reggae-Partys, Joyrider, Bandenkriege, Rap-Battles, jemenitische Hochzeiten und immer wieder mal »Prince« Naseem Hameds roten Ferrari, der vor dem Nachbarhaus parkte (unser Nachbar Mohammed war mit dem Profiboxer verwandt). Firth Park war kein multikulturelles »Utopia« im konventionellen Sinne, doch es war lebendig und gesellig, unternehmerisch und dynamisch, getragen von der toleranten Atmosphäre, die entsteht, wenn ein Raum täglich von Menschen unterschiedlichen Glaubens und unterschiedlicher Kultur geteilt wird. Ich war stolz darauf, aus Firth Park zu stammen, da viele der benachbarten homogenen weißen Gebiete mit sozioökonomisch ähnlich schlechtem Status von Langeweile, Depression, Paranoia und Demoralisierung zerfressene postindustrielle Kadaver waren. Firth Park dagegen war alles andere als langweilig. Es war hart, aber voller Kultur und Gemeinschaftsgeist.2
Mein Nachbar Mohammed war mehr ein älterer Bruder als ein Nachbar für mich. Er gehörte einem größeren Netzwerk von Leuten an, die sich umeinander kümmerten. Seine Familie gab mir zu essen, machte mit mir Ausflüge kreuz und quer durch das Land und gab mir stets Rückendeckung, wenn ich mit einer der härteren Familien in der Gegend Schwierigkeiten bekam. Ich verehrte Mohammed, weil er immer cool und clever und charmant war und in der Community großen Respekt genoss. Als junger Mann war er nicht nur ein guter Fußballer und ein ziemlicher Frauenheld gewesen, sondern auch, was ihm die größte Bewunderung einbrachte, der lokale Champion in Street Fighter 2, das man an einem einsamen Videospiel-Automaten im Kenya Fried Chicken spielen konnte. Mohammed war jemenitischer Abstammung, gehörte aber kulturell zu dem großen ideologischen Konstrukt der »Blackness«, dessen Grundlagen in den siebziger und achtziger Jahren gelegt wurden und das in den neunziger Jahren in der Hip-Hop-Kultur Früchte trug. Es war Mo, der mich in den Hip-Hop und alles, was damit zusammenhing, einführte und der mir raubkopierte VHS-Kassetten von Wild Style!, Der Exorzist und Scarface und von billigen chinesischen Kung-Fu-Filmen vorspielte (dem Quellenmaterial, auf das sich damals jedes Hip-Hop-Album zu beziehen schien). Außerdem brachte er mir bei, einige der Kraftausdrücke aus diesen Filmen auf Arabisch zu wiederholen. Auch das Schachspiel und die Freuden der arabischen Küche lernte ich durch ihn kennen. Ich aß Kohbs, Lahme und Aseeda, wohingegen ich sonst von einer Diät aus Findus Crispy Pancakes, Mars-Riegeln und Pommes vom Imbissstand gelebt hätte.
Am meisten beeindruckte mich an Mo, dass er seinen arabischen Wurzeln treu blieb und sich dennoch in die Community der weißen Arbeiterschaft integrierte, und zwar ohne ein Clown im Stil Charlie Williams' zu sein. Viele andere ethnische Minderheiten der zweiten Generation erwarben sich in unserer Gegend den Respekt der Weißen durch brutale Gewalt: Was sie nicht bekamen, nahmen sie sich, und sie wurden gefürchtet. Mo dagegen fand ein positives Mittel. Er überlebte, ohne seine Integrität zu verlieren, und feierte sein jemenitisches Erbe, indem er es irgendwie relevant und sogar attraktiv für Weiße machte und indem er verschiedene Kulturen gekonnt zu einer zusammenmischte, mit der er arbeiten konnte. In dieser Beziehung war er ganz ähnlich wie der Boxer Prince Naseem, der nach einem Kampf eine Mischung aus jamaikanischem Patois, afroamerikanischem Ebonics und einem ausgeprägten Sheffielder Arbeiterdialekt sprach, bevor er Allah für seinen Sieg dankte, als ob es das Natürlichste von der Welt sei, all diese Dinge miteinander zu verbinden. Und genau das war es natürlich auch. Charlie Williams war in den vierziger Jahren noch eine Art Anomalität auf den Straßen von Yorkshire; Naseem Hamed war es in den neunziger Jahren nicht.
Im Gegensatz zu einigen der weißen »Problemfamilien« (wie meine Mutter sie nannte) hatte Mohammeds Familie einen positiven Einfluss auf mich, was die Solidarität mit der Community, kultivierte Gespräche und die hohe Bewertung von Spiritualität und Bildung betraf. Unser Umgang hatte eine lockere Street-Culture-Fassade, doch sein Zuhause und seine Gewohnheiten waren von Wissen, Bildung und Kunst geprägt, und das trug zu meiner Allgemeinbildung bei, wo die Schule versagte. Schließlich ist der Islam eine Buchreligion, in der Wissen hoch geschätzt wird.
Die jemenitische und die jamaikanische Community hatten es irgendwie geschafft, ein Stück Großbritannien zurückzuerobern und es nach ihrem eigenen Bild zu formen, indem sie eine Kunst, eine Kultur, einen intellektuellen Diskurs und, trotz widrigster Umstände, eine eigene Form von Leben entwickelten. Es war dieser lebendige, atmende Multikulturalismus der Straße, der zunächst ausgenutzt, übernommen oder studiert und dann von Politikern, Akademikern und Theoretikern aus einer verzerrenden Distanz heraus entweder oberflächlich verklärt oder grausam verteufelt wurde. Tony Blairs New Labour war natürlich ein Fortschritt im Vergleich zur Politik von Margaret Thatcher, aber allzu oft nur auf der symbolischen Ebene. Doch diese lokale Community, die wunderbarerweise einen authentischen und bereichernden Lebensstil geschaffen hatte – also genau das, was ihr systematisch verweigert wurde –, konnte sich nur eine beschränkte Zeit halten, bis sie dem externen Druck von rassistischer Benachteiligung, Klasse und Geografie erlag. Das war der Grund, der mich zwang, nach einer Energie jenseits der Liebe zum Lokalen und der abgehobenen Distanz des Nationalen und Globalen zu suchen – nach einer kaum wahrnehmbaren, translokalen Energie, die letztlich Gemeinschaft mit einer größeren schwarzen europäischen Diaspora stiftete. Diese Energie hat mir im Lauf der Jahre geholfen, das Gleichgewicht zu wahren und die eher lähmenden Aspekte meiner Adoleszenz zu überwinden. Ich hatte erlebt, wie viele meiner Kameraden nach und nach einer Art Partizipationserschöpfung erlagen, weil die Magie, die unter dem Partizipationsdruck entstand, ohne zusätzliche Nahrung zu anstrengend wurde.
An diese Tatsache wurde ich brutal erinnert, als ich vor dem Aufbruch zu meiner Tour durch Europa in London die Zelte abbrach und noch einmal bei meiner Mutter in Sheffield wohnte. Dort wurde ich eines Morgens durch folgende Auseinandersetzung geweckt: »Ich hätte dich oft genug einbuchten lassen können, habe ich aber nicht. Und das nicht, weil ich auf Crack bin, du Idiotin.« Das kam von Tina, einer Jamaikanerin, die drei Reihenhäuser neben uns wohnte. Ich griff nach meinem Smartphone und checkte die Zeit: 7:15 Uhr. Dann linste ich durch die Jalousie auf die Horninglow Road hinaus, ein Blick, den ich besser kenne als jeden anderen. Das Fenster war vom Morgenfrost mit einer dünnen Eisschicht überzogen, und durch sie hindurch sahen die Reihenhäuser in der Mischung aus dem Blau der Morgendämmerung und dem Gold der Straßenlaternen beinahe malerisch aus. Tina zankte sich mit einer jüngeren Frau Anfang zwanzig, die aus einer allgemein bekannten weißen Familie stammte, und der Streit war noch nicht zu Ende.
»Hör mal, du kleine Schlampe. Was glaubst du eigentlich, wer du bist?«, schrie Tina, die einen großen Stock in der Hand hatte.
»Tina, du Mongo, gib mir meine Tasche zurück, oder es gibt richtig Ärger«, fauchte die weiße Frau im harten Straßenslang von Sheffield, einer seltsam befriedigenden Mischung von nordenglischem Arbeiterdialekt, jamaikanischem Patois, Urdu und anderen Elementen. Tina hatte nicht nur den großen Stock in der Hand, sondern auch eine billig aussehende braune Kunstlederhandtasche unter dem Arm. Es gab ein Gerangel, als die weiße Frau nach der Tasche griff. Tina schwang wild ihren Stock und verfehlte das Gesicht der jüngeren Frau nur knapp. Die zog sich einen Moment zurück, schrie aber weiter. Und Tina stachelte sie noch zusätzlich an:
»Komm bloß her, du blöde Sau!«
Plötzlich drehte sich die jüngere um und rannte davon. Aber nach einer kurzen Pause, schrillte ihre Stimme wieder durch die Morgenstille: »Und was sagst du jetzt? Wer ist jetzt die Stärkere?« Sie hatte sich aus einem Garten in der Nähe einen Ziegelstein geholt und kam damit auf Tina zu.
»Gib mir meine Tasche zurück, oder ich schlag dir damit deine verdammte Fresse ein«, sagte sie.
»Na, dann komm doch, du kleines Gör. NA LOS!«, schrie Tina.
Sie torkelte auf die junge Frau zu und schlug ihr ins Gesicht. Es kam zu einem Gerangel, Fäuste flogen. Irgendwann fiel der Stock zu Boden, und am Ende hatte Tina den Ziegelstein und die junge Weiße die Tasche in der Hand. Plötzlich, als hätte jemand einen Schalter umgelegt, gab Tina auf. Sie ließ den Stein fallen und ging wortlos zurück in ihr Haus. Doch die Jüngere schimpfte weiter.
»Pass bloß auf, du Schlampe! Du hast mir voll ins Gesicht geschlagen, und ich hab es nicht mal gespürt. Ich komm zurück und schlag dich zusammen, das kannst du mir glauben! Du blöde Schlampe, du! Pass bloß auf. Mir egal, wen du kennst. Ich bringe einen Mann mit, der dich fertigmacht!«
Sie sagte das, während sie Tina, wenn auch in sicherem Abstand, Richtung Haustür folgte. Als die Tür schließlich zu war, kam sie mit völlig zerzausten Haaren und feuerrotem Gesicht an meinem Haus vorbei. Dann sah sie Mohammed, der im Nachbarhaus aus dem Fenster lehnte, und sagte mit weicher, warmer Stimme: »Tut mir echt leid, Mohammed, mein Lieber. Ich wollte dich nicht wecken, Schatz. Aber die hat echt versucht, meine Tasche zu klauen, nicht?« Und damit stolperte sie weiter die Straße hinunter.
Tina war nicht immer so fertig gewesen. Ich weiß noch, wie sie jung und gut gekleidet war, dass sie mich immer wegen meines großen, widerspenstigen Afros aufzog und dass sie mich anflehte, meine Haare in ordentliche Cornrows flechten zu dürfen. Sie fragt mich immer noch, wenn sie mich sieht, aber heute sind es ihre krausen und verknoteten Haare, die die Aufmerksamkeit nötig hätten, die sie meinen angedeihen lassen will. Die putzmuntere, blitzgescheite Frau von einst ist jetzt ein Crackhead. Sie hat ihr Reihenhaus in eine Crackhöhle verwandelt, wo bewaffnete Polizisten regelmäßig Razzien veranstalten und man oft Pistolenschüsse hört. Tinas Zustand war eine Erinnerung daran, warum ich diesen Ort unbedingt hatte verlassen müssen. Tatsächlich gab es viele solche Erinnerungen: Firth Park war voll von Tinas. Die Menschen, mit denen ich aufgewachsen war, wurden ihrem statistisch zu erwartenden Schicksal gerecht. Eine Zeit lang war jedes Mal, wenn ich nach Hause kam, ein Freund aus meiner Kindheit auf der Titelseite des Sheffield Star. Einer ermordete ein dreijähriges Kind; ein anderer, der weiter unten in der Straße wohnte, wurde erstochen; ein früheres Mitglied meiner Fußballmannschaft kriegte zweiundzwanzig Jahre Knast für versuchten Mord; sein Vater war nur wenige Jahre zuvor im Park des Viertels umgebracht worden … Und immer wieder höre ich von Schulfreunden, die in der Psychiatrie gelandet sind, weil sie die traumatischen Erlebnisse und den Druck nicht ausgehalten haben, die man aushalten muss, wenn man als schwarzer Mensch in einer pathologisch rassistischen Gesellschaft in der Spur bleiben soll. Ich hatte sie als Kids gekannt, die gern mit Transformers spielten oder im Park kickten. Wir spielten bei meiner Mutter in der Küche Schach oder lieferten uns auf der Straße Wasserschlachten. Ab etwa sechzehn oder siebzehn begannen sich unsere Leben auseinanderzuentwickeln. Ich ging aufs College und bekam anschließend einen Teilzeitjob in der Jugendarbeit, aber viele von meinen Freunden blieben irgendwann auf der Strecke.
Der einzig erkennbare Unterschied zwischen uns bestand darin, dass meine Eltern für ein einigermaßen stabiles Heim sorgten. Meine Mutter hatte die Unterstützung ihrer weißen Arbeiterfamilie, und mein Vater, ein afroamerikanischer Schauspieler und Sänger, genoss ein gewisses Ansehen als Entertainer. Wegen ihm machten wir auch Reisen, und das nicht aus Notwendigkeit, sondern zum Vergnügen. Meine Mutter und ich reisten ihm an verschiedene Orte im ganzen Land und manchmal auch ins Ausland nach, um ihn in einem Theaterstück oder Musical zu sehen.
Ich hatte also immer wieder, und das nicht nur auf dem Fernsehschirm, einen Blick auf eine Welt erhascht, die sehr viel größer war als Firth Park, und deshalb beruhten meine Erfolgsmaßstäbe auch nicht auf der Mikropolitik des Viertels – einer Politik, die unter anderem in den sogenannten »Postleitzahlenkriegen« zum Ausdruck kam. Damals trug »mein« Gebiet mit der Postleitzahl S 5 mit dem nahe gelegenen Gebiet S 3 einen Konflikt aus, der mit einer Flut gewaltsamer Angriffe und Morde verbunden war.
Es ist vielleicht seltsam, an diesem Punkt Alain de Botton zu zitieren, doch er analysiert in StatusAngst treffend, was mit den Menschen in meinem Umfeld passierte:
Die ohne Status bleiben unsichtbar, sie werden kurz abgefertigt, ihre nicht minder differenzierten Lebensansprüche werden mit Füßen getreten, ihre Gesichter schlichtweg ausgeblendet. Ein niedriger Status […] fordert seinen Preis […] vor allem in der Beeinträchtigung des Selbstwertgefühls. Einschränkungen kann man lange klaglos hinnehmen, wenn sie nicht mit Demütigungen einhergehen, das zeigt sich am Beispiel der Soldaten oder der Forschungsreisenden, die einst bereitwillig Entbehrungen weit über das Los der Ärmsten ihrer Gesellschaft auf sich nahmen und sich mit dem Gedanken trösteten, dass ihr Einsatz hohe gesellschaftliche Wertschätzung genieße.3
Genau das war es. Ich bin mit der Erkenntnis aufgewachsen, dass das Alter zu den bösen Jungs nicht nett ist. Eine einstweilige Verfügung wegen antisozialen Verhaltens war auf der Straße fast genauso viel wert wie ein Realschulabschluss, und wir waren alle fasziniert von der attraktiven Mischung von Gefahr und Aufregung, die in der Popkultur mit der Identität junger Schwarzer verbunden war. Obwohl Tupac Shakurs Geschichte sehr viel tiefer reicht, weiß ich, dass ich nicht als Einziger Tagträume davon hatte, wie er erschossen zu werden. Was aber geschieht, wenn man erwachsen wird und als Dreißigjähriger sein Sixpack verliert, nicht lesen und schreiben kann und von Verhaltenstherapeuten und Knastpsychologen die Diagnose Soziopath verpasst bekommen hat? Was passiert, wenn der Ghettoglanz verflogen ist?
Von Firth Park ins Stadtzentrum ist es eigentlich zu weit zum Laufen, aber ich gehe trotzdem immer zu Fuß, weil auf dem Weg disparate Fragmente meiner Kultur auf mich lauern. Zufrieden mit meinem mäßig großen Rucksack, der genug Kleidung und Unverzichtbares für fünf Monate auf dem Kontinent enthielt, ging ich durch das »Flower Estate«, wo Drogendealer und Autodiebe die Honeysuckle Road, den Sunflower Grove, den Lavender Way, die Clover Gardens und die Primrose Avenue bevölkern. Das ist Sheffield: Die schlimmsten Orte haben die schönsten Namen. Die Chaucer School – an der Wordsworth Avenue – ist eine der schlechtesten Schulen der Stadt, und der Durchschnittsbewohner von Southey Green weiß romantische Verse gewiss nicht zu schätzen. So weit war Robert Southey von der Wirklichkeit entfernt, in der ich aufwuchs, dass ich erst in meinen späten Jugendjahren erfuhr, dass das Gebiet nach einem Dichter benannt ist, der »suthie« ausgesprochen wird, auch wenn die Bewohner fälschlich »southee« sagen.
Von Firth Park geht es weiter nach Wincobank, wo sich angeblich ein im Jahr 500 vor unserer Zeitrechnung erbautes Fort aus der Eisenzeit befindet, von dem allerdings heute kaum mehr eine Spur zu finden ist. Man stößt dort nur auf Reihenhäuser und einen Schnapsladen mit einer hellgelben Fassade, die selbstgestrichen aussieht. Mein Weg von Firth Park ins Stadtzentrum führt auch am größten denkmalgeschützten Gebäude Europas vorbei, was großartiger klingt, als es ist. Es handelt sich um die brutalistischen Park Hill Flats, die bis zu ihrer Gentrifizierung und Privatisierung wie ein monolithisches Monster über der Stadt dräuten und alles darunter in ihren dicken Schatten tauchten. Dennoch ist Park Hill ein angemessenes Wahrzeichen: Die Sheffielder lieben es, ihre Stadt zu hassen. Sie werden nostalgisch, wenn die Bausünden abgerissen werden, über die sie sich jahrelang beschwert haben, und sind beleidigt, wenn jemand von außerhalb genau wie sie selbst die Ansicht vertritt, dass Sheffield ein übles Loch ist.
Der ungern eingestandene heimliche Stolz der Sheffielder auf ihre zerzauste urbane Landschaft wurzelt in einer, wie ich glaube, unbewussten Anerkennung dessen, was diese Landschaft bietet: ein bodenständiges, keinem festen Muster unterworfenes Freiheitsgefühl. Knapp 230 Kilometer von Westminster entfernt, stehen die mehr und mehr verschwindenden Nachkriegsgebäude für die gesellige, von der Arbeiterklasse geprägte Atmosphäre, die in der Stadt herrschte, bevor Primark und Starbucks die Hauptstraßen kolonisierten – in einer Zeit, als die Gewerkschaften noch mächtig waren und sich die Kultur der Arbeiter noch nicht auf Kim Kardashians Kurven und die Bauchmuskeln in der Serie Love Island beschränkte. Die Pläne für die Stadt, die der Architekt John Lewis Womersley im Auftrag des Stadtrats in den fünfziger Jahren entwarf, waren kühn und sozialistisch geprägt.4 Im Lauf der Zeit habe ich nicht nur die Zerstörung der Räume der Arbeiterklasse in der Gemeinde erlebt, sondern sogar die Zerstörung der Idee der Gemeinde in den Köpfen der Arbeiter. Das Streben nach privatem Wohlstand hat den Gemeinschaftsgeist und das intellektuelle Engagement für Ideen, die über kapitalistische Bequemlichkeit hinausgehen, verdrängt. Communitys, die einst durch lokale Industriebetriebe miteinander verbunden und durch Stolz und handwerkliches Können geprägt waren, wurden durch die anonymen Nachbarschaften der Globalisierung ersetzt. Mit Callcentern und Einkaufsgalerien als Zentrum lässt sich nicht viel Kultur aufbauen. Ich spreche hier von den Arbeitervierteln im Norden Sheffields, wo ich geboren und aufgewachsen bin, nicht von den grünen Enklaven der Universitätsprofessoren, Studenten und Künstler, die sich im wohlhabenderen mittelständischen Süden der Stadt entwickelt haben.
Als Margaret Thatcher Großbritannien in den achtziger Jahren für den Freihandel öffnete und die industriellen Grundlagen des englischen Nordens zerstörte, waren die sozioökonomischen Bedingungen und Stadtlandschaften in meinem Teil Sheffields verblüffend ähnlich wie die im New York der siebziger Jahre. Diese Eigenschaft in Kombination mit den Raubkopien des bahnbrechenden Films Wild Style! über die Hip-Hop-Kultur von 1983, die damals die Szene überschwemmten, führte dazu, dass sich ein großer Teil der Stadt in den wichtigsten europäischen Tummelplatz für Graffitikünstler und Musiker verwandelte. Die sozialistischen Gebäude wurden zu Betonleinwänden, und die obersten Stockwerke der Hochhäuser wurden von Piratensendern genutzt. Dies war die Kehrseite von all dem Tod und der Gewalt, mit denen ich in meiner Jugend konfrontiert war. Die Entwicklung einer der wichtigsten kulturellen Bewegungen des späten 20. Jahrhunderts: des Hip-Hop, einer Bewegung, die unsere Probleme sowohl bekämpfen als auch verschärfen konnte.
Sheffields Ruf als sicherer Hafen für Graffitikünstler wurde abrupt zerstört, als Mitte der neunziger Jahre ein Zweiundzwanzigjähriger, dessen Tags jeden Quadratzentimeter der Stadt zu bedecken schienen, erwischt und zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Simon Sunderland alias Fista (seine Signatur entstand durch einen Rechtschreibfehler in »first«, als er sein erstes Graffito anfertigte) war von der Hip-Hop-Kultur inspiriert, doch es dauerte nicht lange, bis das Sprayen als Selbstzweck bei ihm zur Sucht wurde. Seine Arbeit überschritt oft die feine Grenze zwischen Straßenkunst und dem, was viele als Vandalismus betrachten; und seine Motivation lag irgendwo zwischen genuinem politischem Protest und der eines Adrenalin-Junkies.
»Die Gesellschaft ist blind«, sagte er in einem Interview, kurz bevor er erwischt und ins Gefängnis geworfen wurde. »Jeden Tag, und wohin wir auch gehen, bombardiert man uns mit großen Werbeanzeigen, die Geld einbringen und Lügen verkaufen. […] Die Werbung versucht, uns durch Bilder von einer materialistischen Gesellschaft den Verstand zu vernebeln.« Immer wieder einmal tauchte ein wunderschönes, voll ausgemaltes, in Blockbuchstaben ausgeführtes »Piece« von Fista auf: die Art von Graffiti, die öde urbane Landschaften aufhellt. Wofür ihn jedoch die meisten Leute in Erinnerung haben, ist sein »Bombing«, seine schnell und ökonomisch hingeworfene Signatur an Bushaltestellen, Zugtunneln, Autobahnbrücken, Fabriken, Schienenfahrzeugen und allem, was er sonst erreichen konnte. Der Unterschied zwischen ihm und anderen Graffitikünstlern jener Zeit bestand darin, dass er mit Absicht auffällige Flächen in der Stadt wählte, weshalb sich sein Name wie jede groß angelegte Werbungkampagne in das Unbewusste eingrub. Er wurde eine lokale Berühmtheit, die das Licht der Öffentlichkeit scheute, eine wohlbekannte Marke, die einem nichts zu verkaufen versuchte, eine geheimnisvolle Präsenz, die überall den Klatsch dominierte. Schulkinder sagten, Fista sei ihr Bruder oder Cousin, oder behaupteten sogar, selbst Fista zu sein.
Im Jahr 1996, als Fista weggesperrt wurde, fiel im Westen eine ganze Menge subversiver Traditionen einer Entwicklung zum Opfer, die damals viele für fortschrittliche Politik und progressive Innovation hielten. Im Internet entfalteten sich die ersten sozialen Medien, die Wirtschaft boomte, und Tony Blair sollte bald zum Premierminister gewählt werden. In den Vereinigten Staaten wurde der Besitz an Radiosendern durch ein neues Mediengesetz auf ein paar wenige große Unternehmen beschränkt mit der Folge, dass sich der Hip-Hop in diverse Mainstream- und Untergrund-Lager aufspaltete (und ihm praktisch der Garaus gemacht wurde). In ganz Großbritannien und Amerika wurden die Hochhäuser der Nachkriegszeit abgerissen; in East London löste Harry Handelsmans Manhattan Loft Corporation eine Gentrifizierungswelle aus; Rudy Giuliani, damals Bürgermeister von New York, veränderte die soziale Landschaft der Stadt für immer; und Tupac Shakur wurde ermordet, was letztlich zum Ende von Death Row Records führte, dem Phänomen, das in den neunziger Jahren der Black Panther Party am nächsten gekommen war.5
Damals entwickelte sich das Stadtzentrum von Sheffield zu einem stärker überwachten und mehr von Firmen dominierten Raum, und Menschen wie Fista passten nicht mehr ins Bild. Also steckte die Regierung eine Menge Geld in die Grime Busters, eine Einheit zur Bekämpfung von »Vandalismus«, deren Aufgabe darin bestand, sämtliche Graffiti der Vergangenheit und der Gegenwart zu eliminieren. Statt dass man den Versuch gemacht hätte, das kleine bisschen kreative Energie zu fördern, das irgendwie aus der Armut und der hohen Arbeitslosigkeit einer postindustriellen Arbeiterklasse erwachsen war, diffamierte man deren führende Köpfe. In derselben Zeit, als sich Gemälde des toten Jean-Michel Basquiat, der in seinen Anfängen als Graffitikünstler (in einem ähnlichen Stil wie Simon Sunderland) in New York City SAMO getaggt hatte, für eine halbe Million Pfund verkauften,6 sperrte man Fista in einem üblen nordenglischen Gefängnis weg und tilgte alle Spuren seiner Arbeit.
Ein Mitglied der Grime Busters sagte in einem Interview im Lokalfernsehen: »Stellen Sie sich vor, Sie hätten Ihr Auto in der Einfahrt stehen lassen, und wenn Sie am nächsten Morgen aufwachen, hätte jemand einen großen Adler darauf gemalt, und die Leute sagten: ›Das ist ein schöner Adler.‹ Darum geht es nicht, oder? Das Auto ist Ihr Eigentum, und Sie wollten keinen Adler darauf haben, also sollte er auch nicht dort sein, nicht wahr?« Ich aber frage mich, was die Hausbesitzer in der, sagen wir mal, Rutland Road von dem riesigen protzigen Plakat von Virgin Media vor ihren Häusern halten. Hat man sie um Erlaubnis gefragt? Wie stellt man es an, seine Zeichen und Symbole oder seine Werbung offiziell anerkannt zu bekommen? Kein Mensch, mit dem ich aufwuchs, wusste das. Wir wussten nur, dass es viel mehr Geld kosten würde, als einer von uns je zu besitzen hoffen durfte.
Eine Weile spielten die Grime Busters und die Graffitikünstler Katz und Maus. Tagger aus Sheffield machten landesweit Schlagzeilen und wurden in der Daily Mail verteufelt und im Untergrund als Helden verehrt. Mist1, Crome, Des, SB2 und andere kamen zusammen mit Fista in das Pantheon der Sheffielder Graffitiszene und wurden, wenn auch nur für kurze Zeit, berühmt. Aber genau wie Breakdancer und MCs wurden auch die Graff Cats älter, mussten irgendwann eine Familie ernähren und fanden es immer schwerer, eine Kultur aufrechtzuerhalten, mit der man nicht nur spielen kann, sondern die gelebt werden muss. An den Wänden im Stadtzentrum kam neue Anti-Graffiti-Farbe zum Einsatz, und der Fleiß der Grime Busters zahlte sich schließlich aus: Die Graffiti, die sie mit ihren Motorspritzen nicht sofort wegspülten, verblassten mit der Zeit und wurden nicht ersetzt – bei der Geschwindigkeit, mit der sie zerstört wurden, war es sinnlos geworden. Dies führte im Zusammenhang mit dem generellen Niedergang des Hip-Hop nicht nur als Musikgenre, sondern als Kultur der jüngeren Generation im ganzen Westen, und mit der Bedrohung durch mehrjährige Gefängnisstrafen zum fast völligen Ende der einst legendären Szene.
Ich wählte »afropäisch« (statt »europäisch«) als potenziell progressive Bezeichnung für mich, weil das Wesen Europas etwas an sich hat, das durch Assimilation zerstört, ein Phänomen, das ich aus erster Hand kennenlernte, als ich nach London zog und in die Londoner Hip-Hop-Szene eintauchte. Sie wurde hinter den Kulissen von weißen Privatschülern geführt, die über den UK Grime die Nase rümpften, weil er nicht real war – ganz im Gegensatz zu ihrer eigenen komplexen, privat finanzierten Lyrik auf Old-School-Beats, die sie aus teuren Sammlungen alter Vinylplatten zusammenstoppelten.
Immer wenn ich nach Sheffield zurückkehre, suche ich die Straßen ab in der Hoffnung, ein Tag von Fista zu finden, eine Geisterspur des alten, vordigitalen Sheffield, das ich aus meiner Kindheit in Erinnerung habe. Das harte Urteil gegen Fista hatte dem Rest der Graffiticommunity eine Lehre erteilen sollen, und seine Tags wurden von den Grime Busters heftiger bekämpft als alle anderen. Als ich endlich auf einer Brücke in der Nähe des verlassenen Bahnhofs Brightside eines fand, sahen die trotzigen weißen Buchstaben müde und skelettartig und, mehr als alles andere, geschlagen aus. Das System hatte gewonnen. Heutzutage sind die Graffiti, wie auch die meisten anderen Elemente des Hip-Hop, heruntergedimmt, kastriert und kommerzialisiert. Sie werden von Leuten in Auftrag gegeben, die Schablonengraffiti im Banksy-Style auf den Wänden ihrer Kulturindustrietempel haben wollen. Sie sind genauso oft Bestandteil der Werbeplakate, über die sich Fista beklagte, wie sie auf irgendeine Wand um die Ecke gesprayt werden, nur dass es sich bei der Werbung um legalen, von Konzernen betriebenen Vandalismus handelt.
Meine Nostalgie für Fistas Graffiti wurzelt in deren Verbindung mit den randständigen Communitys der Stadt. Wie die Graffiti hatte auch die schwarze Community von Sheffield etwas Vergängliches. Sie war nie so gefestigt und selbstsicher wie die von London, und alles, was mit ihr zu tun hatte, spielte sich heimlich und im Untergrund ab. Der Freund eines Freundes weihte einen ein und erzählte einem von den illegalen jamaikanischen Bluespartys, die Docker oder Donkeyman veranstalteten, oder er gab einem die Frequenz von SCR, dem Piratensender, der unter den Dächern verschiedener Sheffielder Hochhäuser Garage, Ragga, R'n'B und Hip-Hop spielte, der in der Zeit vor dem Internet so schwer zu kriegen war. Eines der ersten großen schwarzen Festivals war Summer Jam, ein karibisches Do-it-yourself-Straßenfest in Pitsmoor. Daraus wurde schließlich das Festival Music in the Sun im Don Valley Bowl – eine der wenigen Gelegenheiten, bei denen sich die ganze schwarze Community Sheffields einmal im Jahr an einem Ort versammelte. Obwohl es ein paar wichtige, ältere Organisationen wie die Non-Stop Foundation gab, bestand immer das Gefühl, dass die Prunkstücke des multikulturellen Sheffield organisch aus der Community gesprossen waren.
Alle damals beteiligten Organisationen haben sich aufgelöst, und selbst in ihrer Blütezeit wirkten sie auf mich verwundbar und temporär. Sobald der Stadtrat versuchte, sie unter Kontrolle zu bringen, wusste man, dass dies ihren Tod bedeutete. Wenn sich das System einmischte, Sperrstunden verhängte, die Musik genehmigte und den Raum durch Firmensponsoren sanktionierte und kolonisierte, kam wieder einmal das Gefühl drohender Entfremdung auf. Die Führung wurde Leuten übertragen, die nicht aus der Community stammten oder mindestens Außenseitern verantwortlich waren. Wenn ich heute durch die schal gewordenen Räume wandere, die einstige Heimat einer verlorenen Geschichte, derer niemand gedenkt, stelle ich mir gern so etwas wie die blauen English-Heritage-Gedenktafeln vor, die die ehemaligen Unterkünfte berühmter und herausragender Gelehrter, Künstler und Entdecker zieren. Ich würde an einer Zeile von Reihenhäusern eine Tafel mit der Inschrift »Mr. Menace, bester MC Sheffields« anbringen oder durch eine Tafel an einem niedrigen Studentenwohnheim, an dessen Stelle einst ein städtisches Hochhaus mit Sozialwohnungen stand, den Passanten mitteilen: »Hier wurde Sheffields bahnbrechender Piratensender SCR ausgestrahlt.«
Black Culture in Sheffield hatte, wenigstens für mich, nicht ausschließlich mit schwarzen Menschen zu tun. Mein Weg in die Community führte nicht über meinen Vater (der als ein »mondäner« afroamerikanischer Sänger nicht besonders stark mit der Erfahrungswelt britischer Schwarzer verbunden war), sondern über Leon Hackett, einen weißen Freund, der in Pitsmoor aufwuchs. Die meisten Bewohner seines Viertels stammten aus Jamaika, also musste er, um zu überleben, sehr schnell alles über die Kultur Jamaikas lernen und identifizierte sich in vieler Hinsicht mehr mit ihr als mit der weißen Arbeiterklasse Sheffields. Er und seine Brüder gehörten zu einer großen Familie. Sie sprachen perfekt Patois, und viele von ihnen wurden MCs und DJs der Szene. Neben Mohammed war es Leon, der mich erstmals mit dem Hip-Hop bekannt machte, einer Kultur, die sich damals noch nach einem Underground-Club anfühlte, in den man nicht so leicht aufgenommen wurde. Leon und ich rappten stundenlang auf Instrumentals und unterzogen uns der mühevollen Prozedur, Mixtapes anzufertigen, indem wir auf SCR die Sendungen von J Rugged und MC Niges aufnahmen und dafür die Stopp- und Starttasten unserer Kassettenrekorder benutzten.
Leon war ein weiterer Grund, warum ich den Rest von Europa durch die Augen der Black Culture sehen wollte. Wie hatte sie sonst noch das Bewusstsein der weißen Bevölkerung des Kontinents beeinflusst und durchdrungen? Wie viele Spuren dieser umgekehrten Kolonialisierung würde ich finden? Die afrikanische Kunst hatte Art déco und Kubismus in Frankreich beeinflusst; Jamaikaner hatten in Deutschland eine riesige Reggae-Szene und eine Identifikation mit dem Rastafarianismus entstehen lassen; Stuart Hall hatte das Studium der Kulturwissenschaft an den britischen Universitäten radikal verändert. Welche Beispiele konnte ich dafür finden, dass die Assimilation für schwarze Communitys wirklich funktioniert hatte und wirklich Einfluss darauf hatte, wie Europa aussah und sich anfühlte? Ich wusste nur zu genau, dass dieser Einfluss schon lang besteht, weil er für meine Existenz verantwortlich ist: Ich bin ein Kind des Northern Soul.
»Northern Soul« ist der von dem Musikjournalisten der Zeitschrift Blues and Soul Dave Godin geprägte Begriff für ein musikalisches Phänomen, das in den sechziger und siebziger Jahren die Clubs und Casinos der Arbeiter in nordenglischen Industriestädten erfasste.
»Die britische Besessenheit von der Klassenzugehörigkeit hat im Lauf der Jahre dazu geführt, dass weiße Arbeiter eine Erfahrung machen, die zu der der schwarzen Amerikaner parallel läuft«, sagt Godin in dem Versuch, diese seltsame Einheit der Kulturen zu erklären. Ich muss ihm widersprechen: Man kann die rassistische Gesetzgebung und die Gewalterfahrung der schwarzen Amerikaner nicht mit den Härten im englischen Norden oder dem dortigen Klassenkampf in den sechziger Jahren vergleichen. Dennoch lag etwas im Schneid und Schmerz der aus der Unterdrückung geborenen Musik der amerikanischen Schwarzen, das in den Communitys der weißen Arbeiter einen Nerv traf. Die Familie meiner Mutter hatte wie viele Arbeiter in Nordengland irische Vorfahren, die während der großen Hungersnot von der Insel geflohen waren, und es kann gut sein, dass die Erinnerung an diese Flucht über den Atlantik irgendwie mit der Musik der über den Atlantik verschleppten und in einer amerikanischen Diaspora verstreuten schwarzen Menschen harmonierte. Weit wichtiger war jedoch das Motiv des Eskapismus: Es war einfach befreiend, eine Woche der Plackerei in den Gruben oder Minen oder Stahlwerken damit abzuschließen, dass man auf der Tanzfläche ein paar Stunden in einer fremden »exotischen« Kultur verlor. Das war definitiv bei meiner Mutter der Fall, deren Familie zu den ärmsten in dem Sheffielder Bezirk Burngreave gehörte. Die Musik brachte etwas Farbe in ihr Leben in der schmutzigen Industriestadt, und sie lernte in dem verfallenen viktorianischen Haus in Pitsmoor, wo der 2018 verstorbene Frauenheld und Unternehmer Peter Stringfellow den Club The Mojo aufgemacht hatte, meinen Vater kennen.
Mein Vater kam 1969 mit der Band The Fantastic Temptations erstmals nach Großbritannien. Er und seine Bandkollegen tourten mit Hits wie »My Girl« und »I Wish It Would Rain« durch den englischen Norden und gewannen eine ordentliche Zahl von Fans. Sie wurden landesweit für ihre Live-Auftritte bekannt. Das Problem war nur, dass sie eben nicht die echten Temptations waren und für einen betrügerischen Promoter arbeiteten, der aus dem Erfolg der Originalband Kapital schlug. Das war kein Einzelfall: Dem soulhungrigen weißen Arbeiterpublikum, das nicht zu viele Fragen stellte, wurden statt berühmten Soulbands wie den Platters, den Drifters oder den Isley Brothers oft andere Gruppen verkauft. Und wenn ihre Mitglieder gut aussahen, schwarz waren, singen konnten und tanzbare Musik lieferten, waren alle zufrieden. Außer den Originalmusikern.
Schließlich kam man den Fantastic Temptations auf die Schliche und drohte ihnen rechtliche Schritte an. Also tauften sie sich schnell in The Fantastics um und hatten sogar einen gewissen eigenen Erfolg. Mein Vater erinnerte sich noch, wie er in Sheffield die wirklichen Temptations traf. Er machte sich schon auf eine Schlägerei gefasst, als er merkte, dass sie gar nicht wütend waren. Die falschen Temptations hatten gute Arbeit für sie geleistet, indem sie ihren Namen in Großbritannien bekannt gemacht hatten – ein Erfolg, der die Fantastics in den frühen siebziger Jahren zu dem eigenen Top-Ten-Hit »Something Old, Something New« anspornte.
Der Northern Soul bot nicht nur der Arbeiterklasse in Sheffield eine Möglichkeit, der harten Realität ihres Alltags zu entfliehen, er war auch für meinen Vater ein Mittel, den zahlreichen Straßengangs in Brooklyn und dem potenziellen Kriegsdienst in Vietnam zu entkommen. Die Musik war ein Ticket in ein Land, wo er als Afroamerikaner nicht als Teil eines nationalen Problems wahrgenommen wurde. Während die schwarze britische Community mit Molotowcocktails gegen die Polizei in Brixton kämpfte, trat mein Vater im West End in diversen Musicals von Andrew Lloyd Webber auf. Dass er schwarz war, stand hier in Europa in keinem direkten Zusammenhang mit einem Kolonialreich oder einer problematischen gemeinsamen Geschichte. In Großbritannien passierte es ihm, dass weiße Engländer zu ihm sagten: »Sind diese Amerikaner nicht übel? Komm herein, Richie, mein Lieber, und trink einen Tee mit uns«, während dieselben Engländer ihre Augen vor dem Schicksal der weniger glamourösen schwarzen Community in Großbritannien verschlossen, das ihr Problem hätte sein müssen. Die Engländer im Allgemeinen und die Sheffielder Engländer im Besonderen empfanden meinen Vater als eine attraktive und aufregende Bereicherung für ihr Land, weil er ihnen dank seiner Abstammung und seiner kulturellen Distanz kein Unbehagen verursachte und seine Existenz nicht zu viele widersprüchliche Fragen aufwarf. Jedes Mal, wenn die Familie meiner Mutter zusammenkam, war er der Stargast. All diese Arbeiter und Arbeiterfrauen mit ihren Tätowierungen und Biergläsern drängten sich um ihn. »Das ist Richie«, sagten sie. »Der Sänger aus New York!« Ich halte den weißen Teil meiner Familie nicht für rassistisch, doch mein Vater konnte unmöglich mit einem der Kanaken vom anderen Ende der Straße verwechselt werden.
Es ist schwer zu beurteilen, ob und wie sich der Kulturaustausch durch den Northern Soul und ähnliche Bewegungen wirklich darauf auswirkten, wie weiße Europäer schwarze Menschen sahen. Ich besuchte vor einiger Zeit mit meinem Dad einen Northern Soul Weekender (der in einem Holiday Park von Pontins stattfand), und wir hatten das surreale Erlebnis, Skinheads, die wie Hooligans aussahen, voller Hingabe zu schwarzer Musik tanzen zu sehen. Die Fans kannten die Musik besser als die Musiker.
Mein Dad hatte einen gewissen Bekanntheitsgrad bei diesen Wochenendveranstaltungen, und die Veranstalter stellten ihm stets ein Ferienhaus zur Verfügung und zahlten sein Essen und all seine Drinks. Er erzählte mir, dass ein paar mit ihm befreundeten afroamerikanischen Musikerkollegen etwas Ähnliches passierte. Sie bekamen einen Anruf mit der Bitte, einen Song zu spielen, von dem sie fast vergessen hatten, dass sie ihn aufgenommen hatten. Der Song war in der britischen Northern-Soul-Szene ein Riesenhit, aber in den USA vielleicht sogar nur als Demo aufgenommen worden. Am interessantesten war der Northern Soul für Sammler, denn er war durch ein seltsames Phänomen in den sechziger und siebziger Jahren entstanden. Damals waren britische DJs in die USA geflogen und hatten massenweise Platten gekauft, die die Händler nicht loswurden. Die Plattenfirmen waren froh, ihre Lager leer zu bekommen und verlangten nur wenig Geld für ihre Ware. Doch die jungen britischen DJs waren clevere Unternehmer. Sie hatten einen Markt entdeckt, und es sollte Jahre dauern, bevor die amerikanischen Plattenfirmen merkten, was die Briten taten: Sie kauften Ladenhüter, verkauften diese als schwer zu kriegende US-Importe an ein hungriges weißes Publikum in Nordengland und verdienten damit ein Vermögen. Die so importierten Tracks wurden, oft ohne, dass die Musiker und ihre Plattenfirmen dies wussten, in der britischen Clubszene riesige Underground-Hits. Auch drei bis vier Jahrzehnte später besteht bei den älteren, heute fünfzig- bis siebzigjährigen Clubbesuchern, die ihre beste Zeit wieder heraufbeschwören wollen, noch eine Nachfrage nach den Musikern von damals. Selbst wenn der Northern Soul keine große kulturelle Lektion für die weißen Briten war, so verschaffte er schwarzen »Stars«, die zuvor nie wirklich hell gestrahlt hatten, immerhin ein bisschen Ruhm an ihrem Lebensabend. Und ganz ähnlich wie die nach dem Krieg überall in Westeuropa stationierten amerikanischen Streitkräfte hinterließ auch der Northern Soul eine Generation multiethnischer Kinder, die heute mit einer irgendwie anderen schwarzen europäischen Identität auf dem Kontinent leben.