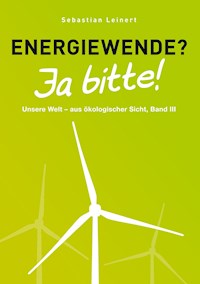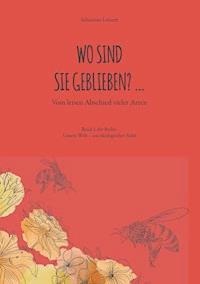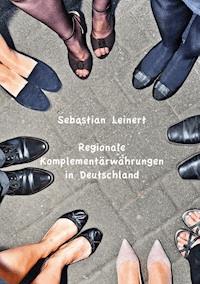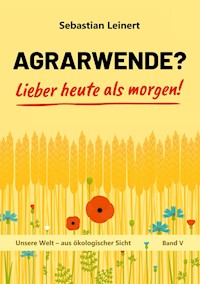
9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Unsere Welt - aus ökologischer Sicht
- Sprache: Deutsch
Seit Jahrzehnten verändern sich die landwirtschaftlichen Strukturen stetig und dies vor allem zu Lasten von Familienbetrieben. Die aktuellen und bereits absehbaren Innovationen werden diese Entwicklungen weiter beschleunigen. Ein positives Ende ist nicht in Sicht. Das Buch behandelt jedoch auch zahlreiche erprobte und nachhaltige Alternativen. Es wird außerdem aufgezeigt, wie der schwierige Übergang zu einer öko-sozialen Wirtschaftsweise gelingen könnte: auf der organisatorisch-technischen Ebene, durch Bildung und Ausbildung und nicht zuletzt durch eine durchgreifende Verhaltensänderung der Konsumenten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 294
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Für Ute und unsere so lebendige Familie
Inhaltsverzeichnis
Geleitwort
Anliegen dieser Buchreihe und dieses Buches
Einführung
Sachlage und Beurteilung
3.1 Boden
Grobe Charakterisierung des Bodens
Nutzung des Bodens
Beeinträchtigung des Bodens
Rechtslage für den Bodenschutz in Deutschland
Regenerierung des Bodens
3.2 Tierhaltung und ökologische Folgen
Allgemeines – Tierhaltung in Deutschland
Umgang mit Nutztieren
Weitere Probleme der Tierhaltung
Grundsätzliches und Folgerungen
3.3 Soziale Aspekte des Strukturwandels
Allgemeine Ausführungen
Wirtschaftliche Lage
3.4 Alternative Wirtschaftsformen
Ökolandbau
Biologisch-dynamischer Landbau
Organisch-biologischer Landbau
Permakultur
Solidarische Landwirtschaft
Urban Gardening
Agroforstwirtschaft
Zusammenfassung
Was sollte »man« tun?
Vorbemerkung
Einige mir besonders wichtige Forderungen
Was kann ich als Einzelperson bewirken?
Einkaufen und Essen
Bildung und Vorbild
Selbst tätig werden
Unterstützung positiver Aktivitäten
Wie wird es wohl weitergehen?
Literatur- und Quellenangaben
Geleitwort
Wieder liegt ein weiteres, ein wichtiges, ein von tiefer Verantwortung und Sorge getragenes Buch zum Thema der nicht mehr verschiebbaren Agrarwende vor. Ein Buch, das am Ende eines langen Lebens mit unendlichen Erfahrungen, im Ringen um eine »enkeltaugliche«, das heißt, zukunftsfähige Landnutzung erarbeitet wurde. Nehmen wir dieses Buch ernst! Vertrauen wir darauf, dass ein von Nachhaltigkeit geprägtes menschliches Denken und Handeln, im Verbund mit dem Wissen um die Selbstheilungskräfte der Natur, die menschliche Gesellschaft weiterführen kann und unsere Zivilisation nicht zu einem »interglazialen Irrtum« werden lässt.
Vor nunmehr über einem halben Jahrhundert wurde mit dem Buch von Rachel Carlson »Der Stumme Frühling« (1963) und dem folgenden Bericht des Club of Rome (1972) der Weltgemeinschaft deutlich aufgezeigt, dass eine weitere Beeinträchtigung der Funktionstüchtigkeit des Naturhaushaltes, vor allem ausgelöst durch die Zerstörung der uns tragenden Ökosysteme mit einer sich weltweit ausbreitenden Agrarindustrie, die Zukunftsfähigkeit der menschlichen Zivilisation in Frage stellt. Was muss noch geschehen, um diesen Eingriffen in den Naturhaushalt nicht mehr als »Fortschritt« zum Wohle der Menschheit zu huldigen?! Es gilt jetzt und sofort zu handeln, statt noch weiter zu forschen, zu verdrängen und auf Detail-Ergebnisse zu warten. Auf der anderen Seite gibt es sie, die Projekte des Gelingens, die Vorbilder im wirklich nachhaltigen Umgang mit unserer Lebensgrundlage Kulturlandschaft im so wunderbar ökologisch gebauten Haus Erde.
All das zwingt zu einschneidenden Veränderungen der Agrarpolitik; ein »Weiter so« ist beim heutigen Zustand großer Teile unserer Agrarlandschaft mit ihrem inzwischen hochgradig gestörten Wasser- und Nährstoffhaushalt, mit den sozialen Verwerfungen, dem Verlust an natürlicher Bodenfruchtbarkeit, dem Verlust der in Jahrhunderten mit der Ackerkultur entstandenen Lebensfülle (Biodiversität) nicht mehr hinzunehmen. Es muss gehandelt, neu orientiert, umgebaut werden.
Das System der Agrarindustrie ist nicht nachhaltig und somit nicht wirtschaftlich; eine Ackerkultur zum Anbau von »Energiepflanzen« ist ein ökonomischer, ökologischer und klimapolitischer Irrweg. Die Wertschöpfung der agrarindustriellen Wirtschaft ist dramatisch negativ, weil sie die natürliche Produktivität der Böden zerstört.
Agrarindustrielle Landwirtschaft ist heute ein hochkomplexes, vernetztes System gegenseitiger Abhängigkeiten aus Chemieindustrie, Maschinenindustrie, Weltmarkt, Immobilienmarkt, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie, Politik, Wissenschaft, Handelsketten, Lobbyorganisationen, Behörden, Energiewirtschaft und Verbrauchern. Der einzelne Landwirt ist dem System auf Gedeih oder Verderb ausgeliefert.
Mit der durchgreifenden Industrialisierung der konventionellen Landwirtschaft seit den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts erfolgte ein grundlegender Paradigmenwechsel. Die zunehmend dominierende Agrarindustrie als »konventionelle Landwirtschaft« zu bezeichnen ist irreführend. Konventionell (im Sinne von herkömmlich) ist eine bäuerliche Landwirtschaft, weiterentwickelt im ökologischen Landbau.
Agrarindustrielle Landwirtschaft basiert auf immensem Energieeinsatz (synthetische Dünger, Pestizide, Kraftstoff für Feldbearbeitung und Transporte) und hat massive Auswirkungen auf Sozialstruktur, Wirtschaft und Umwelt:
Dramatisches Höfesterben und drastischer Abbau von Arbeitsplätzen hat ländliche Regionen sozial veröden lassen und Nährboden für extreme und demagogische Tendenzen bereitet.
Die Subventionierung der Agrarindustrie und die Folgekosten für Schadenskompensation (Sozialausgaben, Trinkwasseraufbereitung, Gesundheitskosten …) belasten öffentliche Haushalte und werden letztendlich vom Steuerzahler getragen.
Die Nivellierung und Uniformierung von Kulturlandschaften zu reinen Produktionsflächen, die Degradation der Böden, Belastung von Grundwasser und Oberflächengewässern, drastische Reduzierung von Lebensvielfalt, Ausschalten von ökosystemaren Leistungen verursachen immer größer werdende Schäden für das Gemeinwohl.
Die Behauptung, die wachsende Weltbevölkerung könne nur durch industrielle Landwirtschaft ernährt werden, ist ein Mythos. Das System global agierender Agrarindustrie hat den Hunger auf der Welt nicht beseitigt, sondern regionale konventionelle Versorgungssysteme liquidiert, traditionelle Sozialstrukturen zerstört, Böden degradiert, Desertifikation verschärft und Flüchtlingsströme produziert. Die Lösung der globalen Umweltprobleme findet entweder nachhaltig, d. h. sozial und ökologisch auf lokaler Ebene – oder überhaupt nicht statt!
Historisch gewachsene, »harmonische« Kulturlandschaft ist in unserem Mitteleuropa ein knappes Gut geworden und damit ein »Sehnsuchtsort« für einen naturorientierten Tourismus, einen zunehmend bedeutender werdenden Wirtschaftszweig. Sein Markenzeichen ist eine ökologisch und sozial intakte Kulturlandschaft. Das heißt Heimat, das heißt Lebensfülle, das heißt gesunde Böden, gesunde Agrarprodukte, gutes Grundwasser und damit gesunde Menschen!
Dieses Buch ist deshalb so wichtig, so wachrüttelnd, so Hoffnung gebend, weil nach einer Zustandsanalyse die Hauptkapitel alternative Wirtschaftsweisen aufzeigen, jeden Einzelnen zum direkten Handeln aufrufen. Denn lassen wir die Natur unverändert, können wir nicht existieren; zerstören wir sie, gehen wir zugrunde. Der schmale, sich verengende Gratweg zwischen Verändern und Zerstören kann nur einer Gesellschaft gelingen, die sich mit ihrem Wirtschaften in den Naturhaushalt einfügt und sich in ihrer Ethik als Teil der Natur empfindet.
Üben wir uns im Erhalten, üben wir uns im Haushalten, gewähren wir der Natur Raum, geben wir ihr Zeit – um ihrer und unserer eigenen Zukunft willen!
Orientieren wir die verfügbaren Förderungsmöglichkeiten auf den einzig zukunftsfähigen Pfad der agrarischen Landnutzung, den sozial und ökologisch vertretbaren Landbau. Die damit verbundene Ertragsminderung um vielleicht 25 %, die Abkehr von den Höchstertragskonzeptionen, ist ohne weiteres hinzunehmen, wenn wir die uns zur Verfügung stehende Agrarfläche Deutschland von dem hochsubventionierten, ineffizienten Energiepflanzenanbau befreien, das Produzieren für die internationalen Märkte beenden und den ungesunden Fleischkonsum senken. Nützlichkeit, Vielfalt und Schönheit unserer Kulturlandschaft zu erhalten, ist das Gebot der Stunde. Danke für dieses Buch!
Prof. em. Dr. Michael Succow
Stiftungsratsvorsitzender der Michael Succow Stiftung
1 Anliegen dieser Buchreihe und dieses Buches
Seit dem Erscheinen des Reports »Limits to growth« des Club of Rome im Jahre 1972, der eindringlich auf die Gefahr der Überforderung der ökologischen Grundlagen der globalen Gesellschaft hingewiesen hat, hat sich dieser negative Prozess weiter verstärkt und beschleunigt. Inzwischen dürfte jedem Menschen, der »Ohren hat zu hören und Augen zu sehen« deutlich geworden sein, dass die gegenwärtigen Gesellschaften und Staaten auf dem besten Wege sind, ihre eigenen Lebensgrundlagen zu vernichten. Und zu diesen zählt in erster Linie der fruchtbare Boden.
Nach wie vor werden jedoch weltweit fruchtbare Böden in zunehmendem Umfang zerstört – und dies mit absehbar katastrophalen Folgen für die dort lebende Bevölkerung. Thiaw, Geschäftsführer der 1992 beschlossenen und inzwischen von 197 Ländern unterzeichneten Konvention zur Bekämpfung der Wüstenbildung UNCCD, hat daher mit der nachfolgenden Warnung im September 2019 die UNKonferenz in Neu-Delhi eröffnet, die den Kampf gegen die Wüstenbildung und die Zerstörung fruchtbaren Bodens weiter voranbringen soll. Er führte nach einem Bericht der Frankfurter Rundschau (FR) vom 06.09.2019 aus: »Über 700 Millionen Menschen könnten in den nächsten 30 Jahren zur Flucht gezwungen sein, wenn die Land-Degradation im selben Maße voranschreitet wie bisher. Die Fortschritte sind bisher zu gering.« Dieses Problem sei nicht neu, sondern schon »vor Jahrzehnten erkannt« worden.
Nach einem Bericht in der FR vom 06.09.2019 (»Land gewinnen«) haben sich über 120 Länder in einer UN-Konvention »offiziell verpflichtet, den Verlust produktiver Landflächen aufzuhalten … Sie streben – analog zur Klimaneutralität gemäß dem Pariser Weltklimavertrag – eine ›Degradationsneutralität‹ für die Böden an.« Diese wird allerdings wiederum durch das Bevölkerungswachstum in Frage gestellt. So versucht beispielsweise Indien die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass dort »2050 die erwarteten 1,7 Milliarden statt heute 1,4 Milliarden Menschen leben können«.
Zusätzlich verschärft wird diese Negativentwicklung durch die Verdrängung vieler Kleinbauern von ihrem Ackerland. Dieser Prozess des »Landgrabbing« wird durch das Bemühen bevölkerungsreicher Staaten, die die Versorgung der eigenen Bevölkerung mit Nahrungsmitteln sichern wollen, aber zunehmend auch durch spezialisierte Versicherungen sowie Pensions- und Hedgefonds vorangetrieben, die in fruchtbaren Ackerflächen in erster Linie rentable Anlageobjekte sehen. Insgesamt werden in Deutschland immer noch täglich etwas mehr als 70 – manche Autoren schreiben sogar 100 – Hektar Landfläche pro Tag für Verkehrszwecke, Infrastrukturmaßnahmen oder Bauland umgewandelt. Dies alles führt auch zu einer Erhöhung der Preise für Agrarland und vor allem für deren Pacht.
Nach Informationen der Menschenrechtsorganisation FIAN (FoodFirst Information and Action Network) gibt es »über 2.000 solcher Fälle vor allem in Afrika, Asien und Südamerika … Landgrabbing führt zu massiven Land-Konzentrationen, das sind manchmal 70.000 Hektar, Dimensionen, die wir uns hier in Deutschland nicht vorstellen können«, teilt Herre, Agrarreferent von FIAN, mit. »Statt mehr Menschen zu ernähren, produziere das Landgrabbing zahlreiche Konflikte mit der lokalen Bevölkerung und Kleinbauern, die vorher von dem Land gelebt haben. Gewaltsame Vertreibung und Landflucht seien oft die Folge.« Die erzeugten Güter würden nicht zur Versorgung der lokalen Bevölkerung genutzt, sondern »in unseren Autotanks landen, zur Fleischproduktion oder für die Nahrungsmittelindustrie verwendet. »Nur noch 43 Prozent der produzierten Lebensmittel würden vom Menschen verzehrt … Die Frage der Welternährung ist in erster Linie eine Frage der Verteilungsgerechtigkeit.« Die Behauptung, durch diese Aktivitäten würden »mehr Lebensmittel für Arme produziert, ist völliger Quatsch … Denn die hier produzierten Lebensmittel werden meist in Supermärkten in den Städten für die Mittelschicht angeboten.«
In Ostdeutschland spielt sich dieser Prozess ebenfalls ab, wenn auch in kleinerem Maßstab. Vor allem in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg gehören nach einer Information des ARD-Textes vom 18.08.2019 inzwischen mehr als 30 Prozent der Ackerflächen Investoren oder derartigen Fonds. Sie sind zu Spekulationsobjekten geworden. Über diese und zahlreiche andere bedrohliche Entwicklungen aus ökologischer Sicht informiert die Aufklärungs-Website FiWiSo-Allianz11 detailliert im dortigen Kapitel »Ökologie« auf Ebene III.
Diese nicht nur aus ökologischer Sicht bedrohlichen Entwicklungen und die völlig unzureichenden Gegenmaßnahmen – übrigens auch in Deutschland – haben mich veranlasst, diese Öko-Reihe anzugehen. Bisher sind in diesem Zusammenhang zwei Bände erschienen. Der erste mit dem Titel »Wo sind sie geblieben?… Vom leisen Abschied vieler Arten« erschien 2018 und befasste sich mit den Problemen des Artenschwundes. Im zweiten Buch, »Energiewende? Ja bitte!«, das 2019 publiziert wurde, behandelte ich die Möglichkeiten und Chancen der Energiewende aus ökologischer und sozialer, aber auch aus wirtschaftlicher Sicht.
Auch das hier vorgelegte Buch sieht sich einer möglichst objektiven Darstellung der Sachverhalte im Sinne einer humanistischen Aufklärung verpflichtet. Es geht von der Grundannahme aus, dass die komplexe und leider zugleich völlig verfahrene Situation auf dem Sektor Landwirtschaft eine grundlegende Neuausrichtung weiter Bereiche der konventionellen, insbesondere jedoch der agro-industriellen Landwirtschaft erfordert. Meine Überzeugung ist, dass diese Grundlage unserer Gesellschaft, die letztlich unser aller Leben und Überleben sichert, dauerhaft nachhaltig gestaltet werden muss. Dieser Kraftakt kann jedoch nur dann gelingen, wenn nicht nur die durchaus wichtigen ökologischen Aspekte eines möglichen Wandels behandelt werden, sondern auch die sozialen und wirtschaftlichen Gegebenheiten und Entwicklungsmöglichkeiten voll einbezogen und berücksichtigt werden.
Es wird zunehmend deutlicher, dass die heutige, vorwiegend technokratische und wirtschaftlich kurzsichtige, ja industriell orientierte Betrachtungsweise Boden, Pflanze, Tier und Mensch überfordert. Ein öko-sozialer Paradigmenwechsel ist überfällig. Sehr viele Landwirte möchten ja in diesem Zusammenhang nicht nur als Teil des Problems, als »Prügelknaben« einer verstädterten Gesellschaft gesehen werden, wie dies gerade heute so oft geschieht. Dahinter steht – meist unbewusst – der Versuch, sich von Schuldgefühlen beispielsweise wegen des Verlusts von fruchtbarem Boden und Pflanzen- wie Tierarten, des enormen Leids der »Nutztiere« und der Selbstausbeutung vieler Landwirte und ihrer Familienangehörigen zu entlasten. Doch diese Probleme sind nicht vom Himmel gefallen. Sie sind durch unsere westliche, rücksichtslose und egozentrische Lebensweise gefördert worden. Die globale Ausbreitung dieses Lebensstils verbunden mit einem weiter ungebremsten Wachstum der Menschheit und hier vor allem ihrer Mittelschichten verschärft dieses Problem kontinuierlich. Denn gerade diese aufstrebenden Schichten möchten leben wie wir im »goldenen« Westen. Wer könnte ihnen dies auch verwehren. Wenn sich jedoch der überwiegende Teil der Menschheit diesem in ökologischer wie sozialer Hinsicht räuberischen Lebensstil weiter hingibt, ist die ökologische wie soziale Katastrophe unausweichlich.
Unabhängig davon, ob man diese Sichtweise teilt oder nicht, müssen die Landwirte unbedingt ein wesentlicher, selbstbestimmter Akteur und damit Teil einer tragfähigen nachhaltigen Lösung sein. Ich bin davon überzeugt, dass heute in Deutschland die übergroße Mehrheit der Bauern dazu auch bereit ist. Sie müssen jedoch unbedingt »auf Augenhöhe« einbezogen werden. Es darf nicht nur über sie geredet, sondern sie müssen in den Prozess als gleichberechtigte Partner gesehen und behandelt werden. Sie sind doch die Experten, die in sehr vielen Fällen nur unter dem Druck der Verhältnisse so handeln, wie sie dies heute tun (müssen). Und viele würden gerne eine andere Art der Landwirtschaft betreiben, die vor allem weniger kapitalintensiv und tiergerechter sein sollte. Daher muss ihnen auch eine dauerhafte, gesellschaftlich und wirtschaftlich gesicherte Existenz als Gegenleistung für ihre unverzichtbaren Dienste – gerade auch im ökologischen Bereich und demjenigen der Kultur- und Landschaftspflege – ermöglicht werden. Meine Hoffnung ist, dass dieses Buch einen – wenn auch sehr – kleinen Beitrag dazu leisten kann.
Es wäre vermessen, diese so vielfältige Problematik der heutigen Landwirtschaft auch nur einigermaßen zutreffend und gerecht in einem notwendigerweise ziemlich schmalen Buch behandeln zu wollen. Ich konzentriere mich daher ausschließlich auf die drei mir besonders am Herzen liegenden Bereiche: die generelle Bodenproblematik, Probleme der Tierzucht in Deutschland und die soziale Frage in der deutschen Landwirtschaft. In diesem Zusammenhang wird auch auf die wirtschaftliche, heute so bedrohte Existenz sehr vieler Höfe mittlerer und kleinerer Größe eingegangen. Gerade diese sind aus ökosozialer Sicht für eine dauerhaft tragfähige und ökologisch vertretbare Landwirtschaft von ausschlaggebender Bedeutung. Europäische oder gar globale Probleme können in diesem Kontext nur am Rande gestreift werden. Die vielfältigen und teilweise – wie moderne Biohöfe beweisen – mit Erfolg beschrittenen Wege aus der gegenwärtigen Misere werden aufgezeigt.
Nicht behandelt werden können die überaus vielen, ebenfalls sehr wichtigen Bereiche, die Bestandteil der modernen Landwirtschaft oder doch mit ihr eng verbunden sind. Sie berühren ein sehr weites Feld: vom Ackerbau über die Probleme der Globalisierung auf dem Ernährungssektor und des wachsenden gentechnischen Potenzials bis hin zu einer durchgreifenden Bekämpfung des Hungers von heute noch über 800 Millionen Menschen und der Verschwendung von etwa der Hälfte der Lebensmittel über alle Stufen hinweg. Ich muss mich daher bescheiden und meine Ausführungen auf die drei oben genannten Bereiche beschränken. Eine umfassende Darstellung der gesamten Problematik und ihrer zahlreichen Lösungsmöglichkeiten steht noch aus.
Ich versuche in diesem Buch, vorrangig die großen Linien auf den drei genannten Feldern herauszuarbeiten. Dennoch bin ich der Überzeugung, dass es wichtig ist, die jeweiligen Entwicklungen und Zustände auch mit Daten und Fakten zu unterfüttern. Diese sind für den interessierten Leser gedacht, denn es ist alles andere als einfach, diese oft weit gestreuten Informationen zusammenzubringen. Wer in geringerem Umfang interessiert sein sollte, kann diese Passagen durchaus überspringen.
Wichtig ist mir, auch praktikable Vorschläge als mögliche Grundlage von Lösungen anzubieten. Daher werde ich es nicht dabei belassen, lediglich allgemeine Schlussfolgerungen zu ziehen und Forderungen aufzustellen, was im gesellschaftlichen Rahmen alles getan oder verändert werden sollte, damit wirklich »Neuland« gewonnen werden kann. Ein Kapitel befasst sich daher auch mit unseren eigenen Möglichkeiten, sich anders und besser zu ernähren, sowie der Aufforderung, den eigenen, oft wenig nachhaltigen Lebensstil, der in aller Regel mit einem zu großen ökologischen Fußabdruck verbunden ist, zu prüfen und gegebenenfalls zu verändern.
Gerade auf dem Gebiet der Agrarwende vollzieht sich seit einiger Zeit ein durchgreifender Wandel. Ständig lassen sich daher neue Entwicklungen zum Positiven wie auch hin zum Negativen beobachten. Daher ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass der Entwurf zu diesem Buch bereits im April 2020 abgeschlossen worden ist, und dass daher neuere Entwicklungen nicht mehr berücksichtigt werden konnten.
2 Einführung
In den letzten fünfzig Jahren hat die Landwirtschaft in Deutschland den größten Umbruch seit etwa 1830, dem zaghaften Beginn ihrer Mechanisierung, erlebt. In einem großen Artikel für die ZEIT vom 18. Januar 2018 wird diese Situation unter dem Titel »Die Landwirtschaft steht vor ihrem größten Umbruch – getrieben von Ökologie, Technik, Konsumenten und Politik« geschildert. Ich werde im Folgenden wesentliche Aussagen dieses Berichts zitieren, da sie den Rahmen und die erforderliche Richtung der notwendigen Weiterentwicklung vor dem Hintergrund einer bald auf zehn Milliarden Menschen mit einer überproportional wachsenden, kaufkräftigen globalen Mittelschicht verdeutlichen.
»Die Landwirtschaft ist mehr als nur irgendein Wirtschaftssektor, sie ist ein zentraler Überlebensfaktor. Was Landwirte tun, beeinflusst Wasser, Klima, Boden, Gesundheit, Wirtschaft und Kultur … Zugleich wird die Landwirtschaft von unser aller Vorstellungen geprägt … Das zeigt sich auch in einer neuen bürgerlichen Agrarbewegung, die urbane Gärten anlegt und in den Städten ›Ernährungsräte‹ gründet. Die ›solidarische Landwirtschaft‹ soll Konsumenten und Bauern näher zusammenbringen und so die klaffende Erkenntnis- und Erfahrungslücke zwischen Hofalltag und Supermarktregal schließen.«
»Der wachsende Druck erzeugt aber auch in der Branche geradezu tektonische Umbrüche. Er zwingt … zu neuen Strategien und bringt neue Akteure aufs Feld … Die Politik reagiert nicht nur auf äußeren Veränderungsdruck. Sie kämpft um Glaubwürdigkeit … Deutschland hat versprochen, deutlich mehr als bisher für den Schutz des Klimas, der Artenvielfalt und der natürlichen Ressourcen zu tun.« In dem Artikel werden die seither eingetretenen Entwicklungen dargestellt. Das Ergebnis ist unter dem Strich negativ – insbesondere auch beim Tierschutz und der Nitratbelastung des Grundwassers.
»Ein Strategiewechsel ist gefragt. Das Bundesumweltministerium ließ daher … einen ›Gesellschaftsvertrag für eine zukunftsfähige Landwirtschaft‹ diskutieren und formulierte gleich zu Anfang …: ›Ein Weiter so ist nicht möglich‹. Doch die überfällige Kurskorrektur muss mit den Landwirten vollzogen werden, nicht gegen sie … Es sind immer noch mehrheitlich Familien, die die Höfe bewirtschaften … Etwas weniger Bürokratie, etwas mehr Ökologie – das wird auf Dauer nicht reichen … Es hängt alles davon ab, wie Europa die Landwirtschaft definiert: Als Relikt der Vergangenheit oder als Chance für eine gemeinsame Zukunft.« Der Strukturwandel in der Landwirtschaft verlief seit gut 20 Jahren – so Busse7 – nach industriellen Prinzipien. Er wurde in erster Linie bestimmt durch »Intensivierung, Technisierung, Spezialisierung und Standardisierung«. Ein ausgesprochen naturfernes und »brutales, aber höchst effizientes System«. In diesem »auf Effizienz getrimmten System werden mehr Ressourcen verbraucht als Werte geschaffen«. Busse weist auch überzeugend nach, um was für eine »Verschwendungswirtschaft« es sich dabei tatsächlich handelt, die auf »tönernen Füssen« steht. Ihr Leitprinzip sei das »Wegwerfen von Anfang an bis zum Konsumenten«.
Auch zahlreiche andere Autoren sind der Ansicht, dass die Landwirtschaft über Jahrzehnte hinweg in eine grundsätzlich falsche Richtung hin entwickelt wurde. Die dahinterstehende Philosophie wird häufig als »Tonnenmentalität« bezeichnet in Verbindung mit einem Primitiv-Darwinismus des »survival of the fittest« oder »Wachsen oder Weichen«. Es herrschen in weiten Teilen turbokapitalistische Produktionsbedingungen, in denen sich vor allem die mittleren und kleineren Landwirte wie »zwischen Hammer und Amboss« befinden. Auf der Angebots- wie Nachfrageseite stehen sie überstarken »Partnern« gegenüber: einem faktischen Kartell von Großschlachtereien, Molkereien, industriellen Unternehmen vom Saatgut bis hin zur Technik und gut organisierten Handelsketten. Darüber hinaus fühlen sich gerade diese Gruppen gesellschaftlich ziemlich allein gelassen und vom eigenen Verband nicht ausreichend vertreten.
So liegt der Deutsche Bauernverband meist auf der Linie der Großlandwirte sowie nicht selten sogar derjenigen großer Hersteller von Saatgut, Mineraldünger, Pestiziden, Pharmazeutika etc. Gefördert wurde diese zudem stark exportorientierte Entwicklung durch eine Subventionierung nach dem »Gießkannenprinzip«. Es dominiert, wenn auch inzwischen etwas abgemildert, die Förderung nach der Fläche und nur in relativ bescheidenem Umfang nach den gesellschaftlich erwünschten Leistungen. Dies alles hat zu einer in Teilen erheblichen Überproduktion geführt, die – EU-gestützt – auf außereuropäische Märkte umgeleitet wurde und dort den Kleinbauern das Leben schwer gemacht hat.
Diese Skizzierung der Verhältnisse ist bewusst grob und etwas überspitzt geraten, weil so deutlicher wird, dass es mit dem Drehen an der einen oder anderen Stellschraube nicht mehr getan ist. Eine grundlegende Reformierung des Gesamtsystems ist vonnöten, sollen kleinere und mittlere Landwirtschaftsbetriebe in Deutschland – allem in ärmeren (Mittelgebirgs-)Lagen mit dominierender Milchwirtschaft – weiterhin existieren können. Wir bewegen uns in dieser Hinsicht leider auf US-amerikanische Verhältnisse zu.
Es ist wichtig zu wissen, von welcher Art Landwirtschaft geredet wird. Daher werden diesem Kapitel die Begriffsbestimmungen für die wichtigsten landwirtschaftlichen Betriebsformen vorangestellt. Allerdings sind die Abgrenzungen zwischen diesen Wirtschaftsformen häufig unscharf. Die folgenden Ausführungen stützen sich weitgehend auf die entsprechenden Passagen von Wikipedia. Die Definitionen alternativer Formen landwirtschaftlicher Tätigkeit wie beispielsweise des Ökolandbaus werden in Abschnitt 3.4 »Alternative Wirtschaftsformen« vorgestellt.
Als »bäuerliche Landwirtschaft« wird eine Landwirtschaft bezeichnet, die in Kontrast zu einer vorrangig auf Produktivität und Rendite ausgerichteten Landwirtschaft – also vor allem der »industriellen Landwirtschaft« – steht. Man sollte sich allerdings darüber im Klaren sein, dass mit diesem weitgehend tautologischen Begriff eigentlich ein Idealbild aus vergangener Zeit beschrieben wird. Eine Abgrenzung zum Begriff der »konventionellen Landwirtschaft« ist schwierig.
Bei der Betriebsform »bäuerliche Landwirtschaft« wird davon ausgegangen, dass es sich hier vor allem um Familienbetriebe handelt, die schon seit Generationen ihr eigenes Land bewirtschaften. Wir dürfen daher auch annehmen, dass diese Betriebe verstärkt auf langfristige Auswirkungen ihres Wirtschaftens wie beispielsweise auf die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit oder auf die Umweltverträglichkeit der Maßnahmen achten. Aus diesem Grund ist diese Form der Bewirtschaftung deutlich positiver als die nachfolgend beschriebenen Arten einzuschätzen. Allerdings darf man nicht automatisch davon ausgehen, dass die »bäuerliche Landwirtschaft« die gesellschaftlich und vor allem in ökologischer Hinsicht wichtigen Ziele besser erreicht als andere Betriebsformen. Man darf nicht übersehen, dass gerade die kleinen und vor allem mittleren Landwirtschaftsbetriebe einen sehr schweren Stand im heute ruinösen Wettbewerb haben. Kleinbetriebe nutzen häufig die Chance, als Nebenbetrieb bewirtschaftet zu werden. Auch können hier leichter andere Funktionen beispielsweise touristischer Art wahrgenommen werden.
Viele Betriebe dieser Kategorie haben sich in der »Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft« zusammengefunden. Diese AG versteht sich als Korrektiv, vielleicht gar als Opposition, zum Deutschen Bauernverband. Diesem wird eine zu große Nähe zu größeren und vor allem Großbetrieben sowie zur Agrarindustrie vorgehalten. Die Interessen der »Kleineren« würden zu wenig berücksichtigt. Diese Haltung kann ich durchaus nachvollziehen, da im Deutschen Bauernverband die Großunternehmen seit Jahrzehnten dominieren und die Verbandspolitik wesentlich mitbestimmen. Weniger überraschen dürfte, dass der Bauernverband dies natürlich ganz anders sieht. Sein offizielles Leitbild deckt sich daher in weiten Teilen mit demjenigen der AG bäuerliche Landwirtschaft: Danach soll eine »moderne Landwirtschaft« dadurch gekennzeichnet sein, dass »aktive Landwirte und bäuerliche Familienunternehmer generationenübergreifend und nachhaltig denken und handeln«.
In Deutschland ist diese so charakterisierte Gruppe von Landwirten, die leider Jahr für Jahr an Boden verliert, vor allem aus ökologischer Sicht besonders wichtig. Ihre Vertreter arbeiten auch noch in den gerade in Süddeutschland so häufig vertretenen Mittelgebirgslagen unter meist schwierigen Bedingungen. Sie sollten daher stärker im Fokus der politischen Betrachtung und hier vor allem auch ökologisch zielgerichteter Förderung stehen. Blicken wir einmal über den nationalen Zaun und vor allem auf die Dritte Welt, so müssen wir feststellen, dass es gerade die Kleinbauern sind, die die landwirtschaftlichen Verhältnisse bestimmen. Und dies im Gegensatz zu den agroindustriellen Unternehmen in ökologisch meist positiverer Art. Sie müssen ja auch in Zukunft noch von ihrem Stück Land einigermaßen leben können. Doch dieses Feld ist zu umfangreich, als dass ich in diesem Zusammenhang noch weiter darauf eingehen kann.
Unter konventioneller Landwirtschaft ist also eine Betriebsform zu verstehen, die sich aus der »traditionellen (bäuerlichen) Landwirtschaft« entwickelt hat. Heute allerdings ist sie idealtypisch dadurch charakterisiert, dass sie »unter Berücksichtigung der regionalen Gegebenheiten und unter Anwendung der von der Agrarwissenschaft empfohlenen Produktionsverfahren bei gleichzeitiger Einhaltung der Landwirtschaftsgesetze und EU-Verordnungen Nahrungs- und Futtermittel erzeugt und die Kulturlandschaft betreut«.
Man kann allerdings diese Wirtschaftsform heute nicht mehr nur aus der Perspektive des bäuerlichen Betriebes betrachten. Vielmehr ist sie »eingebettet in ein komplexes System von Lieferanten–Kundenbeziehungen innerhalb des Systems des Agrobusiness«. Einzufügen wäre eigentlich noch der Begriff »übermächtig«, da die konventionellen Landwirte heute in aller Regel starken, global agierenden und zudem gebündelten Wirtschaftskräften auf der Angebots- wie auch der Nachfrageseite ohne eigene starke Marktmacht gegenüberstehen. In dieser »konventionellen Landwirtschaft« findet man daher eine sehr breite Palette von Betriebsformen und damit die überwältigende Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe. Sogar auf »Massentierhaltung spezialisierte Betriebe« werden häufig hierzu gezählt. Lediglich die Unternehmen, die »ausschließlich zugekaufte Futtermittel verfüttern«, werden der Kategorie der industriellen Landwirtschaftsbetriebe zugerechnet. Entscheidend ist hier der Begriff »ausschließlich«. Wenn demnach ein Mastbetrieb selbst produzierte Futtermittel – wenn auch nur in relativ geringem Umfang – verwendet, wird er als Teil der konventionellen Landwirtschaft gesehen.
Was verwundert es da, dass der Begriff »konventionelle Landwirtschaft« in der Öffentlichkeit häufig nicht eben positiv besetzt ist, zumal er meist als Gegensatz zu »ökologischer Landwirtschaft« oder zu alternativen landwirtschaftlichen Betriebsformen verwendet wird. Auch wird sehr kritisch gesehen, dass diese Wirtschaftsformen oft nicht-geschlossene Kreisläufe aufweisen. Darüber hinaus verwenden sie Kunstdünger und synthetische Pflanzenschutzmittel in nicht unerheblichem Maße, die für unerwünschte ökologische Folgen wie beispielsweise das Insektensterben mitverantwortlich gemacht werden. Es handelt sich demnach um einen höchst unscharfen Begriff, unter dem sich nahezu alle Betriebsformen – vom kleinbäuerlichen Hof bis hin zu einem Betrieb mit Massentierhaltung – zusammenfassen lassen.
In den letzten Jahren wurde daher ein neuer Begriff geprägt: »moderne Landwirtschaft«. So hoffte man, ein besseres Image gewinnen und gleichzeitig die Basis weiter verbreitern zu können. Propagiert wurde diese Bezeichnung vom 2014 umgegründeten Forum Moderne Landwirtschaft (FML), dessen Vorsitzender Rukwied zugleich Präsident des Deutschen Bauernverbandes ist. Nach eigener Darstellung sind Kennzeichen dieser Betriebsform »nachhaltige Verfahren« sowie, dass man sich bewusst sei, »Verantwortung für Tiere und den Naturhaushalt« zu tragen. Überdies wird die »Vielfältigkeit« und vor allem auch die »Fortschrittlichkeit« dieser »modernen« landwirtschaftlichen Betriebe hervorgehoben. Gerade diese Merkmale würden diese Betriebsformen »so faszinierend« machen.
Nach Wikipedia handelt es sich dagegen um eine »deutsche Vereinigung maßgeblicher Organisationen und Unternehmen der Landwirtschaft sowie ihrer vor- und nachgelagerten Bereiche«. In Letzterem ist denn auch der besondere Unterschied zur »konventionellen Landwirtschaft« zu sehen. Wenn man die Mitgliederliste liest, so findet man in dieser »modernen Landwirtschaft« die wichtigen Unternehmen der Agro-Industrie in sehr hohem Maße vertreten. Daher ist davon auszugehen, dass diese Großunternehmen durchaus verstehen werden, ihre speziellen Interessen in dieser »modernen« Landwirtschaft entsprechend durchzusetzen. Den kleinen und mittelgroßen Familienbetrieben dürfte also ein deutlich geringeres Gewicht zukommen, als dies in der Kategorie »konventionelle Landwirtschaft« der Fall ist.
Häufig wird auch von »industrieller Landwirtschaft« oder auch »Agrarindustrie« gesprochen. Mit diesem Begriff werden landwirtschaftliche Unternehmen bezeichnet, die ihre wirtschaftlichen Abläufe ähnlich wie industriespezifische Prozesse organisiert und ökonomisch wie auch in technischer Hinsicht optimiert haben. Derartige Unternehmen haben sich in aller Regel auf relativ wenige Produkte spezialisiert. Im Rahmen dieses Buches beschränke ich mich auf die Betriebe, die sich in erster Linie mit intensiver oder auch Massentierhaltung befassen.
In aller Regel sind diese Unternehmen auf eine Tierart und hier manches Mal nur auf bestimmte Lebensphasen dieser Nutztiere spezialisiert. Ein wichtiges Kennzeichen dieser Betriebe ist, dass sie nicht über ausreichend eigene oder gepachtete Flächen verfügen, um die gehaltenen Tiere aus eigener Produktion ernähren zu können. Sie sind auf Zukauf von Futtermitteln in unterschiedlichem Umfang angewiesen. Auch ist in aller Regel die Kapitalintensität deutlich höher als bei den vorgenannten Betriebsformen.
Man sollte, wenn die gesellschaftliche Position der Landwirtschaft behandelt wird, stets auch die Gesamtgesellschaft in die Betrachtung einbeziehen. Die folgende Abbildung verdeutlich das enorme Wachstum der Bevölkerung seit 1950, das Mitte unseres Jahrhunderts voraussichtlich zehn Milliarden erreichen wird. Der Anteil der Landbevölkerung verringert sich dabei stetig und liegt bereits heute deutlich unter demjenigen der Stadtbevölkerung.
Abb. 1: Entwicklung der Stadt- und Landbevölkerung zwischen 1950 und 2050 in Millionen (nach 2014 extrapoliert)
Quelle: World Population Prospects: The 2014 Revision, Dept. of Economic and Social Affairs, Population Division, UN New York 2014
Unter den 233 in diese Studie einbezogenen Ländern lebten in 25 Ländern zum Untersuchungszeitpunkt (2015) mehr als 60 Prozent der Bevölkerung in Städten. Immerhin 14 Länder wiesen bereits 2014 mit einem Anteil an Stadtbewohnern in Höhe von 80 Prozent einen deutlich höheren Urbanisierungsgrad auf. Man muss feststellen, dass die städtische Bevölkerung heute in weiten Teilen den direkten Bezug zum ländlichen Raum verloren hat. Sie ist zunehmend nicht in der Lage, die völlig anderen Probleme der Landbevölkerung, vor allem der Bauern kleinerer und mittlerer Höfe und der Kleinbauern zu verstehen. In demokratisch organisierten Gesellschaftssystemen stoßen sie daher häufig auf Unverständnis bis auf Ablehnung ihrer Vorstellungen, die dann auch häufig überstimmt werden. Die Folge: Sehr viele Landwirte fühlen sich miss- oder gar unverstanden und gesellschaftlich allein gelassen.
Auch für Deutschland trifft diese Feststellung im Großen und Ganzen zu. Die folgende Abbildung bringt den enormen Strukturwandel, der in der deutschen Landwirtschaft seit 1991 stattgefunden hat, deutlich zum Ausdruck.
Abb. 2: Die Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe in tausend Einheiten und ihrer Flächen in Hektar in Deutschland zwischen 1991 und 2016
Quelle: Statistik und Berichte des BMEL, Bonn (SJG – 930 1010)
Nach einem Bericht des Bundeslandwirtschaftsministeriums hat sich dieser Strukturwandel zwar etwas verlangsamt, beläuft sich jedoch im Durchschnitt der letzten Jahre immer noch auf 1,7 Prozent der Anzahl aller Betriebe. In den Jahrzehnten davor lag er mit etwa bei drei Prozent je Jahr allerdings deutlich höher.
In Zahlen ausgedrückt: Wurden im Jahr 1975 noch etwa 900.000 landwirtschaftliche Betriebe gezählt, so war deren Anzahl 2007 bereits auf 321.600 oder knapp 36 Prozent geschrumpft. Bis 2017 hatte sich ihre Anzahl um weitere 51.800 beziehungsweise 16 Prozent auf 269.800 Betriebe verringert. Dieser Schrumpfungsprozess ist im ganzen ehemals westdeutschen Gebiet festzustellen und betrifft vor allem Hofstellen kleinerer und mittlerer Größe. Nach Prognosen soll sich dieser Trend fortsetzen, so dass es bis 2040 nur noch etwa 100.000 landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland geben soll. Und was dann?
Man muss diesen Strukturwandel auch auf dem Hintergrund der Überschuldung vor allem sehr vieler kleinerer und mittlerer bäuerlicher Betriebe sehen. Viele Hoferben behalten zwar die Hofstelle als Wohnsitz, geben aber den Betrieb selbst auf. Das Land wird dann verpachtet, was heute zu sehr günstigen Konditionen möglich ist. Daher ist bei nahezu gleichbleibender Anbaufläche die Anzahl der bäuerlichen Unternehmen in Deutschland zwischen 2003 und 2013 um 32 Prozent geschrumpft.
Es ist wichtig zu wissen, dass dieser Negativtrend keineswegs nur wirtschaftlich bedingt ist. Natürlich sind die Preise für die meisten landwirtschaftlichen Produkte deutlich zu niedrig. Zu Hohenlohe-Oehringen, der in einem Beitrag in der ZEIT vom 30. Januar 2020 unter dem Titel »Geiz schmeckt nicht geil – Die Deutschen wollen möglichst viele Bio-Lebensmittel – und möglichst wenig dafür bezahlen« ausführt: »Das geht nicht. Deswegen auf die Bauern zu schimpfen, ist verlogen«. Dem kann ich in weiten Teilen nur zustimmen. Er bringt in diesem Artikel unter anderem zum Ausdruck, dass »der Eindruck fehlender Achtung, medialer Verunglimpfung und wachsender Stadt-Land-Entfremdung die Bauern den Mut verlieren lässt«. Auch ich bin seiner Ansicht, dass »die Bauern Teil der Lösung« sein sollten. Genau darum geht es in Zukunft: Respektvoll und verständnisvoll für die Probleme und Nöte aller Seiten Wege in die Zukunft zu finden, die aus der jetzigen Sackgasse herauszuführen.
Die EU ist seit 1957, als der Agrarmarkt vergemeinschaftet wurde, hauptsächlich für die Entwicklung, welche die Landwirtschaft ihrer Mitgliederstaaten genommen hat, verantwortlich. Und man kann mit Fug und Recht feststellen, dass es ihr in diesen gut 60 Jahren nicht gelungen ist, eine befriedigende ökosoziale Situation in der Landwirtschaft zu erreichen. Sie war zu sehr wirtschaftlich orientiert, strebte danach, auch die Landwirtschaft zu globalisieren, und hatte vor allem das Hauptziel, die Bevölkerung mit möglichst billigen Nahrungsmitteln zu versorgen. Zu diesem Zweck wurden enorme Mittel aufgewendet, die anders und zielgerichteter hätten eingesetzt werden müssen.
Mit knapp 60 Milliarden Euro pro Jahr macht der Agraretat den größten Teil des EU-Gesamtbudgets aus. Der auf Deutschland entfallende Anteil liegt bei rund 6,2 Milliarden. In diesem Jahr wird das nächste Sieben-Jahres-Budget vereinbart, das ab Beginn 2021 in Kraft treten soll. Wegen des Brexit und damit des Wegfalls der britischen Zahlungen sowie gestiegener, unabweisbarer Forderungen anderer Politikbereiche wird daher um seine Ausgestaltung besonders hart gerungen. Der Budget-Entwurf für die gemeinsame Agrarpolitik (GAP) wurde zudem bereits im Vorfeld um zehn Prozent gekürzt. Im Abschnitt 3.3 wird unter »Subventionen« näher auf diesen Sachverhalt eingegangen.
3 Sachlage und Beurteilung
3.1 Boden
Vorbemerkung: Das Naturmuseum Senckenberg hatte bis zum 13.08.2017 eine Sonderausstellung in Frankfurt mit dem Thema »Die dünne Haut der Erde – Unsere Böden« durchgeführt, die vom Senckenberg Museum Görlitz gestaltet worden war. Dieser Ausstellung und vor allem dem Führer zur Ausstellung, der von Zumkowsky-Xylander u. a.38 gestaltet worden ist, sind zahlreiche der nachfolgenden Informationen zu verdanken.
Der Boden und insbesondere der fruchtbare Boden stellt für uns alle, aber auch für die terrestrische Tier- und Pflanzenwelt, die weitaus wichtigste Lebensgrundlage dar. Auch als Quelle sehr vieler Nahrungsmittel ist er unverzichtbar. Er ist endlich und sollte daher nicht nur geschont, sondern möglichst verbessert, ja auch vermehrt werden. Allerdings ist genau das Gegenteil der Fall. Mehr als ein Drittel der ursprünglich einmal landwirtschaftlich genutzten Böden ist geschädigt oder gar bereits unrettbar verloren. Es ist daher allerhöchste Zeit, dass wir uns intensiver darum kümmern.
Grobe Charakterisierung des Bodens
Im weltweiten Durchschnitt ist die Bodendecke etwa zwei, in Mitteleuropa dagegen nur etwa einen Meter dick. Global gesehen kann sie jedoch auch nur wenige Zentimeter betragen oder im Extrem sogar bis nahezu 20 Meter an Tiefe aufweisen. Die nachfolgenden Ausführungen lehnen sich in Teilen an das außerordentlich lesenswerte Buch »Food Crash« von zu Löwenstein19 an.
Wie verletzlich diese lebenswichtige Schicht ist, macht ein Vergleich mit einem Apfel mittlerer Größe deutlich. Wenn die durchschnittliche Bodenmächtigkeit der Dicke von zwei Metern der Apfelrinde entspricht, so wäre der dazugehörende Apfel 8,6 Kilometer dick. Von dieser dünnen Schicht hängt jedoch unser aller Leben ab. »Nirgendwo ist das Leben so dicht gepackt wie in der obersten fruchtbaren Erdschicht. In einem einzigen Kubikmeter gesunden Oberbodens leben mehr Organismen, als es Menschen auf der ganzen Erde gibt … Wenn die flache Schicht fruchtbaren Bodens erst einmal fort ist, gelingt es uns kaum mehr, das Land wieder urbar zu machen. Die natürlichen Prozesse der Bodenbildung laufen in zeitlichen Dimensionen ab, mit denen wir Menschen nichts zu tun haben.« (FR vom 28.08.2019)
In Mitteleuropa haben sich die Böden in weiten Regionen erst wieder nach der letzten Eiszeit vor etwa 12.000 Jahren entwickelt. Unter unseren Verhältnissen bedeutet dies, dass die Entwicklung von Böden sehr lange dauert: Im Durchschnitt etwa 120 Jahre pro Zentimeter, in ungünstigen Lagen sogar mehrere Jahrhunderte. Leider ist inzwischen mehr als ein Drittel der ursprünglich einmal landwirtschaftlich genutzten Böden geschädigt oder gar bereits unrettbar verloren. »Ein großer Teil der Böden wird inzwischen so bewirtschaftet, als gäbe es gar kein Leben im Boden, als sei die Erde nur das Substrat, an dem sich die Pflanzen festhalten … Noch nie in der Geschichte der Menschheit sind wir derart flächendeckend weltweit gegen unsere eigenen Lebensgrundlagen – im Wortsinne – zu Felde gezogen« (FR vom 28.08.2019).
Dies ist ein enorm wichtiges Problem. Die FR fährt fort: »Tatsächlich ziehen wir uns selbst den Boden unter den Füßen weg. Auch das wieder wörtlich gemeint, denn unsere Form der Bodenbearbeitung tötet nicht nur das Leben im Boden, sondern sorgt auch für Erosion durch Wind und Wasser.« Der Bericht verweist auf schlimme Beispiele – unter anderem auch in Südeuropa. »Im Süden Spaniens lassen sich malerisch verfallene Fincas besichtigen, die jahrhundertelang die Menschen ernährten. Jetzt stehen sie in einer von tiefen Erosionsgräben durchzogenen, stetig wachsenden Wüste.«
Unsere Sprache macht deutlich, dass unseren Vorfahren durchaus bewusst war, wie wichtig der Boden ist: Man kann seine Bodenhaftung verlieren, aber auch verlorenen Boden wieder gutmachen; etwas kann sich zu einem »Fass ohne Boden« entwickeln oder man kann hoffen, dass Gedanken auf »fruchtbaren Boden« fallen. Diese Liste ließe sich problemlos verlängern. In sehr vielen Sprachen kommt der »Boden« als Grundlage und zugleich als Maß für unser Leben metaphorisch vor.