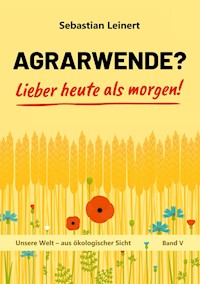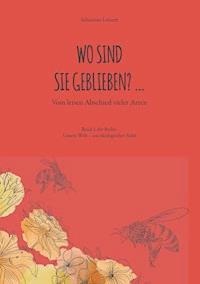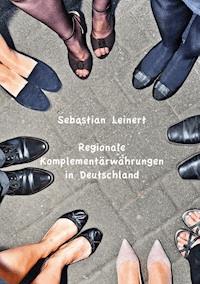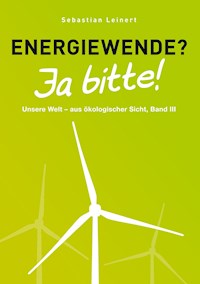
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eine "Energiewende" ist in Anbetracht des Klimawandels unbedingt not- wendig. Darüber stimmen nahezu alle Experten weitestgehend überein. Heiß umstritten sind allerdings wegen der enormen gesellschaftlichen und ökonomischen Auswirkungen dieses Jahrhundert-Prozesses das "Wie?" und "Wann?". Dieses Buch versucht, die heutige Ausgangssituation bei den herkömmlichen wie auch den Erneuerbaren Energien darzustellen. Im Hauptteil werden fossile/atomare und Erneuerbare Energien in ihrer Wirkung unter neun Aspekten verglichen. Diese decken das Feld von der "Emission von Treibhausgasen" über "Soziale Auswirkungen" bis hin zu "Kosten und Subventionen" weitgehend ab. Auf dieser Grundlage werden Empfehlungen für das Verhalten von Gesellschaft und Politik sowie für jeden dasjenige jedes Einzelnen formuliert. Noch kann die "Energiewende" zu einem guten Ende geführt werden. Doch ein grundlegender Kulturwandel ist dafür unerlässlich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 355
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
für Ute
INHALT
Verzeichnis der Abkürzungen
Anliegen dieser Buchreihe und dieses Buches
Einführung
Konventionelle und atomare Energien
1.1 Kohle
1.2 Erdöl
1.3 Erdgas
1.4 Kernenergie
Erneuerbare Energien
2.1 Photovoltaik
2.2. Windenergie (on- und offshore)
2.3 Bioenergie
2.4 Biodiesel
2.5 Wasserkraft (on- und offshore)
2.6 Geothermie
2.7 Wasserstoff
Konventionelle versus erneuerbare Energien
3.1 Emission von Treibhausgasen
3.2 Positive und negative Auswirkungen auf die Ökologie
3.3 Positive und negative Auswirkungen in sozialer Hinsicht
3.4 Beurteilung in organisatorischer Hinsicht
3.5 Auswirkungen auf das Landschaftsbild
3.6 Sicherheit der Stromversorgung
3.7 Kosten und Subventionen
3.8 Organisatorische und technische Innovationen
3.9 Zusammenfassende Beurteilung der Ergebnisse des Kapitels 3
Was sollte „man“ tun?
Was kann ich als Einzelperson bewirken?
Wie wird es wohl weitergehen?
Literatur und Quellenangaben
Anlagenteil
VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN
BGR
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe
BMU
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
BUND
Bund für Umwelt und Naturschutz in Deutschland
EEA
Europäische Umweltagentur
EEG
Erneuerbare-Energien-Gesetz
EU
Europäische Union
FAZ
Frankfurter Allgemeine Zeitung
FNP
Frankfurter Neue Presse
FR
Frankfurter Rundschau
IEA
International Energy Agency
IG BCE
Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie
IPPC
Intergovernmental Panel on Climate Change
kWh
Kilowattstunde
MW
Megawatt (1 Million kW)
NaBu
Naturschutzbund Deutschland
NGO
Nichtregierungsorganisation
TW
Terawatt (1 Billion kW)
UBA
Umweltbundesamt
UN
Vereinte Nationen
UNEP
Umweltprogramm der Vereinten Nationen
„Sei Du selbst die Veränderung, die du dir wünschst, für diese Welt.“
Mahatma Gandhi
ANLIEGEN DIESER BUCHREIHE UND DIESES BUCHES
Wenn man heute seine Zeitung aufschlägt, so stößt man in jeder zweiten Ausgabe auf mindestens einen Artikel, der sich mit dem unbefriedigenden ökologischen Zustand unserer Erde befasst. Man muss dabei leider feststellen, dass selbst die Verhältnisse in Deutschland aus ökologischer Sicht eine ganze Menge zu wünschen übriglassen. Vom einstigen „Musterschüler“ ist nicht mehr viel Positives zu lesen. Dafür haben inzwischen andere Staaten, und hier vor allem die VR China, die Führungsposition bei Investitionen in ökologisch orientierte Programme übernommen.
Im offiziellen politischen Diskurs Deutschlands spielen ökologische Fragen nach wie vor eine nachrangige Rolle. Der beste Beweis dafür ist das Koalitionspapier der aktuellen Regierung. Obwohl so viele ökologische Probleme drängend im Raum stehen, wurden diese kaum – und wenn, dann unzureichend – thematisiert. Auch hat sich die neue Regierung bislang kaum um entsprechende Problemlösungen gekümmert.
Dieser Einstellung des Nicht-Wahrnehmenwollens möchte die Buchreihe „Unsere Welt – aus ökologischer Sicht“ entgegenwirken. Sie möchte das Bewusstsein dafür schärfen, was für einen einmaligen Schatz wir mit unseren natürlichen Grundlagen überkommen haben. Wie dringend sind wir nicht auf ihn in biologischer, kultureller, wirtschaftlicher und vor allem auch gesellschaftlicher Hinsicht angewiesen! Und wie leichtfertig schwächen wir heute diese Lebensgrundlagen und damit die Zukunft unserer Nachgeborenen ohne wirklich triftigen Grund!
Es ist ziemlich mühsam, sich einen genaueren Überblick über die aktuelle ökologische Situation in Deutschland und vor allem in globaler Sicht zu verschaffen. Die Informationen zu den gerade ablaufenden ökologischen Prozessen sind meist verstreut, nicht immer leicht zugänglich und dazu oft noch durch persönliche oder Gruppeninteressen gefärbt. Diesen Sachverhalt treffen wir vor allem bei der Frage an: Wie wollen, wie sollten wir unsere Energie-Zukunft gestalten?
Diese Buchreihe strebt daher an, den Stand und die voraussichtliche Entwicklung der wichtigsten aktuellen Energiearten global und hierzulande möglichst objektiv zu beschreiben und – vorrangig aus ökologischer Sicht – zu beurteilen. Eine zu oberflächliche Darstellung soll vermieden werden. Allerdings darf und möchte diese Reihe auch keinen wissenschaftlichen Anspruch erheben. Sie stellt den Versuch dar, die wesentlichen Ergebnisse wissenschaftlicher Studien und von Berichten seriöser Zeitungen in klarer, verständlicher Weise und dennoch möglichst sachgerecht zum Ausdruck zu bringen. Ihr Hauptanliegen ist die Zusammenschau der vielfältigen Prozesse und ihrer Ergebnisse sowie deren Bewertung von einem humanistischen, dem Leben zugewandten Standpunkt aus.
Bei dieser Betrachtung werden wirtschaftliche Gesichtspunkte keineswegs ausgeklammert. Sind sie doch für unsere marktbasierte Gesellschaft nicht nur wichtig, sondern in aller Regel auch ausschlaggebend für unser Verhalten und unser Wirken. In Zukunft muss der schwierige Spagat zwischen Ökonomie und Ökologie jedoch weitaus besser gelingen, als dies bisher der Fall war. Seit dem Beginn der Industriellen Revolution vor gut 250 Jahren wurde die ökonomische Seite im Zweifel nahezu stets vorrangig behandelt. Die ökologische Problematik dagegen wurde anfangs völlig ausgeblendet und erst seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts zunehmend, jedoch insgesamt mehr schlecht als recht, berücksichtigt.
Dies war anfänglich ja auch durchaus verständlich, obwohl es bereits im 19. Jahrhundert an entsprechenden Hinweisen nicht mangelte. Weizsäcker[25] weist jedoch darauf hin, dass die Menschheit damals noch in einer vergleichsweise „leeren“ Welt gelebt hat. Heute dagegen sehen sich unsere Gesellschaften mit den Problemen einer „vollen“ Welt konfrontiert. Die bisherigen, aus eurozentrischer Sicht so eleganten Möglichkeiten, einen großen Teil der ökologischen und sozialen Folgen unserer Lebens- und Wirtschaftsweise zu externalisieren und auf Kosten der Natur oder der Länder des Südens zu lösen, schwinden nicht nur rapide dahin. Sie sind großenteils bereits nicht mehr vorhanden.
Allerorts werden sich daher die Probleme der Industriegesellschaften nicht mehr auf die bisherige Art und Weise bewältigen lassen. Ihr Externalisieren oder Verschieben an die Peripherie konnte vielleicht in einer „leeren Welt“ noch gerechtfertigt werden. Heute ist ein derartiges Handeln nicht mehr zielführend und ethisch schon gar nicht mehr zu akzeptieren. Weizsäcker ist zuzustimmen, wenn er in seinem Bericht an den Club of Rome „Wir sind dran“ [25] ein grundsätzliches Umdenken und ein verändertes Handeln einfordert. Das Ziel sollte ein balanciertes Gleichgewicht zwischen den beiden Bereichen Wirtschaft und Ökologie sein. Und dieses Ziel darf kein Fernziel bleiben, sondern muss in absehbarer Zeit erreicht werden. Ansonsten sind wir wirklich „dran“.
Daher ist entschlossenes, baldiges Handeln zugunsten der ökologischen Seite angesagt. Noch steht das enge Zeitfenster offen. Es hat allerdings bereits begonnen, sich langsam, aber sicher zu schließen. Und niemand weiß mit auch nur halbwegs ausreichender Sicherheit, ob die „tipping points“, nach denen eine Rückkehr zu den bisherigen Verhältnissen nicht mehr so einfach, vielleicht überhaupt nicht mehr zu bewerkstelligen sein dürfte, bei einem „Weiter so!“ der Industriegesellschaften schon in 20 oder erst in 30 Jahren erreicht sein werden.
Dass die ökologischen Verhältnisse für die Menschheit allerdings dann, wenn mehrere dieser Kipp-Punkte erreicht sein sollten, ziemlich ungemütlich werden dürften, darüber sind sich nahezu alle Experten einig. Außerdem verlangt allein schon die Generationengerechtigkeit gebieterisch, dass wir unser bisheriges Tun und Lassen im Lichte der sich bereits heute deutlich abzeichnenden negativen Entwicklungen genauer überdenken. Eine „neue“ Aufklärung ist daher nach Weizsäcker[25], nach der Enzyklika „Laudato Sí“ von Papst Franziskus[18] sogar eine „Kulturrevolution“ vonnöten.
Diese Buchreihe wendet sich in erster Linie an interessierte, unvoreingenommene Leser, die sich ihre eigenen Gedanken zu den ökologischen Nachrichten machen und ihre Positionen überdenken und prüfen möchten. Im Normalfall kann man sich bei der Fülle der Fakten und Informationen gerade auf diesem Gebiet nicht ausreichend tiefgehend informieren. Diese Buchreihe und speziell dieses Buch, das sich mit einem Thema befasst, das neue wirtschaftliche Perspektiven eröffnet, jedoch im Gegenzug bisher als sicher angesehene und außerordentlich lukrative Geschäftsmodelle gefährdet, ist daher darauf ausgerichtet, die verschiedenen Aspekte so angemessen zu behandeln, dass dem Leser eine möglichst objektive Grundlage für seine Beurteilung dieser Sachverhalte vermittelt werden kann.
Diese Reihe soll daher ausreichend fundierte Informationen liefern und damit selbst ein Mosaikstein dieser notwendigen „neuen“ Aufklärung sein. Die Hoffnung besteht, dass auf diesem Wege vielleicht der eine oder andere Leser angeregt wird, über sein bisheriges und zukünftiges Verhalten als „homo oeconomicus“, und hier vor allem auch als Konsument, nachzudenken und dieses sinnvoll zu verändern.
Dies ist gerade in der jetzigen Diskussion, in der über die Energieversorgung der nächsten hundert Jahre und sehr wahrscheinlich darüber hinaus entschieden werden wird, besonders wichtig. Denn es ist doch offensichtlich, dass gerade diese neue Weichenstellung massiv wirtschaftliche, aber auch soziale Interessen tangiert. Und da ist es wenig verwunderlich, dass vor allem aus der Energiewirtschaft und ihr nahestehenden Kreisen diese Debatte häufig interessengeleitet und bewusst verkürzt geführt wird. Diese Haltung kann jedoch nicht länger toleriert werden. Die sich bereits heute deutlich abzeichnenden Entwicklungen zwingen dazu, vorrangig das Gemeinwohl der heutigen, in besonderer Weise aber auch der zukünftigen Generationen ins Auge zu fassen. Es ist schon viel zu viel wertvolle Zeit durch hinhaltende Diskussionen, durch Taktieren und Tatenlosigkeit verloren gegangen. Zudem liegen die allermeisten Fakten bereits seit längerem auf dem Tisch. Die Zeit zu energischem, zielorientiertem Handeln ist gekommen.
Dass jedoch nicht einfach ein Schalter umgelegt werden kann, sondern eine angemessene Übergangsphase vorgesehen werden muss, in der die zahlreichen, schwierigen wirtschaftlichen und sozialen Probleme abgefedert werden können, ist selbstverständlich und inzwischen allgemeiner Konsens. Dies hat auch das wenige Wochen vor Redaktionsschluss (28.02.2019) bekannt gewordene Ergebnis der Kohlekommission für „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ bestätigt. Allerdings müssen diese Ergebnisse jetzt erst einmal und möglichst eins zu eins in Gesetze gegossen und umgesetzt werden. Die Zeiten, in der wichtige Entscheidungen vertagt und vor allem nicht entschlossen gehandelt worden ist, müssen möglichst bald der Geschichte angehören.
Es werden bewusst zahlreiche mehr oder weniger detaillierte Beispiele für bereits praktizierte Handlungs- und Vorgehensweisen angeführt. So möchte ich dem Leser, der sich intensiver mit diesen Möglichkeiten konkret befassen möchte, eine gewisse Übersicht und Möglichkeit zu eventueller Kontaktaufnahme vermitteln. Diese Passagen wie auch detaillierte Informationen wie beispielsweise zur Kohleförderung einzelner Länder sind wieder dieser Absatz hier einzeilig abgefasst, so dass sie sofort ins Auge springen. Der an diesen Erwägungen oder Informationen weniger Interessierte möge sie daher ruhig überspringen.
EINFÜHRUNG
Der wichtigste Auslöser für die Diskussionen um die Energiewende ist bekanntlich der Klimawandel. Dieser wird von über 90 Prozent der damit befassten Klimaforscher auf die zunehmende Konzentration von Treibhausgasen in der erdnahen Atmosphäre zurückgeführt.
Die folgende Grafik 1 vermittelt einen Überblick über die Entwicklung des Anteils dreier wichtiger Treibhausgase in den vergangenen 2000 Jahren. Es wird deutlich, dass etwa mit dem Beginn der Industriellen Revolution um die Mitte des 18. Jahrhunderts diese Emissionen immer markanter angestiegen sind. Ein Zusammenhang mit menschlichen Aktivitäten muss daher zwingend angenommen werden, auch wenn sicherlich nicht der gesamte Anstieg darauf zurückgeführt werden kann. Es gilt als gesicherte Erkenntnis, dass der weitaus größte Teil dieser Emissionen auf menschliches Wirken zurückzuführen ist.
Grafik 1: Atmosphärische Konzentration wichtiger Treibhausgase im Zeitraum von der Zeitenwende bis 2005
Quelle: Kasang, Bildungsserver Hamburg, IPPC 2013; Copyright vom 10.09.2018.
Nach Mitteilung des Umweltbundesamtes in Dessau-Roßlau[21] ist es Deutschland gelungen, den Beitrag zu den globalen Emissionen an Kohlendioxid zwischen 1990 und 2016 auf knapp 800.000 Tonnen oder 77 Prozent bezogen auf 1990 zurückzuführen (siehe Übersicht 4). Allerdings stagniert diese Entwicklung seit einigen Jahren auf einem zu hohen Niveau. Klammert man die durch den weitgehenden Zusammenbruch der DDR-Wirtschaft und die dadurch in Teilen erfolgte Umstellung auf weniger schmutzige Technologien besonders hohen Emissionswerte der Jahre bis 1995 aus, so zeigt sich ein wenig ermutigendes Bild: Der Rückgang der Emissionen betrug dann nämlich nur noch 0,63 Prozent pro Jahr (siehe Übersicht 5), wobei die letzten Jahre nur noch einen geringen bis nahezu gar keinen Beitrag mehr zu dieser Entwicklung beigetragen haben. Nach einer Mitteilung des Geomar-Instituts, Kiel, dürfte 2018 gar ein „Allzeithoch“ bei den Emissionen der Treibhausgase erreicht worden sein. Auf der Grundlage des Global Carbon Budget 2018 wird ein voraussichtlicher globaler Ausstoß von Kohlendioxid aus der Verbrennung fossiler Energieträger in Höhe von 371 Milliarden Tonnen erwartet (Mitteilungen für die Konferenz in Kattowitz, Januar 2019).
Durch den jüngsten, alarmierenden Bericht des IPPC wurde erneut die Dimension dieser Gefährdung unserer globalen Lebensgrundlagen sehr plastisch verdeutlicht. So führt nach Ansicht des Klimaforschers Latif (Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung [Geomar], Kiel) „kein Weg an der massiven Verringerung der CO2-Emissionen vorbei“ (FR vom 08.10.2018). Diese seien eindeutig zu einem wesentlichen Teil auf den Einsatz fossiler Energien zurückzuführen.
Im Zentrum der Diskussionen steht dabei das Kohlendioxid, dessen globale Emission für 2015 mit knapp 40.000 Millionen Tonnen angegeben wurde (siehe Übersicht 2). Mit einem Anteil von etwa 26 beziehungsweise 18 Prozent waren damals die Volksrepublik China und die USA die wichtigsten Emittenten. Deutschland trug lediglich mit 2,4 Prozent zu diesen globalen Emissionen bei.
In diesem Zusammenhang ist es von Bedeutung, ob für diese Zurechnung nach Ländern das Konsum- oder Produktionsprinzip angewandt wird. Nach dem erstgenannten Prinzip werden die Emissionen dem Land zugerechnet, in dem die Produkte und Dienstleistungen verbraucht werden. Das zweite Prinzip bezieht die Emissionen auf das Herstellerland. Bei Ländern, die einen hohen Konsum von in anderen Ländern erzeugten Waren aufweisen, führt daher die Berechnung der Emissionen nach dem Konsumprinzip zu deutlich höheren Werten. Im Falle von Deutschland errechnete sich so für 2015 eine Emission von 18,3 gegenüber 13,2 Tonnen je Einwohner (siehe Übersicht 3) – eine Erhöhung des zuzurechnenden Wertes um immerhin 39 Prozent.
Generell jedoch wird nicht das Konsum-, sondern das Produktionsprinzip angewandt, wodurch insbesondere Entwicklungs- und Schwellenländer benachteiligt und spiegelbildlich die Industrieländer begünstigt werden, da in diesen sehr viele Produkte aus jenen Ländern konsumiert werden. Logischerweise müsste der zugehörige CO2-Ausstoß daher auch den Industrieländern zugerechnet werden. Würde man vom letztgenannten Prinzip ausgehen – ein Vorgehen, das ich für logischer und daher zutreffender halte, so müssten wir unsere Anstrengungen auf dem Sektor „Reduktion von Treibhausgas-Emissionen“ noch deutlich ambitiöser gestalten. In diesem Fall sind dann jedoch die von der Bundesregierung vorgegebenen Reduktionsziele noch schwieriger zu erreichen. Daher ist es jetzt auch höchste Zeit, durchgreifende, heute weithin noch unvorstellbare Maßnahmen zu ergreifen, denn unsere Lebensgrundlagen stehen tatsächlich auf dem Spiel.
Die nachfolgende Grafik weist den globalen Anstieg der durchschnittlichen Jahrestemperatur seit 1950 aus. Es handelt sich um einen erdgeschichtlich gesehen winzig kleinen Zeitraum. Und dennoch ist in diesem Moment der Erdgeschichte dieses Temperaturmittel um etwa 1,2 Grad Celsius gestiegen. Dies mag auf den ersten Blick sehr gering erscheinen. Für den Klimaforscher handelt es sich hierbei jedoch um einen sehr erheblichen Anstieg, da die atmosphärischen Regelkreise sehr empfindlich auf Temperaturerhöhungen reagieren. Entsprechende Auswirkungen wie die Verlagerung der Wein-Anbaugrenze in Richtung Skandinavien sind ja schon heute deutlich zu spüren und nicht nur den Katastrophenmeldungen der Nachrichten zu entnehmen. So ist die Zunahme der Entschädigungszahlungen der Rückversicherer für Schadensereignisse, die wie beispielsweise Niederschlags- oder Temperaturextreme weitgehend auf den Klimawandel zurückzuführen sind, dafür ein deutlicher Beleg – dies übrigens auch nach der Einschätzung dieser Konzerne. Man sollte in diesem Zusammenhang bedenken, dass die tatsächlichen Schäden weitaus höher liegen dürften, da ein sehr großer Teil der weltweit Betroffenen nicht gegen klimatische Risiken wie Unwetter, Stürme oder Überschwemmungen versichert ist.
Grafik 2: Globale Jahrestemperatur seit 1950
Quelle: verändert nach The Guardian, Dezember 2011.
Selbst wenn man „nur“ das Zwei-Grad-Ziel erreichen und damit die gefürchtete „Heißzeit“ vermeiden könnte, sind nach IPPC „dafür schnelle und weitreichende Veränderungen in allen wichtigen Sektoren der Weltwirtschaft nötig“ (FR, s. o.).
Nach diesem Papier des IPPC steuern wir jedoch auf eine Erwärmung von mindestens drei Grad zu, wenn wir uns so wie bisher weiter verhalten. Eine derartige Erwärmung hätte zweifelsfrei katastrophale Auswirkungen für Mensch und Natur. Aus diesem Grunde ist es höchste Zeit, durchgreifende Maßnahmen zu ergreifen. Dieses Buch widmet sich daher den Möglichkeiten, die sich für eine Verringerung der energiebedingten Emissionen von Treibhausgasen bereits heute und erst recht morgen anbieten.
Aus ökologischer Sicht – und nicht nur aus dieser – stellt die permanente Vermehrung der Bevölkerung, und dies vor allem in Nahost, Afrika und einigen Staaten Südostasiens, ein gewaltiges Problem dar. Diese Problematik wird durch das überproportionale Anwachsen der globalen Mittelschichten verstärkt. So erfreulich es ist, wenn dank des medizinischen Fortschritts Millionen Menschen am Leben bleiben und dank des globalen wirtschaftlichen Wachstums ebenfalls Millionen bedrückender Armut entfliehen können, so negativ wirken sich die damit verbundenen ökologischen Belastungen auf die Biosphäre aus. Wir gestehen heute den restlichen Lebewesen beispielsweise nur noch etwa 30 Prozent des terrestrischen Lebensraumes zu. Rund 70 Prozent nimmt die Menschheit inzwischen mehr oder weniger vollständig für ihre Zwecke in Anspruch. Und da sich die Mittelschichten in aller Welt natürlich am Lebensstandard der industrialisierten Länder messen und diesen ebenfalls erreichen wollen, wird diese Problematik laufend zusätzlich und sehr erheblich verschärft.
Andererseits kann und darf man diesen Menschen ihr Bemühen, in ähnlicher Weise leben zu können, wie wir es gewohnt sind, keineswegs zum Vorwurf machen. Auf der anderen Seite darf man aber ehrlicherweise diese globale Problematik ebenfalls nicht ausblenden. Man sollte sie vielmehr ins Bewusstsein heben und humanen Grundsätzen gemäß handeln. Denn wird es bei dieser Entwicklung bleiben, ist der ökologische Kollaps vorprogrammiert, und dies wahrscheinlich schon, bevor die für etwa 2050 prognostizierte Anzahl von etwa zehn Milliarden Erdbewohnern erreicht ist. Erst danach sollen nach den meisten Prognosen die Gesellschaften dieser Erde ein demographisches Gleichgewicht erreichen. Die folgende Grafik „Entwicklung der Erdbevölkerung“ verdeutlicht diesen Sachverhalt.
Grafik 3: Entwicklung der Erdbevölkerung seit 1960
Quelle: Brookings: Global Economy and Development, Working Paper, Februar 2017; Copyright vom am 06.05.2018.
Die wachsende Bevölkerung der Erde, das Bemühen der Schwellen- und Entwicklungsländer, ihr Wirtschaftswachstum entsprechend zu fördern, und unser auf Wachstum fixiertes Wirtschaftssystem führten in den letzten 25 Jahren zu einem stetig ansteigenden Energieeinsatz. Dieser konnte trotz der teilweise beachtlichen Bemühungen, Energie einzusparen und ihren Einsatz effizienter zu gestalten, bislang nicht zurückgeführt werden. Die Grafik 4 „Weltenergieverbrauch in Millionen Tonnen …“ weist den globalen Energieverbrauch seit 1992 für die wichtigsten Energiearten in Erdöl-Äquivalenten aus. Danach ist dieser Verbrauch in diesem Zeitraum um rund 36 Prozent beziehungsweise 1,4 Prozent pro Jahr gestiegen.
Grafik 4: Weltenergieverbrauch in Milliarden Tonnen von Erdöl-Äquivalenten zwischen 1992 und 2017
Quelle: BP Statistical Review of World Energy 2018 [2]; Copyright vom 26.06.2018.
Nach der untenstehenden Grafik 5 („Anteile der Energiearten am globalen Verbrauch von Primärenergie“) ist es in den vergangenen 50 Jahren lediglich gelungen, den Einsatz von Erdöl und Kohle in den ersten zwanzig Jahren deutlich zu verringern. Der weitere Rückgang beim Verbrauch von Erdöl in den vergangenen 20 Jahren wurde jedoch durch den höheren Einsatz anderer Energieträger, und hier vor allem von Kohle, kompensiert. Aufs Ganze gesehen stieg jedoch der Energieverbrauch langsam, aber stetig an.
Wie dieser Abbildung ebenfalls zu entnehmen ist, blieb Erdöl trotz des erwähnten Rückgangs mit etwa einem Drittel knapp vor Kohle und Erdgas der wichtigste Energieträger. Diese drei Energiearten deckten 2016 deutlich mehr als 80 Prozent des globalen Verbrauchs an Primärenergie ab. Inzwischen allerdings dürften die regenerativen Energien deutlich an Boden gewonnen haben. So wurde beispielsweise in der VR China in den letzten Jahren massiv in Windkraft und Photovoltaik investiert.
Grafik 5: Anteile der Energiearten am globalen Verbrauch von Primärenergie im Zeitraum 1966 bis 2017 in Prozent des Gesamteinsatzes
Quelle: BP Statistical Review of World Energy 2018 [2]; Copyright vom 26.06.2018.
Dieser wachsende Energieverbrauch auf überwiegend fossiler Grundlage führte zwangsläufig zu einer steigenden Emission von Klimagasen. Abb. 6 gibt einen Überblick über die weltweite Entwicklung der Kohlendioxid-Emissionen im Zeitraum von 1971 bis 2015. Deutlich lässt sich der überragende Einfluss der VR China erkennen. Auch die USA sind ein Hauptemittent. Allerdings stagniert ihr CO2-Ausstoß seit Jahren auf hohem Niveau. Deutschland dagegen steuert mit zwei Prozent nur einen geringen Beitrag zu diesen Emissionen bei.
Grafik 6: Entwicklung der weltweiten Kohlendioxid-Emissionen im Zeitraum 1971 bis 2015
Quelle: Quaschning, Berlin[20]; Copyright vom 20.07.2018.
Betrachten wir nun die Verhältnisse in Deutschland. In Grafik 7 ist der Primärenergieverbrauch für den Zeitraum von 1990 bis 2012 dargestellt. Darunter wird der gesamte Einsatz von Energie – also einschließlich beispielsweise späterer Übertragungsverluste – verstanden. In der genannten Periode sank dieser Verbrauch von knapp 15.000 Petajoule (PJ) nur um etwa sieben Prozent auf rund 13.600 PJ. Außerdem stagnierte der Rückgang in den beiden letzten erhobenen Jahren auf diesem hohen Niveau. Diese Tendenz hat sich auch übrigens nach 2012 fortgesetzt. In Übersicht 1 sind zum besseren Verständnis die wichtigsten Maßeinheiten für die verschiedenen Energiearten zusammengestellt.
Auch in dieser Betrachtung dominiert der Verbrauch von Erdöl mit 34 Prozent gegenüber Erdgas und Kohle mit jeweils etwa 22%. Auf die erneuerbaren Energieträger entfielen damals lediglich 12 Prozent.
Grafik 7: Primärenergieverbrauch nach Energieträgern in Deutschland in Petajoule zwischen 1990 und 2012
Quelle: Quaschning, Berlin[20]; Copyright vom 20.07.2018.
Nun ist der Rückgang dieses Energieverbrauches insgesamt zwar beträchtlich, jedoch je nach Energiesystem doch sehr unterschiedlich. Auch sind die Energieverluste im Hinblick auf den Endenergieverbrauch erheblich So weisen auf fossilen Energien basierende Systeme Effizienzverluste zwischen 40 und 70 Prozent auf. Bei der Atomkraft geht man dagegen davon aus, dass nur etwa ein Drittel der eingesetzten Energie verloren geht. Mit Kohle beheizte Kraftwerke verlieren meistens gut 40 Prozent ihrer Energie. Schlecht gedämmte Gebäude und sehr viele Fahrantriebe, die häufig Energie auf Mineralölbasis verbrauchen, weisen sogar häufig noch schlechtere Energieausbeuten auf.
Nach Wirth[26] entfällt der größte Einzelanteil des Endenergieverbrauches mit 31 Prozent auf die „mechanische Energie“ und damit vor allem auf den Verkehr. Allerdings wird hier auch der Energieverbrauch stationärer Motoren erfasst. Seit 2014, dem Basisjahr dieser Erhebung, hat der verkehrsbezogene Verbrauch deutlich zugenommen, da in diesem Bereich kaum Einsparungen erzielt werden konnten. Trotz Fortschritten in der Abgastechnik wurden diese CO2-Reduktionen durch die Zunahme der Motorisierung, die wachsende Anzahl der Kraftfahrzeuge und vor allem auch durch den Anstieg der Motorleistung der Flotten weitestgehend kompensiert.
Die Bereitstellung von Wärme als „Raumwärme“ für die Zubereitung von Warmwasser oder als Prozesswärme beanspruchte mit insgesamt 54 Prozent einen deutlich höheren Anteil. Die übrigen Bereiche sind dagegen mit einem Anteil von sieben Prozent von untergeordneter Bedeutung. Wenn man Energie wirklich einsparen möchte, müsste daher vorrangig in den Bereichen „Mechanische Energie“ und „Wärme“ angesetzt werden.
Dieser relativ hohe Einsatz an konventionellen Energieträgern schlägt sich auch in Übersicht 4 „Entwicklung der CO2-Emissionen in Deutschland …“ nieder. Danach haben sich im Zeitraum von 1990 bis 2016 diese Emissionen um lediglich etwa 235.000 Kilotonnen beziehungsweise um 23 Prozent verringert. Wegen des Zusammenbruchs der Industrie in der DDR entfielen gut 11 Prozent – also nahezu die Hälfte – dieses Rückgangs auf das erste Jahrfünft. Diese Bilanz kann daher keinesfalls zufrieden stellen. Sie wird auch durch die Darstellung in Übersicht 5 untermauert, in der diese Einsparungen auf drei Perioden bezogen werden. Für den gesamten Zeitraum (1990-2016) konnten diese Emissionen zwar noch im Mittel um 0,87 Prozent reduziert werden. Dagegen wurde für die Gesamtzeit bis 2016 nur noch eine Reduktion dieser Emissionen um 0,63 Prozent erreicht.
Allerdings haben sich diese Verhältnisse in den letzten Jahren vor allem in Hinblick auf die Stromerzeugung in Deutschland wesentlich zugunsten der Erneuerbaren verändert. So setzte sich der Strommix nach Angaben des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft im Jahr 2018 zu 35 Prozent aus Braun- und Steinkohle, zu ebenfalls 35 Prozent aus erneuerbaren Energien, zu 13 Prozent aus Gaskraftwerken und zu 12 Prozent aus Atomkraft zusammen. Der Rest ist Pumpspeicher- und Ölkraftwerken zuzuschreiben.
Nach anderen Presseberichten soll der Anteil der Erneuerbaren am deutschen Strommix mit 219 Terawatt-Stunden sogar auf 40% gestiegen sein. Zum Vergleich: 2017 belief sich dieser Anteil noch auf 38,2 Prozent. Mit einem Zuwachs in Höhe von 16 Prozent bezogen auf 2017 lieferte die Photovoltaik den größten Anteil zu diesem Anstieg.
Dieser Sachverhalt wird nochmals in Grafik 8 für die vier wichtigsten Treibhausgase zum Ausdruck gebracht. Ihnen werden die Ziele der Bundesregierung gegenübergestellt. Inzwischen hat diese ja das Ziel für 2020 offiziell kassiert. Wenn die Anstrengungen, die Emissionen von Treibhausgasen zurückzuführen, nicht drastisch gesteigert werden, werden auch die weiteren in dieser Grafik ausgewiesenen Ziele nicht zu erreichen sein. Nach der Überzeugung der meisten Klimawissenschaftler muss jedoch Deutschland seine Treibhausgas-Emissionen bis 2050 um 95 Prozent in Bezug auf 1990 reduzieren, wenn das 2-Grad-Ziel eingehalten werden soll. Bisher wird jedoch offiziell trotz dieser Faktenlage immer noch davon gesprochen, dass das 1,5-Grad-Ziel eingehalten werden könne.
Grafik 8: Energiebedingte Emissionen von Treibhausgasen in Millionen Tonnen von CO2-Äquivalenten in Deutschland 1990 – 2016 sowie die Ziele der Bundesregierung bis 2050
Emissionen ohne Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft
* Ziele 2020 bis 2050: Energiekonzept der Bundesregierung (2010)
** Schätzung 2018, Emissionen für F-Gase gesamt
Quelle: Umweltbundesamt Dessau-Roßlau, 2017, Treibhausgas-Emissionen seit 1990 [23]; Copyright vom 18.06.2018.
Das Umweltbundesamt hat eine Übersicht „Energiebedingte Emissionen von Treibhausgasen in Deutschland nach Wirtschaftssektoren in Prozent der Gesamtemissionen für das Jahr 2015“ herausgegeben (siehe Übersicht 6 im Anlagenteil). Nach dieser Mitteilung entfielen im Jahr 2015 exakt die Hälfte der energiebedingten Emissionen von Treibhausgasen in Deutschland auf den Wirtschaftssektor „Energiewirtschaft“ und 20 Prozent auf den Verkehr. Unter „Energiewirtschaft“ ist in erster Linie die industrielle Erzeugung von Strom und Wärme zu verstehen. Während in diesem Bereich seither zum Teil beachtliche Einsparungen erreicht werden konnten, hat der dem Verkehr zuzurechnende Anteil an diesen Emissionen erheblich zugenommen. Natürlich sollte grundsätzlich in allen Wirtschafts- und Lebensbereichen versucht werden, diese Emissionen nach Möglichkeit zu vermeiden. Doch es ist offensichtlich, dass besonders in den beiden oben genannten Sektoren diese Emissionen besonders wirksam reduziert werden müssen.
Aber auch im gebäuderelevanten Bereich bedarf es sehr großer Anstrengungen, damit der Energieverbrauch als noch tragbar betrachtet werden kann. Die nachfolgende Grafik 9 „Endenergieverbrauch für Raumwärme, Raumkühlung, Warmwasser und Gebäude in Deutschland in Petajoule für die Periode 2008 bis 2016“ zeigt die bisherige, aus ökologischer Sicht völlig unbefriedigende, Entwicklung auf. Seit 2011 stagnieren die Verbrauchswerte auf einem sehr hohen Niveau. Die Ziele für 2020 wurden ja inzwischen aufgegeben. Sie wären auch in diesem Bereich nicht mehr zu erreichen gewesen.
Grafik 9: Gebäuderelevanter Endenergieverbrauch für Raumwärme, Raumkühlung, Warmwasser und Beleuchtung in Petajoule für die Periode 2008 bis 2016 und für das Zieljahr 2020
Quelle: Umweltbundesamt Dessau-Roßlau[23]; Copyright vom 18.06.2018.
Von besonderer Bedeutung für das Gelingen der Energiewende ist der Bereich der Stromerzeugung. Hier ist es auch am leichtesten, in kurzer Zeit wesentliche Fortschritte zu erzielen. Aus der folgenden Grafik 10 kann die Entwicklung der Zusammensetzung des Stroms in Deutschland zwischen 2007 und 2016 entnommen werden. Zwar ist die Zunahme des Anteils der erneuerbaren Energien nicht gerade überwältigend, doch konnte immerhin ihr Anteil in dieser Dekade mehr als verdoppelt werden. Völlig unbefriedigend ist der nach wie vor sehr hohe Anteil der besonders klimaschädlichen Braunkohle mit über 23 Prozent.
Grafik 10: Bruttostromerzeugung in Deutschland nach Energieträgern und in anteiligen Prozenten der Periode 2007 bis 2016
Quelle: AGEB e.V., Stromreport.de, Copyright vom 09.07.2018.
Nach einer Mitteilung der Arbeitsgemeinschaft „Energiebilanzen“ ging allerdings der Energieverbrauch in Deutschland von Januar bis September 2018 um 5,3% bezogen auf das Vorjahr zurück (ARD, Videotext vom 31.10.2018). Als Gründe wurden vor allem steigende Energiepreise, die milde Witterung im Winter und Verbesserungen der Energieeffizienz angegeben. Dadurch konnte der Ausstoß von Kohlendioxid um rund sieben Prozent verringert werden. Eine durchaus erfreuliche Entwicklung.
1. KONVENTIONELLE UND ATOMARE ENERGIEN
Dieses Kapitel befasst sich mit den konventionellen, fossilen Energieträgern sowie mit der Kernenergie. Für Kohle, Erdöl, Erdgas und Kernkraft wird der heutige Anteil an der Energieerzeugung global und in Bezug auf Deutschland vorgestellt.
1.1 KOHLE
Kohle ist weltweit, aber auch in Deutschland, nach wie vor der wichtigste Energieträger. Der nachstehenden Grafik11 wie auch der Übersicht 7 „Gesamte bestätigte globale Reserven von Braun- und Steinkohle …“ kann entnommen werden, welche gigantischen und bestätigten Kohlevorräte noch in der Erde schlummern: 1.139 Milliarden Tonnen. Nahezu die Hälfte dieser Reserven findet sich im asiatisch-pazifischen Raum.
Grafik 11: Verteilung der bestätigten Kohlereserven in Millionen Tonnen von Erdöl-Äquivalenten und in Prozentanteilen nach Weltregionen 2017
Quelle: BP Statistical Review of World Energy 2018 [2]; Copyright vom 26.06.2018.
Die Grafik 12 stellt den globalen Verbrauch an Kohle in Erdöl-Äquivalenten dar. Dieser weist seit 2010 eine leicht fallende Tendenz auf. Nach Übersicht 8 „Globaler Verbrauch an Braun- und Steinkohle nach Regionen …“ lag er 2017 bei 3,7 Milliarden Tonnen. Legt man die Übersichten 7 und 8 zugrunde, so dürften bei gleichbleibendem Verbrauch diese Kohlevorräte noch für etwa drei Jahrhunderte reichen.
Grafik 12: Verbrauch von Kohle in Millionen Tonnen von Erdöl-Äquivalenten nach Weltregionen zwischen 1992 und 2017
Quelle: BP Statistical Review of World Energy 2018 [2]; Copyright vom 26.06.2018.
Mit einem Beitrag von insgesamt 33,4 Milliarden Tonnen sind die globalen Emissionen von Kohlendioxid ausgesprochen hoch. Sie werden in Übersicht 9 „Globale CO2 – Emissionen auf der Basis von Braun- und Steinkohle …“ für das Jahr 2016 nach Regionen wiedergegeben. Erwartungsgemäß ist nahezu die Hälfte dieses Ausstoßes den Regionen Asien und Pazifik zuzurechnen. Auf Europa und Eurasien beziehungsweise Nordamerika entfielen aber immerhin noch jeweils 19 Prozent. Lateinamerika und Afrika trugen dagegen mit 7,6 Prozent relativ wenig zur Emission von Kohlendioxid bei. Im Durchschnitt der beobachteten Dekade stiegen die jährlichen Emissionen um 1,8 Prozent. Besonders bedrohlich ist die Situation in der Region „Asien und Pazifik“, da die prozentuale Zunahme in Höhe von 3,8 Prozent von einem sehr hohen Sockel aus erfolgte.
Braunkohle
Die globalen Braunkohlevorräte betragen nach BGR etwa 283 Milliarden Tonnen. Ihr Schwerpunkt liegt mit 33 Prozent in Russland. Dagegen verfügt Deutschland mit einem Anteil von lediglich 14 Prozent über deutlich geringere Vorräte. Nach Angaben der BGR werden global zur Zeit etwa 1,1 Milliarden Tonnen pro Jahr an Braunkohle gefördert. Erstaunlicherweise entfällt dabei auf Deutschland mit etwa 185 Millionen Tonnen die weltweit höchste Förderungsrate. Bei gleichbleibender Förderung könnten die globalen Vorräte noch knapp 300 Jahre, in Deutschland gut 200 Jahre reichen.
Braunkohle ist der wichtigste Energieträger für die Stromerzeugung in Deutschland. So wurden nach Übersicht 10 im Jahr 2016 rund 165, Millionen Tonnen Braunkohle gefördert, von denen 88% in Kraftwerken verfeuert wurden. Die Produktion von Braunkohle in Deutschland erreichte 1985 ihren Höhepunkt und ging seither zwar leicht, aber immer noch auf hohem Niveau verharrend, zurück. Gut die Hälfte der deutschen Braunkohle wird im Rheinland, der Rest vor allem in der Lausitz abgebaut. Eingeführt werden insgesamt rund 45.000 Tonnen, überwiegend aus Polen.
Der Beitrag der Braunkohle zur Bruttostromerzeugung in Deutschland lag 2016 bei etwa 150 TWh und damit bei 24 Prozent. Bei ihrer Verstromung wird im Durchschnitt mit 1.100 Gramm je Kilowattstunde ein unverhältnismäßig hoher Anteil an Kohlendioxid freigesetzt.
Insgesamt waren zu Beginn des Jahres 2018 Braun- und Steinkohlekraftwerke mit einer Gesamtleistung von 42,6 Gigawatt mit einer zusätzlichen Reserve für die Winterzeit am Netz.
Steinkohle
Steinkohle ist weltweit der mit Abstand wichtigste Energieträger. Da Steinkohle zudem in vielen Ländern im Tagebau gewonnen werden kann, ist ihr Einsatz in der Verstromung verhältnismäßig preisgünstig. In Deutschland dagegen, wo die Steinkohle in ziemlicher Tiefe ansteht, musste ihre Förderung aus wirtschaftlichen Gründen aufgegeben werden. Importkohle war und ist wesentlich billiger.
Nach Angaben der BGR[4] liegen die weltweit förderfähigen Vorräte an Steinkohle im Bereich von etwas über 736 Milliarden Tonnen. Die größten Vorräte entfallen mit 29 Prozent auf die USA. Es folgen die VR China mit 23 und Indien mit 13%.
Im Jahr 2014 wurden global etwa 7 Milliarden Tonnen Steinkohle gefördert. Nach dem Weltenergiereport von BP sind die größten Kohleförderländer (Prozentangaben bezogen auf die globale Fördermenge): VR China (47,5%), USA (13,4%), Australien (6,3%), Indonesien (6,2%) und Indien (6,0%). In der EU waren zum gleichen Zeitpunkt die wichtigsten Förderländer Polen mit 73 und Tschechien mit 8,3 Millionen Tonnen. Allerdings steigt nach der International Energy Agency (IEA) die jährliche Nachfrage und dementsprechend auch die Fördermenge um etwa 2,3 Prozent pro Jahr.
In Deutschland wurde die Förderung in den letzten Jahrzehnten sehr stark zurückgefahren. Die Steinkohle muss mit sehr hohem technischem Aufwand aus tiefen Flözen gefördert werden. Sie kann daher mit der sehr viel preiswerteren Importkohle, die überwiegend aus Tagebauförderung kommt, in preislicher Hinsicht nicht konkurrieren. 2014 betrug die Förderung in Deutschland noch 8,3 Mio. Tonnen. Diese Förderung wurde im Dezember 2018 endgültig eingestellt. Da jedoch der „Klimaplan 2050“ der Bundesregierung kein konkretes Ausstiegsdatum für die Kohleverstromung aufweist, wurde bisher sogar – allerdings verhalten – weiter in den Ausbau von deutschen Kohlekraftwerken investiert.
1.2 ERDÖL
Rohöl (Petroleum) wird nicht nur als Treibstoff im Verkehr oder als Ausgangsstoff für die chemische Industrie, sondern auch als Energieträger zur Stromerzeugung eingesetzt. Nach einer Studie der BP wird das Ende 2016 weltweit förderfähige Volumen auf gut 240 Millionen Tonnen Barrel geschätzt. In Übersicht 11 sowie in der nachfolgenden Abbildung 13 werden diese nachgewiesenen Reserven nach Weltregionen aufgeführt. Die letztgenannte Abbildung macht zugleich deutlich, dass im Zeitraum von 2006 bis 2016 durch verbesserte und intensivere Prospektion diese Reserven um 23 Prozent erhöht werden konnten.
Grafik 13: Verteilung der bestätigten Erdölreserven in Tausend Millionen Barrel und in Prozentanteilen nach Weltregionen 2007 und 2017
Quelle: BP Statistical Review of World Energy 2018 [2]; Copyright vom 26.06.2018.
Das theoretisch mögliche Fördervolumen ist allerdings sehr schwer zu schätzen. Auch werden durch die Einbeziehung unkonventionellen Erdöls wie Ölschiefer, Ölsande, Tief- und Tiefsee-Erdöl und die Erwartungen, dass große Ölfelder in absehbarer Zeit in den Ozeanen entdeckt werden, in der Literatur sehr unterschiedliche Zahlen genannt. Ob der Gipfel der Ölförderung bereits oder noch nicht erreicht sei, wird je nach Interessenlage unterschiedlich beurteilt. Vor allem durch das Fracking von Erdöl und „Schiefergas“ ist USA zum „Weltmeister“ und weltweit größten Rohöl-Förderer aufgestiegen.
Bei dieser Art von Erdöl-Förderung wird dieses sowie Erdgas aus tiefliegenden Schichten gepresst. Verwendet wird dazu ein Gemisch aus Wasser, Sand und überwiegend giftigen Chemikalien. Die wichtigste Fracking-Region in den USA ist das Permian Basin in Texas. Der Nachrichtendienst Bloomberg bezeichnet sie als das „heißeste Ölfeld der Welt“. USA-weit beläuft sich die tägliche Fördermenge auf mehr als elf Millionen Barrel. Davon entfallen auf das Permian Basin knapp 30 Prozent.
So warnte beispielsweise die Internationale Energieagentur (IEA) in ihrem letzten World Energy Outlook vor einem Rückgang des Angebots, „wenn die Ölindustrie ihre Investitionen in die Förderung aus neuen Quellen nicht massiv erhöht und die USA nicht deutlich mehr Fracking-Öl produzieren. … Tatsächlich sind die globalen Ölfunde … kontinuierlich gesunken. … Bisher wurde der Rückgang der Förderung durch sogenanntes unkonventionelles Öl aus Fracking, Teersanden und Tiefseequellen ausgeglichen“ (zitiert nach FR vom 21.11.2018). Allerdings beurteilen andere Institutionen diese Situation durchaus verschieden. So geht der Verband der Mineralölwirtschaft in Deutschland davon aus, dass es sich bei dieser Diskussion um ein „rein hypothetisches“ Problem handele. „Öl ist reichlich vorhanden und ein Ende des Ölzeitalters nicht in Sicht“ (FR, ebd.).
Nach der oben bereits genannten BP-Studie wurden 2016 knapp 4,4 Millionen Tonnen Erdöl gefördert. In Übersicht 12 wird diese Fördermenge in Höhe von knapp 4,4 Billiarden Barrel nach Weltregionen gegliedert wiedergegeben. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass die Förderung selbst in vielen Erdölländern problemlos dem Bedarf angepasst werden könnte. Es liegt alles andere als Ölknappheit vor.
Übersicht 13 weist den globalen Verbrauch an Erdöl nach Regionen für die Periode 2005 bis 2016 aus. Erwartungsgemäß entsprach der Verbrauch ungefähr der Fördermenge. Der mit 35 Prozent höchste Anteil wurde in Asien und im Pazifikraum verbraucht. Die Regionen Nordamerika sowie Europa und Eurasien folgen mit einem Anteil von knapp 24 beziehungsweise 20 Prozent. In diesen beiden Regionen konnte zudem dieser Verbrauch in der genannten Periode im Durchschnitt um etwa ein Prozent pro Jahr gesenkt werden. Dafür boomte er mit Werten zwischen 2,7 und 3,3 Prozent in den übrigen Regionen.
Heute wird Erdöl nur noch in geringem Maße zur Stromerzeugung eingesetzt, da es dafür als zu wertvolle Ressource eingeschätzt wird. So wurden 2016 nur noch 0,9 Prozent des Stroms in Deutschland auf der Basis von Mineralöl erzeugt. Der gesamte deutsche Erdölverbrauch betrug dagegen im gleichen Jahr 113 Millionen Tonnen und lag damit bei 2,6 Prozent des globalen Verbrauchs.
Die nachfolgende Grafik 14 vermittelt einen Eindruck davon, wie sich der Verbrauch an Erdöl im Zeitraum von 1992 bis 2017 in den verschiedenen Weltregionen entwickelt hat. Nach den Erläuterungen der BP-Studie[2] ist der durchschnittliche Anstieg des Verbrauchs von 1,6 Millionen Barrel je Tag vorrangig auf die aufsteigenden Schwellenländer VR China und Indien, in zweiter Linie dagegen auf die OECD-Staaten zurückzuführen.
Grafik 14: Täglicher Verbrauch von Erdöl in Millionen Barrel nach Weltregionen zwischen 1992 und 2017
Quelle: BP Statistical Review of World Energy 2018 [2]; Copyright vom 26.06.2018.
1.3 ERDGAS
Erdgas entsteht in ähnlicher Weise wie Erdöl und wird daher häufig zusammen mit diesem gefördert. Es setzt sich überwiegend aus Methan zusammen, einem besonders stark wirkenden Klimagas. Die Grafik 15 zeigt die Verteilung der bestätigten Erdgasreserven nach Weltregionen. Man erkennt deutlich, dass sich diese Reserven dank der intensiven Prospektion von 2006 auf 2016 um 18 Prozent auf etwa 187 Trillionen Kubikmeter erhöht haben. Knapp 43 Prozent lagern in Ländern des Nahen Ostens.
Grafik 15: Verteilung der bestätigten Erdgasreserven in Trillionen Kubikmetern und in Prozentanteilen nach Weltregionen 2007 und 2017
Quelle: BP Statistical Review of World Energy 2017[2]; Copyright vom 26.06.2018.
Nach einer Studie der BGR[4] von 2010 betragen die weltweiten Reserven etwa 192.115 Milliarden Kubikmeter. Fackelgas und Recycelgas sind in dieser Angabe nicht enthalten. Danach würden diese Vorräte bei gleichbleibendem Verbrauch noch für 59 Jahre ausreichen. Die mit Abstand größten Reserven liegen in Russland (24,8%), Iran (15,6%) und Katar (13,2%).
Übersicht 15 im Anhang gibt den Stand der Förderung von Erdgas nach Weltregionen für das Jahr 2016 wieder. Danach entfielen auf Nordamerika sowie Europa und Zentralasien 55 Prozent der Förderung, während der Nahe und Mittlere Osten mit knapp 18 Prozent vergleichsweise wenig zum globalen Fördervolumen beigetragen haben.
Dagegen weist die nachfolgende Grafik 16 den Verbrauch von Erdgas nach Weltregionen für den Zeitraum von 1991 bis 2016 aus. Man erkennt, dass die Nutzung von Erdgas in dieser Zeit sehr deutlich zugenommen hat: Um 75 Prozent insgesamt beziehungsweise um durchschnittlich 3 Prozent pro Jahr. Die Weltregionen mit dem höchsten, in besagter Periode allerdings nur noch leicht steigenden Gasverbrauch sind Nordamerika und Eurasien. Die höchsten Steigerungsraten weisen erwartungsgemäß die großen Schwellenländer (BRIC-Staaten) auf.
Grafik 16: Verbrauch von Erdgas in Milliarden Kubikmetern nach Weltregionen zwischen 1992 und 2017
Quelle: BP Statistical Review of World Energy 2018 [2]; Copyright vom 26.06.2018.
Im Durchschnitt der Jahre zwischen 2005 und 2015 stellte die BP-Studie (siehe Übersicht 16) dagegen einen Anstieg des Verbrauchs um durchschnittlich 2,3 Prozent fest. Auch liegen die eindeutigen Schwerpunkte mit 27 Prozent in Nordamerika und mit 29 in Eurasien. Nach Übersicht 17 verbrauchen die USA mit 21 und Russland mit 12 Prozent den höchsten Anteil am Gesamtverbrauch in Höhe von 3.600 Milliarden Kubikmetern Erdgas. Lediglich drei Prozent dieses Verbrauches werden Deutschland zugeordnet.
Der weit überwiegende Teil des Erdgases wird in Deutschland für die Erzeugung von Nutzwärme in der Industrie und im Privatsektor eingesetzt. Zunehmend wird aber auch Erdgas als Treibstoff für Kraftfahrzeuge verwendet. Der Anteil dieses Energieträgers an der Bruttostromerzeugung in Deutschland betrug 2016 80,5 Terawattstunden, was 17,2 Prozent entsprach.
In der Mehrzahl der Fälle wird Erdgas über Pipelines zu den Verbrauchern transportiert. Allerdings gewinnt der Transport mit Spezialschiffen zunehmende Bedeutung. Diese LNG-Schiffe transportieren das bei minus 160 Grad Celsius verflüssigte Erdgas von entfernt und für den Pipeline-Transport ungünstig gelegenen Ländern zu Spezialterminals in den Industrieländern. Diese Transportform wird beispielsweise von den USA als Alternative zu Nordstream II vorgeschlagen – natürlich mit Fracking-Gas aus den USA.
1.4 KERNENERGIE
Bei der Kernenergie handelt es sich um eine ausgesprochen kapitalintensive Energieerzeugung auf der Grundlage von Uran. Im Juni 2017 waren weltweit 447 Kernspaltungs-Reaktorblöcke in 31 Ländern am Netz. Ihre gesamte Leistung wird mit 391 Gigawatt angegeben. Weitere 60 Atomkraftwerke mit einer Gesamtleistung von 60,6 GW waren damals im Bau. Allerdings wurden dazu parallel auch 149 Reaktorblöcke abgeschaltet. Daher ist die globale Anzahl der Reaktoren seit 1995 mehr oder weniger konstant geblieben. In der EU waren 2018 noch 127 Meiler am Netz – 50 weniger als 1988, dem Allzeit-Maximum.
Nach dem World Nuclear Industry Status Report (WNISR) von 2018 (zitiert nach FR vom 13.09.2018) ist diese Entwicklung gegenwärtig allerdings deutlich stärker rückläufig als oben geschildert. Außer der VR China würde kein anderes Land mehr in „großem Maßstab auf den Ausbau der Atomkraft“ setzen. Und es wird angefügt: „Selbst in der Volksrepublik laufen Wind- und Solarkraft dieser Technologie längst den Rang ab“. Nach WNISR produzierten zuletzt nur noch 403 Reaktoren Strom mit einer Erzeugungskapazität von insgesamt 351 GW. Zehn neue Reaktoren gingen danach 2017 ans Netz, davon fünf in der VR China. Zwei Anlagen wurden im Gegenzug abgeschaltet. Nach diesem Report befinden sich weltweit 53 Anlagen im Bau – 20 davon in der VR China.
Allerdings gibt es sehr große Unterschiede zwischen den Ländern. Während in Frankreich 58 Reaktoren mit einer Leistung von etwa 63 Gigawatt laufen, sind in Deutschland nur noch sieben Kraftwerke am Netz. Diese trugen 2016 mit 84,6 TWh 13 Prozent zur Bruttostromerzeugung bei. Diesen Reaktoren müssen weltweit noch etwa 180 weitere hinzugerechnet werden, die auf Schiffen – von Eisbrechern bis hin zu Unterseebooten – installiert sind.
Der Anteil der globalen Erzeugung von Elektrizität auf der Grundlage von Kernenergie betrug 1993 noch 17 Prozent. Er fiel bis 2011 auf 11 Prozent – bei mehr oder weniger konstanter Gesamtleistung. Diese scheinbare Reduktion ist dem weltweiten Anstieg der Stromerzeugung und hier vor allem auch derjenigen auf der Basis von erneuerbaren Energien geschuldet. In der EU deckt Strom aus Kernenergie etwa ein Drittel des gesamten Stromverbrauchs.
Die deutsche Bundesregierung hat als Konsequenz aus dem GAU von Fukushima (Japan) im Jahr 2011 beschlossen, dass bis 2022 alle Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet sein und vom Netz gehen müssen. Der Bau neuer Kernkraftwerke ist nicht mehr zugelassen. Sieben Reaktorblöcke sind noch an ebenso vielen Standorten aktiv. Sie verfügen über eine installierte Netto-Gesamtleistung von knapp 9.500 MW. 28 Blöcke wurden in der Vergangenheit bereits dauerhaft vom Netz genommen. Bis zum 31.12.2022 müssen auch die letzten drei Blöcke – Isar 2, Emsland und Neckarwestheim 2 – abgeschaltet werden.
Nach einem Bericht der BGR[4] von 2008 beläuft sich der förderfähige Vorrat an Uran global auf 1.766 Millionen Tonnen. Uranlagerstätten finden sich vor allem in Australien (709.000 t, 40% des globalen Vorrates), Kanada (270.000 t, 15%) und Kasachstan (240.000 t, 13%). Größere Vorräte finden sich außerdem noch in Russland, Niger, Namibia, Usbekistan und den USA. 70 Prozent der weltweit bekannten Lagerstätten liegen auf Land, das – eigentlich – indigenen Völkern gehört. Allerdings sind nach dem Red Book der Internationalen Atomenergie Organisation (IAEA) und der Nuclear Energy Agency (NEA) der OECD davon nur „maximal vier Millionen Tonnen noch wirtschaftlich abbaubar“. Diese Annahmen sind jedoch heftig umstritten.
Gefördert wird Uran vor allem im Tagebau unter dem Einsatz großtechnischer Anlagen. Diese Tagebaue nehmen meistens sehr große Flächen in Anspruch. Sie weisen nicht selten Durchmesser von einigen Kilometern und Tiefen bis zu 1.000 Metern auf. In Einzelfällen finden sich sogar noch deutlich tiefere Anlagen. Nach Angaben der BGR[4] wurden 2014 weltweit 56.252 Tonnen Uran gefördert. Die wichtigsten Förderländer waren 2012 Kasachstan mit einem Anteil an der globalen Förderung von 21,3, Kanada mit 9, Australien mit 7, Niger mit 4,7 und Namibia mit 4,5 Prozent.
Großverbraucher an Uran sind nach einer Studie der BGR aus dem Jahr 2008 die USA mit 18.900 Tonnen beziehungsweise 29,3 Prozent am gesamt Uranverbrauch, Frankreich (10.500 t/16,3%) und Japan (7.600 t/11,7%). Deutschland rangiert mit einem Verbrauch von 3.300 Tonnen beziehungsweise einem Anteil von 5,2 Prozent im oberen Mittelfeld. Alle diese Länder sind auf den Import von Uran angewiesen.
Der Grafik 17 kann der Stromverbrauch auf der Basis von Kernenergie entnommen werden. Für die Periode zwischen 1992 und 2017 werden in der bereits erwähnten BP-Studie[2] ein deutlicher Anstieg bis etwa zum Jahr 2005 und ein leichter Abstieg mit größeren Schwankungen bis 2016 ausgewiesen. Knapp 80 Prozent dieses Verbrauchs entfallen auf Nordamerika, Europa und Eurasien. Im Jahr 2016 betrug der Zuwachs 1,3 Prozent.
Grafik 17: Stromverbrauch auf der Basis von Kernenergie in Millionen Tonnen Erdöl-Äquivalenten nach Weltregionen zwischen 1992 und 2017