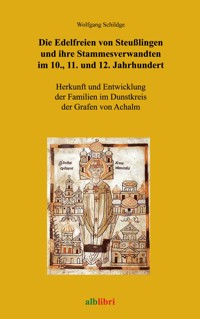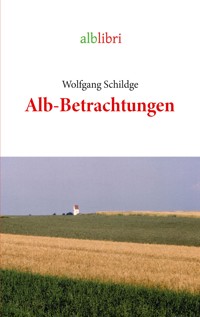
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Geschichten und Betrachtungen um das Land- und Stadtleben aus dem Biosphärenreservat Schwäbische Alb. Mit nachhaltigen Anregungen ganz im Blickpunkt der Zeit, heiter und hintergründig, nachdenklich und satirisch und daher nicht immer ernst gemeint.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Landleben
Dödeldödeldüü
Kernzone
Stadt und Land
Die liebe Ordnung
Tablettenteiler
Totenvögel
Schwarzsehen
Blühstreifen
Nachbarschaft
Vereine
Zeitungsbotenalltag
Wolkenvorhang
Ratsprotokolle
Winterschlaf
Kehrwoche
Alkohol
Fortunens Lob
König Wilhelm
Die Geister der Vergangenheit
Denken
Waldarbeit mit Pferden
Erziehung
Bericht aus dem Polizeirevier
Die Bank
Geschmacksache
Creation
Gewohnheiten
Ortsbekannt und nicht alltäglich
Nebel
Unsinn
Gartenlüste
Irritationen
Märchenwald
Kahnfahrt ins Totenreich?
Innere Emigration
Moralischer Kompass
Die Ohnmacht des Rationalen
Aus der Suspektionsforschung
Flucht
Symmetrische Eskalation
Planungen
Landleben
Lambert lehnte nachdenklich am Gatter. Er beobachtete seine Kuh Elsa, die sich von der Herde abgesondert hatte und stoisch rupfend das saftige Gras der Weide genoss, als gäbe es nichts Wichtigeres auf der Welt.
Gewiss, er hatte bisweilen seine liebe Mühe mit dem Hornvieh, etwa, wenn es auf dem Weg zur Weide freudige Bocksprünge machte oder sich – mit übelsten Folgen – in Vorgärten verlustierte, anderes Mal sich weigerte, in den Stall zurückzukehren, beim Melken nervös tänzelte oder ihm einen spritzenden Fladen servierte. Aber diese Eindrücke vermittelten doch ein ganz falsches Bild. Im Grund genommen waren seine Milchrinder phlegmatische, friedliche Zeitgenossen.
Beruhigend, besänftigend, ja mahnend konnten sie ihn mit ihren großen Augen anschauen, als wollten sie sagen »ist ja schon gut, nimm dir Zeit für uns, schau die herrlichen Weiden, die Welt ist so schön!«
Die Zwiesprache zwischen Kreatur und Mensch bestand neben Augenkontakten auf der einen Seite aus einem herzhaften hohen Muh und Stupsen mit der Nase, mit dem sie andeuteten, dass er zu ihrer Herde gehörte – eine Ehre, die er sich durch viel Zuwendung erarbeitet hatte –, auf der anderen Seite aus einem liebevollen klopfenden Streicheln und gutem Zureden, von dem sie natürlich nur die herzliche wohlwollende Zuneigung verstanden, nicht die Rede selbst, hin und wieder aber auch aus einem wütenden Schimpfen und widerborstigen Stampfen oder Brüllen, wenn ihnen der Wille des Menschen zuwider war.
Dem Städter mögen die tierischen Lautäußerungen spärlich erscheinen: Außer dem hohen Muh gibt es noch ein tiefes lautes Muhen aus voller Brust, das der Kuh als Fern- oder Orientierungsruf dient, manchmal auch ein schnell hintereinander folgendes Muhen, vielleicht Ausdruck von Ärger oder Freude. Dem Landmann jedenfalls genügt die emotional geführte Zwiesprache und es geht ihm weniger um die Verständigung en détail als um die Herstellung einer angenehmen Atmosphäre. Meine Kühe sind empfindsame, zartbesaitete Wesen, pflegte Lambert zu sagen, keine Maschinen, die mittels Futter Milch produzieren; sie schätzen freundlichen Umgang und reagieren auf grobe Behandlung mit Krankheit oder dem Abfall ihrer Milchleistung.
Ein sprachlich bewanderter Zeitgenosse hatte ihn anerkennend »Animalist« genannt, wobei er wohl soviel wie Freund der Tiere sagen wollte, und Lambert hatte sich die Plakette lächelnd und mit einer Portion Genugtuung angeheftet. Er betrachtete den Ertrag des Hofes als notwendige Komponente, reduzierte jedoch die Beziehung zwischen Mensch und Tier nicht auf die ökonomische Seite. Gegenseitiger Respekt verlangte eine übergreifende Sichtweise: Das Zusammenleben der Kreaturen in einer intakten Welt hatte zu kosmischer Eintracht beizutragen.
In spärlichen Momenten entrückten Schauens beneidete Lambert seine Kühe, die, wie er glaubte, aller Nöte ledig waren. Sie mussten sich ja keine Sorgen machen um den Milchpreis, der wieder einmal zu fallen drohte, um die Heuernte, die bei schlechter Witterung nur mit Mühe einzubringen war oder die Kosten für den Doktor, die manchmal schmerzlich zu Buche schlugen. Nein, das war wohl eher ein Leben wie im Schlaraffenland: Schlafen, köstliches Gras genießen, aromatisches Wasser schlürfen, im Schatten liegen, dösend wiederkäuen, zur rechten Zeit einen Bullen haben und, im Gegensatz zu früher, als Kühe und Bullen noch vor Wagen und Pflug gespannt wurden, von jeglicher Arbeit befreit sein. Was konnte man mehr wollen? Die regelmäßige Gabe einer ordentlichen Portion Milch war im Grunde genommen die einzige Gegenleistung, die sie zu erbringen hatten. Keine Ausbeutung (augenzwinkernd), sondern geben und nehmen, leben und leben lassen.
Andererseits: Ein eintöniges, langweiliges Dasein, dachte er bei sich. Im Sommer auf der Wiese faulenzen, im Winter stickige Stallluft bei Wasser, Heu und portionierter Gabe Kraftfutter, der Bewegungsspielraum von Fall zu Fall stark reduziert, fast wie in einem staatlichen Gefängnis. Aber er war sicher, dass die Kühe dies anders empfanden und dass man sie nicht in menschlichen Kategorien messen konnte.
Gedankenverloren war Lambert entgangen, dass er Besuch bekommen hatte. Ein Mann in Jeans und Windjacke, mit Rucksack und Wanderstock trat zu ihm an den Zaun heran.
»Guten Tag, schöne, starke Kühe haben sie da«, begrüßte er ihn. »Peter Dohl aus Leonberg. Habe mir vorgenommen, von Leonberg zum Bodensee zu laufen.«
Lambert streckte ihm die Hand entgegen. »Grüß Gott, Lambert Müller. Vielen Dank für die lobenden Worte. Meine Kühe würden sich freuen, wenn sie Deutsch verstünden. Was bringt einen dazu, eine derart große Strecke alleine zu gehen?«
»Nun ja«, erwiderte der Wanderer mit Schulterzucken und freundlicher Mine, »ich habe in meinem Leben bislang keine Zeit gefunden, etwas Ungewöhnliches zu tun, mal auszubrechen, habe immer nur Verpflichtungen erfüllen müssen. Mein kleines Unternehmen, die Familie, irgend etwas war immer wichtiger. Verstehen sie, wie das ist, wenn man wie ein Hamster im Laufrad gezwungen ist zu laufen, damit man seinem Pflichtgefühl gerecht wird? Mein größter Wunsch war, einmal alleine zu sein, unser schönes Land zu erleben, die Charakteristika seiner Landschaften, Dörfer und Städte, seiner Wälder und Wiesen, bei Wind und Wetter unterwegs zu sein und letztlich nicht zu wissen, wo man abends eine Bleibe findet. Sie haben’s gut, können draußen sein im Freien, ich fühle mich oft eingesperrt.«
Lambert hatte aufmerksam zugehört. Er neigte bedenklich den Kopf und schwieg einen Moment, bevor er antwortete. »Sicher, ich kann das nachempfinden, aber jede Medaille hat zwei Seiten – Kuhhaltung ist arbeitsaufwendig, Urlaub machen ist nicht drin. Familienfeste müssen unterbrochen werden, wenn Futter- und Melkzeit ist. Der Abstand zwischen zwei Melkzeiten sollte zwölf Stunden betragen, deshalb muss ich früh raus, damit ich abends fertig werde. Sie sehen, jeder Stand hat seine Plage.«
»Da können wir uns ja die Hand reichen!«, antwortete der Wanderer. Er lächelte zufrieden und betrachtete aufmerksam die Herde. »Machen die Kühe auch Mal eine Pause?«
»Ja natürlich, aber an viel Schlaf ist nicht zu denken. Ihre Fressaktivität beginnt auf der Weide meist schon nach Mitternacht. Die geistige Erholung beschränkt sich dann auf gelegentliches Dösen. Beobachten sie einmal Elsa: Sie leckt die Gräser mit ihrer rauen Zunge an und reißt die Büschel ab. Viel gekaut wird dabei nicht. Das kommt später. Auf der Weide ist sie mehr als die Hälfte des Tages mit Fressen beschäftigt, denn sie braucht über fünfzig Kilogramm Gras pro Tag, um ihren Energiebedarf zu decken. Dabei bildet sie nahezu zweihundert Liter Speichel. Unglaublich, nicht wahr?«
»Aber dann muss sie ja enorm viel Wasser trinken!?«
»Ja sicher, an die 50 Liter am Tag. Das Gras kommt zunächst in die große Gärkammer, den Pansen, übrigens einer der Vormägen. Dort wird mit Hilfe von Bakterien Zellulose aufgeschlossen. Wenn sie genug gefressen haben, legen sie sich erst einmal zur Ruhe. Häufig tun sie dies gemeinsam. Sie träumen vor sich hin und ... plopp ... plötzlich haben sie die Backen voll und fangen an zu kauen. Dazu haben sie ja beim Fressen keine Zeit gehabt.«
»Uuh, wenn ich mir vorstelle, ich müsste mein Mittagessen noch mal hochwürgen, um es nachzubearbeiten.«
»Kein schöner Gedanke, nein ...«, erwiderte Lambert. »Aber der Pansen ist kein Magen; erst im eigentlichen Magen der Kuh wird wie beim Menschen Salzsäure eingeleitet, um die Proteine aufzuschließen. Ein Fachmann hat einmal gesagt: Wir füttern nicht die Kuh, sondern den Pansen. Er wollte damit zum Ausdruck bringen, dass man für richtiges Füttern viel Erfahrung und Kenntnisse braucht, damit das sensible Gleichgewicht der Pansenflora nicht durcheinander gerät. Übrigens: Ein Drittel der Tagesbeschäftigung ist mit Wiederkäuen ausgefüllt.«
Peter Dohl war nachdenklich geworden. »Wenn ich mir’s so überlege – den ganzen Tag nichts anderes tun als mich um meinen Bauch kümmern, ich weiß nicht, anfangs würde mir das ja gefallen, aber dann ...? Da bliebe keine Zeit für das Entwickeln einer Kultur.« Er schmunzelte. »Vielleicht haben Kühe deshalb keine Zivilisation aufbauen können.« Worauf Lambert mit einem Heiterkeitsausbruch reagierte.
Während die beiden sich unterhielten, prüfte Elsa sorgsam die Gräser und Kräuter mit ihrem feinen Geruchsinn und zupfte sie selektierend ab, auch Giftpflanzen erkannte sie mühelos, Sauerampfer, Disteln, Brennnesseln, Storchenschnabel oder Herbstzeitlosen mochte sie nicht. Dafür wertvolle Futterkräuter wie Löwenzahn, Schafgarbe, Spitzwegerich, diverse Klee- und diverse Grassorten. Sie wedelte mit dem Schwanz, um Fliegen zu vertreiben und zuckte immer wieder mit dem Fell.
»Gemütliche Zeitgenossen, ihre Kühe. Ich habe mal gelesen, dass unsere heutigen Rinder in ihrem Wesen vom wild lebenden Ur-Rind so weit entfernt sind wie der Mensch vom Schimpansen. Stammvater war wohl der Auerochs. So ein schnaubendes, blitzschnelles Ungetüm zu jagen erforderte sicher eine Menge Mut.«
»In der Tat«, erwiderte Lambert. »Und mancher der Jäger wird sich wohl, statt am Festmahl der Jagdgesellschaft teilzuhaben, an Odins Tafel wiedergefunden haben. Überhaupt spielten die Rinder bei den Germanen – sie waren ja Bauern – eine wichtige Rolle. Es war die Kuh Audhumbla, die zu Beginn der Welt Götter aus einem Eisblock hervor leckte. So steht‘s jedenfalls in der Edda geschrieben. Und soweit ich weiß, waren auch die Kelten, die hier in Süddeutschland lange vor den Germanen ihre Wohnsitze hatten, in erster Linie Viehzüchter. Wildrinder waren Herdentiere und manche ihrer Verhaltensweisen finden wir heute noch bei unseren hochgezüchteten Hornviechern. Nehmen wir mal an, sie treiben einige auf eine Weide, in der es einen Hügel gibt, dann steht in Kürze eine Kuh darauf, sozusagen als Wachposten. Oder: Lassen sie mal einen Hund Kühe jagen. Kaum freut er sich, dass die Viecher davonlaufen, da ist er schon eingekreist und muss froh sein, wenn er mit heiler Haut davon kommt. Kurzum: Wenig empfehlenswert ist es, als Fremder in die Herde eines Bullen einzudringen.«
»Kann ich mir vorstellen. Soweit ich weiß, sollte man dann stehen bleiben, oder ...?«
Lambert lächelte. »Ja, ja, gewiss, so sagt man; ich kenne diese Regel – aber ich habe nicht den Eindruck, dass der Bulle sie kennt.« Sie lachten und beobachteten die Herde mit stillem Vergnügen.
»Ob die Tiere ihre Umwelt überhaupt bewusst wahrnehmen können?«, fragte Peter Dohl nach einer Weile.
Lambert überlegte. »Ich glaube schon, dass sie das können – im Rahmen ihres Horizontes. Wenn sie an eine Weide gelangen, die selten von Menschen besucht wird, drängen sich die Tiere sofort neugierig heran und begleiten den Besucher bis in den letzten Winkel. Es sind soziale Wesen. Sie begrüßen sich mit tiefgehaltenem Kopf und ausgestrecktem Hals, eine Mischung aus Demuts- und Freundschaftsgeste. Wenn eine Kuh Freundschaft mit ihnen geschlossen hat, werden sie auf die gleiche Weise begrüßt. Ansonsten lässt sie sich nicht anfassen und geht erst einmal einige Schritte zurück. Sie können durchaus schnell unterwegs sein, auch im Stall. Wenn sie ihre verrückten fünf Minuten bekommen, rennen sie die Gänge rauf und runter. Dann heißt es schnell aus dem Weg gehen.«
»Was sie wohl im Vergleich zum Menschen empfinden? Kennen sie so etwas wie Glück, Zufriedenheit? Ihr Tagesablauf mit Fressen, Wiederkäuen und Schlafen muss doch sehr eintönig sein.«
»Sehen Sie‘s mal so: Kühe haben keine Welterklärungsnöte, keine Götter und keine Feinde, führen daher auch keine Kriege, sie kümmern sich nicht um den Anfang und das Ende der Welt, haben keine Vorstellung von Leben und Tod und vom Metzger, leben gedankenlos in den Tag hinein. Dennoch sind sie für Zuwendung empfänglich. Und was ihre intellektuellen Leistungen angeht: Sie finden ihren Weg zum Stall, schön und gut, aber ob sie über ihre angeborenen Verhaltensmuster Größeres zu leisten fähig sind?«
»Und wie steht‘s mit ihrer sprichwörtlichen Dummheit?«, fragte Peter Dohl. »Die Metapher von der beschränkten Kuh etwa, wenn es gilt, dem Kontrahenten einige Trainingseinheiten fürs Gehirn zu empfehlen.«
Lambert grinste. »Wird wohl nur auf Frauen angewendet, bei Männern ist es der Ochse. Dass meine Kühe von Sprichwort und Volksmund wenig Schmeichelhaftes angedichtet bekommen, etwa blöde Kuh – steht da wie eine Kuh vor dem neuen Scheunentor – steht da wie eine Kuh beim Donnern –, ist einfallslose Polemik in Reinkultur. Höchst ärgerlich, wenn man Kühe so ungerecht verunglimpft. Wie beim Menschen sind ihre intellektuellen Fähigkeiten unterschiedlich ausgeprägt.«
»Peter Dohl nickte nachdenklich. »Kann ich mir vorstellen. Kuhhaltung und Hochleistungsmilchproduktion steht in letzter Zeit zunehmen in der Kritik. Was ist daran richtig?«
Lambert biss sich auf die Lippen und kratzte sich an der Stirne. »Da stechen Sie in ein Wespennest, weil die Kritik berechtigt ist. Die einzige Aufgabe einer Milchkuh ist es, viel Milch zu produzieren und Milch gibt sie nur, wenn sie ein Kalb zur Welt bringt. Die mütterliche Bindung zwischen der Kuh und ihrem Neugeborenen wird nach wenigen Tagen schon durchtrennt, weil der Mensch die Milch beansprucht, dem Kalb wird dann billigere Ersatzmilch verabreicht. Das bedeutet schwere Belastungen für Mutter und Kalb. In den vergangenen fünfzig Jahren hat sich die Milchproduktion vervielfacht – und das, obwohl es heute viel weniger Milchkühe gibt als früher.«
»Woran liegt das?«
»Das liegt zum einen an der Züchtung und am Hochleistungsfutter. Grundfutter ist in unseren Breiten Gras, entweder frisch, siliert oder getrocknet, dazu Mais, zumeist siliert. Zur Ergänzung einer bedarfsgerechten Fütterung wird Kraftfutter wie Raps oder Soja eingesetzt, dazu Biertreber, die festen Rückstände von Malz. Sie sind in der Anschaffung und Lagerung teuer, deshalb im Fokus jedes Landwirts, der rechnen kann.«
»Soja aus Südamerika, für dessen Anbau Urwälder weichen müssen. Das Klima fährt Achterbahn, aber niemand tut etwas. Die Doppelmoral der Regierenden.«
»Sie haben ja Recht, doch bedenken Sie bitte: Die Problemfelder Ernährung, Klima und Wirtschaft sind über Kontinente hinweg auf vielfältige Weise miteinander verschränkt und schaffen einem Komplex, der schnelle Lösungen erschwert.«
»Hoffen wir, dass die weltweit zunehmenden Klimakapriolen unsere Politiker zu schnellerem Handeln veranlassen.«
»Das wäre sehr wünschenswert. Übrigens: Eine moderne Kuh, die ohne Ergänzungen auskommen muss, gibt zwar weniger Milch, ist aber nicht gesünder, weil sie häufig Stoffwechselerkrankungen entwickelt. Eigentlich ist die ergänzende Fütterung nicht artgemäß, denn Rinder sind Wiederkäuer, deren Nahrung normalerweise aus Gras und Heu besteht. Die enorme Milchleistung bringt die Tiere an ihre körperlichen Grenzen.«
»Die Schattenseiten?«
»Es häufen sich Krankheiten wie Euterentzündungen, die Fruchtbarkeit nimmt ab, die Kühe sterben früher. Statistisch gesehen werden Kühe heute meist um die fünf Jahre alt.«
»Kritiker warnen auch vor Medikamentenrückständen in der Milch.«
»Wenn Euterentzündungen, also Berufskrankheiten, um es scherzhaft zu sagen, behandelt werden müssen, kommen auch Antibiotika zum Einsatz, ist aber kein Problem, denn jeder Landwirt ist gehalten, vor der Ablieferung eine Milchprobe einzusenden und sie im Labor untersuchen zu lassen. Die Strafen gegen Vergehen sind horrend. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass ich diese Art der Viehhaltung nicht praktiziere.«
»Wie arbeiten Sie?«
»Meine Kühe haben sommers- wie winters viel Weidegang, leben also hauptsächlich vom Gras der Weiden, Wohlbefinden und Gesundheit der Kuh nehme ich wichtiger als die ständige Steigerung der Milchproduktion. Nach dem Motto: Gesunde und zufriedene Kühe leben länger und geben damit auch länger und auf Dauer mehr Milch. Bequeme Liegeflächen im Stall statt Anbindehaltung, Vermeidung von Stress durch Fütterung von mehrheitlich Grün- und wenig Kraftfutter.«
»Glückliche Kühe für bessere Milch?«
»Ja, und die Kälber bleiben bei der Mutter, die erst gemolken wird, wenn das Kalb getrunken hat.«
Peter Dohl sah zu den dunklen Wolken auf. »Ich glaube, wir bekommen Regen. Macht es den Kühen nichts aus, bei schlechtem Wetter draußen zu sein?«
»Nein, eigentlich nicht. Im Gegenteil. Sie härten ab und sind dann im Winter, wenn sie im Stall stehen müssen, weniger anfällig für Erkältungskrankheiten.«
»Um das zu vermeiden, müssen sie ihren Stall vermutlich heizen?«
»Du lieber Himmel, nein«, lachte Lambert, »die Kühe vertragen Temperaturen bis null Grad, wenn sie sich bewegen können; nur Zugluft schadet über die Maßen und ist daher zu vermeiden.«
»Wie steht es mit dem viel beschriebenen Problem der Kuh als Klimakiller?«
»Da kann ich nur lachen. Die Kuh als klimaneutral darzustellen wäre nicht richtig. Jedoch ist die Aussage „die Kuh ist ein Klimakiller“ ebenso falsch. Aufgrund der Fakten lässt sich bestätigen, dass Kühe beim Methanausstoß eine untergeordnete Rolle spielen. Ihr Beitrag ist deutlich geringer, als es durch den Aufschrei in den Medien den Anschein erweckt. Soll hier von den wahren Ausstoßquellen abgelenkt werden, zum Beispiel vom Menschen, der den größten Teil davon über den Verkehr und Heizung selbst verursacht? Gerade der von Menschen verursachte erhebliche CO2 Ausstoß, der im Vergleich zum Methan wesentlich länger in der Atmosphäre verweilt, ist die Hauptursache der Klimaproblematik. Satellitenbilder zeigen, das Gebiete mit Kohleabbau oder Fracking deutlich mehr Methan produzieren als Gebiete mit Rinderhaltung. So beträgt der Anteil der Wertschöpfungskette für Milch weltweit lediglich 4% der gesamten Treibhausemissionen. Laut internationaler Klimaberichterstattung verursachte die deutsche Landwirtschaft 2017 insgesamt 66 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente, also 7% der gesamten Treibhausgasemissionen in Deutschland. Dabei stammen 60% des Methans aus der Landwirtschaft. «
»Ja, das ist sehr interessant.« Inzwischen fielen die ersten Tropfen, so dass sich Peter Dohl genötigt sah, seinen Regenschutz aus dem Rucksack zu holen. Sie verabschiedeten sich, man tauschte freundliche Worte und der Wanderer dankte für die Lehrstunde in Kühen.
Der Erfolg des charismatischen Lambert hatte sich allmählich in weiterem Umkreis herumgesprochen. Im Dorf nannte man ihn ein wenig scherzhaft den Cow-whisperer, weil er seine Kühe sichtlich glücklich zu machen verstand, und Lambert war sich wohl bewusst, dass man seine Methode teils mit neidvollen Blicken, teils mit aufrichtiger Anerkennung kommentierte.
Die Kuh hat unseren Respekt verdient, brachte er in Versammlungen nachhaltig zum Ausdruck. Aus ihrer Milch machen wir köstlichen Käse, Butter und Joghurt, sie nährt unsere Kinder. Dass indische Kollegen Kühe als heilige Tiere verehrten und ihnen Narrenfreiheit einräumten, fand er – bei allem Verständnis für deren Sitten und Gebräuche – übertrieben.
Dödeldödeldüü
Städte gleichen einem stark sprudelnden Suppentopf, der regelmäßig überkocht. Reibung erzeugt Hitze und Hitze veranlasst die Teile des Gefüges, sich aus der Masse abzuheben und zurückzufallen. Ein kleiner Teil der Flüssigkeit fließt über den Rand. Die sprudelnden Teilchen der Flüssigkeit repräsentieren Menschen, die sich nach Freiheit, Ruhe, Einsamkeit sehnen und die nach der Phase der Erholung wieder ins Gefüge zurückkehren. Andere »kochen über«. Sie bleiben draußen, wohnen auf dem Land und tun dies aus freien Stücken, weil sie empfinden, dass Natur und Kultur dort eher im Gleichgewicht sind als in komprimierten Wohnsilos des Ballungsraums.
Und jener, der draußen lebt? Er ist den Verlockungen der Hochkultur zwangsläufig ausgesetzt: Den nutzlosen Tand der Zivilisation mit Augenmaß gewichtend gerät er doch ab und zu in den Kontakt mit urbanen Lebensformen und kehrt bald erleichtert und einsichtig wieder zurück in das harte Leben der ländlichen Wildnis.
So mancher hält es mit Epikur: Lebe im Verborgenen, entziehe dich den Vergewaltigungen durch die Gesellschaft – ihrer Bewunderung wie ihrer Verurteilung.
Ich habe mich heute abgesondert, vereinzelt möchte ich sein, nicht abgelenkt von äußeren Einflüssen, von kultureller Aktivität, von Menschen, ihren Fragen oder Meinungen, die mich hindern, auf mein Selbst zu hören, dieses semantisch dunkle Selbst, das mit Selbstverwirklichung einher geht und immer noch in Verbindung mit politischer, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Befreiung gedacht wird, weniger mit Selbstdarstellung oder Konsum.
Abstand halten bedeutet, dass man irgendwo dazu gehört, aber dennoch imstande ist, für sich selbst stehen zu können, ohne seine Identität in der Gruppe zu suchen, es bedeutet, sein Leben und Denken in Frage zu stellen, fern von gesellschaftlichen Einflüssen; Arbeit an sich selbst braucht Ruhe und Abgesondertsein.
Unbelastete aromatische Luft einsaugen fern von Ballungsräumen, unbeschwert sein ohne Pflichten und Aufgaben, die so manches Mal wie ein schwerer Rucksack auf dem Rücken lasten: Ich bin froh, endlich einmal alleine sein zu dürfen.
Der schmale Weg führt durch ein verlassenes Tal, umsäumt von Felsentürmen aus härterem Gestein, die hier und da wie Riesen am Weg hoch aufragen, rechts und links weicht steiler Hangwald zurück, urwälderisch nun sich selbst überlassen: Gieselwald und Heumacherfels voraus sind heute eine Kernzone des Biosphärengebiets Schwäbische Alb.
In den saftigen Wiesen schlängelt sich der Bach, unentschlossen, wie es scheint, wechselt er immer wieder seine Richtung, aber der Untergrund ist von unterschiedlicher Härte, durchbeißen muss er sich. Seine Musik ist ein Adagio, mal kaum hörbares Fließen, leises Rauschen oder Plätschern, wenn er schaumig über felsige Stufen springt. Unter meinen Schuhsohlen knirscht gelblich weißer Schotter, er federt die Tritte, ist kein harter Asphalt, durchdringlich für Wasser.
Unterwegs habe ich einen knorrigen Ast aufgelesen, Totholz wie alles rundum irgendwann zum Absterben verurteilt. Wanderstab oder Stütze? Je nachdem, er gibt den Takt an und orchestriert meine Schritte. Herrlich, diese Ruhe!
Ruhe? Ich achte nun aufmerksamer auf die Geräusche der Natur. Ich nehme Vögel wahr, hier und da kann ich sie zuordnen, so den Buchfink, deutlich zu hören der Zilpzalp, über mir der Schrei des Roten Milan, und weiter voraus steht in lauernder Stellung ein Reiher in den Wiesen, bereit, zuzustoßen.
In den Kernzonen des Biosphärengebiets darf man den Weg nicht verlassen. Aber stört es außerhalb Reh und Wildschwein, wenn Wandergruppen hörbar durch den Wald touren? Grundsätzlich lieben es wilde Tiere leise, nicht weil sie lärmempfindlich sind, aber wenn ein Sturm tobt oder ein Platzregen herunter rauscht, dann hören sie nicht den Fuchs, Wolf oder Luchs. Lärmende Menschen sind für sie keine Gefahr. Der bei weitem größere Feind ist jedoch der Mensch in Form von Jägern, manchmal steht alle paar hundert Meter ein Schießturm.
Im Winter anfüttern tun sie die Tiere hier und da immer noch, einer der Gründe, weshalb sich der Wildbestand über das vernünftige Maß hinaus erhöht hat, für Trophäenkult? Die Forstpartie wirft der Jagd vor, dass selektive Bejagung und sogenannte Hegemaßnahmen einen großen Wildbestand zur Folge haben und dass Jagdpächter daher häufig überfordert sind, die Jagdpartie entgegnet, der Forst sei wildfeindlich, denke nur an Holzzuwachs – ein Schwarze-Peter-Spiel. Passen die Rituale der Jägerschaft, identitätsstiftend offensichtlich, noch in die Zeit? Verbiss im klimageschädigten Wald und die nötige Verringerung der Schalenwildbestände ist Dauerthema.
Der Frühling ist mit Macht hereingebrochen, die Wiesen sind geflutet vom Gelb des Löwenzahns, Stickstoffanzeiger, vielerorts gedüngt und daher keine reine Natur, aber mit dem saftigen Grün der Gräser und den weißblühenden Schlehen garnieren sie das Tal und stimulieren Sinne und Gemüt.
Wie Computerprogramme bestimmen Gene Gestalt und Wachstum bis in die feinen Verästelungen des Blattwerks und der Leitungsbahnen, unten im Wurzelwerk liefert das Mahlwerk der Erosion Mineralien, Basis und Nahrung gleichermaßen, nutzlos, wenn das Wasser fehlte. Pflanzen sind Tieren und Menschen verwandt. Alle haben wir unseren gemeinsamen Ursprung in einzelligen Lebewesen, die sich nun nach fast drei Milliarden andauernder Evolution zu einzigartiger Vielfalt differenziert haben. Wie alle Lebewesen reagieren auch Pflanzen auf Veränderungen der Umwelt, sie kommunizieren über und unter der Erde durch vielfältige Signale und durch Duftstoffe. Ich bemerke es deutlich, während ich tief einatme.
Eine lebenswerte Umwelt bedarf der pflanzlichen Vielfalt. Wenn wir erkennen, dass wir der Natur erheblich mehr Raum gewähren müssen, damit es gelingt, die Biosphäre zu stabilisieren und das Klima in den Griff zu bekommen, dass Pflanzen angesichts der Ernährungslage in der Welt in Zukunft erhebliche Bedeutung haben werden, dann müssen wir ihnen mit mehr Respekt begegnen, urwüchsige, schöne, filigrane und farbige Natur ist für unser Wohlbefinden darüber hinaus entscheidend.
Beflügelt erhebt sich nun der erkennende Geist, lässt irdische Enge zurück, gewinnt an kosmischer Einsicht und Weisheit, schön gesagt, aber ein bisschen diffus in seiner Sinnhaftigkeit, Gefühltes ist sehr oft ein Gradmesser des Selbstwertempfindens.
Ich liebe die Natur, die frei ist von lärmenden Menschen, frei von steinernen Zeugen menschlicher Kultur, zeitweilig, bis zu Heuernte oder Pflegearbeiten der Forstmänner, Pflanzen und Tieren überlassen. Hin und wieder zeigt sich dann die konkurrierende Kreatur im Kampf um das Überleben auf der Bühne des Lebens: Bewundernswert die Strategien der Pflanzen um Licht und Nährstoffe, die schnellen Richtungswechsel des hakenschlagenden Hasen, die aquadynamisch der Strömung trotzende stillstehende Forelle, der Sturzflug des Falken, doch grausam das Schicksal der Maus, die er am Boden mit seinen Krallen packt. Perspektivisch gesehen freilich, aus menschlicher Sicht.
Konrad Lorenz hatte in seiner vergleichenden Verhaltensforschung das Verhalten von Tierarten in Bezug auf Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten untersucht und dabei auch den Menschen mit einbezogen. Als Konstanten bezeichnete er dabei die Furcht, den Ernährungs- und Fortpflanzungstrieb sowie den Aggressionstrieb, den er einschränkend als das sogenannte Böse bezeichnete, weil es lebensvernichtend wirkt, stammesgeschichtlich aber bei allen Tierarten zu erblich festgelegten Verhaltensmustern führt, die er im Gegensatz zur viel schneller abgelaufenen kulturellen Entwicklung des Menschen als nicht veränderbar erkannte.
Ich beschließe, zu dieser Ruine hochzusteigen; oben, vom Bergfried aus, soll ein fantastischer Blick über die Landschaft möglich sein. Was fasziniert uns daran, auf den Höhen den Überblick zu haben? Ist es das Gefühl von Freiheit, über den Dingen zu stehen, unbehelligt von den Einflüssen anderer, frei zu sein in Entscheidungen? Freiheit kann nicht identifiziert werden mit dem Uneingeschränkten. Sie hat ihre eigene Natur und darin ihre Begrenzungen. Vielleicht schlummert in unseren Genen noch die Erinnerungen an unser Leben als Jäger und Sammler, als es wichtig war, den Überblick zu behalten und kommende Gefahren im Blick zu haben. Unsicherheit produziert Angst, Sicherheit Wohlbefinden.
Der auf meiner Karte eingezeichnete Weg scheint für Fußkranke angelegt zu sein. Ich fühle mich frisch und voller Tatendrang, der Druck im Dampfkessel stimmt, Adrenalin wird ausgeschüttet, so dass ich den direkten Weg durch das bewaldete Seitental wähle. Auf meine Orientierungsgabe kann ich mich verlassen. Nebenbei: Das Moos an der Westseite der Bäume soll dabei helfen, weil es die Wetterrichtung anzeigt. – Stimmt leider nicht immer. Es kommt auch darauf an, wie der Regen von den Ästen abgeleitet wird.
Jetzt steige ich schon seit zehn Minuten den steilen Bergweg aufwärts, der Atem geht schwer, ich sollte halt mehr für meine Fitness tun. Die schwarze, laubbedeckte Erde weicht unter meinen Füßen zurück (zugegeben, sie ist die Klügere, aber auch ein bisschen gemein, weil sie dem Subjekt missgünstig das Steigen erschwert), dabei habe ich die schroff aufragenden weißen Riffkalke im Blick: Sagenhafte einhundertfünfzig Millionen Jahre sind diese Felsen alt – mich schaudert bei der Vorstellung der zeitlichen Abgründe. 1000 Mal 1000 Jahre kann man sich nicht gut vorstellen, noch weniger alles mit 150 multipliziert. Ehemaliger Meeresboden, in halben Ewigkeiten abgelagert von Schalentieren und Foraminiferen, dann emporgehoben weit über das ursprüngliche Niveau hinaus.
Ich schwitze und schnaufe und fühle mich dennoch in bester Laune. Oben angekommen stelle ich fest: Kein Wegweiser! Ringsum Stangenwald, eine Pflanzung Fichten, ordentlich angereiht! – Wanderstäbe für Riesen, witzele ich vor mich hin; langweilige, vom Menschen geordnete Natur. Die Bäume haben oben grüne Wipfel, aber unten nur dürre Äste, der Boden ist übersäuert und das Bodenleben ist abgestorben. Was habe ich auch erwartet.
Im lichtarmen Inneren zwischen den Bäumen wächst fast nichts, nur ein Ameisenhaufen am Wegrand fällt mir auf. Waldameisen brauchen die Nadeln für den Nestbau, im Laubwald finden sich darum keine. Geschätzt gibt es 2,5 Millionen Mal mehr Ameisen als Menschen. Die Biomasse aller Ameisen entspricht rund 20% der Biomasse der Menschen.
Die Fichte war beliebt bei Förstern und bei Waldbesitzern, weil sie schnell und so schön gerade wächst, doch die Anfälligkeit für den Borkenkäfer und niedrige Grundwasserstände bedeuten für die flachwurzelnde, kälteliebende Nordländerin in Zeiten des Klimawandels das Aus. 2022 betraf das geschlagene Schadholz zu 99% die Fichte, die ein Viertel der Waldfläche Deutschland einnimmt, andere Nadelhölzer stellen 30%, der Rest entfällt auf Laubbäume, aber auch die zeigen Belastungssymptome.
Gibt es für den Wald noch Hoffnung? Je stärker sich die Baumarten eines gemischten Waldbestandes in ihren funktionalen und hydraulischen Eigenschaften unterscheiden, sagt Christian Ammer, der an der Universität Göttingen Waldbau und Waldökonomie lehrt, um so eher kommt es zu einer komplementären Wassernutzung; verschiedene Bäume hätten unterschiedliche Fähigkeiten, Wasser aus tieferen Bodenschichten zu holen und so die Möglichkeit, ihren Wasserverbrauch flexibel anzupassen.