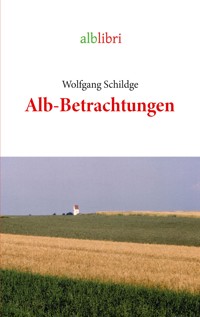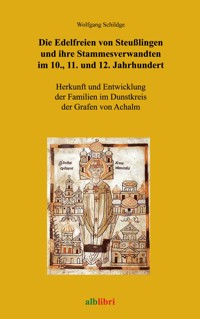
Die Edelfreien von Steußlingen und ihre Stammesverwandten im 10., 11. und 12. Jahrhundert E-Book
Wolfgang Schildge
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Zunächst war das Interesse an einem Geschlecht, dessen Ableger im 13. Jahrhundert in Marktgeschehen und städtische Entwicklung investierte, in Verbundenheit mit dem gewählten Wohnort zu verstehen und daher ein Lokales, schnell reichte dabei der Blick über das enge Umfeld hinaus und zurück in die turbulente Zeit der Anfänge. Der Hintergrund: In den ersten Jahrzehnten zu Beginn des 12. Jahrhunderts klangen die schweren Verwerfungen, die der Kampf um das Primat von König oder Papst besonders in Schwaben verursacht hatte, langsam ab; erst 1122 fanden die gegensätzlichen Auffassungen im Wormser Konkordat ihren Ausgleich. Die verödeten und verwüsteten Landstriche begannen sich zu erholen, die Bevölkerung wuchs, nun wurden Waldgebiete gerodet und Sümpfe trockengelegt, Siedlungen entstanden in großer Zahl. Die Ausstattung des Gründervaters Walter war im 11. Jahrhundert durchaus gut. Doch Erbteilungen, ein unseliger Brauch, der immer wieder gegen jede Vernunft vollzogen wurde, Schenkungen an Zwiefalten und andere Klöster, die Ausstattung von Töchtern und ein standesgemäßes Leben schwächten schon in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts die wirtschaftliche Basis des Steußlinger Zweigs. Spätestens um 1200 nach einer weiteren Teilung war es dann soweit, dass man nicht mehr vom Zins leben konnte und das Kapital angreifen musste, mit anderen Worten: Nach Verpfänden und Verschulden folgte dann nach Agonie der Zusammenbruch. Klüger verhielt sich der Gundelfinger Zweig, doch nach einer kapitalverzehrenden Stadtgründung folgte schablonenhaft der Niedergang seiner Nachkommen. Die hier vorliegende Untersuchung war vor längeren Jahren zu Stande gekommen, unter anderem als Basis des Romans "Jahrhundertsturm", einer Familiengeschichte zur Zeit der Ungarnstürme im 10. Jahrhundert, der in Kürze in neuer Auflage wieder zur Verfügung steht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 172
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Familie Steußlingen und ihre Stammesverwandten – eine Spurensuche
Über die Herkunft der Steußlinger und ihrer stammesverwandten Zweige Gundelfingen, Justingen, Schelklingen und wohl auch Heiligenberg ist nur wenig bekannt. Gemutmaßt wird, dass sie Abkömmlinge der Bertholde und damit Abkömmlinge der alten Alemannenherzöge seien. Die in den Jahren nach 1550 verfasste Zimmersche Chronik bringt sie mit den „alten, rechten Herzögen von Bayern“, den Agilolfingern, in Verbindung. Wie viel Wahrheit steckt im Erinnerungswissen des Chronisten, der die Ereignisse immerhin 500 Jahre später zu Pergament brachte? Es ist der Versuch eines Anschlusses dieser Familie an die großen Geschlechter Schwabens des 10., 11. und 12. Jahrhunderts, wobei dies im Bewusstsein geschieht, dass ein abschließendes, widerspruchsfreies Bild nicht zu gewinnen ist.
Bei der Erforschung der frühen Geschichte gerät man stets in Gefahr, genealogische Beziehungen festzustellen, wo Indizien eigentlich nur die Möglichkeit solcher Verbindungen andeuten. Denn eine präzise Filiation ist leider häufig auf Grund der dürftigen Quellenlage im genannten Zeitraum und besonders auf Grund der anfänglich vorherrschenden Einnamigkeit schlichtweg nicht möglich. Erst Ende des 11. Jahrhunderts lichtet sich der Nebel etwas mit der Benennung nach Burgen oder festen Plätzen. Leitnamen können dabei den Grad der Wahrscheinlichkeit steigern, genealogische Verbindungen plausibel zu machen, besonders, wenn es sich um seltene Namen handelt. Darüber hinaus versucht die Forschung mittels der Besitzgeschichte Lücken im Puzzle zu schließen, denn Besitz am gleichengleichen Ort kann als Indiz für verwandtschaftliche Nähe hinzutreten. Ungestörte Vererbung ist jedoch angesichts der Schwäche der Zentralgewalt, der politischen Konflikte im 10. und 11. Jahrhundert und komplizierten Rechtslagen nicht zu erwarten.
Inhaltsverzeichnis
Frühe Ereignisse: Das 10. Jahrhundert
Von den Ottonen zum Jahrhundert der Salier
Steußlingen, Nebenzweig eines gräflichen Geschlechts?
Anfangs des 12. Jahrhunderts: Von der zweiten zur dritten Generation. – Die ersten Staufer
I. Die Söhne und Töchter Ottos I. von Steußlingen
1.1. Adalbert d.Ä. von Steußlingen
1.2. Swigger von Gundelfingen
1.3. Eberhard von Justingen
1.4. Otto von Grötzingen
1.5. Ernst von Oberstetten, ein weiterer Sohn Ottos I.?
1.6. N.N. von Steußlingen
1.7. N.N. von Steußlingen aus der Familie Sperberseck?
II. Kuno von Steußlingen
III. Rudolf (?) von Frickingen
IV. Haymo/Heinrich von Steußlingen
Das 12. Jahrhundert – Steußlingen zwischen Staufern und Welfen
Gundelfingen in der 3. und 4. Generation Mitte des 12. Jahrhunderts – Das Hirschbühler Erbe
Die Großfamilie – Hinwendung zu den Staufern
Zeittafel
Überblick
Frühe Ereignisse: Das 10. Jahrhundert
Es war eine bewegte, stürmische Zeit. 911 starb mit Ludwig dem Kind der letzte ostfränkische Karolinger. Die Teilung in Ost und West war bereits seit 888 vollzogen, adlige Machtkonzentrationen hatten im Laufe des 9. Jahrhunderts die Königsmacht erodiert. Die Könige vergaben daher in wachsendem Umfang Hoheitsrechte und Herrscherpositionen an Bistümer, um sie durch Übertragung an die Kirchen dem Adel zu entziehen. Vor dem Hintergrund des Lehnswesens hatte diese Praxis entscheidende Vorteile: Waren die weltlichen Vasallen stets bemüht, ihr Lehen in erbliches Eigengut umzuwandeln, so stellte sich bei Bischöfen und Äbten infolge des Zölibats die Frage der Erbschaft nicht, zudem gewannen die Herrscher Einfluss auf die Kandidatenkür. Dass den führenden Adelsfamilien Schranken ihres Expansionsstrebens ein Dorn im Auge sein musste, kann man sich vorstellen.
All diese Konflikte um Einfluss, Selbstbehauptung und Macht konzentrierten sich im Ostfränkischen Reich in einem Prozess, der zur Entstehung der Stammesherzogtümer führte, in Schwaben kamen die Kämpfe der einflussreichsten Adelsfamilien um das Stammesherzogtum allerdings erst unter König Konrad I. (911-918) zum Ausbruch, und dies in einer Zeit regelmäßiger Einfälle der räuberischen Ungarn, bei deren Beutezügen Kirchen und Klöster in besonderem Maße heimgesucht wurden.
Zwei Familien, von denen sich eine auf das Markgrafenamt in Rätien stützte, die andere auf das Pfalzgrafenamt, strebten nach dem Herzogtum und damit quasi in eine vizekönigliche Stellung, heftig bekämpft vom Kanzler des Königs, Bischof Salomon von Konstanz. Das ostfränkische Episcopat stemmte sich also im Bündnis mit dem König einer Entwicklung aufs schärfste entgegen, die zur Folge hatte, dass Königsgut in Adelshand fiel und Kirchengut von Herzögen eingezogen wurde.
Aber was muss man sich in dieser Zeit unter dem Aufleben eines Herzogtums Schwaben und seiner räumlichen Ausdehnung vorstellen? Unter der Bezeichnung ducatus allamanniae hatte dieses Schwaben bereits zu Zeiten der Karolinger die Räume Alemannien, Rätien und wechselnd das Elsass umfasst, im letzten Drittel des 10. Jahrhunderts ist sogar von einem ducatus alsaciensis die Rede, also von einer eigenen politischen Einheit, was wir für unseren Diskurs im Auge behalten wollen.
Im Norden grenzte die Alemannia in Höhe von Stuttgart und Ellwangen an Franken, im Osten an den Lech und den Raum Augsburg, im Süden verlief die Grenze auf der Höhe von Chur, im Südwesten innerhalb des Aarebogens gegen Burgund und nördlich davon gegen den Oberrhein. Die Orthenau und das Elsass nahmen wohl eine Sonderstellung ein.
Wenn man die wichtigen Orte in den Blick nimmt, so sind zunächst die Bischofssitze Konstanz mittig und Augsburg in Randlage zu nennen, Straßburg dann um die Jahrtausendwende, ferner die Reichsabteien Reichenau im Bodensee und St. Gallen im Thurgau. Zentrale weltliche Orte waren der in der Entstehungszeit des Herzogtums genannte Herzogensitz Hohentwiel, die Münzstetten Zürich, Breisach und Esslingen, aber auch die auf Ludwig den Deutschen zurückgehende Königspfalz Ulm, die nach 1000 als Vorort des Herzogs von Schwaben genannt wird, so 1027 als Schauplatz der Unterwerfung des aufständischen Herzogs Ernst II. Hier wird deutlich, dass die Vergabe der Herzogswürde durch den König nur unter Zustimmung der einflussreichsten Adelsfamilien zustande kommen konnte, wenn sie einen der ihren als primus inter pares akzeptierten.
Von alters her verfügte die Bertholdsippe über großen Einfluss und umfangreichen Besitz in der Baar. Die Begriffe „Baar“ und insbesondere „Gau“ sind als Grundwörter frühmittelalterlicher Raumnamen verbreitet, die meist fruchtbare Ebenen von Höhenzügen abgrenzten, etwa „Bertholdsbaar“ oder „Eritgau“. Ob sie in früher Zeit Verwaltungscharakter hatten, ist in der Forschung umstritten. Die Bertholdsbaar oder Westbaar umfasste die heutige Landschaft Baar um Donaueschingen und vor Schwarzwald, die für uns besonders interessante Ost- oder Folcholtsbaar reichte etwa von der Linie Lauchert bis Ulm und umfasste dabei die Donaulanden und die Alb.
Nun gibt es in unserer Gegend weitere Raumbezeichnungen, die jeweils mit Orten namens Hundersingen korrespondieren, nämlich die Goldineshuntare um Heuneburg und Hundersingen an der Donau, die für Münsingen namensgebende Munigiseshuntare um Münsingen, die Munterichshuntare um Munderkingen mit dem südlich gelegenen Hundersingen sowie die Swerzenhuntare um Gundelfingen und Hundersingen an der Lauter bis hin zu Steußlingen.
Eine These geht dahin, dass es sich bei diesen Einrichtungen um eine fränkisch initiierte Militärkolonisation in Neusiedelland handelte, wobei die Kolonisten, wenn man den Namen Huntare (bzw. gleichbedeutend Centena) heranziehen darf, vielleicht in Hundertschaften siedelten und dies in auffälliger Nähe zu Höhen, die sich von jeher zu Fluchtburgen eigneten. Der Huntaris des 7. Jahrhunderts wäre dann eine Person, die Huntari des 8. Jahrhunderts ein Herrschaftsbezirk. Wie dem auch sei: Ein Zusammenhang zwischen Personennamen und Raumbezeichnung ist offensichtlich. Im Lautertal ist beispielgebend festzustellen, dass sich mit Ausnahme Hundersingens von Dapfen bis zur Lautermündung kein einziger alter Ort befindet, so dass Hundersingen und der sich der als Fluchtpunkt anbietende Umlaufberg bei Gundelfingen in siedlungsgeschichtlicher Sicht wohl aufeinander bezogen sind. Gundelfingen ist wegen seiner kleinen Markung als hochmittelalterlicher Burgweiler aufzufassen, während das zwei km entfernte Hundersingen wie Hayingen in die Landnahmezeit des 6./7. Jahrhunderts fällt.
Der Gesamtraum der Baaren zeigt in den Quellen differenzierte Landstriche. In der heutige Baar findet man die Bezeichnung „Fildira“, wohl wegen ihrer fruchtbaren Felder, im Westen „Scherra“ nach den Felsen der Balinger Alb, dann die Landschaft „Appha“ um Riedlingen und die Alb sowie „Swerzza“ zwischen Hayingen und den Lutherischen Bergen, vielleicht von der Gemeinde Schwörzkirch abgeleitet oder von schwarzem Boden. Die altertümlichen Landstrichnamen, zunächst ohne jeden rechtlichen Auftrag, deuten an, dass die Gesamtbaar einst ein Einheit war, weil im Osten wie im Westen die Bertholde als einflussreichste Grundherren erscheinen.
Nach 800 hören wir nun im Raum der Ostbaar erstmals von drei Grafschaften, die man sich in den Landschaften Appha um Riedlingen, den Eritgau um Ertingen und Swerzza zwischen Hayingen und Altsteußlingen vorstellen muss. Was war geschehen? Nach dem letzten alemannischen Aufstand gegen die Frankenherrschaft hatten die fränkischen Hausmeier 746 in Cannstatt die Strukturen des alemannischen Adels zerschlagen, die bisherigen Herrschaftsbereiche aufgelöst und das Hausgut des Herzogs in Kronbesitz überführt. Damit hatte sich natürlich auch das alemannische Herzogtum erledigt. Nun ging man daran, nach und nach und mit großer Verzögerung die fränkische Grafschaftsverfassung einzuführen. Mehr oder wenig unbehelligt blieben bei diesem „Reinemachen“ einzelne Familien aus dem alemannischen Hochadel, so auch jene oben erwähnte Familie, die ihren Einfluss in den Baaren mit dem Erwerb des Grafenamtes hatte sichern können und die wegen des häuftig vergebenen Namens „Berthold“ in der Forschung als Bertholdinger bzw. Bertholde in Erscheinung treten. Wenn man davon ausgeht, dass es in der großen Ostbaar eine Reihe allodialer Herrschaften gab, von denen die der Bertholde die umfangreichste war und dass sie deshalb eine Art Vorherrschaft im Verband ausübten, dann könnte die Herrschaft Steußlingen, wenn man die Möglichkeit von Verwandtschaft zu den Bertholden und denen von Achalm mal beiseite lässt, von sehr hohem Alter gewesen sein.
Um 840 bemächtigten sich die Bertholde sämtlicher Grafschaften in der Ostbaar, verloren aber ihre Positionen in der Westbaar, doch nicht ihren Allodialbesitz. Zusätzlich konnte sie das Pfalzgrafenamt erwerben. Da sich im Zuge der Untersuchung erweist, dass die Bertholdsippe im 10. Jahrhundert über weitverstreuten anderweitigen Besitz und Ämter verfügte, wird klar, weshalb sie damals in der schwäbischen Geschichte eine so große Rolle spielte.
915 ließ sich in Zeiten großer Ungarnnot der Pfalzgraf Erchanger aus der mächtigen Bertholdsippe ohne Einverständnis Königs Konrads zum Herzog ausrufen. Große Zerwürfnisse regierten das Land, der König, verstrickt in Händel mit dem Adel, bündelte nicht die Kräfte, es schien, als sei ein Kampf aller gegen alle ausgebrochen, während die Feinde immer wieder einfielen. Die Krise der Königsmacht und das problematische Verhältnis zu den führenden Adelsfamilien wurde zusätzlich belastet durch die Haltung des Episkopats, der sich aufs Schärfste als Gegner der Machtkonzentration in Adelshand positionierte. Nicht erst seit den Ottonen hatten die Herrscher begonnen, der Reichskirche große Teile des Königsguts zu überlassen, weil ihnen die Einbindung der kirchlichen Amtsträger in die Reichsangelegenheiten weiterhin den rechtlichen Zugriff auf die als Lehen ausgegebenen Güter sicherte, faktisch lief die Kirche aber stets Gefahr, sie im Laufe der Zeit ganz an dreiste und gewalttätige Lehnsnehmer aus dem Adel zu verlieren. So wundert es nicht, dass der Konflikt zwischen Erchanger und Bischof Salomon von Konstanz eskalierte, als Erchanger den Bischof auf der Diepoldsburg über dem Lenninger Tal gefangen setzte. Bischof Salomon und Konkurrenten Erchangers trieben den König schließlich in so tiefe Gegnerschaft, dass er Erchanger und Berthold entgegen Gerichtsbeschluss enthaupten ließ. König Konrad war mit deren Schwester Kunigunde verheiratet.
Konstanz zur Zeit Bischof Salomons
Mit der klugen Politik König Heinrichs, des ersten Ottonen, änderten sich die Dinge zum Positiven, nicht nur die Abwehr der Ungarn betreffend. Zunächst ging die Herzogswürde an Burchard I. aus dem Haus der rätischen Burchardinger über, nach dessen Tod 926 an Hermann aus dem Haus der Konradiner. Die Beherrschung Schwabens war wichtig geworden für die Stärkung der Königsmacht, der Besitz der Bündnerpässe Schlüssel für die Italienpolitik König Heinrichs und der späteren Kaiser. Schwaben wurde bis zum Ende der Staufer zu einem Kernland des Reiches. Otto der Große übertrug 950 das Herzogtum Schwaben seinem Sohn Liudolf, danach Burchard II., dessen Ehe mit Hadwig, bekannt aus Scheffels Roman „Ekkehard“, kinderlos blieb, anschließend Liudolfs Sohn Otto.
982 eröffnet sich für Kaiser Otto II. nach Herzog Ottos Tod großer Handlungsspielraum. Er entschied sich für den Konradiner Konrad aus dem eberhardingischen Zweig des Hauses, dessen Nachkommen ihre Spuren in den Geschlechtern unserer Region hinterlassen haben. Seit langen Jahren führt die Forschungsgemeinschaft teils mit harten Bandagen eine Diskussion um den illustren Kuno von Öhningen, dessen Gleichsetzung mit dem Schwabenherzog Konrad inzwischen einhellig akzeptiert ist.
973 war Berthold von Marchtal, der letzte aus der Sippe der Bertholde, der Sohn des Adalbert von Marchtal und Enkel jenes enthaupteten Bertholds verstorben. Danach erscheint Hermannn II., Sohn des Schwabenherzogs Kuno von Öhningen und 997 Nachfolger im Herzogsamt, als Inhaber der Herrschaft Marchtal, und zwar per „successionem“, wie der Marchtaler Chronist aus einem „sehr alten Büchlein“ vermerkt. In der Forschung wird dies häufig so verstanden, dass kein üblicher Erbgang vorlag, weil ansonsten der Begriff „hereditas“ verwendet worden wäre. Wenn die Ereignisse aber, was wahrscheinlich ist, mit gehörigem zeitlichen Abstand, also nach 997 niedergeschrieben wurden, dann wusste man halt, dass Hermann II. Herzog war und 973 auf den ehrenhalber als Herzog bezeichneten Berthold folgte. Im Kern geht es um die Frage, wer die Mutter Hermanns II. und Gattin Kunos von Öhningen war: Die in der Welfenhistorie und im Reichenauer Nekrolog genannt Richlind, die Tochter der Kaiserin Adelheit, oder Jutta/Judith, Tochter Adalberts von Marchtal.
Im 10. Jahrhundert erscheinen im Ufgau und der Orthenau Grafen der Abfolge Gebhard, Kuno, Kuno. Vermehrt Zuspruch bekommt die von Jackman/Fried vertretene Lösung, dass es sich eigentlich um drei Träger des Namens Kuno handelt, wobei der erste Kuno als Herzog vom Elsass aufzufassen wäre, der – von der Lebenszeit her – besser zu einer Tochter Adalberts von Marchtal passte, womit auch erklärt wäre, dass Kuno von Öhningen, der Sohn des vermuteten elsässischen Herzogs, 983 erstmals als Herzog von Schwaben und des Elsass in der Überlieferung genannt wird. Dass Walter von Steußlingen und seine Gattin Engela um die Jahrtausendwende ebenso wie Hermann II. in einem ehemaligen Kerngebiet der Bertholdsippe erscheinen, sollte nachdenklich machen; auch gibt es kaum eine andere Möglichkeit als die vermutete Verwandschaft über Richlind, um Namen wie Heinrich und besonders Otto in der ersten Steußlinger Generation plausibel zu machen. Wenn Jutta/Judith die Großmutter Hermanns II. war, erklärt dies zwanglos, wie Hermann und seine Gattin Gerberga, die Tochter König Konrads von Burgund, 973 in den Besitz der Herrschaft Marchtal kamen. Kuno, der Sohn Kunos von Öhningen und vermutete Vater der Engela von Steußlingen, Bruder Hermanns II., hätte dann aber ebenso Anteil am Erbe seiner Großmutter gehabt.
Bertholds Vater Adalbert von Marchtal war 954 im Kampf gegen den Pfalzgrafen Arnulf von Bayern bei Schwabmünchen gefallen. Er gehörte zu Zeiten der Opposition Schwabens gegen Otto I. neben den Hupaldingern (den späteren Dillingern) zu den wenigen, die zum König hielten. Der Sohn des verdienten Anhängers des Königs und andere königliche Parteigänger konnten daher ihren Besitz im Illergau aus der Gütermasse des Königssohns Liudolf erheblich mehren. Nach Mang gehörten dazu wichtige Orte wie Kellmünz, Dettingen, Kirchberg a.d. Iller, Bonlanden. Somit wurde nach dem Jahre 954 der bis dahin zusammenhängende Güterkomplex Illertissen-Kellmünz-Babenhausen-Kettershausen bzw. einige seiner Bestandteile als Konfiskationsgut an königliche Parteigänger für deren Verdienste und Treue verteilt (Dss. Thomas Reich, Kellmünz und Illertissen). Die Erbtochter Bertholds von Marchtal brachte über den Vater Kunos von Öhningen (den mutmaßlichen Herzog Kuno vom Elsass, verheiratet mit Judith von Marchtal) dessen umfangreiche Besitzungen, darunter den Stammsitz Kellmünz, an Herzog Hermann II. von Schwaben, den Sohn Kunos von Öhningen. Später wird sich erweisen, dass der Name Steußlingen häufig mit dem Illergau in Verbindung gebracht wird.
Nach der Jahrtausendwende: Von den Ottonen zum Jahrhundert der Salier (1024-1125)
Das beginnende 11. Jahrhundert brachte bedeutende Umwälzungen. Die gesellschaftliche Mobilität nahm zu, mit großer Dynamik formierte sich das Bürgertum, das Prinzip der Arbeitsteilung steigerte die Effizienz der Versorgung mit Gütern und deren Verteilung über Märkte, Städte wuchsen mit bisher nicht bekanntem Tempo. Die Stände bezogen nun ihr Selbstbewusstsein zunehmend von ihrer Funktion her. Das verschaffte dem Klerus, der das Seelenheil zu vermitteln hatte, einen mächtigen Autoritätsschub.
Der Hochadel begann Mitte des Jahrhunderts mit Burgbauten und Klostergründungen territoriale Mittelpunkte zu schaffen, unter salischer Herrschaft blühten Kunst und Kultur, sichtbar in Dombauten wie die von Speyer und Worms, auch Angehörige der Familie Steußlingen sind wohl durch verwandtschaftliche Nähe zum Königshaus begünstigt worden und in einflussreiche Stellungen gekommen. Andererseits erfasste das Verhängnis, das unter Heinrich IV. im Investiturstreit über das Reich kam, Schwaben schwer, weil dort die geistigen Strömungen und politischen Interessen besonders stark aufeinander trafen.
Der Investiturstreit war der Höhepunkt eines politischen Konfliktes zwischen geistlicher und weltlicher Macht um die Amtseinsetzung von Geistlichen (Investitur) durch die weltliche Macht. Als Zeit des Investiturstreites gelten die Jahre ab 1076 (Hoftag in Worms) bis zur Kompromisslösung des Wormser Konkordates im Jahre 1122. Die kirchliche Reformbewegung, von Heinrich III. zunächst in bester Absicht gefördert, auch um das Papstamt dem Einfluss des römischen Stadtadels zu entziehen, sah spätestens seit der Wahl Papst Gregors in der Simonie – dem Kauf oder Verkauf kirchlicher Ämter und Pfründen – das Grundübel der Zeit. Letztlich ging es um die Frage, wer Vorrang haben sollte: die weltliche Macht des Königs oder die geistliche des Bischofs von Rom.
Königsdom zu Speyer
Mit Walter von Steußlingen und seiner Gattin Engla treffen wir am Anfang des 11. Jahrhunderts erstmals eine Familie in der Ostbaar an, die sich bisher einer gesicherten Zuordnung entzogen hat. Walter war der Vater der Erzbischöfe Anno von Köln (1056-1075) und Werner von Magdeburg (1063-1078), außerdem Großvater der Bischöfe Burchard von Halberstadt (1063-1088) und Kuno von Trier (1066 ermordet). Annos Bruder Walter wird von Erzbischof Siegewin, dem Nachfolger Annos, als „miles meus“ bezeichnet. Seine Schwester Engela und sein Bruder Adalbero gründen Familien nördlich des Harzes. Annos Bruder Haymo (friesische Kurzform für Heinrich) erscheint neben anderen Familienmitgliedern im Totenbuch des von Anno gegründeten Klosters Andreas zu Grafschaft im Sauerland, der Bruder seiner Mutter Engela, Haymo, in Annos Stiftung Mariengraden (Haymo prepositus huius ecclesiae avunculus beati Annonis archeepiscopi). Neben Otto, der als Stammvater der Steußlinger, Gundelfinger und Justinger gilt, ist ein Bruder namens Kuno erwähnt (A.Uhrle). Später wird zu prüfen sein, ob weitere Kinder wahrscheinlich gemacht werden können.
Walters Gattin Engela, begraben im Magdeburger Dom, hatte also einen Bruder Haymo, Kanoniker im 1007 von Heinrich II. gegründeten Bistum Bamberg und auch Propst an Maria ad Gradus in Köln. Von ihm wird berichtet, dass er Anno ohne Einwilligung der Eltern nach Bamberg geholt habe, um ihn in der Stiftskirche St. Stephan ausbilden zu lassen.
Als 20jähriger ging Anno zum Studium nach Paderborn, um schon zwei Jahre später von Bischof Suitger (dem späteren Papst Clemens II.) als Leiter der Domschule und wissenschaftlicher Ratgeber eingesetzt zu werden. Dort, wo nur Söhne des Hochadels ihre Ausbildung erhielten, wirkte er 15 Jahre als deren Lehrer. 1054 berief ihn Kaiser Heinrich III. zum Propst des Reichsstifts St. Simon und Juda in der Kaiserpfalz Goslar und nahm ihn in seine Hofkapelle auf. Doch schon zwei Jahre später berief ihn der Kaiser gegen den Willen der Kölner zum Erzbischof des bedeutendsten Bistums Köln. Er kann also unmöglich als „homo novus“ betrachtet werden. Nur wer zu den edelsten Geschlechtern Schwabens zählte, über Rang und Namen verfügte und über (verwandtschaftliche) Beziehungen zum Königshaus, konnte in diese Stellungen gelangen.
Das Urteil über ihn wird in der Forschung einseitig von Lambert von Hersfeld und insbesondere von Adam von Bremen bestimmt, dessen Bericht aus dem Amtsbereich des größten Nebenbuhlers um die höchste Stellung im Reich, Adalberts von Bremen, stammte; daher wird meist Annos angebliche bescheidene Herkunft betont, dessen Nepotismus in der Zeit der Vormundschaftsregierung für den jungen Heinrich IV. seinen Bruder Werner und Neffen Kuno und Burchard in hohe kirchliche Ämter gebracht hätte. Dagegen urteilt die „Gesta archiepiscoporum Magdeburgensium“, Anno und sein Bruder Werner seien uterque oriundus ex alto sanguine Suevorum. Annos Neffe Burchard von Halberstadt erreicht sein Hochstift zudem vor Annos Staatsstreich im Jahr 1062. Die Miracula „S.Annonis“ (12.Jh.) weiß von Anno und seiner Mutter zu sagen: Erat in regione Saxonum celebre tum Annonis nomen et meritum, nam et genus inde duxerat maternum. Die sich andeutende Verwandtschaft zum Königshaus würde also über Engela, die Stammmutter der Steußlinger führen. Sie müsste eine Tochter des 1004 zuletzt im Ufgau erwähnten Sohns Kunos von Öhningen sein, an dessen Erbmasse später die Steußlingen und ihre Verwandten am Bodensee beteiligt zu sein scheinen; Richlind, die angenommene Gattin des Schwabenherzogs Konrad und Enkelin Ottos des Großen wäre ihre Großmutter.
Die Steußlinger Namen Otto, Heimo (Heinrich), Hazecha und Engela (die Mutter des Bischofs Burchard von Halberstadt) finden wir bei Nachkommen des ottonischen Hauses; Werner, Burchard und Jutta/ Judith sind im Öhninger Sippenkreis nicht fremd. Mit Adalbero von Steußlingen konnte ein ganzer Zweig im östlichen Ausläufer des Harzes als spätere Grafen von Arnstein Fuß fassen, was voraussetzt, dass die Familie dort begütert war und was bei den Nachkommen Ottos des Großen nicht verwundern würde. Annos Nichte und Tochter Adalberos von Steußlingen/Arnstein, Äbtissin von St. Cäcilien in Köln, trug den Namen Jutta/Judith, und Werner, ein Enkel Adalberos, war 60 Jahre nach Annos Tod von 1132-1151 Bischof von Münster. Dass Walter von Steußlingen Vater einer großen Kinderschar war, erklärt u.a. Annos Bemühen, seinen Angehörigen kirchliche Ämter zu verschaffen.