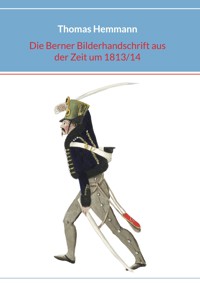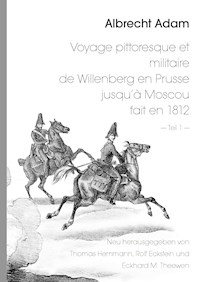
Albrecht Adam - Voyage pittoresque et militaire de Willenberg en Prusse jusqu’à Moscou fait en 1812 - Teil 1 - E-Book
Thomas Hemmann
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Große Armee ist 1812 in Russland nicht erst beim Rückzug in Frost und Schnee zugrunde gegangen, sondern verlor bereits beim Vormarsch nach Moskau einen Großteil ihres Bestandes durch Gefechte, schwierige Witterungsbedingungen, den allgegenwärtigen Mangel an Trinkwasser, Proviant und Pferdefutter sowie die dadurch hervorgerufenen Krankheiten. Kein bildender Künstler hat dies so umfangreich und detailliert dargestellt wie Albrecht Adam. Seine hier erstmals vollständig neu herausgegebene lithografische Serie „Voyage pittoresque et militaire de Willenberg en Prusse jusqu’à Moscou fait en 1812“ zeigt auf rund 100 Tafeln die Große Armee (vor allem die Italiener und Bayern unter Vizekönig Eugène) im Kampf, auf dem Marsch und im Biwak. Neben dem kompletten Nachdruck der Adam’schen Serie inklusive vieler Detailaufnahmen) sowie ihres offiziellen Begleittextes werden im Rahmen einer umfassenden Analyse zu allen Tafeln Hintergrundinformationen zusammengetragen. Der offizielle Begleittext zu den Adam’schen Tafeln, biographische Informationen, eine Übersicht zum Russlandfeldzug 1812 und zur Entstehung der Lithografienserie, Kartenmaterial so wie eine Orde de Bataille des von Eugène geführten Armeeverbandes ergänzen diese Edition.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Préface
Einleitung
Zum „Schlachtenmaler“ Albrecht Adam
Zum Verständnis des Feldzugs 1812
Zur Armee des Königreichs Italien
Bemerkungen zur „Voyage pittoresque“
Zu den Subskribenten von Adams Bilderserie
Über vergleichbare zeitgenössische Bilderserien zum Feldzug 1812
Voyage pittoresque et militaire de Willenberg en Prusse jusqu’à Moscou fait en 1812, pris sur le terrain même et lithographié par Albert Adam
Analyse
I. Titre avec portrait de l‘artiste – Titelblatt mit Porträt des Künstlers
II. Portrait de Napoléon - Porträt Napoleons
III. Portrait d’Eugène - Porträt des Prinzen Eugène
IV. Portrait de Murat - Porträt Murats
1. Willenberg, Quartier-général – Haupt-Quartier Willenberg (10. Juni)
2. Bivac des dragones de la garde italienne prés de Willenberg – Dragoner der italienischen Garde im Bivac bey Willenberg (10. Juni)
3. Sensbourg, Quartier-général – Haupt-Quartier Sensburg (13. Juni)
4. Quartier-général du Vice-Roi d‘Italie à Rastenbourg – Haupt-Quartier Rastenburg (14. Juni)
5. À Kalvary – Zu Kalvary (24. Juni)
6. Bivac des gardes d‘honneur italienne prés de Marienpol – Biwak der Italienischen Ehren-Garde bey Marienpol (26. Juni)
7. Garde d‘honneur italienne à Michalsky – Italienische [Ehren-] Garden zu Michalsky (27. Juni)
8. Jachimitzki - Jachimitzki (28. Juni)
9. En avant de Pilony près du Niemen - Vor Pilony am Niemen (29. Juni)
10. Episode au bivac de Pilony – Episode aus dem Bivac zu Pilony (29. Juni)
11. Quartier-général du Vice-Roi à Pilony sur le Niemen – Haupt-Quartier des Vicekönigs zu Pilony am Niemen (30. Juni)
12. Au Bord du Niemen – Am Ufer des Niemen (30. Juni)
13. Passage du Niemen à Pilony - Uebergang über den Niemen bey Pilony (30. Juni)
14. Marche du 4me Corps d’armée sur la route de Pilony à Kroni – Anmarsch des 4ten Armee-Corps auf der Strasse von Pilony nach Krony (1. Juli)
15. Kroni, Quartier-général du Vice-Roi d’Italie – Haupt-Quartier [des Vice-Königs von Italien] zu Kroni (1. Juli)
16. À Riconti près de Wilna - Zu Riconti in der Nähe von Wilna (3. Juli)
17. Garde impériale près de Wilna – Kaiserliche Garde bey Wilna (3. Juli)
18. Convoi des bestiaux pris par réquisition (Juillet) – Transport einer Viehherde (Juli)
19. Trokiy, Quartier-général - Haupt-Quartier Trokiy (4. Juli)
20. Bivac du Vice-Roi d‘Italie, dans la nuit, à Wielkie-Soleizniki – Biwac des Vice-Königs von Italien in der Nacht bey Wielke-Solezniki (8./9. Juli)
21. Ancienne cour du château Holzany, Quartier-général du Vice-Roi – Hof des alten Schlosses Holzany, Hauptquartier des Vice-Königs (11. Juli)
22. Marche de la division Pino – Marsch der Division Pino (16. Juli)
23. Étude du soldats français (Juillet) – Studium von französischen Soldaten (Juli)
24. À Dokzice – Zu Dokzice (18. Juli)
25. Convoi d‘ambulances en avant de Dokzice – Geleit eines Feldlazareths vor Dokzice (20. Juli)
26. Prisonnier de guerre russe, au Quartier-général de Kamen – Russischer Kriegs-Gefangener im Haupt-Quartier von Kamen (21. Juli)
27. À Bechenkovitschi – Zu Bezenkovitschi (24. Juli)
28. Études de chevaux au bivac (Juillet) – Pferde-Studien im Bivac (Juli)
29. Episode sur le passage de la Dwina près de Bezenkowitschi –Uebergang über die Dwina bey Bezenkowitschi (24. Juli)
30. Passage de la Dwina à Bechenchovitski – Uebergang über die Dwina [Düna] zu Bezenkovitschi (24. Juli)
31. Napoléon accompagné de quatre régiments de cavalerie Bavaroise va reconnaître la rive droite de la Dwuina – Napoleon rekognoscirt mit vier bayerischen Kavallerie-Regimentern das rechte Dwina-Ufer [Düna] (24. Juli)
32. Sur la route de Bechenkowitschi à Ostrowno – Auf der Strasse von Bechenkowitschi nach Ostrowno (25. Juli)
33. En avant de Bezenkovitschi – Vor Bezenkovitschi (25. Juli)
34. Combat d‘Ostrowno – Gefecht bey Ostrowno (25. Juli)
35. Transport de prisonniers de guerre Russes – Transport russischer Kriegsgefangener (25. Juli)
36. Combat d‘Ostrowno, le matin – Gefecht bey Ostrowno, am Morgen (26. Juli)
37. Combat d‘Ostrowno, à midi – Treffen zu Ostrowno, Mittags (26. Juli)
38. Combat en avant d‘Ostrowno – Die Schlacht vor Ostrowno (26. Juli)
39. Arrivée de l’Empereur sur le champ de bataille d’Ostrowno – Ankunft des Kaisers auf dem Schlachtfelde von Ostrowno (26. Juli)
40. Entre Ostrowno et Witepsk sur le soir – Zwischen Ostrowno und Witepsk, Abends (26. Juli)
41. Devant Witepsk, après midi – Vor Witepsk, Nachmittags (27. Juli)
42. La Garde impériale devant Witepsk – Die kaiserliche Garde vor Witepsk (27. Juli)
43. Devant Witepsk, à midi – Um 12 Uhr vor Witepsk (27. Juli)
44. Devant Witepsk – Vor Witepsk (27. Juli)
45. Bivac sur le hauteur de Witepsk – Bivac auf der Anhöhe vor Witepsk (27. Juli)
46. Repos dans la journée – Episode [Ruhepause am Tag] (28. Juli)
47. Bivac de l‘Empereur en avant de Witepsk – Bivak des Kaisers jenseits von Witepsk (28. Juli)
48. Sur la route vers Lianvawitschi –Auf der Route nach Lianvawitschi (14. August)
49. Bivac d’artiste – Des Künstlers Bivac (16. August)
50. Bivac de Vice-Roi dans la nuit - Bivac des Vice-Königs in der Nacht (16./17. August)
51. Marche de troupes françaises, dans les environs de Smolensk – Marsch französischer Truppen in den Umgebungen von Smolensk (17. August)
52. Camp aux environs de Smolenzk – Feldlager in der Umgegend von Smolenzk (17. August)
53. Aux environs de Smolensk – In der Gegend von Smolensk (17. August)
54. Un régiment de grenadiers français faisant halte devant Smolensk – Halt eines französischen Grenadier-Regiments vor Smolensk (17. August)
55. Devant Smolensk – Vor Smolensk (18. August)
56. Smolensk – Zu Smolensk (18. August)
57. Bivac aux environs de Smolensk – Bivac in der Umgegend von Smolensk (19. August)
58. Smolensk, vu du côte du Nord – Smolensk, von der Nord-Seite, Tafeln a und b (19. August)
59. Devant Smolensk – Vor Smolensk (20 August)
60. Quartier-général à Pologhi – Haupt-Quartier zu Pologhi (24. August)
61. Le Prince Eugène aux rives de la Vopp - Prinz Eugène am Ufer der Vop (25. August)
62. Episode sur le pasage de la Vopp – Episode bey dem Uebergang über die Vop (25. August)
63. Passage du Dniéper près de Dorogobuy – Uebergang über den Dnieper [Djnepr] bey Dorogobuy [Dorogobush] (26. August)
64. Sur la route de Wjazma – Auf der Strasse nach Wiazma (20. bzw. 28. August)
65. Devant Wjazma – Vor Wiazma (28. August)
66. Marche de l‘armée dans la plaine de Wiazma – Marsch der Armee [in der Ebene von Wiazma] (28. August)
67. Aux environs de Wiazma – Aus der Umgegend von Wiazma (30. August)
68. Sur la route de Woremiero – Auf der Strasse nach Woremiero (3. September)
69. Avant la bataille de la Moscwa – Vor der Schlacht an der Moscwa [Borodino] (4. September)
70. Prés de la Moskwa, le matin – An der Moskawa, Morgens (5. September)
71. Avant la bataille de Mojaisk - Vor der Schlacht von Mojaisk (Borodino) (5. September)
72. À la bataille de la Moscwa prés de Borodino sur le soir – In der Schlacht an der Moscwa bey Borodino Abends (5. September)
73. Prés de la Moscava, le soir – An der Moscawa [Borodino], Abends (5. September)
74. Prés de Borodino – In der Nähe von Borodino (6. September)
75. Prés de Borodino – Bey Borodino (6. September)
76. Vue générale du champ de bataille de la Moscwa pris du côte de Borodino – Das Schlachtfeld an der Moskawa von Borodino aus gesehen, Tafeln a und b (6. September)
77. Bataille de la Moscawa – Die Schlacht an der Moscawa [Borodino] (7. September)
78. Prise de la grande redoute à la bataille de la Moskawa - Einnahme der grossen Redoute in der Schlacht an der Moscawa [Borodino] (7. September)
79. Sur le champ de bataille de la Moscva – Auf dem Schlachtfelde an der Moscava [Borodino] (7. September)
80. Bivac des gardes d’honneur italienne – Bivac der italienischen Garden in der Nacht (7. September)
81. Champ de bataille près de la Moscwa – Ansicht des Schlachtfeldes an der Moscava [Borodino] (8. September)
82. Sur le champ de bataille près de la Moscava – Auf dem Schlachtfelde an der Moscawa [Borodino] (8. September)
83. Champ de bataille près de la Moscwa – Schlachtfeld an der Moscawa (Moscwa / Borodino) (8. September)
84. Sur la route de Moscou, près de Borodino – An der Strasse nach Moskau bey Borodino (8. September)
85. Sur la route de Mozaik à Moscou – Auf der Strasse von Mozaik nach Moskau (9. September)
86. Vue de l‘abbaye de Zwenighorod – Ansicht der Abtey von Zwenighorod (10. September)
87. Marche des Grenadiers de la Garde impériale en avant de Mojaisk – Grenadiers der kaiserl. Garde auf dem Marsche vor Mojaisk (10. September)
88. Maraudeurs aux environs de Moscou (Septembre) – Maraudeurs in der Umgegend von Moscau (September)
89. Devant Moscou – Vor Moskau (20. bzw. 29. September)
90. L’armée française dans le camp devant Moscou – Die französische Armee im Lager vor Moskau (20. September)
91. Devant Moscou – Vor Moskau (20. September)
92. À Moscou – Zu Moscau (20. September)
93. À Moscou – Zu Moscau (22. September)
94. À Moscou – Zu Moscau (22. September)
95. Retour d‘Artiste (Octobre) – Die Rückkehr des Künstlers (Oktober)
96. Episode aux environs de Magdebourg, d‘après le tableau par C. de Heideck – Episode in der Umgebung von Magdeburg, nach einem Bild von C. v. Heideck
Die Voyage pittoresque in der Kartenansicht inklusive einer Übersicht der Lithografien und Begleittexte
Vorwort
Die Große Armee ist 1812 in Russland nicht erst beim Rückzug durch Frost und Schnee zugrunde gegangen, sondern verlor bereits beim Vormarsch nach Moskau – neben den in Kämpfen Gefallenen und Verwundeten – etwa drei Viertel ihres Bestandes durch die schwierigen Witterungsbedingungen und den allgegenwärtigen Mangel an Trinkwasser, Proviant und Pferdefutter sowie die dadurch hervorgerufenen Krankheiten. Kein bildender Künstler hat dies so umfangreich und detailliert dargestellt wie Albrecht Adam. Sein Werk zu 1812 besteht aus vier Teilen: den noch weitgehend unveröffentlichten mehreren Hundert vor Ort entstandenen Skizzen und Studien, dem „Russischen Album“1, dem Leuchtenberg-Zyklus2 und der hier erneut herausgegebenen „Voyage pittoresque“.
Unser Motiv für diese Veröffentlichung war (neben dem künstlerischen Gehalt und der historischen Bedeutung der „Voyage“), dass – im Gegensatz zu Faber du Faurs mehrfach nachgedruckter Serie – seit der Erstauflage der „Voyage“ (ab 1827) kein vollständiger Nachdruck mehr publiziert wurde. Lediglich einige Teilausgaben erschienen, unter anderen von J. Tranie und J.-C. Carmigniani (hier wurden fast alle Lithografien Adams, jedoch kleinformatig, abgedruckt), J. North3 (teilweise unzuverlässig koloriert) und A. Pigeard4, daneben freilich zahlreiche Werke, in denen einzelne Blätter der Adam’schen Bilderfolge zur Illustration verwendet wurden5.
Neben dem kompletten Nachdruck der Adam’schen Serie (inklusive vieler Detailaufnahmen) sowie ihres offiziellen französischsprachigen Begleittextes war es unser Ziel, im Rahmen einer umfassenden Analyse so viele Informationen wie möglich zu den einzelnen Tafeln zu ermitteln und zusammenzutragen, um dem heutigen Bildbetrachter (und Leser) das Verständnis zu ermöglichen bzw. zu erleichtern. Grundlage für diese Analyse waren – neben den eigentlichen Bildinformationen – die Erinnerungen Adams, der erwähnte Begleittext (darunter Auszüge aus dem „Journal“ Adams sowie Berichte von Labaume und Ségur), Urkundeneditionen (besonders die Korrespondenzen Napoleons und Eugènes), andere zeitgenössische Memoirenliteratur (v.a. von französischen und italienischen Feldzugsteilnehmern aus den Reihen des IV. Armee-Korps sowie von bayerischen Chevaulegers, die dem IV. Korps attachiert waren) und die Sekundärliteratur.
Bei den Übersetzungen der Adam’schen Begleittexte sowie der in ihnen verwendeten Zitate aus Werken Labaumes und Ségurs haben wir uns – soweit erreichbar - auf zeitgenössische deutschsprachige Ausgaben gestützt, um dem Leser das Zeitkolorit möglichst authentisch zu vermitteln. Bei der Edition dieser Begleittexte haben wir uns zugleich von den „Empfehlungen zur Edition frühneuzeitlicher Texte“ des Arbeitskreises „Editionsprobleme der Frühen Neuzeit“6 leiten lassen (z.B. Einschub von [!] bei offensichtlichen Grammatikfehlern). Teilweise entsprechen die deutschen Titel der Texte bzw. Tafeln nicht genau den französischen Titeln, wurden aber von uns belassen, wenn keine überwiegenden Gründe entgegen standen.
Zur Identifikation der von Adam genannten Ortsnamen konsultiere man die einschlägigen Kartendienste im Internet (siehe Literaturverzeichnis), dazu ältere Atlanten7 für die genannten preußischen, polnischen, litauischen und russischen Ortschaften8.
Für ihre großzügige Unterstützung möchten wir uns bei den nachfolgend Genannten herzlich bedanken: Frau Farida Hamma, Luxemburg, für Hilfe bei der Übersetzung französischer Texte; Frau Dr. Ulrike v. Hase-Schmundt, München, für zahlreiche sachdienliche Hinweise, Frau Regina Hemmann für Korrekturhinweise zum Text, Herrn Daniel Hohrath (Bayerisches Armeemuseum Ingolstadt) für die Zusendung einer Diplomarbeit, Herrn Dr. Carl Körner für Beratung zu Fragen des lithografischen Druckes, Herrn Kirner, Bayerisches Hauptstaatsarchiv (Abt. IV Kriegsarchiv), München; und Herrn Dr. Strobl, Staatliche Graphische Sammlung, München, für die Unterstützung bei unseren Recherchen; sowie Herrn Prof. Dr. Alexander Mikaberidze, Louisiana State University Shreveport / USA, für die Übermittlung von zeitgenössischem Kartenmaterial des Russischen Reiches.
Unser Buch ist wie folgt gegliedert: In der Einleitung geben wir eine kurze Biographie Adams bis zum Jahr 1812, eine Übersicht zum Verlauf des Russlandfeldzugs 1812 bis zur Einnahme von Moskau, eine Skizze zur italienischen Armee im 1. Kaiserreich (1804-1812), eine allgemeine Beschreibung der „Voyage pittoresque“, ihrer Subskribenten und vergleichbarer Bilderserien, bevor im Hauptteil die einzelnen Blätter der „Voyage pittoresque“ besprochen werden. Bei der Beschreibung der Tafeln wird, insofern entsprechende Informationen verfügbar sind, folgendes Schema angewandt:
Eine auf die jeweilige Tafel Bezug nehmende Passage aus Adams Erinnerungen.
Der offizielle Adam‘sehe Begleittext zur Tafel (in der deutschen Version). Der französische Begleittext wird – wie oben erwähnt – von uns weiter hinten vollständig abgedruckt.
Anmerkungen zur speziellen militärischen Situation zum auf der jeweiligen Tafel genannten Datum (als Ergänzung und Detaillierung zur oben erwähnten Übersicht zum Verlauf des Russlandfeldzugs 1812).
Sonstige Bemerkungen (z.B. Diskussion von uniformkundlichen und sonstigen Besonderheiten).
Im Anhang findet sich ein Literatur- und Internetseiten-Verzeichnis. Hierbei haben wir auch das Ziel verfolgt, dem interessierten Leser die selbstständige weitere Forschungsarbeit zu Albrecht Adams Œuvre zu erleichtern. Ergänzend bemerken wir, dass wir bei der Auswahl der Literatur zur Kriegsgeschichte primär auf deutschsprachige Publikationen zurückgegriffen haben, da sie (zumindest für Leser aus dem deutschsprachigen Raum) in der Regel leichter erreichbar sind – wohl wissend, dass insbesondere im Französischen und Englischen zahlreiche modernere Darstellungen verfügbar sind. Dasselbe gilt für die Memoirenliteratur. Einige wichtige (französische und italienische) Erinnerungswerke wurden ins Deutsche übersetzt bzw. von Deutschen in französischen Diensten geschrieben, andere hingegen sind nach wie vor (vollständig) nur in Französisch oder Italienisch verfügbar.
Die im Vorwort und Einleitung abgebildeten Ausschnitte aus den Tafeln Nr. 15, 7, 85, 11, 73, 13, 33 sind aus dem Bildteil entnommen worden.
Zum Schluss: Anmerkungen und Korrekturen sind jederzeit unter der unten genannten E-Mail-Adresse willkommen.
Bornheim, Rheinbach und Köln im September 2014,
Thomas Hemmann, Rolf Eckstein und Eckhard M. Theewen
E-Mail: [email protected]
Internet: www.Napoleonzeit.de
1Teilweise veröffentlicht in Asvaritsch et al., Russisches Album.
2Publiziert von Papi.
3North, Napoleon’s Army in Russia.
4Pigeard, La Campagne de Russie.
5Siehe für eine keineswegs repräsentative Auswahl: Kircheisen und Zamoyski.
6www.ahf-muenchen.de/Arbeitskreise/empfehlungen.shtml (Zugriff am 4. Juni 2014).
7Wir haben hier das Kartenmaterial aus Osten-Sacken und Freytag-Loringhoven sowie Andrees Handatlas, 5. Aufl. (1908), verwendet.
8Eine Liste der Toponyme (verschiedene Schreibweisen der Ortsnamen im Kriegsgebiet: Russisch in deutscher Umschrift, Polnisch und heutige Schreibweise) bringt Zamoyski, 627ff.
Préface
La Grande Armée en 1812, en Russie, a péri bien avant sa pénible retraite entreprise dans le gel et le froid. Lors de sa marche vers Moscou, elle avait déjà perdu environ trois quart de ses effectifs en raison cette fois des grandes chaleurs et des intempéries sans compter les problèmes de ravitaillement affaiblissant les hommes comme les bêtes ou encore les maladies conséquence des privations et de l’insalubrité régnante. Albrecht Adam est le seul artiste à avoir su « croquer » ces évènements de manière aussi complète et détaillée. Son œuvre sur l’année 1812 est composée de quatre parties : plusieurs centaines d’esquisses et d’études prises sur place et pour la plupart encore inconnues du grand public, « l’Album Russe », le « Cycle de Leuchtenberg » et le « Voyage Pittoresque» qui est présenté ici.
Depuis le début de la toute première édition en 1827, il n’y a plus eu de reproduction complète du Voyage– contrairement à la série de Faber du Faur qui, elle, fit l’objet de plusieurs reproductions. Quelques parutions, pour ne citer qu’elles, celles de J. Tranie et J.-C Carmigniani (qui reprend presque toutes les lithographies d’Adam, mais en format réduit), celles de J. North (dont la qualité des coloriages est partiellement insuffisante) et de A. Picard. Certes, à côté de ses reproductions, il en existe de nombreuses autres dans lesquelles, cependant, n’apparaissent que très peu des compositions appartenant au «Voyage Pittoresque ». C’est ce constat qui, en plus de la dimension artistique et de la portée historique du „Voyage“, a motivé la réalisation de ce livre.
Ainsi notre intention était-elle de publier une reproduction complète de la série des lithographies d’Adam, soignant les détails et accompagnées de leur texte officiel en français. Nous voulions également trouver et rassembler le plus d’informations possibles sur ces compositions pour en faciliter la compréhension au lecteur contemporain. Notre analyse s’appuie sur l’autobiographie d’Adam, sur les textes narratifs évoqués plus haut (entre autres les extraits du « Journal » d’Adam ainsi que sur les livres de Labaume et de Ségur), sur les éditions de source (en particulier les correspondances de Napoléon et d’Eugène), sur d’autres mémoires de l’époque (surtout de soldats français et italiens appartenant au IVème Corps d’Armée ou encore de che-vau-légers bavarois attachés au IVème Corps) ainsi que sur de la littérature secondaire.
Nous recommandons aux lecteurs avertis, ou à celui en passe de le devenir, de consulter des services de cartographies accessibles sur le net afin de pouvoir identifier les noms des localités nommées par Adam ou encore d’étudier d’anciennes cartes et atlas de Prusse, de Pologne, de Lituanie et de de Russie (voir la bibliographie).
Nous tenons à exprimer toutes notre gratitude aux personnes suivantes pour leur très généreux soutien et leur aide précieuse à la réalisation de ce projet: Madame Farida Hamma, Luxembourg, pour son support en matière de traduction de textes français; Dr. Ulrike v. Hase-Schmundt, Munich, pour ses précieux conseils; Monsieur Daniel Hohrath (Musée de l’Armée Bavaroise, Ingolstadt) pour la fourniture d’un mémoire universitaire; Dr. Carl Körner pour ses conseils en matière de lithographie ; Monsieur Kirner, Archives Bavaroises (Dpt. IV Archives de Guerre), Munich, et Dr. Strobl, Collections Graphiques de l’Etat, Munich, pour son soutien dans nos recherches ainsi que le Prof. Dr. Alexander Mikaberidze, Louisiana State University Shreveport / USA, pour la transmission de cartes d’époque de l’Empire Russe.
Le livre s’articule autour des parties suivantes : Dans l’introduction, nous présentons une courte biographie d’Adam jusqu’en 1812, s’ensuit une brève synthèse de la campagne de Russie 1812 jusqu’à la prise de Moscou, un aperçu sur l’Armée Italienne au Premier Empire (1804-1812), une description générale du « Voyage Pittoresque », une analyse des souscripteurs et une étude comparée de planches dessinées par d’autres soldant ayant participé à la campagne de 1812 avant de passer à la partie principale consacrée à une analyse individuelle des planches composant le « Voyage pittoresque ». Au niveau de leur description, nous appliquons le schéma suivant dans la mesure où les informations correspondantes sont disponibles :
Citation d’un passage de l’autobiographie d’Adam qui se réfère à la planche objet de l’analyse,
Reprise du texte narratif officiel d’Adam (dans sa version allemande). Le texte français est imprimé à la suite de la partie dédiée à la reproduction des planches,
Rédaction de commentaires sur la situation militaire particulière à la date indiquée sur la planche (qui viennent enrichir la brève synthèse évoquant le déroulement de la campagne de Russie 1812 dans l’introduction),
Et d’autres observations (par exemple l’examen approfondi des particularités concernant les uniformes etc.).
Une bibliographie et un répertoire des pages internet se trouvent en annexe. Ici aussi notre dessein est d’aider le lecteur intéressé à mener des recherches personnelles sur l’œuvre d’Albrecht Adams.
Le mot de la fin : Vos remarques et corrections sont les bienvenues. Vous pouvez les adresser à l’adresse courriel indiquée ci-après.
Bornheim, Rheinbach et Cologne en septembre 2014,
Thomas Hemmann, Rolf Eckstein et Eckhard M.
Theewen
E-Mail: [email protected]
Internet: www.Napoleonzeit.de
Einleitung
Zum „Schlachtenmaler“ Albrecht Adam
Wir fassen in diesem Kapitel die biografischen Informationen zusammen, die zu Adams Karriere als „Schlachtenmaler“ bis zum Jahr 1812 vorliegen. Die wichtigste Quelle hierfür sind Adams Erinnerungen, daneben v.a. Archivarbeiten des Nachfahren Luitpold Adam (Briefe Adams usw. betreffend)9.
Albrecht Adam war Autodidakt. Geboren 1786 in Nördlingen als Sohn eines Konditors, entwickelte er schon als Kind den Drang zu zeichnen, zu modellieren und zu schnitzen, soweit es seine knapp bemessene Freizeit erlaubte (Adam musste bereits ab dem 9. Lebensjahr im elterlichen Geschäft mitarbeiten). Daneben las der talentierte Jugendliche viel, lernte Entbehrungen zu ertragen und sich auf alle mögliche Art und Weise abzuhärten, was ihm bei seinen späteren Feldzügen zustatten kam. Die zahlreichen Durchmärsche französischer Revolutionstruppen und österreichischer Armeen durch Nördlingen weckten sein Interesse für militärische Ereignisse10. In diese Zeit fallen auch erste Auftragsarbeiten für französische Soldaten, die sich von Adam porträtieren ließen11. Ebenso begann Adam sich für Tierdarstellungen, besonders die Pferdemalerei, zu interessieren; seine Debütarbeiten in diesem Metier entstanden im Marstall der Fürsten von Oettingen-Wallerstein.
Da Nördlingen um 1803 an das damalige Kurfürstentum Bayern fiel, wurde der junge Konditor von seinem Vater in die damals noch Freie Reichsstadt Nürnberg geschickt, um den vielversprechenden jungen Mann der Konskription zu entziehen.
In Nürnberg kam Adam erstmals in Kontakt mit der akademischen Kunstszene und beschloss, sich ganz der Malerei zu widmen. Es gelang ihm hier unter anderem, einige Kupferstiche an den bekannten Nürnberger Verleger und Buchhändler Campe zu verkaufen. Daneben gaben die militärischen Ereignisse des Jahres 1805 (Krieg der Österreicher und Russen gegen Franzosen, Bayern u.a.) Adam reichlich Gelegenheit zum künstlerischen Studium, da durch Nürnberg Bayern, Franzosen, Österreicher und die – neutralen – Preußen marschierten. 1806 erschienen als Ergebnis dieser Adam’schen Studien – neben einigen Kupfern mit Jagdszenen – mehrere Stiche mit „Militär- und Reiterscenen“12. Die genannten Stiche wurden 1807/08 in Augsburg gedruckt – damals die „Bilderfabrik“ Deutschlands13 – wohin sich Adam nach einem mehrmonatigen Zwischenaufenthalt in seiner Vaterstadt Nördlingen gewandt hatte.
Neben vielen Porträtarbeiten von Augsburger Bürgern fertigte Adam in den Jahren 1808/09 Studien von Soldaten und Offizieren des in Augsburg garnisonierenden bayerischen Königs-Chevauxleger-Regiments an, wobei er sich besonders mit den Brüdern und Offizieren Baronen Karl14 und Christian v. Zweibrücken anfreundete. Über diese Zeit schreibt Adam: „Später malte ich im Auftrage der Barone Zweibrücken ihre Portraits zu Pferde, wie der jüngere Bruder Karl an der Spitze seines Regimentes dem älteren auf dem Marsche begegnet. Dies war mein erstes militärisches Bild, überhaupt mein erstes Bild in dem Sinne, welchen man angenommener Weise diesem Worte beilegt. Auch die beiden Prinzen von Oettingen malte ich zusammen auf ein Bild in einer Lagerscene. Diesen folgten noch mehrere militärische Portraits mit Pferden...“15 Eine Zeitlang erwog Adam sogar, ins Militär einzutreten, wovon ihn aber Karl v. Zweibrücken mit dem Hinweis auf bessere Karrieremöglichkeiten als Maler wieder abbrachte.
Von Augsburg verlegte16 Adam seinen Wohnsitz 1807/08 in die bayerische Hauptstadt, um sich als Künstler in der dortigen Akademie weiter ausbilden zu können. In München machte er u.a. die Bekanntschaft des königlichen Generaladjutanten Generalmajor Graf Froberg-Montjoye und des Oberstallmeisters Baron v. Kesling (Kesling v. Bergen) – Kontakte, die für seine weitere Lebensplanung entscheidend wurden. König Max I. Joseph kaufte in dieser Zeit bereits einige Pferdestudien Adams und schenkte sie dem Oberstallmeister. Nebenbei durfte Adam im königlichen Marstall Reitstunden nehmen; seine „Leidenschaft für Pferde und Reiterei wuchs mit jedem Tage“17. Zwischenzeitlich, im Herbst 1808, machte Adam wieder Studien in Augsburg, als dort Teile der bayerischen Armee zu einem großen Übungslager zusammengezogen wurden.
Bei Ausbruch des österreichisch-französischen Krieges Anfang April 1809 erhielt Adam einen Befehl des Grafen Froberg, mit Leuten und Equipagen des Generals ins Hauptquartier des französischen Marschalls Lefébvre (Kommandeur des bayerischen Kontingents) aufzubrechen. Nach mancherlei Abenteuern und Fährlichkeiten nahm er am 19. April 1809 bei Abensberg an seiner ersten Schlacht teil. Etwas ernüchtert verzeichnete er: „Alles, was um mich her vorging, ergriff mich auf das äußerste und versetzte mich in die größte Spannung; doch müßte ich Unwahrheit reden, wenn ich sagen wollte, ich hätte eine Schlacht gesehen. Weder meine Stellung als Stallmeister des Grafen Froberg und als Maler, noch viel weniger das Terrain, auf welchem am 19. der Kampf fortgesetzt wurde, war hiezu geeignet. Es hatte hier mit der Bodenbeschaffenheit dieselbe Bewandtniß, wie bei den vorangegangenen Kämpfen: Nichts als Hügelland mit kleineren oder größeren Gehölzen durchschnitten, welche die Kämpfenden oft selbst einander verbargen und die Ausdehnung einer größeren Schlachtlinie, wie bei Aspern und Wagram, nicht zuließen. […] Erst drei Jahre später im russischen Kriege, an der Seite des edlen Helden, des Prinzen Eugen, in seiner unmittelbaren Nähe kam ich öfters in die Lage, mich inmitten der Schlacht zu befinden.“18
Mit der französisch-alliierten Armee gelangte Adam – stets den Skizzenblock in der Hand – in Folge des Siegeslaufs Napoleons nach Wien, wo er sofort ein Porträt des französischen Generals Coëhorn (des Siegers des Gefechts von Ebelsberg) malte, dem zahlreiche Aufträge anderer Generale und Beamter folgten. Diese Malarbeiten wurden nur unterbrochen von der Teilnahme Adams an der Schlacht von Wagram (5./6. Juli). Anfang September erhielt der Künstler Besuch von zwei unbekannten Offizieren, von denen einer der Stiefsohn Napoleons und Vizekönig von Italien, Prinz Eugène de Beauharnais, der andere dessen Adjutant Oberst Bataille war. Bei einem zweiten Besuch unterbreitete Bataille dem Maler das Angebot des Prinzen bzw. Vizekönigs Eugène, in dessen Dienste zu treten – unter der Bedingung, dem Vizekönig auf Reisen und im Kriege überall hin zu folgen. Adam nahm sofort an. Zu seinen ersten Arbeiten zählte die Darstellung der Schlachten des Feldzugs 1809 in Italien und Ungarn, in denen der Vizekönig die italienische Armee kommandiert hatte. Ende 1809 kam Adam am Hofe des Vizekönigs und seiner Frau, der vormaligen bayerischen Prinzessin Auguste, in Mailand an, wo er die Jahre bis 1812 – unterbrochen von einigen Reisen – zubrachte. In diese Zeit fällt auch die Anfertigung (gemeinsam mit Bruder Heinrich Adam) von zwei Stichen mit jeweils Hunderten Figuren zur italienischen Armee. Die beiden Blätter19, die dem Kriegsminister des Landes, Divisionsgeneral Fontanelli, gewidmet sind, zeigen einerseits die Infanterie und andererseits die Kavallerie (in deren Mitte Vizekönig Eugène mit seinem Stab) und Artillerie des Königreichs.
Im Mai 1812 erhielt der frisch vermählte Künstler in München den Befehl des Vizekönigs, sich zum Hauptquartier des italienischen Armee-Korps der Großen Armee Napoleons zu verfügen. Der Kaiser stand auf dem Sprung, in Russland, mit dem er sich in den zurückliegenden Jahren mehr und mehr verfeindet hatte, einzufallen. Adam verließ München mit einem Wagentransport, schloss sich jedoch von Pegnitz an einen bayerischen Kurier, von Dresden an einen französischen Gardeoffizier (der mit Extrapost reiste) und schließlich von Plock an einen italienischen Kurier an, um schneller ins Hauptquartier des Vizekönigs zu gelangen. Am 10. Juni 1812 erreichte er Eugène in Willenberg / Ostpreußen20.
9Siehe Adam, Hase-Schmundt, 67ff, und Holland.
10„Für mich gab es nichts Anziehenderes als ein österreichisches Lager“ (Adam, 5).
11Darstellungen französisch-alliierter Soldaten, von Adam gezeichnet, bringt Crusius.
12Adam, 24. Die ganz neue Technik der „Lithographie kannte man damals noch nicht“, wie Adam am selben Ort schreibt.
13Vgl. Paas, speziell den Aufsatz von A. Teuscher zu J. L. Rugendas‘ d.J. Bilderfolge über die Napoleonischen Kriege, 235ff. Adam war mit Rugendas befreundet, s. Adam, 30f.
14Vgl. den Text zur Tafel 79.
15Adam, 28f.
16Nach seinen Angaben unternahm er die erste Reise Ende Juli 1807. Die vorgeschilderten Erlebnisse mit dem Königs-Chevauxleger-Regiment fallen jedoch in die Zeit ab den ersten Wintertagen (Ende) 1807, nach der Rückkehr des Regiments aus dem preußisch-russischen Feldzug. Die Datierung bei Hase-Schmundt, 68 (vor Juli 1807), ist missverständlich.
17Adam, 41.
18Adam, 60f.
19„Von dem Adam’schen Infanterie-Blatte [sind] zwei etwas von einander verschiedene Ausgaben vorhanden“ (Knötel, Mittheilungen, Jg. 1892, Heft No. 12, 1).
20Adam, 153.
Zum Verständnis des Feldzugs 1812
Die Analyse der „Voyage pittoresque“ erfordert – neben kunsthistorischen Kenntnissen – vor allem ein tiefes Verständnis des militärhistorischen Kontextes der Entstehung der Bilderfolge (bzw. der ihr zugrunde liegenden Skizzen), d.h. der Strategie Napoleons, der Operationen der Truppen unter dem Kommando Eugènes, der Taktik der damaligen Zeit, der Uniformierung und Bewaffnung sowie des militärischen Lebens der Großen Armee.
Wir versuchen, in diesem Buch die folgenden Fragen zu beantworten: Warum befanden sich die dargestellten Personen und Truppen zu den genannten Zeiten an den betreffenden Orten? Wie war der Zustand der Menschen und Tiere (hier vor allem der Pferde)? Welche Einheiten sind dargestellt? Gibt es Besonderheiten bei der Uniformierung, der Bewaffnung bzw. Ausrüstung und den sonstigen Details? Oder ganz allgemein gefragt: Was will der Künstler uns mit seinen Bildern sagen?
Bevor wir den Verlauf des Feldzuges kurz skizzieren und die Tafeln gruppenweise bestimmten Episoden bzw. Orten und Daten zuordnen, seien einige allgemeine Bemerkungen zum russischen Kriegsschauplatz vorausgeschickt: Russland befand sich seit etwa 1700 auf dem Weg, eine europäische Großmacht zu werden, die u.a. ihre westliche und südliche Grenze immer weiter vorschob. Obwohl eines der bevölkerungsreichsten Länder Europas (1812 etwa 34 Millionen Einwohner21), war – bei den riesigen Dimensionen des Reiches – die Bevölkerungsdichte sehr gering. Außer Moskau und St. Petersburg gab es nur fünf Städte mit mehr als 10.000 Einwohnern (Wilna, Smolensk, Witebsk, Mohilew und Wiasma). Moskau (mit damals etwa 240.000 Einwohnern) nicht eingerechnet, lebten in Russland weniger als 18 „Seelen“ pro Quadratkilometer. In den Kämpfen der vorigen Jahrhunderte gegen die Polen und Schweden hatten die Russen gezeigt, dass sie – auch unter Inkaufnahme von hohen Opfern – bereit und in der Lage waren, ausländische Invasionsheere zurückzuschlagen. In den Kriegen seit der französischen Revolution (Kämpfe in den Alpen 1799, in Österreich 1805 und in Preußen 1807) hatte sich die russische Armee als schwieriger Feind erwiesen, der Napoleon als erster Gegner ein Unentschieden abzunötigen vermocht hatte (in der Schlacht bei Preußisch Eylau am 7./8. Februar 1807).
Es war ferner für den französischen Kaiser leicht vorauszusehen, dass die Logistik und die geografischen Bedingungen in einem zukünftigen Russland-Feldzug eine entscheidende Rolle spielen würden: Mit Ausnahme der gut unterhaltenen russischen Reichsstraßen war das – ohnehin dünne – Wegenetz kaum ausgebaut, so dass Geschütze und Trains bei Regenwetter im Boden versanken, hingegen bei heißem, trockenem Wetter gewaltige Staubwolken die Kolonnen einhüllten und das Atmen erschwerten. Da große Teile des Kriegsschauplatzes auf der Wasserscheide zwischen den nördlich zur Ostsee und den südlich zum Schwarzen Meer fließenden Strömen lagen (in der Gegend zwischen Düna, Dnjepr, Beresina und Moskwa), herrschte dort Mangel an gutem Trinkwasser und Rauhfutter, zumal die abziehenden Russen die Brunnen ausschöpften und die Magazine verbrannten. Der schnelle Vormarsch und das ständige Biwakieren erlaubte den Soldaten nicht, die Wäsche zu wechseln bzw. zu waschen. Krankheiten, wie Ruhr und Fleckfieber (Nervenfieber, Kriegstyphus), waren die notwendige Folge. Dies alles wurde verschärft durch die Unbill des Wetters: Auf starke Regenfälle in den ersten Tagen folgte eine geradezu tropische Hitzewelle. Ab September wurden die Nächte empfindlich kalt.
Der seit Anfang 1812 durchgeführte Aufmarsch22 der französischen23 Großen Armee führte zu einer Ballung von etwa einer halben Million Soldaten östlich der Weichsel, mit Schwerpunkt in Ostpreußen. In dieser preußischen Provinz konzentrierten sich die Truppen des Zentrums und des linken Flügels der Großen Armee. Die Truppen des Königreichs Italien (IV. Armee-Korps der Großen Armee) lagen am 10. Juni – dem Tag des Eintreffens Adams beim Hauptquartier des Prinzen Eugène – in Kantonierungen um Willenberg / Ostpreußen, etwa 150 km nördlich von Warschau. Nach dem Aufbruch von dort (11. Juni) ging der Marsch über Sensburg (13. Juni), Rastenburg (14.-18. Juni), Kalvary (24. Juni), Marienpol (26. Juni), Michalsky (27. Juni) und Jachimitzky (Joehmizky, 28. Juni) nach Pilony (Piloni) am Njemen [Niemen, deutsch: die Memel], damals Grenzfluss zwischen dem Herzogtum Warschau und Russland (Tafeln 1 – 8). In Pilony lag das Hauptquartier Eugènes am 29. und 30. Juni, bevor die russische Grenze überschritten wurde.
Die Strategie Napoleons24 wechselte in den verschiedenen Phasen des Feldzugs (vom Njemen bis nach Moskau): Der Einmarsch in Russland (ab 24. Juni, bei Kowno) ist als Versuch Napoleons anzusehen, die Russen strategisch zu überfallen und die russische 2. West-Armee (General Bagration) nach Süden abzudrängen und zu vernichten25. Dazu schob Napoleon seine Hauptkräfte wie einen Keil zwischen die mehr nördlich aufgestellte russische 1. West-Armee (General Barclay) und die vorgenannte 2. West-Armee. Der nunmehrige strategische Versuch, beide russische Armeen in ihrer Trennung zu erhalten und – wenn möglich – die eine oder andere zu vernichten, führte zum Vorschieben des mittleren französischen Angriffskeils bis Witebsk / Smolensk. Es sei hier gleich vorweggenommen, dass dieser erste Operationsplan Napoleons vollkommen scheiterte und die Russen Anfang August bei Smolensk ihre Vereinigung vollziehen konnten, ohne dass Napoleon die eine oder andere russische Armee entscheidend schlagen konnte. Nach Smolensk beschränkte sich Napoleon auf eine mehr oder weniger frontale Verfolgung der nunmehr vereinigten beiden russischen West-Armeen und auf eine fast grobschlächtig zu nennende Schlachtenanlage bei Borodino (ohne beispielsweise die von Marschall Davout vorgeschlagene Umgehung der russischen linken Flanke ins Werk zu setzen). Entsprechend häuften sich die Verluste bei der französischen Hauptarmee: Hatten die Franzosen anfangs eine dreifache Überlegenheit (bezogen auf die Kräfte, die auf beiden Seiten im Zentrum standen), war inzwischen – Anfang September bei Borodino – ein annäherndes Gleichgewicht der Kräfte eingetreten26.
Der Vizekönig Eugène führte in der ersten Phase des Einmarsches (bis Wilna) den rechten Flügel des französischen Zentrums (unter Napoleons unmittelbarem Kommando). Dazu wurden Eugène zeitweise – neben dem IV. Armee-Korps (AK) – auch noch andere Verbände27 unterstellt. Eugènes Flügel wurde anfangs „versagt“, d.h. zurückgehalten, um der französischen Zentrumskolonne die rechte Flanke zu sichern und Bagration nicht vorzeitig aufzuschrecken. Eugène überschritt daher erst ab 30. Juni bei Pilony, etwa 20 km oberhalb (südlich) von Kowno den Njemen (vgl. Tafeln 9 - 13), um von dort Richtung Nowoi Troki (westlich von Wilna, etwa am 4. Juli erreicht) weiter zu marschieren (Tafeln 14 - 19). Hier wurde Eugène südöstlich – über Ozmiana – nach Olzany (Holzany) und weiter auf schlechten Querwegen Richtung Deweniki (mehr südwestlich) in Marsch gesetzt, um zunächst bei der Verfolgung General Bagrations mitzuwirken (Tafeln 20 - 23, bis etwa 10. Juli).
Nachdem Napoleon erkannte, dass Bagration von Eugène nicht mehr eingeholt werden konnte, ließ er den Vizekönig umkehren und ihn – im Rahmen der Verfolgung der russischen 1. West-Armee (General Barclay) – in entgegengesetzter (nordöstlicher) Richtung auf Smorgoni vorgehen. Dort traf Eugène am 12. Juli ein und verblieb bis zum 14. des Monats. Von dort marschierte der Vizekönig weiter nach Dokszitzi (Dokzice, 18.-20. Juli, Tafeln 24 und 25) und Kamen (21. Juli, Tafel 26). Im weiteren Marschverlauf näherte Eugène sich der Düna, die in der Nähe von Beszenkowiczi (Bezenchowitschi, 24. Juli, Tafeln 27 - 29) erreicht werden sollte, um Barclay, wenn möglich, von Witebsk abzuschneiden und ihm den Rückzug Richtung Smolensk zu verlegen. Bei Beszenkowiczi stieß eine bayerische leichte Kavallerie-Division (Preysing-Moos) zu Eugène28. Die bayerische Kavallerie ging, von Napoleons selbst geführt, zur Aufklärung über die Düna voraus (Tafeln 30 - 31). Am 25./26. Juli hatte die zu Eugènes Armee-Korps gehörende Division Delzons bei Ostrowno das erste – gleich äußerst lebhafte – Gefecht29 gegen die russische Nachhut unter General Ostermann-Tolstoi (Tafeln 32 - 40). Diesen Gefechten folgte ein größeres Treffen – gegen die verstärkte russische Arrieregarde unter General Konownitzyn – bei Witebsk (27. Juli). Napoleon hoffte, die Russen hier festhalten und zu einer entscheidenden Schlacht zwingen zu können. Geschickt entzog sich jedoch General Barclay der Bedrohung unter dem Schutz seiner Nachhut (Tafeln 41 - 45), wobei es ihm zusätzlich gelang, seine Rückzugsrichtung zu verschleiern. Eugène wurde deshalb am 28. Juli zunächst in eine falsche Direktion (gegen Rudnia) zur Verfolgung angesetzt und musste im Laufe des Tages – bei großer Hitze – umkehren (Tafeln 46 und 47).
Bei Witebsk bezogen die französisch-alliierten Truppen (darunter das IV. Armee-Korps) nunmehr Erholungsquartiere, um ihre Trains an sich zu ziehen, die Verpflegung besser einzurichten und die gelockerte innere Ordnung wieder herzustellen (zwischen Adams Tafeln 47 und 48, letztere vom 14. August, klafft daher eine zeitliche Lücke von 17 Tagen). Das IV. Armee-Korps unter Eugène wurde hierzu in Kantonierungen zwischen Surasch, Welisch und Janowiczi (Gegend nordöstlich von Witebsk) verlegt. Es bildete hierbei den linken Flügel von Napoleons Aufstellung und erhielt später die Anweisung, sich demonstrativ noch weiter links auszudehnen, um Barclay für die rechte (nördliche) russische Flanke besorgt zu machen.
Den beiden russischen West-Armeen war, wie oben angedeutet, Anfang August bei Smolensk die Vereinigung gelungen. Obwohl den französischen Truppen immer noch hoffnungslos unterlegen30, wurde Barclay von einer Fronde russischer Generale gezwungen, nunmehr zur Offensive überzugehen, um die Invasoren an der alten russischen Grenze zurückzuschlagen. Zögernd setzte Barclay die beiden West-Armeen von Smolensk zu einer Offensive in nordwestlicher Richtung in Bewegung, wobei es ihm gelang, die französische Kavallerie-Division Sebastiani am 8. Juli bei Inkowo zu überfallen. Napoleon, der dies geahnt haben mochte, hatte inzwischen alle Vorbereitungen getroffen, um die unter seinem unmittelbaren Befehl stehenden Heeresteile blitzschnell nach dem rechten Flügel zusammenzuziehen, südlich von Smolensk den Dnjepr (Dnieper, in älteren Quellen auch als Borysthenes / Borystène bezeichnet) zu überschreiten und Smolensk von Süden her anzugreifen, wobei er hoffte, die zur Verteidigung Smolensks herbeieilenden russischen Armeen vor den Toren der Stadt entscheidend schlagen zu können.
Die Versammlung (ab 9. August) und der Rechtsabmarsch (ab 11. August) des französischen Heeres führten dazu, dass der auf dem äußersten linken Flügel stehende Eugène sich am Ende der gewaltigen französisch-alliierten Marschkolonne befand. Das IV. Armee-Korps überschritt am 14. August bei Rasasna den Dnjepr und folgte der Hauptkolonne Napoleons Richtung Smolensk (Tafeln 48 - 50), wurde aber in der Schlacht bei dieser Stadt in Reserve gehalten (Tafeln 51 - 59), kam also nicht zum Schlagen.
Da die beiden russischen Armeen nach zweitägiger Schlacht bei Smolensk sich – wenn auch nicht ohne Mühe – vom Gegner lösen konnten, stand Napoleon vor der Wahl, entweder den Feldzug am Dnjepr zu beenden, die bereits eroberten Gebiete zu sichern und sich auf einen zweiten russischen Feldzug im Jahr 1813 vorzubereiten oder die Verfolgung der Russen tief ins Landesinnere fortzusetzen. Der Kaiser entschied sich für die zweite Variante.
Die Russen setzten inzwischen ihren Rückzug nach Osten fort, in der Hoffnung, weitere Verstärkungen an sich zu ziehen und vor Moskau eine verteidigungsfähige Stellung finden zu können, bei der sie der durch die Kämpfe und Marschverluste fortwährend geschwächten französischen Armee mit Aussicht auf Erfolg entgegentreten konnten. Außerdem wurde mit dem General Kutusow ein neuer Oberbefehlshaber für alle gegen Napoleon im Felde stehenden russischen Heere ernannt.
Bei der weiteren Verfolgung der russischen Hauptarmee blieb Eugène nunmehr auf dem linken Flügel von Napoleons Hauptkolonne. Sein Marsch führte über den Fluss Wop (einen rechten bzw. nördlichen Seitenfluss des Dnjepr), bei Dorogobusch (Dorogobuy) wiederum über den Dnjepr, und von dort über Wjäsma (Wiazma) nach Borodino (Tafeln 60 - 69). Beim letztgenannten Dorf – am Fluss Moskwa (Moscwa) gelegen – stellten die Russen sich Anfang September erneut zur Schlacht, um Napoleons Vordringen nach Moskau – wenn irgend möglich – zu verhindern.
Am 5. September entriss Napoleon den Russen die wichtige – der russischen Hauptkampflinie vorgelagerte – Schanze von Schewardino und begann, sein Heer vor der Stellung der Russen zu entfalten (Tafeln 70 - 73). Der 6. September wurde französischerseits zum weiteren Aufmarsch und auf beiden Seiten mit Vorbereitungen zur kommenden Schlacht (Heranziehen aller verfügbaren Einheiten, Verteilung von Munition und der wenigen noch vorhandenen Lebensmittel, Einweisung der Kommandeure usw.) benutzt (Tafeln 74 - 76).
Die eigentliche Schlacht von Borodino wurde am 7. September ausgetragen. Der auf dem linken Flügel stehende Eugène besetzte dabei zunächst das gleichnamige Dorf, wehrte im Laufe des Tages einen Umgehungsversuch eines russischen Kavallerie-Korps ab und sicherte schließlich mit seiner Infanterie die von den sächsischen, polnischen und französischen Kürassieren eroberte Große Schanze (grande redoute, Rayewsky-Schanze) der Russen. Mit dem – durch riesige Verluste erkauften – Zurückdrücken der beiden russischen West-Armeen um etwa 1 km nach Osten endete (wegen beiderseitiger Erschöpfung) am späten Nachmittag das welthistorische Ringen (Tafeln 77 - 80).