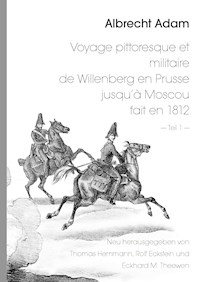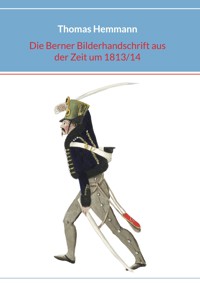
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die hier erstmals in Farbe publizierte Berner Bilderhandschrift mit 200 Zeichnungen zeigt zur Hälfte eidgenössische Milizen, zur anderen Hälfte Angehörige der Hauptarmee der Verbündeten (Österreicher, Russen, Preußen und Bayern) sowie Schweizer Soldaten in fremden Diensten, französische, britische, spanische, italienische und sardische Truppen aus der Zeit des Marsches der Verbündeten durch die Schweiz (um 1813/14). Eine Einführung in den Kontext der Entstehung der Bilderhandschrift, ein Vergleich mit anderen zeitgenössischen Bilderserien, eine Analyse der Zeichnungen sowie eine Dislokation der eidgenössischen Grenzsicherungstruppen Ende 1813 ergänzen diese Edition.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 193
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Einleitung
Zur politisch-militärischen Situation der Schweiz bis zum Ende des Jahres 1813
Der Durchmarsch der Verbündeten durch die Schweiz
Anmerkungen zu den in der Berner Bilderhandschrift gezeigten Armeen und ihrer Darstellung in anderen zeitgenössischen Bilderhandschriften und Druckserien
Zum Schweizer Militär in den Jahren 1813-1814
Zu den anderen dargestellten Armeen in den Jahren 1813-1814
Zur Bilderhandschrift
Die Bilderhandschrift
Französischer Dienst, 1. Restauration - Service de France; Première Restauration
Nr. 1: Ein Gemeiner von den l00 Schweitzern
Nr. 2: Ein Gemeiner von den l00 Schweitzern
Nr. 3: Ein Oberstlieutenant vom ersten Schweizerregiment
Nr. 4: Ein Füsilierofficier vom 4ten Regiment
Nr. 5: Ein Oberstlieutenant vom 4ten Regiment.
Nr. 6: Ein Officier vom 2ten Regiment
Nr. 7: Ein Voltigeur Officier vom 4ten Regiment
Nr. 8: Ein Voltigeur vom 1ten Regiment
Nr. 9: Ein Füsilier vom 4ten Regiment
Nr. 10: Ein Gemeiner vom 2ten Regiment
Zürich
Nr. 11: Ein Zürcher Grenadier Officier
Nr. 12: Ein Grenadier vom Bataillon Heß
Nr. 13: Ein Füsilier Offitzier
Nr. 14: Ein gemeiner Füsilier vom Bataillon Füeßli
Nr. 15: Ein Voltigeur Offizier
Nr. 16: Ein gemeiner Voltigeur vom Bataillon Landolt
Nr. 17: Ein Offizier von den Reserven
Nr. 18: Ein Gemeiner von den Reserven
Nr. 19: Ein Scharfschützen Offizier
Nr. 20: Ein Scharfschütz
Bern
Nr. 21: Ein Berner Dragoner Offizier
Nr. 22: Ein Offizier von der reitenden Artillerie
Nr. 23: Ein Dragoner
Nr. 24: Ein reitender Artillerist
Nr. 25: Ein Artillerie-Offizier
Nr. 26: Ein Feldwebel von der Artillerie Compagnie Studer
Nr. 27: Ein Artillerist
Nr. 28: Ein Gemeiner von der Stadtcompagnie
Nr. 29: Ein Gemeiner von der Standescompagnie
Nr. 30: Ein Gemeiner von der Compagnie von Worb
Nr. 31: Ein Offizier des 3ten Bataillons
Nr. 32: Ein Gemeiner des 3ten Bataillons
Nr. 33: Ein Offizier des Studentenfeldjägercorps
Nr. 34: Ein Gemeiner des Studentenfeldjägercorps
Nr. 35: Ein Gemeiner vom 8ten Bataillon
Nr. 36: Ein Scharfschütz
Nr. 37: Ein Scharfschützenoffizier
Nr. 38: Ein gemeiner Scharfschütz
Luzern
Nr. 39: Lutzerner Grenadier Offizier
Nr. 40: Lutzerner Grenadier
Nr. 41: Lutzerner Füsilier Offizier
Nr. 42: Lutzerner Füsilier
Nr. 43: Voltigeur Officier
Nr. 44: Voltigeur
Nr. 45: Scharfschützen Offitzier
Nr. 46: Scharfschütz
Uri
Nr. 47: Urner Offizier
Nr. 48: Gemeiner Füsilier
Schwyz
Nr. 49: Schwytzer Füsilier Offizier
Nr. 50: Füsilier
Nr. 51: Scharfschützen Offizier
Nr. 52: Scharfschütz
Unterwalden
Nr. 53: Unterwaldner Offizier
Nr. 54: Gemeiner Füsilier
Zug
Nr. 55: Zuger Offizier
Nr. 56: Gemeiner Soldat
Glarus
Nr. 57: Glarner Officier
Nr. 58: Officier
Nr. 59: Infanterie Officier
Nr. 60: Gemeiner von der Infanterie
Basel
Nr. 61: Basler Officier
Nr. 62: Infanterist
Freiburg
Nr. 63: Freyburger Husar
Nr. 64: Artillerist
Nr. 65: Artillerie Officier
Nr. 66: Gemeiner von der Artillerie
Nr. 67: Officier
Nr. 68: Officier
Nr. 69: Infanterie Offizier
Nr. 70: Gemeiner von der Infanterie
Solothurn
Nr. 71: Solothurner Officier von den Jägern zu Pferd
Nr. 72: Jäger zu Pferd
Nr. 73: Artillerie Oberst
Nr. 74: Artillerist zu Pferd
Nr. 75: Artillerie Officier
Nr. 76: Gemeiner Artillerist
Nr. 77: Unteroffizier von der Standescompagnie
Nr. 78: Gemeiner von der Standescompagnie
Nr. 79: Unteroffizier von der Militz
Nr. 80: Gemeiner von der Militz
Schaffhausen
Nr. 81: Infanterie Officier von der Schaffhauser Militz
Nr. 82: Gemeiner Infanterist
Appenzell Innerrhoden
Nr. 83: Appenzeller Infanterie-Offitzier von Innerroden
Nr. 84: Infanterist
Appenzell Ausserrhoden
Nr. 85: Stabsfurier von der Infanterie von Außerroden
Nr. 86: Infanterist
Aargau
Nr. 87: Aargauer Infanterie Offizier
Nr. 88: Infanterist
Waadt
Nr. 89: Waadter Artillerist
Nr. 90: Grenadier
Nr. 91: Eliten Officier
Nr. 92: Elit
Graubünden
Nr. 93: Graubündter Infanterie Offizier
Nr. 94: Infanterist
Thurgau
Nr. 95: Thurgauer Infanterie Officier
Nr. 96: Infanterist
Nr. 97: Scharfschützen Officier
Nr. 98: Scharfschütz
Neuenburg
Nr. 99: Grenadier der Neuenburger Bürgergarde
Nr. 100: Füsilier Officier der Bürgergarde
Nr. 101: Gemeiner Artillerist der Bürgergarde
Nr. 102: Artillerieofficier der Militz
Nr. 103: Bürgerwacht
Nr. 104: Grenadier von der Militz
Nr. 105: Infanterie Officier der neuen Militz
Nr. 106: Infanterist
Nr. 107: Scharfschützenoffizier
Nr. 108: Scharfschütz
Französischer Dienst, 1. Restauration
Nr. 109: Officier vom 3ten Schweizerregiment unter Ludwig XVIII.
Nr. 110: Gemeiner vom 3ten
Nr. 111: Jäger-Furier vom 3ten
Nr. 112: Grenadier vom 2ten
Nr. 113: Füsilier vom 1ten
Nr. 114: Füsilier vom 2ten
Nr. 115: Füsilier vom 3ten
Nr. 116: Füsilier vom 4ten
In preußischen Diensten
Nr. 117: Offizier des Neuenburgischen Gardejägerregiments
Nr. 118: Gemeiner Gardejäger in Preußischem Dienst
Preußen
Nr. 119: Preußischer Dragoner Officier
Nr. 120: Dragoner
Nr. 121: Jägerofficier
Nr. 122: Jäger
Russland
Nr. 123: Rußischer Officier der Garde
Nr. 124: Rußischer Officier der Garde
Nr. 125: Gardegrenadier
Nr. 126: Scharfschütz
Nr. 127: Officier der rußisch-deutschen Legion
Nr. 128: Gemeiner der rußisch-deutschen Legion
England
Nr. 129: Englischer Scharfschützen Oberst
Nr. 130: Infanterie Oberst
Nr. 131: Scharfschützen Oberst
Nr. 132: Infanterie Offizier
Nr. 133: Officier eines englischen Schweizerregiments
Nr. 134: Officier eines englischen Schweizerregiments
Nr. 135: Jäger Offizier
Nr. 136: Jäger
Oesterreich
Nr. 137: Oesterreichischer Küraßier
Nr. 138: Oesterreichischer Küraßier
Nr. 139: Dragoner Offizier
Nr. 140: Dragoner
Nr. 141: Dragoner
Nr. 142: Dragoner
Nr. 143: Chevaux-légers Offizier
Nr. 144: Chevaux-légers
Nr. 145: Husaren-Offizier
Nr. 146: Husaren-Offizier
Nr. 147: Husar
Nr. 148: Husar
Nr. 149: Husar
Nr. 150: Husar
Nr. 151: Husar
Nr. 152: Husar
Nr. 153: Husar von der deutschen Legion
Nr. 154: Husar von der deutschen Legion
Nr. 155: Artillerie Offizier
Nr. 156: Artillerist
Nr. 157: Grenadier
Nr. 158: Grenadier
Nr. 159: Grenadier
Nr. 160: Grenadier
Nr. 161: Infanterie Officier
Nr. 162: Infanterie Officier
Nr. 163: Linieninfanterie
Nr. 164: Linieninfanterie
Nr. 165: Linieninfanterie
Nr. 166: Linieninfanterie
Nr. 167: Croaten Officier
Nr. 168: Croat
Nr. 169: Jäger
Nr. 170: Jäger
Nr. 171: Füsilier der deutschen Legion
Nr. 172: Jäger der deutschen Legion
Frankreich
Nr. 173: Französischer Officier
Nr. 174: Offizier der Lantzier
Nr. 175: Garde d’honneur
Nr. 176: Husarenoffizier
Nr. 177: Husarenoffizier
Nr. 178: Husar von der 1ten Compagnie des 1. Regiments
Nr. 179: Artillerie Officier
Nr. 180: Pionier
Nr. 181: Linieninfanterie
Nr. 182: Linieninfanterie
Nr. 183: Jäger
Nr. 184: Jäger
Bayern
Nr. 185: Baierischer Dragoner
Nr. 186: Chevaux légers
Nr. 187: Garde
Nr. 188: Landwehr
Nr. 189: Nationalgarde
Nr. 190: Ein Corporal vom Regiment Herzog Carl
Nr. 191: Gemeiner des Bataillons Taxis
Nr. 192: Linieninfanterie
Spanien
Nr. 193: Spanischer Grenadier
Nr. 194: Füsilier
Italien
Nr. 195: Italienischer Jägerofficier unter dem Vicekönig
Nr. 196: Italienischer Infanterieofficier
Nr. 197: Linieninfanterie
Nr. 198: Linieninfanterie
Königreich Sardinien
Nr. 199: Officier vom 1ten freywilligen Piemonteser
Regiment im Dienste des Königs von Sardinien
Nr. 200: Gemeiner des 2ten Regiments
Die Berner Bilderhandschrift
Abkürzungen
Literatur
Anlage: Dislokation der Schweizer Truppen am 18. Dezember 1813
Vorwort
Ich veröffentliche hier die sogenannte Berner Bilderhandschrift aus den Jahren um 1813/14, erstmals vollständig in Farbe und mit einer Zuordnung der Darstellungen sowohl der eidgenössischen als auch der ausländischen Soldaten zu bestimmten Einheiten (soweit möglich).
Für ihre Hilfe bei der Beschaffung von Unterlagen sowie der Auswertung und Interpretation zahlreicher Abbildungen danke ich besonders Oliver Schmidt (der die Bilderhandschrift lokalisiert und das Buchmanuskript gegengelesen hat), Markus Gärtner, Ben Townsend, Stanislav Lyulin, Peter Bunde, Christian Kraus, Michael Wenzel, Markus Stein sowie Moritz und Florin Hemmann. Ohne ihre wertvollen Hinweise und Materialien zu einzelnen Armeen wäre diese Arbeit nicht möglich gewesen. Schließlich bin ich Herrn Thomas Schmid von der Burgerbibliothek Bern für seine umfassende Unterstützung bei der Recherche zum Buch sowie der Burgerbibliothek für die Veröffentlichungserlaubnis und die Beistellung weiterer Materialien zu großem Dank verpflichtet.
Wie immer gilt ein besonderer Dank meiner Frau Regina Hemmann für die Durchsicht des Manuskripts sowie dafür, dass sie so viel Verständnis und Geduld für mein zeitraubendes Steckenpferd aufbringt; sowie Conni und Katrin für zahlreiche durchtanzte Nächte, die ein Gegengewicht zu meinem Hobby schaffen und mich in der Gegenwart erden.
Zum Schluss: Anmerkungen und Korrekturen sind jederzeit unter u.g. E-Mail-Adresse willkommen.
Bornheim (Rheinland) im Februar 2024, Thomas Hemmann
E-Mail: [email protected]
Internet: www.Napoleonzeit.de
Einleitung
Zur politisch-militärischen Situation der Schweiz bis zum Ende des Jahres 1813
Infolge der Französischen Revolution änderten sich auch die staatlichen Verhältnisse der Schweizer Eidgenossenschaft: In den 1790er Jahren mussten einige der sogenannten Dreizehn Alten Orte den Verlust der Herrschaft über ihre „Untertanengebiete“ hinnehmen, die von Patriziern regierte Stadt Bern verlor im Zuge dieser Entwicklungen die Kontrolle über das Waadtland und den Aargau. Im Jahr 1798 besetzten französische Truppen das Gebiet der Eidgenossenschaft, damit endete das Ancien Régime. Die Nachfolge trat die Helvetische Republik an, die im Wesentlichen nach französischem Vorbild organisiert war, wenn auch die Einteilung der Kantone sich mehrfach änderte. Der Abzug der französischen Truppen 1802 hinterließ ein Machtvakuum, in dem es sofort zu bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen kam. Infolgedessen ergriff Napoleon – damals noch Erster Konsul – die Gelegenheit, sich auch hier als der starke Mann zu erweisen. Er berief Schweizer Repräsentanten nach Paris, um mit ihnen eine „Mediationsakte” (1803) für die Schweizerische Eidgenossenschaft - zugleich ihre Verfassung - auszuarbeiten und zu garantieren1.
Die Schweiz war damit zu einem Vasallenstaat Frankreichs herabgedrückt worden: 1810 verleibte Napoleon sich das Simplon-Departement ein, im selben Jahr marschierten italienische Truppen ins Tessin und annektierten dieses de facto. Trotzdem gab es nach wie vor eine profranzösische Fraktion in der Eidgenossenschaft, insbesondere in den sechs neuen Kantonen (Graubünden, St. Gallen, Thurgau, Aargau, Waadt und Tessin), die zuvor sogenannte Untertanengebiete mächtiger Kantone, beispielsweise Berns, waren2. Die Phase der Mediationszeit dauerte bis 1813/14, d.h. bis zum ersten Sturz Napoleons.
Nach der Niederlage Napoleons in Russland 1812 - bei der auch 6.000 Schweizer Soldaten zugrunde gegangen waren - kamen in der Schweiz die politischen Verhältnisse erneut in Fluss. Die Schweiz ergänzte zwar auch in diesem Jahr wieder die vier Fremdenregimenter im französischen Sold (für die ein Sollstand von 16.000 Mann festgelegt war)3. Mit der zunehmend schwieriger werdenden Lage Napoleons bis hin zur Niederlage des französischen Kaisers in der Völkerschlacht bei Leipzig und der darauffolgenden Räumung der östlich des Rheins gelegenen deutschen Territorien geriet schließlich auch die Eidgenossenschaft in den Strudel der Kriegsereignisse.
Die Verbündeten waren Napoleon bis zum Rhein gefolgt, wobei das Bülow’sche Armeekorps der Nord-Armee am weitesten nördlich stand und demnächst über den Fluss in Holland einmarschierte. Südlich davon stand Blücher mit der Schlesischen Armee, etwa bis Frankfurt. An die Blücher’sche Armee schlossen sich die Kantonierungen der Hauptarmee (auch Böhmische Armee genannt) unter dem österreichischen Feldmarschall Fürst Schwarzenberg an. Zur Hauptarmee stieß jetzt auch der bayerische General Wrede, der zuvor mit einer bayerisch-österreichischen Armee vom Inn heranmarschiert war und erfolglos versucht hatte, sich Napoleon bei Hanau vorzulegen (30./31. Oktober 1813). Napoleons geschlagene Armee überquerte Anfang November bei der Festung Mainz den Rhein, somit bildete der Strom im Wesentlichen die Grenze zwischen den feindlichen Heeren.
Die Vortruppen der Verbündeten erreichten Frankfurt a.M. am 5. November, dort begannen dann ab Mitte November die Beratungen über die Fortsetzung des Kampfes gegen Napoleon. Der Vorschlag des preußischen Generals Gneisenau, ohne weiteren Aufenthalt über den Rhein und auf dem kürzesten Wege nach Paris vorzudringen, da Napoleons Truppen stark geschwächt waren und der französische Kaiser nicht gleichzeitig eine Armee ins Feld stellen und die zahlreichen Grenzfestungen besetzen könne, wurde verworfen. Immerhin ließ man sich auch nicht auf die Vorschläge der Theoretiker alter Schule ein, zunächst Winterquartiere zu beziehen und dann methodisch den Festungsgürtel Frankreichs (mit über 100 Festungen im Osten und Norden) einzunehmen. Schlussendlich drang das österreichische Oberkommando der Hauptarmee, vor allem vertreten durch die Generäle Radetzky und Langenau, mit seinem Vorschlag durch, entlang des östlichen Rheinufers links abzumarschieren, dann bei Basel das Schweizer Gebiet zu betreten und in Richtung des vermeintlich beherrschenden französischen Plateaus von Langres vorzudringen. Man hoffte, auf diesem Wege ohne größeres Blutvergießen den französischen Festungsgürtel und zugleich die großen Flüsse im französischen Osten und Zentrum an den Quellen zu umgehen. Nach einigem Hin und Her (der russische Kaiser Alexander widersetzte sich zunächst einem gewaltsamen Vordringen durch die Schweiz) wurde dieser Plan von den verbündeten Monarchen gutgeheißen.
In der Schweiz wurde die herannahende Gefahr etwa ab September 1813, nach Wiederausbruch der Feindseligkeiten in Deutschland am 17. August, erkannt. Der Landammann, Bürgermeister Reinhard von Zürich, bot Anfang September die ersten Truppen auf, die an die Südgrenze, nach Graubünden und Tessin, in Marsch gesetzt wurden. Aus dieser Richtung meinte man, mehr bedroht zu sein, aber auch die Integrität des eidgenössischen Territoriums wiederherstellen zu können. Am 20. Oktober übermittelte der Schweizer Landammann (d.h. der Repräsentant der Bundesgewalt) Reinhard dem französischen Gesandten in der Schweiz, Talleyrand, den Wunsch der Eidgenossenschaft nach Anerkennung ihrer Neutralität. Am 25. Oktober wurde eine außerordentliche Tagsatzung (d.h. Versammlung der Abgesandten der Kantone) für den 15. November einberufen. Am 4. November gab Napoleon den Befehl, dass die italienischen Truppen das Tessin freigeben sollten, tatsächlich begann die Räumung bereitsam 5. November, da der Vizekönig des Königreichs Italien Eugène, eigenständig die Initiative dazu ergriffen hatte. Die beantragte Neutralität der Schweiz kam Napoleon sogar entgegen, da sie ihn - angesichts seines arg dezimierten Heeres - der Sorge enthob, die Südwestgrenze Frankreichs decken zu müssen4.
Am 18. November beschloss die Tagsatzung nach mancherlei diplomatischen Finessen Talleyrands und Reinhards die bewaffnete Neutralität und gestattete dem Landammann die Einberufung des einfachen Kontingents (15.000 Mann, s.u.) sowie des ersten Drittels des zweiten Kontingents (5.000 Mann), also insgesamt 20.000 Mann Milizen unter Befehl des Generals Wattenwyl5. Ferner sollten die Kantone die restlichen Truppen des zweiten Kontingents (10.000 Mann) bereithalten und die Einberufung des dritten Kontingents (weitere 15.000 Mann) vorbereiten6. Die Neutralität der Schweiz wurde in den späteren Verhandlungen von den Verbündeten jedoch nicht anerkannt, da die Schweiz weiterhin Napoleon als „Mediator” ansah, die Schweizer Fremdenregimenter nicht aus Frankreich zurückrief und die diesbezügliche Militärkapitulation mit Frankreich nicht aufkündigte, d.h. de facto Frankreich militärisch unterstützte7.
Am 5. Dezember 1813 waren 22 Schweizer Bataillone Infanterie, 8 Kompanien Scharfschützen, 5 Kompanien Artillerie und 3 Kompanien Dragoner verfügbar, insgesamt 12.500 Mann. Diese wurden disloziert nach Graubünden und Tessin (1. Division Ziegler, 2.500 Mann), Basel mit der großen Rheinbrücke (2. Division Herrenschwand mit 2.000 Mann, Kommando Basel) sowie schwerpunktmäßig entlang der deutschen Grenze (2. Division Herrenschwand, Kommando Rheinfelden) und 3. Division Gady, insgesamt 8.000 Mann8. Das Hauptquartier des Generals v. Wattenwyl lag in Aarau, etwa 50 km von Basel entfernt9.
Für den 19. Dezember wurde die Schweizer Armeeführung von den Österreichern um eine dringende Unterredung bei den Vorposten in Lörrach gebeten. Der eidgenössische Oberst Herrenschwand kam in Begleitung seines Brigadiers Füeßli dieser Aufforderung nach, auf österreichischer Seite nahmen FML Bubna und GM Langenau an der Besprechung teil. Letztere eröffneten den eidgenössischen Offizieren, dass die Verbündeten bei Rheinfelden und Basel noch in der Nacht vom 19./20. Dezember über den Rhein gehen würden, d.h. ein Einmarsch in die Schweiz unmittelbar bevorstünde. Herrenschwand erreichte diesem Ultimatum gegenüber nur einen Aufschub von 24 Stunden10. Bereits am Vortag hatte General v. Wattenwyl eine fast gleichlautende Botschaft durch den österreichischen Gesandten Graf Senfft v. Pilsach erhalten11.
General v. Wattenwyl ließ - da jeder Widerstand angesichts einer zehnbis zwanzigfachen Übermacht der Verbündeten zwecklos war - nunmehr den Rückzugsbefehl ausfertigen, den Oberst Herrenschwand in Basel am 20. Dezember um 20:00 Uhr erhielt. Zuvor hatte er mit FML Bubna eine Vereinbarung getroffen, die es den Schweizern erlaubte, sich mit ihrem beweglichen Kriegsmaterial ungestört von der Grenze zurückzuziehen12. Beiden Seiten war daran gelegen, Reibungen und gewaltsame Auftritte zwischen den Truppen zu vermeiden. Der Einmarsch der Österreicher in Basel durfte am 21.
Dezember um 2:00 Uhr morgens beginnen. Die verschiedenen Kontingente der Eidgenossen marschierten schnellstmöglich in ihre Heimatkantone zurück, wo sie bis Jahresende eintrafen und demobilisiert wurden. Am 30. Dezember legte v. Wattenwyl sein Kommando nieder13.
Der Durchmarsch der Verbündeten durch die Schweiz
Die verbündete Hauptarmee unter dem Kommando des FM Fürsten Schwarzenberg, zu der österreichische, russische, preußische bayerische, württembergische und andere deutsche Kontingente gehörten (in den ersten Tagen - ohne Russen, Preußen und Württemberger - ca. 130.000 Mann, insgesamt etwa 195.000 Mann), marschierte ab dem 21. Dezember, 6:00 Uhr, wie oben geschildert, in die Eidgenossenschaft ein. Es existieren Ende 1813 Rheinbrücken bei Basel, Rheinfelden, Säckingen, Laufenburg, Kaiserstuhl, Eglisau, Rheinau, Schaffhausen, Diessenhofen, Stein und Konstanz. Zusätzlich plante der Generalstab der Hauptarmee, bei Grenzach oberhalb von Basel eine Pontonbrücke einzubauen, was jedoch beim ersten Versuch misslang. Als Übergangspunkte wählte der Generalstab schließlich Basel (mit der großen Rheinbrücke), Rheinfelden, Laufenburg und Schaffhausen aus, vergleiche die Karte unten14.
Abbildung 1: Durchmarsch der Alliierten durch die Schweiz (Kasser)
Das österreichische II. Armee-Korps FML Fürst A. v. Liechtenstein ging am 21. Dezember bei Basel über, ebenso die Avantgarde unter FML Bubna (s.u., außerdem die beigefügten Abbildungen mit den Zeichnungen Karl Howalds zum Durchmarsch der Österreicher durch Bern), die zunächst die Pontonbrücke bei Grenzach benutzen sollte.Das III. Armee-Korps FZM Graf Gyulai (ohne die vorerst vor Hüningen verbleibende Division FML Crenneville) folgte unmittelbar. Das I. Armee-Korps FZM Graf Colloredo überschritt gleichfalls am 21. Dezember die Brücke bei Laufenburg.
Abbildung 2: Wie General Bubna im Dec. 1813 die Östreicher beym vierröhrigen Brunnen vorbeidefilieren ließ (Karl Howald, Stadtbrunnenchronik, Burgerbibliothek Bern)
Die österreichische Grenadier-(Reserve-)Division Trautenberg ging am 22. Dezember bei Eglisau über, gefolgt von der Leichten Division Fürst M. v. Liechtenstein und der Grenadier-Division Weißenwolff. Am selben Tag rückten die bayerischen Truppen des gemischten österreichisch-bayerischen Korps des GdK Graf v. Wrede über die Brücke bei Basel.
Abbildung 3: Wie der Restaurator Haller die Oesterreichischen Husaren zur Vernichtung der Franzosen auffordert (Karl Howald, Stadtbrunnenchronik, Burgerbibliothek Bern)
Ihnen folgten am 23. Dezember die österreichischen Verbände Wredes, das Korps des GdK v. Frimont. Die österreichische Kürassier(Reserve-)Division unter FML Nostitz war am 23. Dezember in Schaffhausen. Ob die Kürassier-Division unter FML v. Lederer direktnachrückte, ist nicht ganz klar. Das Hauptquartier der Verbündeten, unter der Leitung des FM Fürst Schwarzenberg, verblieb vorerst in Lörrach, Schwarzenberg weilte aber häufig in Basel zu Gast15.
Die alliierten Verbände waren in zunächst sieben Kolonnen unterteilt, davon fünf österreichische, eine österreichisch-bayerische und eine württembergische. Die Avantgarden-Kolonne unter FML Bubna, zusammengesetzt aus seiner eigenen 1. Leichten Division und aus Teilen des II. Armee-Korps FML Fürst Liechtenstein (ca. 20.000 Mann), marschierte mehr links, nach Bern, hielt sich dort einige Tage auf und stieß dann weiter Richtung Genf vor. Eine Seitenkolonne Bubnas unter GM Zechmeister operierte zunächst Richtung Jura, bog aber später von Biel weiter südlich ab und übernahm die Rolle einer rechten Flügelsicherung Bubnas. Die Bubna’schen Truppen fungierten als selbständiges Korps (oder Südarmee), um Genf einzunehmen und strategisch sowohl als Bindeglied zwischen der Hauptarmee und der österreichischen Armee unter Hiller in Norditalien zu operieren als auch - später - die französische Armeegruppe unter Marschall Augereau bei Lyon in Schach zu halten16. Als achte Kolonne folgten später die russisch-preußischen Garden, die neunte Kolonne bildete das Korps Wittgenstein, das die Blockade von Kehl übernahm.
Die Bewegungen der einzelnen Kolonnen wurden in den nächsten Tagen, entsprechend einer mittlerweile geänderten Lageauffassung Schwarzenbergs, von zunächst eher südlicher Richtung - Bern als geplanter Konzentrationsraum - schließlich nach Westen (Dijon) und Nordwesten (Langres) gedreht. Daher kamen nur die folgenden Verbände in das hier besonders interessierende Bern.
Abbildung 4: Durchmarsch der Oesterreicher im Christmonat 1813 (Karl Howald, Stadtbrunnenchronik, Burgerbibliothek Bern)
Die erste oder Avantgarden-Kolonne (Bubna) erreichte die Stadt am 23. Dezember, die dritte Kolonne (I. Armee-Korps FZM Graf Colloredo) am 26. Dezember und die fünfte Kolonne (Österreichische Reserven GdK Prinz v. Hessen-Homburg mit den Divisionen FML M. v. Liechtenstein, FML Trautenberg, FML Weißenwolff, FML Nostitz) am 29.-31. Dezember17. Die Einquartierungen der gewaltigen Truppenmassen in der Stadt und ihrer Umgebung gingen nicht ohne zahlreiche Beschwerlichkeiten ab: Bei den Truppen ging das Nervenfieber (Flecktyphus) um, einige Einheiten betrugen sich „störrisch und raubsüchtig”, eine Freikorps-Abteilung legte Feuer im Dörfchen Bühl, worauf wiederum die Bauern einen Reiter totschlugen. Manche Einquartierte quälten ihre Quartiergeber mit unmäßigen Forderungen, so ein österreichischer General, der von einem Bauern verlangte, ihm ein Pfund Kaffee zu verschaffen, damals ein Luxusgut18.
Anmerkungen zu den in der Berner Bilderhandschrift gezeigten Armeen und ihrer Darstellung in anderen zeitgenössischen Bilderhandschriften und Druckserien
Zum Schweizer Militär in den Jahren 1813-1814
Die Schweizer Streitkräfte waren seit der Mediationsakte von 1803 (siehe Kapitel XX der Bundesverfassung) ganz überwiegend auf Basis eines Milizsystems organisiert. Artikel 1 regelte die wechselseitige Beistandspflicht der 19 Kantone. Artikel 2 legte die Beiträge aller Kantone an Milizsoldaten, ungefähr 1% der jeweiligen Einwohnerzahl, und Geldmitteln fest: Bern - 2.292 Mann, Zürich - 1.929 M., Waadt - 1.482 M., St. Gallen - 1.315 M., Aargau - 1.205 M., Graubünden - 1.200 M., Tessin - 902 M., Luzern - 867 M., Thurgau - 835 M., Freiburg - 620 M., Appenzell - 486 M., Solothurn - 452 M., Basel - 409 M., Schwyz - 301 M., Glarus - 241 M., Schaffhausen - 233 M., Unterwalden - 191 M., Zug - 125 M., Uri - 118 M., insgesamt 15.203 Mann, die auch als 1. Auszug oder Kontingent bezeichnet wurden (s.o.). Dieses Kontingent konnte durch ein 2. (realisiert in Zürich, Bern, Basel und Luzern) und - theoretisch - ein 3. Kontingent, also auf dem Papier bis etwa 45.000 M., ergänzt werden19. Aufgrund ihrer Verfassungen (niedergelegt in der Mediationsakte) bestand eine bestimmte Ausprägung der Wehrpflicht in folgenden Kantonen: Aargau, Basel, Bern, Freiburg, Luzern, St. Gallen, Schaffhausen, Tessin, Thurgau, Waadt und Zürich. Die verfassungsmäßige Formel hierfür lautete, jeder in diesen Kantonen wohnende Schweizer könne „zu Militärdiensten angehalten werden”. Im Jahr 1814 traten die drei neuen Kantone Neuenburg (Neuchâtel), Genf und Wallis der Eidgenossenschaft bei, die ihre militärischen Einrichtungen den neuen Verhältnissen anpassten (wobei das vorübergehend „souveräne” Fürstentum Neuenburg jetzt wieder vom König von Preußen regiert wurde und auch ein Bataillon für dessen Garde stellte, worauf wir bei der Beschreibung der entsprechenden Abbildungen eingehen werden). Der jährliche Militäretat - gebildet durch Beiträge der Kantone (s.o.), ungefähr im Verhältnis ihrer Wirtschaftskraft - betrug 490.507 Schweizer Franken20.
Die Mobilisierung der Miliz war an strenge Bedingungen geknüpft: „Kein Kanton kann in seinem Innern mehr als 500 Mann Milizen aufbieten und in Bewegung sezen, ohne den Landammann der Schweiz davon benachrichtigt zu haben.” Ferner war festgelegt: „Die Tagsazung [sic] befiehlt die Stellung des im zweiten Artikel für jeden Kanton festgesezten Truppencontingents; sie ernennt den General, der sie anführen soll, und trifft überdies alle nöthigen Verfügungen für die Sicherheit der Schweiz und für die Vollziehung der übrigen Vorschriften des ersten Artikels [über wechselseitigen Beistand der Kantone]. Das nämliche Recht steht ihr zu, wenn der Ausbruch von Unruhen in einem Kanton die Ruhe der übrigen Kantone bedroht.”21