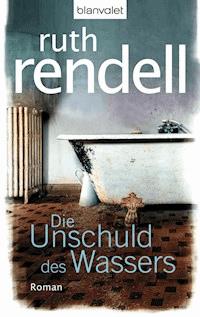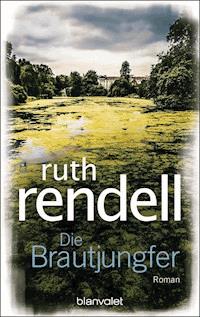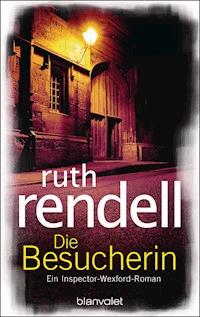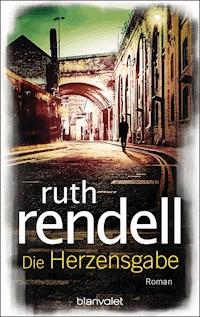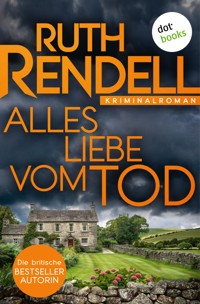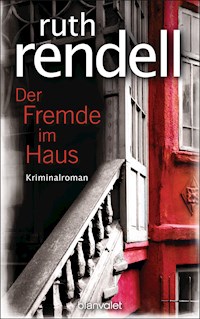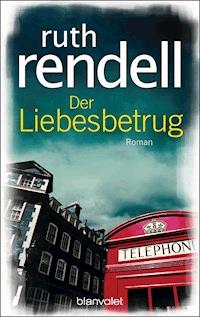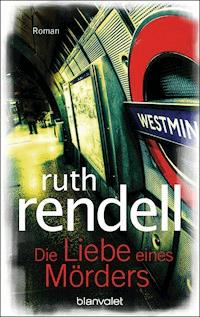2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Hinter den schönsten Fassaden lauern die dunkelsten Abgründe …
Preston Still ist Banker, Millionär – und ein Mörder. Er hat den Liebhaber seiner Frau getötet, indem er ihn eine Treppe hinabstieß. Nun soll das AuPair der Familie ihm helfen, die Leiche zu entsorgen. Doch das Mädchen ist Mitglied der Gesellschaft der heiligen Zita – eines selbstgegründeten Vereins von Dienstboten, die für die Anwohner des noblen Londoner Hexam Place arbeiten und deren Absichten nicht unbedingt wohlwollend sind. Als dann auch noch Dex, der psychisch gestörte ehemalige Gärtner des Viertels, aus der Psychiatrie entlassen wird, geraten die Geschehnisse am Hexam Place vollends außer Kontrolle …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Buch
Preston Still ist Banker, Millionär – und ein Mörder. Er hat den Liebhaber seiner Frau getötet, indem er ihn eine Treppe hinabstieß. Nun soll das Au-pair der Familie ihm helfen, die Leiche zu entsorgen. Doch das Mädchen ist Mitglied der Gesellschaft der heiligen Zita – eines selbstgegründeten Vereins von Dienstboten, die für die Anwohner des noblen Londoner Hexam Place arbeiten und deren Absichten nicht unbedingt wohlwollend sind. Als dann auch noch Dex, der psychisch gestörte ehemalige Gärtner des Viertels, aus der Psychiatrie entlassen wird, geraten die Geschehnisse am Hexam Place vollends außer Kontrolle …
Autorin
Ruth Rendell wurde 1930 in London geboren und lebte dort bis zu ihrem Tod 2015. Sie arbeitete als Journalistin, bevor sie sich ganz dem Schreiben von Romanen widmete. 1997 wurde sie mit dem Grand Master Award der Crime Writers’ Association of America, dem renommiertesten Krimipreis, ausgezeichnet und darüber hinaus von Königin Elizabeth II. in den Adelsstand erhoben. Ruth Rendell ist auch unter dem Pseudonym Barbara Vine bekannt.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Ruth Rendell
Alle bösen Geister
Kriminalroman
Deutsch von Eva L. Wahser
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Die Originalausgabe erschien 2012 unter dem TitelThe Saint Zita Societybei Hutchinson, London.
1. AuflageCopyright der Originalausgabe © Kingsmarkham Enterprises Ltd 2012Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2016 by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München Redaktion: Dr. Rainer SchöttleUmschlaggestaltung: www.buerosued.deUmschlagmotiv: Plainpicture/Elektrons 08Illustration (Karte von Hexam Place): Roger WalkerAF · Herstellung: kwSatz: Uhl + Massopust, AalenISBN 978-3-641-15586-5V001www.blanvalet.de
Meiner Cousine Sonia herzlichst gewidmet
1
_____
Irgendjemand hatte Dex erzählt, die Königin wohne in Victoria, genau wie er. Allerdings gehörte ihr ein Palast, während er nur ein Zimmerchen in einer Seitenstraße vom Warwick Way hatte. Trotzdem malte er sich gerne aus, dass sie seine Nachbarin gewesen wäre. Eigentlich mochte er sogar ziemlich viel an seinem neuen Leben in den letzten Monaten. Er hatte einen Job bei Dr. Jefferson. Das bedeutete, dass er dreimal pro Woche vormittags im Garten arbeiten konnte. Außerdem hatte Dr. Jefferson gesagt, er würde mit der Dame von nebenan reden, ob Dex nicht auch noch einen Vormittag bei ihr arbeiten könne. Man hatte ihm erklärt, er dürfe nichts dazuverdienen, solange er die Beihilfe wegen Arbeitsunfähigkeit bekäme, aber Dr. Jefferson hatte nie danach gefragt, und vielleicht würde diese Dame – sie hieß Mrs. Neville-Smith – es auch nicht tun.
Jimmy, der Dr. Jefferson täglich zur Arbeit ins Krankenhaus fuhr, hatte ihn für heute Abend ins Pub eingeladen. Das Pub lag an der Ecke Hexam Place und Sloane Gardens und hieß Dugong. So einen seltsamen Namen hatte Dex noch nie gehört. Dort wollten sich alle Leute treffen, die am Hexam Place arbeiteten. Dex war noch nie auf irgendeiner Versammlung gewesen und wusste nicht recht, ob er so etwas mochte, aber Jimmy hatte versprochen, ihm sein Lieblingsgetränk zu spendieren, ein Guinness. Dex hätte jeden Nachmittag ein Guinness getrunken, wenn er es sich hätte leisten können. Mitten auf der Pimlico Road zog er sein Handy heraus, um nachzusehen, ob er eine Sprachnachricht oder eine SMS von Peach hatte. Manchmal war das der Fall, und das löste bei ihm immer ein Glücksgefühl aus. Normalerweise wurde er in der Nachricht mit seinem Namen angeredet. Es hieß, er sei so toll gewesen, dass ihm Peach zehn kostenlose Anrufe schenke, oder so. Diesmal war keine Mitteilung eingegangen. Trotzdem würde er wieder einmal eine Nachricht bekommen, da war er sich ganz sicher. Vielleicht würde Peach sogar persönlich mit ihm sprechen. Peach war sein Herrgott. Das wusste er, weil die Dame aus dem ersten Stock zu ihm gesagt hatte, Dex, Peach ist dein Gott. Sie hatte ihn beobachtet, wie er mit strahlendem Gesicht immer wieder eine Handynachricht abgerufen hatte.
Dex brauchte einen Gott. Er sollte ihn vor den bösen Geistern beschützen, auch wenn er schon einige Zeit keinen mehr gesehen hatte. Aber das lag nur daran, dass Peach ihn beschützte, das wusste er. Genauso war er felsenfest davon überzeugt, dass Peach ihn warnen würde, sobald ein böser Geist in seine Nähe kam. Dex vertraute auf Peach, wie er noch nie einer Menschenseele vertraut hatte.
Vor dem Dugong blieb er stehen. Er kannte es gut, es lag gleich neben dem Haus von Dr. Jefferson – nein, nicht Wand an Wand, denn Dr. Jefferson hatte ein großes freistehendes Haus mit einem großen Garten, um den Dex sich kümmern durfte. Aber doch gleich nebenan. Auf dem Pubschild war irgendein großer Fisch abgebildet, der zur Hälfte aus den blauen Wellen herausragte. Es war ein Fisch, das wusste er genau, denn er schwamm im Meer. Dex drückte die Tür auf, und da war auch schon Jimmy und winkte ihm freundlich zu. Die anderen Leute um den großen Tisch schauten ihn alle an, aber er konnte sofort erkennen, dass kein böser Geist darunter war.
»Ich bin kein Dienstbote.« Thea nahm sich eine Handvoll Nüsse. »Du vielleicht, aber ich nicht.«
»Und was bist du dann?«, fragte Beacon.
»Keine Ahnung. Ich erledige für Damian und Roland ein paar Kleinigkeiten. Ich habe schließlich ein Diplom.«
»Wohl der, die nicht sitzt, da die Spötter sitzen.« Beacon zog die Schale außer Theas Reichweite. »Die Nüsse sind für alle da. Wer davon isst, sollte dazu wenigstens nicht die Hand benutzen, die er sich vorher in den Mund gesteckt hat.«
»Kinder, zankt euch nicht«, sagte June. »Wir wollen doch nett zueinander sein. Thea, wenn du kein Dienstbote bist, dann kommst du auch nicht dafür infrage, Mitglied in der Gesellschaft der heiligen Zita zu werden.«
Es war August, der Tag war sonnig und heiß gewesen. Leider konnten nicht alle künftigen Mitglieder der Gesellschaft anwesend sein. Das Kindermädchen Rabia, eine Muslima, ging abends nie aus, und schon gar nicht in ein Pub. Zinnia, die bei der Prinzessin, den Stills und bei Dr. Jefferson putzte, wohnte nicht in der Gegend, und Richard kochte heute Abend für die Gäste von Lady Studley, während seine Frau Sondra bei Tisch bediente. Das Au-pair-Mädchen der Stills, Montserrat, hatte geheimnisvoll getan und gemeint, sie käme vielleicht, allerdings habe sie später noch etwas zu erledigen. Und der Neue, dieser Dex, der Gärtner bei Dr. Jefferson, sagte außer »Prost!« keinen Ton. Allerdings erwarteten sie noch Henry. Und tatsächlich spazierte er herein, während sich June noch darüber beklagte, dass die Nüsse im Dugong nicht gesalzen waren und deshalb nach nichts schmeckten.
In der guten alten Zeit hätte der hünenhafte Henry, der große Ähnlichkeit mit Michelangelos David besaß, das Zeug zum Lakaien gehabt, und sein Urururgroßvater war um 1882 tatsächlich herzoglicher Lakai gewesen. Nach Montserrat war er der Zweitjüngste in der Gruppe. Er sah zwar wie ein Hollywoodstar in den Dreißigerjahren aus, war aber in Wirklichkeit Chauffeur, Teilzeitgärtner und Mädchen für alles bei Lord Studley, wo er die Dinge erledigte, zu denen Richard nicht fähig oder nicht willens war. Sein Arbeitgeber bezeichnete ihn als sein »Generalfaktotum« und lachte dabei gönnerhaft. Er wurde nie Henry oder Hal gerufen.
Beacon meinte, diese Runde ginge auf Jimmy. Was Henry trinken wolle? »Ein Glas vom weißen Hauswein, bitte.«
»Das ist doch nichts für Männer. Das ist ein Damengetränk.«
»Ich bin noch kein erwachsener Mann. Außerdem trinke ich bis zu meinem fünfundzwanzigsten Geburtstag nächste Woche weder Bier noch Schnaps. Habt ihr gesehen? Drunten am Embankment wurde wieder ein Junge erstochen. Damit wären es diese Woche schon drei.«
»Das steht hier nicht zur Debatte, Henry«, sagte June.
Einer wollte eindeutig nicht darüber reden, und das war Dex. Er trank seinen letzten Schluck Guinness aus, stand auf und ging wortlos. June sah ihm nach und meinte: »Keine Manieren, aber was kann man schon erwarten? Jetzt müssen wir uns über unsere Gesellschaft unterhalten. Übrigens, wie gründet man eigentlich eine Gesellschaft?«
»Man wählt einen Vorsitzenden, aber weil das vielleicht auch eine Dame sein kann, muss man von Vorsitz sprechen.«
»Das klingt wie ein Möbelstück. So bezeichne ich niemanden.« Thea griff nach der Schale mit den Nüssen. »Warum können wir nicht Jimmy zu diesem Vorsitzmenschen machen und June zur Schriftführerin? Und der Rest, also wir, sind einfach nur Mitglieder? Damit wäre die Sache geritzt. Dann könnte heute die Gründungsversammlung der Gesellschaft der heiligen Zita sein.«
Henry tippte gerade eine SMS in sein iPhone. »Wer ist diese heilige Zita?«
Den Namen für die Gesellschaft hatte June gefunden. »Sie ist die Schutzpatronin aller Dienstboten, die Essen und Kleidung an die Armen verteilt hat. Sie wird immer mit einem Beutel und einem Schlüsselbund abgebildet.«
»Der Junge wurde erstochen«, meinte Henry. »Seine Mama war im Fernsehen und hat gesagt, er hätte in drei Fächern kurz vor dem Schulabschluss gestanden und so ein gutes Herz für alle gehabt. Alle hätten ihn geliebt.«
Jimmy schüttelte den Kopf. »Ist doch komisch: Immer wenn eines dieser Kids ermordet wird oder sonst was mit ihm geschieht, heißt es nie, dass diese Mistkerle ihre Umgebung schikaniert haben.«
»Na ja, wer sagt das schon über einen Toten?« Henrys iPhone meldete mit einem Klingelton den Eingang einer SMS. Genau darauf hatte er gewartet. Bei Huguettes Nachricht musste er ein bisschen grinsen. »Übrigens, wofür soll diese Gesellschaft eigentlich gut sein?«
»Für Solidarität«, betonte Jimmy. »Zur gegenseitigen Hilfe. Außerdem können wir Ausflüge machen und ausgehen.«
»Das können wir doch sowieso. Um uns Les Mis anzuschauen, brauchen wir doch keine Dienstbotengesellschaft.«
»Ich bin kein Dienstbote«, sagte Thea.
»In dem Fall kannst du Ehrenmitglied werden«, entgegnete June. »Also, für mich wär’s das. Es ist schon ziemlich dunkel. Die Prinzessin wird sich allmählich Sorgen machen.«
Montserrat war nicht erschienen, und niemand wusste, worum es sich bei ihrer »mysteriösen Angelegenheit« handelte. Jimmy und Thea diskutierten noch gut eine Stunde über die Gesellschaft. Welchen Zweck hatte sie? Könnte sie verhindern, dass Chauffeure bis in die frühen Morgenstunden hinein wach bleiben und Cola trinken mussten, während sie auf den Anruf ihrer Brötchengeber warteten? Dr. Jefferson sei davon natürlich ausgenommen, er sei ein leuchtendes Vorbild für alle Arbeitgeber. Henry wollte wissen, wer der komische kleine Typ mit dem Strubbelkopf gewesen sei, dieser Dex oder so. Den habe er vorher noch nie gesehen.
»Er macht unseren Garten.« Jimmy hatte sich eine Sprechweise angewöhnt, als gehöre Simon Jeffersons Besitz dem Kinderarzt und ihm zu gleichen Teilen. »Dr. Jefferson hat ihn aus reiner Herzensgüte eingestellt.« Jimmy trank sein Bier aus und fügte dramatisch hinzu: »Er sieht böse Geister.«
»Was tut er?« Henry riss den Mund auf, genau wie es Jimmy beabsichtigt hatte.
»Na ja, jedenfalls hat er das mal getan. Er hat versucht, seine Mutter umzubringen, und man hat ihn in – in eine Anstalt für verrückte Verbrecher gesteckt. Dort hat sich dann ein Psychiater um ihn gekümmert, und der war mit Dr. Jefferson befreundet. Nachdem ihn dieser Psychiater kuriert hatte, wurde er entlassen, weil es hieß, er würde es nie wieder tun. Und dann hat ihm Dr. Jefferson diesen Job bei uns gegeben.«
Thea wirkte, als sei ihr leicht mulmig zumute. »Glaubst du, dass er deshalb einfach abgehauen ist, ohne Auf Wiedersehen zu sagen? Ist ihm das Gerede über den Erstochenen an die Nieren gegangen? War das der Grund? Was denkst du?«
»Dr. Jefferson sagt, er sei geheilt«, meinte Jimmy. »Er würde es nie wieder tun. Sein Freund hat es hoch und heilig geschworen.«
Henry ging als Letzter. Er gönnte sich noch ein Glas von dem Damengetränk. Die anderen waren alle in dieselbe Richtung gegangen. Ihre Arbeitgeber wohnten samt und sonders am Hexam Place, einer Straße mit goldfarbenen Backsteinhäusern mit weißen Stuckelementen. Unter Immobilienmaklern kannte man so etwas als georgianischen Stil, obwohl keines der Häuser vor 1860 gebaut worden war. Das Haus Nummer 6, direkt gegenüber vom Dugong, befand sich im Besitz Ihrer Kaiserlichen Hoheit, Prinzessin Susan Habsburg, ein Titel, der mit Ausnahme des Vornamens völlig unkorrekt war. Die Prinzessin – so kannten sie nicht nur die Mitglieder der Gesellschaft der heiligen Zita – war zweiundachtzig und lebte schon seit fast sechzig Jahren in diesem Haus. Und genauso lange war auch die vier Jahre jüngere June bei ihr.
Ein paar Stufen führten ins Souterrain hinunter, zu Junes Tür, aber immer wenn sie abends ausgegangen war, betrat sie das Haus durch die Vordertür, auch wenn sie dafür acht Stufen hinaufsteigen musste und nicht zwölf hinunter. An manchen Abenden machte June ihre Arthrose das Treppensteigen zur Qual. Und trotzdem tat sie es. Schließlich sollten vorbeigehende Fußgänger und andere Anwohner am Hexam Place ruhig wissen, dass sie für die Prinzessin eher eine Freundin war als eine bezahlte Hausangestellte. An ihrer Stelle hatte Zinnia heute Gussie gebadet und ein neues Raumspray besorgt, deshalb roch es weniger heftig nach Hund. Es war sehr warm. Wenn es ums Heizen ging, war die ansonsten geizige Prinzessin verschwenderisch. Die Zentralheizung lief den ganzen Sommer über, und wenn es zu warm wurde, riss man eben die Fenster auf.
Obwohl June hören konnte, dass bei der Prinzessin Holby City lief, marschierte sie zu ihr hinein. »Also, Madam, was kann ich Ihnen bringen? Einen schönen Wodka Tonic oder einen frisch gepressten Orangensaft?«
»Ich möchte gar nichts, meine Liebe. Meinen Wodka hatte ich bereits.« Die Prinzessin drehte sich nicht einmal um. »Sind Sie betrunken?« Diese Frage stellte sie regelmäßig, wenn sie wusste, dass June im Pub gewesen war.
»Selbstverständlich nicht, Madam«, antwortete June genauso regelmäßig.
»Also, meine Liebe, kein Wort mehr. Ich möchte unbedingt wissen, ob dieser Bursche Schuppenflechte oder ein bösartiges Melanom hat. Sie sollten jetzt besser zu Bett gehen.«
Das war ein Befehl. Auch nach sechzig Jahren hielt es June für klüger zu gehorchen, egal, ob Freundin oder nicht. Die jüngeren Mitglieder der Gesellschaft der heiligen Zita konnten gerne mit ihren Arbeitgebern auf freundschaftlichem Fuß verkehren. Montserrat sagte zu Mrs. Still sogar Lucy, aber mit zweiundachtzig und achtundsiebzig war das etwas anderes. Seit jenen Tagen, als Susan Borrington mit diesem schrecklichen italienischen Jungspund durchgebrannt war und June sie nach Florenz in sein Haus begleitet hatte, hatten sich die Regeln nicht sehr gelockert. June trollte sich ins Bett und war schon am Einschlafen, da läutete das Haustelefon.
»Haben Sie Gussie zu Bett gebracht, meine Liebe?«
»Das habe ich vergessen«, murmelte June völlig schlaftrunken.
»Nun, dann tun Sie es jetzt, ja?«
Alle Häuser hatten unterschiedliche Souterrainbereiche. Bei einigen waren unter der Treppe kleine Abstellkammern eingebaut, andere Abstellmöglichkeiten in Nischen an der Gartenmauer zum Nachbargrundstück. Vor den meisten Häusern standen Pflanztöpfe mit Baumfarnen, Orangenblumen und selbst gezogenen Avocadobäumen, und ab und zu gab es auch eine Skulptur. Alle verfügten über ein Außenlicht, meistens eine runde oder quadratische Wandlampe. Nummer 7, wo die Familie Still wohnte, hatte einen Abstellschrank in der Mauer, aber keine Topfpflanzen. Die Hängelampe über dem Souterraineingang brannte nicht. Trotzdem konnte Henry im matten Schein einer Straßenlaterne erkennen, dass eine Gestalt im Mauerschrank stand. Er blieb stehen und spähte übers Geländer. Eine männliche Gestalt drückte sich möglichst eng in die flache Nische.
Vermutlich ein Einbrecher. In letzter Zeit waren hier in der Gegend viele Straftaten vorgefallen. Erst letzte Woche hatte ihm Montserrat erzählt, dass in Nummer 5 – hier wohnte die Familie Neville-Smith – einfach jemand durchs Fenster spaziert war und sich den Fernseher, eine prall gefüllte Brieftasche und die Schlüssel für einen BMW geschnappt hatte. Danach sei er zur Vordertür hinausspaziert und mit dem Auto davongefahren. Aber was könne man erwarten, wenn sich die Fenster nicht absperren ließen und man obendrein im Erdgeschoss ein Fenster einen Spaltbreit offen ließ? Dieser Mann führte eindeutig nichts Gutes im Schilde. Henry mochte diesen Ausdruck, den er von seinem Arbeitgeber gehört hatte. Lord Studley würde ihm nahelegen, mit seinem Handy die Polizei zu rufen, aber erstens folgte er nicht jeder Empfehlung von Lord Studley, und zweitens hatte Henry gerade etwas vor, was der Lord zutiefst missbilligt hätte.
Er drehte sich um. In dem Moment öffnete sich die Souterraintür, und Montserrat erschien. Sie winkte Henry zu, rief Hallo und gab dem Mann in der Nische ein Zeichen. War sicher ihr Freund. Henry wartete auf einen Kuss, aber nichts geschah. Der Mann trat ein, die Tür ging zu. Eine Viertelstunde später war Henry in Chelsea, in der Wohnung des ehrenwerten Fräuleins Huguette Studley. Der Einbrecher oder Freund war längst vergessen. Henrys Besuche liefen in letzter Zeit immer nach demselben Schema ab: Erst ging es ins Bett, dann gab’s Streit. Auf Letzteren hätte Henry liebend gern verzichtet, um dafür doppelt so lange im Bett zu bleiben, aber leider setzte er sich nur selten durch. Die neunzehnjährige Huguette, die den Namen ihrer französischen Großmutter trug, war bildhübsch. Sie hatte einen ausgeprägten roten Mund, blaue Kulleraugen und einen Krauskopf, wie es ihre Großmutter genannt hätte. Andere fühlten sich dagegen an die wilde Lockenmähne erinnert, die Julia Roberts in dem Film Der Krieg des Charlie Wilson in Mode gebracht hatte. Jedes Mal brach Huguette den Streit vom Zaun.
»Henry, wenn du hier bei mir wohnen würdest, könnten wir den ganzen Tag im Bett bleiben. Kapierst du das denn nicht? Dann gäbe es auch keinen Streit, weil wir dafür keinen Grund mehr hätten.«
»Und du kapierst nicht, dass mich dann dein Papa feuern würde. In zweierlei Hinsicht«, erwiderte Henry, der bei seinem Brötchengeber ein paar Brocken Parlamentarierjargon aufgeschnappt hatte. »Erstens weil ich nicht in Nummer 11 wohne, und zweitens weil ich seine Tochter bumse. Um das mal klarzustellen.«
»Du könntest dir einen anderen Job besorgen.«
»Wie denn? Ich habe schon ein Jahr gebraucht, um den hier zu bekommen. Und dein Herr Papa würde mir ein Zeugnis ausstellen? Denkste. Ich wäre ja gaga.«
Ans Heiraten verschwendete Henry keinen Gedanken, und wenn, dann käme so etwas für ihn nur infrage, wenn er schon um die fünfzig wäre, und auch dann nur eine mit eigenem Geld und einem großen Vorstadthaus. »Heute heiratet doch niemand mehr«, sagte er. »Außerdem bin ich schon weg. Vielleicht erinnerst du dich daran, dass ich um Punkt 7 Uhr früh vor Nummer 11 im BMW sitzen und auf deinen Herrn Papa warten muss, auch wenn er dann erst gegen 9 Uhr zu erscheinen geruht.«
»Schick mir ’ne SMS«, meinte Huguette.
Henry ging zu Fuß zurück. Aus dem Grundstück von Nummer 5 tauchte ein Fuchs auf, warf ihm einen giftigen Blick zu und lief dann über die Straße, um den Mülleimer von Miss Grieves zu plündern. Droben in Nummer 11 brannte immer noch Licht, im Schlafzimmer von Lord und Lady Studley. Henry blieb eine Weile stehen und schaute hinauf. Er hoffte, die Vorhänge würden sich teilen und Lady Studley würde herunterschauen, vorzugsweise in ihrem schwarzen Spitzennegligé. Vielleicht würde sie ihn zärtlich anlächeln und die Lippen zum Kuss spitzen. Leider geschah nichts dergleichen. Das Licht ging aus, und Henry betrat durch die Souterraintür das Haus.
Montserrat hatte nicht die Tür zu ihrem möblierten Zimmer samt Bad geöffnet, das ihre Arbeitgeber als Apartment bezeichneten, sondern hatte den Besucher über die Treppe ins Erdgeschoss und dann auch noch die nächste Treppe hinaufbegleitet, die in einem Halbbogen zur Galerie hinaufführte. Im Haus war es ganz still, nur droben im Kinderzimmer tappte Rabia mit ihren Pantoffeln über den Boden. An der dritten Tür rechts klopfte Montserrat, öffnete und verkündete: »Lucy, Rad ist da.« Dann waren die beiden sich selbst überlassen, wie Montserrat fünf Minuten später zu Rabia sagte. »Warum kommst du nicht ein bisschen runter, sobald alle schlafen? Ich habe noch eine halbe Flasche Wodka.«
»Montsy, du weißt doch, dass ich nicht trinke.«
»Du kannst den Orangensaft haben, den ich zum Mischen mit dem Wodka besorgt habe.«
»Ich würde aber nicht hören, wenn Thomas weint. Er bekommt Zähne.«
»Die bekommt er doch schon seit Wochen, können auch schon Monate sein«, erwiderte Montserrat. »Wenn er mein Kind wäre, würde ich ihn ersäufen.«
So dürfe sie nicht reden, schalt Rabia, das sei schlimm. Also erzählte Montserrat dem Kindermädchen die Sache mit Lucy und Rad Sothern. Rabia hielt sich die Ohren zu und ging wieder zu den Kindern. Hero und Matilda schliefen tief und fest in ihrem gemeinsamen Schlafzimmer. In der Kinderstube ruckelte Thomas in seinem Gitterbett herum, schrie aber nicht. Manchmal grübelte Rabia darüber nach, warum man ein Schlafzimmer als Kinderstube bezeichnete. Ihr Vater arbeitete in einer Gärtnerei und nannte das Treibhaus seine Kinderstube. Trotzdem fragte Rabia nie, denn sie wollte nicht dumm dastehen.
Montserrat hatte sich lautstark verabschiedet. Die Zeit verging sehr langsam. Allmählich wurde es spät, und Rabia dachte allen Ernstes daran, sich in ihrem Zimmer auf der Rückseite des Hauses schlafen zu legen. Aber was wäre, wenn Mr. Still heimkäme und anschließend hier hinaufginge? Manchmal tat er das. – Thomas fing an zu greinen und brüllte schließlich los. Rabia hob ihn hoch und ging mit ihm auf und ab. Das war das Allheilmittel. Die Kinderstube ging auf die Straße hinaus. Kopfschüttelnd sah Rabia durchs Fenster, wie Montserrat diesen Mann namens Rad über die Souterraintreppe hinausließ. Montserrat hatte mit einer begeisterten oder amüsierten Reaktion gerechnet, aber Rabia war einfach nur zutiefst schockiert.
Thomas hatte sich inzwischen beruhigt, aber als er wieder in sein Bettchen gelegt wurde, ging das Gequengel wieder los. Rabia hatte eine Engelsgeduld und liebte den Kleinen abgöttisch. Sie war Witwe, ihre beiden Kinder waren noch als Babys gestorben. Einer der Ärzte hatte gemeint, daran sei ihre Ehe mit einem Cousin ersten Grades schuld. Aber auch Nazir hatte nicht sehr lange gelebt, und jetzt war sie allein. Rabia setzte sich auf den Stuhl neben dem Bettchen und redete leise mit Thomas. Als er wieder zu weinen anfing, hob sie ihn hoch und ging mit ihm zu dem Tisch, auf dem ein Wasserkocher stand. In der Ecke war ein kleiner Kühlschrank. Sie kochte ihm eine Kindermilch. Sie war viel zu weit vom Fenster weg, um das Auto zu sehen oder zu hören. Erst als sie ziemlich schwere Schritte auf der Treppe hörte, wusste sie, dass Preston Still heimgekommen war. Anstatt im ersten Stock stehen zu bleiben, wo seine Frau schlief, ging er weiter nach oben. Damit hatte Rabia gerechnet. Preston war ein besorgter Vater, genau wie die Ente Pratschel-Watschel in einem Kinderbuch, das Rabia den Kindern manchmal vorlas. Diese meinten dann, mit Rabias Akzent würde es besonders komisch klingen. Oft dachte Rabia, Preston sei das genaue Gegenteil von seiner Frau. Er kam herein, sah müde und abgekämpft aus. Sie wusste, dass er auf einer Konferenz in Brighton gewesen war. Lucy hatte es ihr erzählt.
»Ist bei ihm alles in Ordnung?« Preston hob Thomas hoch und drückte ihn, allerdings so fest, dass es dem Kind unangenehm war. Nur selten spielte er mit Thomas, und noch weniger redete er mit ihm. Prestons einzige Sorge galt Thomas’ Gesundheit. »Er hat doch nichts, oder? Beim geringsten Verdacht sollten wir Dr. Jefferson anrufen. Er ist ein guter Freund und würde auf der Stelle kommen, davon bin ich überzeugt.«
»Er ist völlig in Ordnung, Mr. Still.« Die Sitte, dass Rabia ihre Arbeitgeber mit Vornamen ansprach, galt nicht für Mr. Still. »Er will einfach nicht schlafen, das ist alles.«
»Wirklich sonderbar«, entgegnete Preston trübsinnig. Er konnte sich nicht vorstellen, dass jemand nicht schlafen wollte, besonders wenn es sich um sein eigen Fleisch und Blut handelte. »Und die Mädchen? Als ich Matilda gestern gesehen habe, hatte ich den Eindruck, sie würde leicht husten.«
Rabia meinte, Matilda und Hero schliefen tief und fest nebenan. Mit den Kindern sei alles in bester Ordnung. Und auch Thomas würde sich sicher beruhigen, wenn Mr. Preston ihn einfach sanft hinlegen würde. Um ihn loszuwerden und endlich selbst ins Bett zu kommen, fügte sie noch hinzu: »Er hat nur seinen Papa vermisst, aber jetzt sind Sie ja da, und damit ist alles in Ordnung.« Rabia wusste genau, was er gerne hörte.
Na also, kein Kinderarzt und auch sonst keine Störung mehr. Sie konnte endlich schlafen gehen. Vielleicht für fünf Stunden. Als sie zu Mr. Still gesagt hatte, Thomas würde seinen Papa vermissen, hatte sie nicht die Wahrheit gesagt. Mit dieser Lüge hatte sie ihm eine Freude machen wollen. Insgeheim glaubte Rabia, dass keines der Kinder die Eltern auch nur einen Augenblick vermisste. Die Kinder bekamen Vater und Mutter nur selten zu sehen. Rabia gab Thomas ein Küsschen auf die Wange und flüsterte: »Mein Schatz.«
2
_____
Auf dem Tablett stand ein kleiner Becher mit einem Joghurt, der angeblich für bessere Verdauung sorgte, dazu eine Feige, eine Scheibe Buttertoast, Marmelade und eine Kanne Kaffee. Die Joghurtphase der Prinzessin war zur Hälfte vorbei, das wusste June, denn solche Phasen dauerten immer circa vier Monate. Und zwei hatten sie schon hinter sich. Sie fischte das Tablett mit den vier Beinchen heraus – keine von beiden kannte die richtige Bezeichnung dafür – und stellte es auf die Daunendecke. Die Prinzessin drehte sich vor dem Schlafengehen regelmäßig die Haare ein. Jetzt nahm sie die Lockenwickler Stück für Stück heraus und verteilte dabei Schuppen auf dem Toast.
»Gut geschlafen, meine Liebe?«
»Ja, vielen Dank, Madam. Und wie steht es mit Ihnen?«
»Ich hatte einen höchst sonderbaren Traum.« Die Prinzessin hatte oft sonderbare Träume und schilderte jetzt ausführlich ihren letzten. June hörte gar nicht hin. Sie zog die Vorhänge auf, blieb am Fenster stehen und schaute auf den Hexam Place hinunter. Auf der gegenüberliegenden Seite, vor Nummer 11, stand Lord Studleys schwarzer BMW mit dem armen Henry am Steuer. June wusste definitiv, dass er schon seit zwei Stunden dasaß. Anscheinend war er eingeschlafen. Kein Wunder! Wirklich schade, dass die Gesellschaft der heiligen Zita keine Gewerkschaft war, aber vielleicht könnte man einige gewerkschaftliche Vorrechte übernehmen und sich gegen eine dermaßen herzlose Behandlung durch einen Arbeitnehmer verwahren. Handelte es sich dabei etwa um einen Verstoß gegen Henrys Menschenrechte?
Aus der Lower Sloane Street bog der schicke silbrige Schulbus mit dem blauen Rallyestreifen um die Ecke. Draußen vor Nummer 7 warteten bereits Hero und Matilda Still an der Hand von Rabia. Sie begleitete die Mädchen bis zum Bus, der sie dann in ihre sündhaft teure Schule nach Westminster brachte. Also wirklich, warum konnte das nicht ihre Mutter machen? Liegt noch im Bett, dachte June. Heißt Still und ist es auch. Was für eine Welt! Damian und Roland waren aus dem Haus Nummer 8 getreten. Leider konnte June deren Haustür von ihrem jetzigen Standplatz aus nicht sehen. Beide machten keinen Schritt allein. Als gemischtgeschlechtliches Paar hätten sie Händchen gehalten. Die durch und durch progressive June hielt es für eine himmelschreiende Schande, dass man diesen Punkt im Kampf gegen Vorurteile und Bigotterie noch nicht erreicht hatte. Soeben trat Mr. Still aus dem Haus Nummer 7, und auch die Prinzessin kam allmählich ans Ende ihrer Traumgeschichte. Aus jahrelanger Erfahrung wusste June instinktiv, wann dieser Punkt erreicht war.
»… aber leider war es nicht meine Mutter, sondern die Rothaarige, die für diese Tunten putzt. Und dann bin ich aufgewacht.«
»Faszinierend, Madam, aber ›Tunten‹ sagt man nicht mehr. Heutzutage spricht man von einem ›Schwulenpärchen‹.«
»Ach, na ja, wenn Sie darauf bestehen. Ich bin überzeugt, Lady Studley würde es sich verbitten, wenn Sondra in einem solchen Ton mit ihr spräche.«
»Vermutlich nicht, Madam«, sagte June. »Darf ich Ihnen sonst noch etwas bringen?«
Nein. Jetzt würde die Prinzessin noch eine Weile schmollen und dann aufstehen. June hatte Zinnia kommen hören. Diese Runde hatte sie gewonnen. Hocherfreut ging sie hinunter. Nachdem sie die Putzfrau überredet hatte, den Wandanstrich im Esszimmer zu reinigen, schickte sie sich an, die Tagesordnung für die nächste Zita-Sitzung voranzutreiben.
June war ganze fünfzehn gewesen, als ihre verwitwete Mutter, die bei Caspar Borrington als Wirtschafterin arbeitete, ihr eine Stellung als Kammerzofe oder besser gesagt als Mädchen für alles bei dessen Tochter Susan Borrington besorgt hatte. Ganze zwei Monate nach ihrem achtzehnten Geburtstag hatte Susan es geschafft, sich mit Prinz Luciano Habsburg zu verloben, dem Spross eines dubiosen italienischen Adelshauses, den sie beim Skifahren in der Schweiz kennengelernt hatte. Na ja, der Stammhalter war er vielleicht doch nicht ganz gewesen, denn er hatte zwei ältere Brüder und arbeitete als Skilehrer. Geld war hier nicht zu holen, und über den Titel lachten sich die Italiener regelmäßig schief, da Lucianos Vater seinen Familiennamen Angelotti erst vor wenigen Jahren gegen Habsburg eingetauscht hatte. Er besaß in Mailand einige Dessousläden. Seltsamerweise war gerade das ein Bindeglied zwischen beiden Familien, denn der schwerreiche Caspar Borrington, dem in Mayfair drei Häuser und eine Riesenwohnung gehörten, hatte sein Vermögen aus nicht ganz unähnlichen, ja sogar noch weniger gediegenen Quellen geschöpft. Seine Fabriken stellten Damenbinden her. Mit dem Auftauchen von Tampax war der Ruin vorprogrammiert gewesen, aber als Susan dem Prinzen Luciano begegnete, war die Familie stinkreich und Susan das einzige Kind gewesen.
Sie heirateten, und June zog mit ihnen nach Florenz, in die von Susans Vater bezahlte Wohnung. Die ganze Stadt war für June ein einziges Wunder gewesen: die Leute mit ihrer komischen Sprache, immer nur schönes Wetter – Susan hatte im Mai geheiratet –, die Gebäude, der Arno, die Brücken, die Kirchen. Kaum hatte sie sich an alles gewöhnt und konnte schon »Buon giorno« und »Ciao« sagen, da kam es zwischen Susan und Luciano zu einem ungewohnt heftigen Streit, der in eine Prügelei ausartete. Daraufhin befahl sie June zu packen. Sie würden heimfahren.
Da Susan die fixe Idee hatte, dass man sich in Italien nicht scheiden lassen konnte, kam es nie dazu. Caspar Borrington gab Luciano einen Riesenbatzen Geld, damit er den Mund hielt, und Susan sah ihn nie wieder. Jahre später ließ er die Ehe annullieren. Er war keine Kaiserliche Hoheit. Es bestanden sogar begründete Zweifel, ob er überhaupt ein Prinz war. Trotzdem nannte sich Susan Ihre Kaiserliche Hoheit Prinzessin Susan Habsburg. Diesen Namen ließ sie auf ihre Visitenkarten drucken und in der City of Westminster in die Wählerliste eintragen. Ihr Vater kaufte ihr das Haus Nummer 6 am Hexam Place. Damals war das noch keine ganz so schicke Adresse gewesen wie in späteren Zeiten. Seither hatte sie hier gewohnt und sich unter Generalswitwen, Exfrauen von Sportgrößen und uralten ledigen Töchtern von Fabrikdirektoren einen Freundeskreis aufgebaut. Auch Liebhaber hatte es gegeben, allerdings nicht viele und nicht für lange.
Auch Zinnia gehörte zu jenen Frauen, die sich umbenannt hatten. Der Name Karen, auf den man sie in Antigua getauft hatte, hatte ihr nicht gefallen. Ihr Familienname, St. Charles, war echt. Die Tatsache, dass sie im Herzen von Knightsbridge für eine Prinzessin arbeitete, verschaffte ihr ein großes Renommee. Die Putzstellen in den Häusern Nummer 3, 7 und 9 waren ihr in den Schoß gefallen. Nachdem June sie überredet hatte, im Esszimmer den Wandanstrich zu reinigen, fragte sie sie, ob sie nicht Mitglied in der Gesellschaft der heiligen Zita werden wolle.
»Was kostet das?«
»Nichts. Außerdem hast du die Chance, oft auf einen Drink eingeladen zu werden.«
»Okay«, meinte Zinnia. »Hab nichts dagegen. Ist Henry Copley auch Mitglied?«
»Ist er«, sagte June, »aber mach dir keine Hoffnungen. Er hat genug um die Ohren.«
Sie ging ins Arbeitszimmer, das die Prinzessin nie betrat, setzte sich an den von der Prinzessin nie benutzten Schreibtisch und begann, die Satzung der Gesellschaft zu formulieren. Außerdem machte sie sich darüber schlau, was alles zu einer richtigen Protokollführung gehörte.
Alle Häuser am Hexam Place hatten vorn und hinten Gärten, nur Nummer 3 besaß auch seitlich noch eine kleine Grünfläche, die es vom Dugong trennte. Die Vorgärten waren sehr pflegeleicht: gepflasterte quadratische Flächen mit je einem Baum in der Mitte, zum Beispiel eine Japanische Blütenkirsche im Pflaster vor Nummer 4 und vor Simon Jeffersons Haus zwei Affenschwanzbäume. Dex war froh, dass es in diesem Vorgarten nur wenig zu tun gab, denn die Affenschwanzbäume machten ihm Angst. Sie sahen ganz anders aus als alle Bäume, die er bisher gesehen hatte, und erinnerten mehr an Gewächse, die man unter der Meeresoberfläche, etwa in der Nähe eines Korallenriffs, erwartete. Solche Sachen kannte Dex aus dem Fernsehen. Wenn er sein Zimmer betrat, schaltete er sofort den Fernseher ein und ließ ihn bis zum Zubettgehen laufen, egal, was gerade kam. Wenn er sich fürchtete oder einfach auf der Hut war und Peach nicht zu ihm sprach, lief der Fernseher manchmal die ganze Nacht.
Dr. Jeffersons rückwärtigen Garten mochte Dex. Er war groß und hatte ringsherum eine Mauer und eine Rasenfläche. Dex mähte den Rasen öfter als nötig, weil der Rasenmäher so schön war und so gut lief. Dr. Jefferson meinte, Dex könne gerne Pflanzen kaufen, und wies Jimmy an, ihm Geld zu geben. Also ging Dex in die Belgrave-Gärtnerei und kaufte auf den Rat des großen Orientalen – er hieß Mr. Siddiqui – im Mai einjährige Pflanzen und im September Lavendel. Dr. Jefferson war mit seiner Arbeit zufrieden und empfahl ihn Mr. und Mrs. Neville-Smith in Haus Nummer 5. Damit hatte Dex jetzt zwei leicht zu bewältigende Jobs.
Seit er angefangen hatte, am Hexam Place zu arbeiten, hatte er keine bösen Geister gesehen, aber leider konnte er böse Geister nicht immer mit Sicherheit identifizieren. Manchmal musste er sie wochenlang beobachten und ihnen sogar oft nachgehen, bevor er sich sicher sein konnte. Andererseits musste er sich immer wieder vorsagen, was er Mr. Jeffersons Freund, Dr. Mettage, dem Psychiater in der Klinik, versprochen hatte: Er würde ihnen nichts tun, solange sie ihn nicht bedrohten. Natürlich hing das davon ab, was man unter »Bedrohung« verstand. Frauen waren für ihn sowieso eine Bedrohung, aber das hatte er weder Dr. Mettage noch Dr. Jefferson erzählt. Nur seinem Gott, aber Peach hatte nicht geantwortet.
Während es im Vorgarten von Nummer 3 wenig zu tun gab, hatte er im Vorgarten von Nummer 5 viel Arbeit. Links und rechts von den Pflasterquadraten wuchs eine Hecke, die auch noch die vordere Treppe einrahmte, und vor der Hecke gab es eine schmale Blumenrabatte. Dex kniete sich hin, um in diesen Beeten Unkraut zu rupfen. Doch vorher legte er noch eine alte Fußmatte aufs Pflaster, die ihm Mrs. Neville-Smith zum Schutz seiner Knie gegen die kleinen Steine gegeben hatte.
Er beobachtete gerne die Leute vom Hexam Place, auch wenn er nicht mit ihnen reden wollte: die Rothaarige von gegenüber, die rauchend auf der Treppe saß, die alte Dame namens June, die einen fetten kleinen Hund Gassi führte, den jungen Mann, der eher wie ein Fernsehstar aussah und am Steuer eines großen glänzenden Autos saß. Allerdings wartete er mehr, als dass er fuhr. Im selben Haus wie die Rothaarige wohnten zwei Männer. Jeden Morgen, wenn Dex gerade mit der Arbeit angefangen hatte, gingen sie gemeinsam aus dem Haus. Sie trugen immer Anzug und Krawatte und an kalten Tagen schmal geschnittene Mäntel.
Jetzt musste er hinten weitermachen, und dann sah er nur noch Klematis, Dahlien und Rosen. Mr. Neville-Smith liebte Rosen über alles. Nebenan, in Nummer 7, wohnten viele Kinder, zwei größere und ein Baby, und ein Mädchen, das Jimmy ein Au-pair nannte. Dex sah sie die Souterraintreppe von Nummer 7 hinauf- und hinuntergehen. Er sah auch eine Dame in einem langen schwarzen Kleid mit einem schwarzen Kopftuch, die in einem Buggy das Baby schob. Allerdings hätte er keinen von ihnen wiedererkannt, wenn er sie zufällig außerhalb seiner häuslichen Umgebung getroffen hätte. Gesichter hatten für Dex keine Bedeutung. Er sah sie nur als leere, nichts sagende Masken.
3
_____
Nur wenige Stammgäste wussten, was ein Dugong war. Auf dem Schild über den Türen war ein Tier mit einem hübschen Frauengesicht abgebildet, halb Robbe, halb Delfin. Einige Gäste meinten, es sei eine Meerjungfrau, andere bezeichneten es als Seekuh. Der Betreiber empfahl Google. Eventuelle Ergebnisse wurden nicht bekannt, falls überhaupt jemand gegoogelt hatte. Anscheinend war es unwichtig. Das Dugong gehörte zu den wenigen Londoner Pubs, die alles überlebt hatten: die Rezession, die Gesetze gegen Alkohol am Steuer und die dringlichen Ermahnungen allseits zu weniger Alkoholkonsum. Dafür gab es Gründe: Die Klientel bestand aus reichen, hauptsächlich jüngeren Leuten, das Lokal hatte auf der Rückseite einen geschmackvoll dekorierten Garten, und vor der Tür war der Gehsteig so breit, dass man dort mit einem Sauvignon stehen und plaudern konnte. Das Dugong war also ein beliebter Treffpunkt.
Obwohl es schon Mitte September war, war es abends noch schön warm. Und so fand die erste Sitzung der Gesellschaft der heiligen Zita am größten runden Tisch im Garten statt. Eigentlich hätte Jimmy den Vorsitz führen sollen. Daraufhin geriet er zwar nicht direkt in Panik, protestierte aber, er habe keine Ahnung, was er tun solle. Eigentlich habe er nie behauptet, er würde den Vorsitzenden machen. Das solle ruhig June tun. Also verlas June das ziemlich knappe Protokoll der Gründungssitzung, und Jimmy, Beacon, Thea, Montserrat – Letztere war gar nicht dabei gewesen – und Henry waren sich einig, dass der Bericht korrekt gewesen war.
Kaum hatte June die ersten Sätze ihrer vorformulierten Rede gehalten, in der sie schilderte, wie der arme Henry stundenlang hinter dem Steuer des BMW auf das Eintreffen von Lord Studley warten musste – ja, sie war noch nicht einmal zu dem Punkt gekommen, an dem Lord Studleys Name fiel –, da sprang auch schon das Subjekt ihrer Beschwerde auf und rief laut: »Halt! Halt! Halt!«
»Um Himmels willen, was ist denn los?« Im Garten des Dugong wimmelte es nur so von Wespen. »Hat dich etwas gestochen?«
»Willst du, dass ich meinen Job verliere?« Henry dämpfte seine Lautstärke. Er glaubte, nicht nur Wände, sondern auch Büsche und Topfpflanzen hätten Ohren. »Es hat ein ganzes verflixtes Jahr gedauert, bis ich meinen Job bekommen habe. Und was ist mit meiner Wohnung?« Und fügte dann im Flüsterton zischend hinzu: »Willst du, dass ich meine Wohnung verliere?«
»Also, das tut mir nun wirklich sehr leid«, sagte June. »Ich hatte es gut gemeint. Ich war immer tief betroffen, wenn ich dich in diesen frühen Morgenstunden halb schlafend am Steuer gesehen habe.«
»Themenwechsel, wenn es dir nichts ausmacht. Und eigentlich auch dann, wenn es dir etwas ausmachen sollte«, fügte Henry hinzu und funkelte sie wütend an.
»Zeit für eine zweite Runde«, warf Beacon ein. »Was trinken wir denn jetzt?« Er versuchte, sich einen passenden Bibelspruch einfallen zu lassen, aber in der Bibel stand nichts über Autos und auch nicht viel über Menschenrechte. »Henry, was soll’s denn sein?«
Henry und Montserrat wollten einen Weißwein, June einen Wodka Tonic und Thea ein Glas Merlot. Jimmy entschied sich für ein Bier. Nur Beacon gab sich mit Mineralwasser »mit einem Hauch Schwarze Johannisbeeren« zufrieden. Leider bestand immer die Möglichkeit, dass ihn Mr. Still auf dem Handy anrief und sich von der Victoria Station abholen ließ.
Nachdem außer »Ausgaben und Einnahmen« nichts mehr auf der Tagesordnung stand und diesbezüglich bisher kein Eintrag zu verzeichnen war, kam man schnell zu dem Punkt »Verschiedenes«. Montserrat schlug eine Kampagne zur Rekrutierung weiterer Mitglieder vor. Auch wenn sich die Mitgliedschaft bisher auf den Hexam Place beschränkte, fehlten immer noch Rabia, Richard und Zinnia. Beacon meinte, man hätte alle über diese Versammlung informiert, und wenn die Leute nicht wollten, könne man sie nicht dazu zwingen.
»Aber überzeugen kann man sie sehr wohl«, widersprach June. »Man kann an ihren Gemeinsinn appellieren.« Sie schlug vor, bei der nächsten Versammlung über den gemeinsamen Besuch »einer Show« zu diskutieren und einen Termin festzusetzen. Wie häufig in zu langen Versammlungen machte sich eine Mischung aus Apathie und Unruhe breit. Augen fielen zu, Schultern sackten nach unten, und in den verkrampften Beinen kribbelte und stach es. Erleichtert stimmten alle für den Betriebsausflug, besonders weil dieses Thema erst wieder im Oktober zur Sprache kommen sollte. Die Versammlung war zu Ende. Endlich durfte man intensiver dem Alkohol zusprechen.
Bisher hatte sich Henry an seine Regel gehalten, nichts Hochprozentiges zu konsumieren, und seinen Wein getrunken, aber jetzt brauchte er etwas Stärkeres. Als er einen Campari Soda bestellte und dabei wenig Soda signalisierte, gingen die Augenbrauen in die Höhe. Auf Henry wartete eine schrecklich erfreuliche Feuerprobe, aus der es leider kein Entrinnen gab. Huguette erwartete ihn zum Stelldichein. Ihr Vater war auf einem zweitägigen Parlamentarierausflug in Brüssel – das wusste sie und damit auch, dass Henry definitiv nicht Fahrbereitschaft im BMW hatte. Sie würde vergeblich warten müssen, denn er hatte um 21 Uhr eine andere Verabredung in der Familie Studley.
Beacon ging als Erster. Er hatte einen Anruf erhalten. Mr. Still saß nicht Richtung Victoria im Zug, sondern Richtung Euston, und käme in zwölf Minuten dort an. Das war auch das Stichwort für Montserrat. Sie sah Beacon gehen, vergewisserte sich, dass der Audi weg war, und sauste dann im Haus Nummer 7 die Treppe hinauf und klopfte an Lucys Tür, um Rad zu warnen. In spätestens drei Minuten müsse er weg sein. Dann begleitete sie ihn ins Erdgeschoss hinunter und weiter über die steile schmale Treppe ins Souterrain und auf den Vorplatz hinaus. Kaum hatte sie ihn Richtung Sloane Square verschwinden sehen, rannte sie schnurstracks ins oberste Stockwerk. Thomas schlief endlich einmal, die Mädchen schauten fern, während sie sich fürs Bett fertig machten, und Rabia trank eine Tasse Tee.
Das Haus Nummer 11, in dem die Studleys residierten, war das auffallendste Gebäude am Hexam Place. Es hob sich durch seine Größe, kunstvollere Balkongeländer und die Tatsache, dass es sich um ein freistehendes Haus handelte, von der übrigen Häuserzeile ab. Man betrat es durch ein von kannelierten Säulen gerahmtes Doppelportal, über dem das große Schlafzimmer lag. Von hier führten raumhohe Fenstertüren auf einen großen Balkon hinaus, auf dem in griechischen Vasen Palmen und Pampasgras wuchsen. Obwohl diese Fenster verriegelt und versperrt waren, wirkte das Schlafzimmer irgendwie exponierter und weniger sicher, als wenn dort eine feste Mauer gewesen wäre. Deshalb zog Oceane Studley einen Besuch bei Henry vor, anstatt ihn zu sich zu bitten.
Zehn Minuten vor 21 Uhr war Henry aus dem Dugong zurück. Schnell wechselte er seine Bettwäsche, zog die Rollos herunter und stellte die Weingläser bereit. Den Wein würde sie mitbringen. Das tat sie immer, auch wenn es erst zweimal passiert war. Heute wäre das dritte Mal. Zum Duschen blieb ihm keine Zeit mehr, allerdings hatte er schon morgens einmal geduscht. Das müsste eben genügen. Henry war unschlüssig: Wollte er Oceane sehen, oder wäre es ihm lieber gewesen, wenn sie ihn auf dem Handy angerufen und gesagt hätte, sie könne nicht kommen. In Wahrheit schob er Panik, solange sie in seinem Zimmer war, von der ersten bis zur letzten Minute. Vermutlich lag es an seinem jugendlichen Alter, dass er überhaupt funktionieren konnte und sich nicht vor Angst verkrampfte. Bei Huguette war das etwas ganz anderes. Da trieben sie es in Huguettes Wohnung, die anderthalb Kilometer weit weg lag und nicht ihrem Papa gehörte, auch wenn dieser mit Sicherheit die Miete bezahlte. Hier gehörte Lord Studley das ganze Haus, Henrys Zimmer genauso wie das eheliche Schlafgemach. Und Henry fürchtete sich davor, ausspioniert zu werden, sogar wenn er seinen Arbeitgeber definitiv in Brüssel wusste. Als er heute Abend aufgesperrt hatte, hatte er auf der Treppe Sondra getroffen. Sie war absolut nett zu ihm gewesen, und trotzdem quälte ihn immer noch die fixe Idee, sie hätte ihn argwöhnisch gemustert.
Oceane war eine höchst attraktive, knapp vierzigjährige Frau, und genau darin lag das Problem. Eigentlich fand Henry sie attraktiver als ihre Tochter, aber Huguette war jung, und das war ein Riesenvorteil. Jedenfalls hatte er nicht im Traum daran gedacht, Huguette zurückzuweisen. Aber zu Oceane Nein zu sagen – davor hatte er sich gefürchtet. Henry kannte zwar die Geschichte von Joseph und Potiphars Weib nicht, aber jeder, der sich diese Situation ausmalte, wusste, wie die Geschichte enden musste. Du sagst: Nein danke, lieber nicht, und sie verklickert ihrem Ehemann, der zufällig dein Boss ist, du hättest sie angemacht.
Er malte sich gerade das Ende dieser Geschichte aus, da ging die Tür auf, und herein kam Oceane. Sie klopfte nie an. Schließlich war Henry der Chauffeur ihres Mannes, egal, was er ihr vielleicht bedeutete. »Ach Liebling«, hauchte sie, »schwebst du bei meinem Anblick im siebten Himmel?« Sie presste ihren Unterleib an ihn und steckte ihm die Zunge in den Mund.
Henry reagierte dementsprechend. Ihm blieb gar nichts anderes übrig.
Montserrat wusste bestens Bescheid. Sie betrachtete es als ihre Aufgabe zu wissen, wer mit wem eine Affäre hatte, wer sich verdrückte, und wer sich trotz strikten Verbots einen BMW oder einen Jaguar ausborgte. Nein, erpresst hatte sie nie jemanden, aber sie genoss es, die Möglichkeit zu einer leicht abgewandelten Form von Erpressung in der Hinterhand zu haben. Ihre einzige Freundin am Hexam Place war Thea. Von allen Mitgliedern der Gesellschaft der heiligen Zita besaß nur Montserrat ein eigenes Auto, einen ziemlich alten VW, den sie in der Remise geparkt hatte, die zum Haus Nummer 7 gehörte.
Sämtliche Versuche, Rabia zum Eintritt in die Gesellschaft zu überreden, waren gescheitert. »Du müsstest doch gar nichts trinken. Jedenfalls keinen Alkohol, meine ich. Du würdest nur am Tisch sitzen und dich unterhalten. Und außerdem könntest du mit uns ausgehen.«
Rabia meinte, das könne sie sich nicht leisten. Außerdem würde ihr Papa Nein sagen, wenn sie fragen würde, ob sie in ein Pub gehen könne.
»Warum sagst du es ihm eigentlich?«
»Weil er mein Vater ist«, antwortete Rabia in ihrer schlichten direkten Art. »Ich habe keinen Mann mehr, der mir sagt, was ich tun soll.« Montserrat verdrehte die Augen, aber darauf ging Rabia nicht weiter ein und bot ihr stattdessen noch eine Tasse Tee an.
Montserrat meinte, ein Glas Wein wäre ihr lieber, aber vermutlich wolle Rabia nicht, dass sie eine Flasche hier heraufbrächte. »Nein, richtig«, sagte Rabia. »Entschuldigung, aber das ist das Reich der Kinder.« Und damit ging sie zu Thomas, der wieder vor sich hin wimmerte.
June, die Prinzessin und Rad Sothern, der Junes Großneffe war, tranken im Salon von Nummer 6 Kaffee. Die Prinzessin tolerierte diesen Verwandten von June nur deshalb, weil er ein berühmter freischaffender Schauspieler war. Außerdem sah er extrem gut aus und spielte in einer ihrer liebsten Klinikserien den Unfallchirurgen Mr. Fortescue. Mr. Fortescue war in der TV-Serie Avalon Clinic ein wichtiger Akteur mit wöchentlichem Auftritt und damit eine bekannte Persönlichkeit, die beim Überqueren des Sloane Square auffiel. June konnte Rad halbwegs leiden, obwohl sie genau wusste, dass er nur vorbeikam, wenn er nichts Besseres zu tun hatte. Sie hatte beobachtet, wie man ihn durch die Souterraintür ins Haus Nummer 7 geschleust hatte, und sie missbilligte seine Affäre mit Montserrat, die in ihren Augen eine ganz Durchtriebene war. Es war ihr ein Rätsel, wie er das Au-pair-Mädchen der Stills überhaupt kennengelernt hatte. Ihres Wissens war Rad nur ein einziges Mal mit den Bewohnern von Nummer 7 in Kontakt gekommen. Vor einigen Monaten hatte die Prinzessin hier im Haus einen Empfang gegeben und ihn dabei Lucy Still vorgestellt.
Die Prinzessin sprach ihn mit »Mr. Fortescue« an. Das hielt sie für witzig, obwohl Rad sie gebeten hatte, es nicht zu tun. Aber darum scherte sie sich nicht. Das Gespräch drehte sich immer nur um Klatschgeschichten. Klatsch und Tratsch aus der Film- und Fernsehwelt. Über den Hexam Place wurde nie gelästert. Das wäre Rad vielleicht doch unter die Haut gegangen. Denn eines war June klar: Rads häufige Besuche in Nummer 7 hatten nichts mit einer gewissen Sympathie für die Prinzessin zu tun. Damit wollte er nur sicherstellen, dass die Nachbarn bei seinem Anblick glaubten, seine Besuche gälten seiner Großtante und nicht Montserrat.
Wie immer wollte die Prinzessin von ihm alles über das Privatleben der Besetzung von Avalon Clinic erfahren. Er tat ihr den Gefallen in einer verwässerten Version, mit der sie sich offensichtlich zufriedengab.
»Mr. Fortescue, kann ich Ihnen einen Cognac anbieten?«
»Warum nicht?«, erwiderte Rad.
June bekam keinen angeboten, bediente sich aber trotzdem. Sie war müde und musste auch noch mit Gussie um den Block. Ohne einen Stups ihrerseits, wie sie es nannte, würde Rad noch stundenlang sitzen bleiben. Allerdings fiel der Stups etwas kräftiger aus. »Rad, Zeit zum Gehen. IKH möchte sich schlafen legen.«
Gussie wurde angeleint und Rad an Ort und Stelle verabschiedet, wie es June zu nennen pflegte. Und damit hinaus zur Vordertür und die Treppe hinab. Die Nacht war klar, aber langsam wurde es kalt. Rad nahm sich in der Ebury Bridge Road ein Taxi, während June mit Gussie ihre Runde um den Block drehte. Trotz der späten Stunde brannte in einigen Schlafzimmern noch Licht, während Damian und Roland immer noch in ihrem Wohnzimmer saßen. Allerdings hatten sie die Rollos heruntergezogen. Niemand war mehr auf der Straße, niemand konnte June durch die Vordertür gehen sehen. Also betrat sie das Haus mit Gussie über die bequemere Souterraintreppe.
Thea bewohnte im Haus Nummer 8 das Dachgeschoss, während Damian und Roland das Erdgeschoss und den ersten Stock belegten. Roland übernahm widerwillig einen Teil der Putzarbeiten, den Rest besorgte Thea. Nur für Miss Grieves im Souterrain putzte niemand. Sie konnte es sich nicht leisten. Thea ging bereits für sie einkaufen und brachte ihr manchmal eine Mahlzeit, was gegenüber Essen auf Rädern eine deutliche Verbesserung darstellte. Heute schob sie zusätzlich den Staubsauger herum und staubte die uralten Möbelstücke ab. Das war eine von vielen Arbeiten, die sie ungefragt erledigte, weil sie sich dazu verpflichtet fühlte. Aus demselben Grund übernahm sie auch für Damian und Roland sogenannte »Kleinigkeiten«. Sie blieb daheim, um einem Installateur aufzumachen oder vom Postboten ein Paket entgegenzunehmen, sie telefonierte mit der Stadtverwaltung, wenn es einen Grund zur Beschwerde gab, sie stellte die gemeinsame Recyclingtonne hinaus, tauschte Glühbirnen aus und wechselte Sicherungen. Eigentlich tat sie das nur ungern, sah aber keine Möglichkeit, wie sie jetzt damit aufhören könnte. Thea war auch nicht stolz auf ihre gutherzige Nachbarschaftshilfe. Ach, hätten sie solche Erledigungen doch nur glücklich gemacht! Wie schön wäre es gewesen, wenn sie sich ihres Wertes bewusst und innerlich zufrieden geworden wäre, weil sie unbezahlt etwas Nützliches geleistet hatte. Leider war sie am Ende nur abgekämpft und hatte die Nase voll. Und manchmal war sie sogar verbittert. Sie machte es eben, müde und enttäuscht.
Montserrat schien immer einen Mann zu haben. Und sie? Sie hatte vor zwei oder drei Jahren ihren letzten Freund gehabt. Die Jahre vergehen, hatte ihr ihre verheiratete Schwester Chloe unter die Nase gerieben. Oder um es mit Rolands Worten auszudrücken, der aus irgendeinem Buch zitierte: Rasch naht die Zeit auf Flügelrossen. Manchmal schoss es ihr durch den Kopf, dass sie sofort Ja sagen würde, wenn irgendein Mann sie um ein Rendezvous bäte, solange er nicht abgrundtief hässlich oder grob war. Allmählich entwickelte sich dieser gesichtslose Mann zu einem Traumgeliebten. Sie sah ihn vor sich, wie er in einem schönen Auto vorgefahren kam, um mit ihr einen Ausflug zu machen und sie zum Lunch einzuladen. Dann würde sie ihm vom Fenster aus zuwinken, könnte sich endlich einmal von Damian und Roland verabschieden, die Treppe hinunterlaufen und zur Tür hinaus.