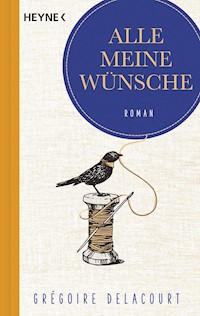16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantik
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jocelyne ist eine glückliche Lottogewinnerin. Doch den millionenschweren Scheck konnte sie nie einlösen – ihr war klar, dass er ihr geliebtes, einfaches Leben im Norden Frankreichs gehörig auf den Kopf stellen würde. Mit einem Teil des Geldes ist ihr Mann durchgebrannt. Für die übrigen Millionen hat Jocelyne nur einen Traum: sie sinnvoll auszugeben. Aber wie? Bei den Anonymen Gewinnern trifft sie auf Menschen, die wie sie mit plötzlichem Reichtum ringen. Während sie hier neue Freundschaften knüpft und sich zum ersten Mal seit Langem verliebt, versteht sie langsam, was für sie am schönsten wäre: ihr Geld an andere zu verschenken. Doch das erweist sich als gar nicht so einfach ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 230
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Grégoire Delacourt
Alle meine Träume
Roman
Sophia Marzolff
Für das Mädchen, das auf dem Auto saß,
immer noch ganz oben auf der Liste.
»Und nimmt man dir auch, was du besitzt, wer kann dir nehmen, was du gibst?«
Antoine de Saint-Exupéry
»Bei mir sind es Taschen. Alle Arten von Taschen. Shopper, Abendtäschchen, Envelope Handtaschen, Bucket Bags, Perlentäschchen, Doctor Bags, Tote Bags, Bowling Bags. Ich bin verrückt nach dem Zeug. Wobei es natürlich noch Verrückteres gibt, es soll ja Leute geben, die sammeln Eulen. U-hu-huu, diese heulenden Viecher. Oder Camembert-Schachteln. Oder Ambosse. Nee, also wirklich, Ambosse … Außerdem sagt meine Therapeutin, dass Bagomanie – so lautet mein Username als Sammlerin – nichts Krankhaftes ist. Nur eine Leidenschaft. Wie auch immer, an jenem Tag wollte ich unbedingt eine Birkin Bag haben. Aus Straußenleder, im Farbton Mandarine. Ich also rein in den TGV, erste Klasse und Einzelplatz, schließlich hat man’s ja. Rund fünfzig Minuten später bin ich in Paris, wo natürlich ein reserviertes Taxi auf mich wartet, mit einem kleinen Namensschild, so etwas liebe ich. Im Wageninnern Ozeanduft. Der Chauffeur fährt mich direkt zu Hermès, zu der altehrwürdigen Adresse Rue du Faubourg Saint-Honoré, das ist einfach die edelste, ganz abgesehen davon, dass es hier in Arras keinen Hermès-Laden gibt – als würden wir in der Pampa leben –, und wisst ihr, was die Verkäuferin zu mir gesagt hat?
Zuerst einmal sagt sie gar nichts und lächelt nur. Kein angenehmes Lächeln wohlgemerkt, mehr ein verkniffener Mund, eine Grimasse. Sie sieht mich an, ja, sie mustert mich, und ich spüre deutlich einen Hauch Verachtung. Nur einen Hauch, aber doch. Sicher, ich sah nicht ganz so aus wie die anderen Kundinnen. Die Provinz wittert man drei Meilen gegen den Wind, die hat einen ganz eigenen Geruch. Die Verkäuferin erklärt mir, die Wartezeit für eine Birkin Bag aus Straußenleder beträgt drei Jahre. Drei Jahre Wartezeit! Aber selbst ein Mensch lässt sich in neun Monaten produzieren, sage ich zu ihr, und wegen ihres musternden Blicks füge ich noch hinzu, dass ich das Geld habe, daran soll’s nicht hapern, ich zahle auch den doppelten Preis. Hier, sehen Sie, dreißigtausend Euro.
Sie zieht die Augenbrauen hoch, nur unmerklich, aber mir ist klar, dass ich sehen soll, wie sie die Augenbrauen hochzieht. Ich soll spüren, wie lästig ich ihr bin. Madame, hat sie schließlich in einem Ton geantwortet, als wäre ich völlig unterbelichtet, der Strauß für Ihre Tasche, der ist noch nicht einmal geboren. Weit davon entfernt. Wir haben eine Straußenzucht in Südafrika, und die Eier für die nächsten drei Jahre sind schon reserviert, wenn Sie sich also registrieren möchten, wird das Ei für Ihre Tasche in drei Jahren ausgebrütet. Schlagen Sie noch ein Jahr drauf, denn so lange dauert es, bis Ihr Tier ausgewachsen ist.
Und wenn ich das kleinste Modell nehme, muss ich dann auch warten, bis das Tier ausgewachsen ist?
Das kleinste Modell, Madame, das wir B25 nennen, B für Birkin, 25 für das Format, ist ja gerade das seltenste.
Ach so.
Die Produktionszeit für Ihre Birkin Bag, fährt sie fort, und inzwischen nahm ich einen geradezu gereizten Unterton wahr, beträgt viereinhalb Jahre. Also, sollen wir die Bestellung aufnehmen, Madame?
Und auch einhunderttausend Euro können den Brutprozess nicht beschleunigen?, habe ich gefragt.
Nein, Madame, ebenso wenig wie zweihundert- oder dreihunderttausend Euro. Sie sind hier bei Hermès, nicht bei Teppich-Tausch.
Ich war enttäuscht, kann ich euch sagen. Richtig enttäuscht. Um mich ein bisschen zu trösten, bin ich daraufhin zu Dalloyau gegangen – es sind nur sechshundert Meter zu Fuß, aber ich habe mir ein Uber genommen, wozu ist man schließlich vermögend. Bei Dalloyau habe ich mir zwei Tonka-Törtchen gegönnt, ein sehr feines Dessert mit Karamell, Schokolade, Nougat. Aber es konnte mich nicht wirklich aufmuntern. Und auf der Rückfahrt im Zug hatte ich auch noch Sodbrennen, richtig unangenehm …«
»Herzlichen Dank, Brigitte«, unterbricht unser Gruppenleiter und klatscht. Er ist ein liebenswürdiger Mensch, der vor allem viel Geduld besitzt, denn Brigitte ist keine, die sich kurzfasst. »Lasst uns einmal über ihren Wortbeitrag nachdenken«, fügt er hinzu, nachdem der Beifall der Gruppe verebbt ist. »Was sagt uns Brigittes Erfahrung? Vielleicht fällt dem einen oder anderen etwas dazu ein? Georges? Dir vielleicht?«
Georges hebt langsam den Kopf. Er ist ein Schüchterner. Fünf Richtige und zwei Sternzahlen, an einem dreizehnten November vor fünf Jahren. Eine Erschütterung wie ein Hochhaus, das über einem zusammenbricht. Ein Hiroshima im Schädel. 169827000 Euro und ein paar Zerquetschte. Im Folgemonat Scheidung. Seine bessere Hälfte mit der Hälfte auf und davon. Fünf Jahre Depressionen. Ein Suizidversuch. Nunmehr ein verknöcherter Mensch, das Gesicht wie versteinert.
Georges räuspert sich. »Hm … Dass man mit Geld weder Geduld noch Wünsche kaufen kann. Ähm, würde ich sagen.«
»Danke, Georges. Ein wertvoller Gedanke.« Wir klatschen. »Noch jemand? Raoul?«
Raoul. Die Ziehung vom Valentinstag. 30341254 Euro und 27 Cent. Seither hat es viele Valentinas gegeben, doch kaum schenkt er ihnen einen Diamanten – mindestens drei Karat, weniger ist zu mickrig, hat man ihm erklärt –, verschwinden sie mitsamt dem Ring am Finger. Manchmal auch noch mit etwas Tafelsilber.
»Arroganz«, wirft Raoul ein. »Geld macht menschliche Arroganz sichtbar.«
Er senkt den Blick, plötzlich blass geworden, wirkt gedankenverloren. Eine Erinnerung steigt in ihm hoch: »In meiner Jugend kam ich jeden Tag an einem prächtigen Haus am Dorfausgang vorbei. Ich fand es wunderschön. Es hatte vorn einen großen Garten, darin Trauerweiden mit streichelzarten Zweigen, und hinter dem Haus, hieß es, gebe es noch einen Teich, und sogar ein Wäldchen. Aus einem der Fenster im ersten Stock drang Klaviermusik, und oft bin ich stehen geblieben, um zuzuhören. Die Melodien klangen so schön, dass es mir manchmal die Tränen in die Augen trieb. Später fand ich heraus, dass es die Gnossiennes von Satie waren.
»Gnocchi?«, platzt Brigitte dazwischen.
»Brigitte!«, ruft unser Leiter. »Wir fallen niemandem ins Wort.«
Raoul starrt vor sich hin. Ein grauer Schleier trübt seinen Blick. Eine Schwermut à la Satie.
»Nachdem ich das viele Geld gewonnen hatte und allmählich das Ausmaß der Folgen realisierte, dachte ich, es sei an der Zeit, etwas für mich zu tun. Also bin ich zum ersten Mal nach Jahren wieder zu diesem Haus gegangen. Es sah ganz unverändert aus. Ich habe auf die Klingel gedrückt und mit heftigem Herzklopfen abgewartet. Ein kleines Mädchen öffnete die Tür. Mit einem Kind hatte ich nicht gerechnet, und ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Sie rief: Maman, da ist jemand für dich!, und plötzlich hätte ich am liebsten Reißaus genommen. Als ihre Mutter kam, schaute ich auf ihre Hände. Sie hatte sehr lange Finger, eine Spanne von mindestens einer Oktave. Ja?, fragte sie. Ich atmete tief ein, wie mein Osteopath es mir beigebracht hat, und sprach den Satz aus, den ich all die Jahre hundertmal, tausendmal geübt hatte.«
Die ganze Runde blickt ihn gespannt an.
»Ich würde gern Ihr Haus kaufen.«
Raoul hebt den Kopf. Seine Wangen sind gerötet. Er ist aufgewühlt.
»Sie hat mich angelächelt und gesagt: Selbst wenn Sie mir zwanzig Millionen dafür bieten würden, würde ich es nicht verkaufen. Ich antwortete ihr, die hätte ich tatsächlich, die zwanzig Millionen. Für das Haus. Ich könnte sofort zahlen. Sie hat mich nur mitfühlend angesehen, ich weiß nicht, ob sie mich für verrückt oder schlicht für einen armen Tropf hielt. Da habe ich mich bei ihr für die Störung entschuldigt und mich für die Gnossiennes bedankt. Ich erzählte ihr, die Musik habe meine Jugend versüßt.«
Raouls Augen glänzen, als er schließt: »Diese Frau war so viel reicher als ich. Als jeder von uns hier.«
Alle zehn Teilnehmer klatschen. Unser Gruppenleiter ist sehr zufrieden. Es fehlt nicht viel, und er würde mit sich selbst einen High five machen.
Er lobt den Zusammenhalt der Gruppe. Jedes Mitglied sei auf dem Weg der Besserung und lerne allmählich, sein Geld mit der nötigen Distanz richtig einzusetzen. Trotzdem sei es noch ein weiter Weg.
Denn man erholt sich nicht von einem Tag auf den andern von einer Millionenlast, die auf einen niederstürzt, das eigene Leben umkrempelt, eigene Pläne über den Haufen wirft und manchmal die dunklen Seiten seiner Mitmenschen offenbart. Mitmenschen, die plötzlich die wundersame Macht des Geldes entdecken.
Des Geldes anderer Leute.
Unseres Geldes.
»Und du, Jocelyne?«, fragt der Gruppenleiter und wendet sich mir zu. »Was ist deine Geschichte?«
Oh, über mein Leben könnte man einen ganzen Roman schreiben. Der vermutlich sogar erfolgreich wäre.[1]
Ich bin eine ganz normale Frau aus Arras, wo ich vor einundfünfzig Jahren geboren wurde.
Meine Mutter starb, als ich siebzehn war. Ein Schlaganfall. Mitten auf dem Gehweg ging sie plötzlich zu Boden, sackte zusammen wie ein Akkordeon. Auf ihrem Kleid breitete sich in Schritthöhe ein dunkler Fleck aus, und ich empfand Scham, ich schämte mich für sie, für mich, für alle Frauen. Sie war immer so zart und elegant gewesen, und dann ein solcher Absturz, eine solche Kränkung der Schönheit. Die folgenden Jahre mussten Papa und ich allein zurechtkommen. Ein alter Mann und sein Stock. Mussten ohne ihr Lachen auskommen. Ohne ihr schwingendes Kleid, wenn sie glücklich war. Ihren scharfen Blick, wenn sie uns mit Kohlestift skizzierte, ihren weichen Blick, wenn sie uns mit Aquarellfarben malte. Maman war Künstlerin. Sie betrachtete die Welt anders als wir. Sie sah immer zunächst deren Schönheit, ihre liebenswerten Seiten. Es war ihr Einfluss, der mich lange davon träumen ließ, Modedesignerin zu werden. Damals liebäugelte ich mit der Pariser Modeschule Esmod oder dem Studio Berçot, doch Paris ist weit weg, und Papa hatte begonnen, »etwas verwirbelt im Kopf« zu werden, wie meine Freundinnen Danièle und Françoise es nannten, die den Schönheitssalon Coiff’Esthétique führen.
Verwirbelt im Kopf, den Ausdruck fanden die Zwillinge lustig, weil er sie an das Wirbeln der Lottokugeln erinnerte, und nach Lotto waren sie süchtig. Ich fand es weniger lustig, denn der Zähler in Papas Gedächtnis sprang alle sechs Minuten auf null. Dann sah er mich mit großen Augen an, manchmal wie ein Kind, das etwas angestellt hat, und fragte: »Und wer sind Sie, Mademoiselle?«
Lange brachte mich diese Frage zum Weinen, denn von seinem eigenen Vater nicht erkannt zu werden, ist unendlich traurig.
Aber mit der Zeit gewöhnte ich mich daran.
Ich brach nicht mehr in Tränen aus.
Doch eben wegen dieser Krankheit, die ihn auch Mamans Tod vergessen ließ (»Wann kommt sie nach Hause?«, fragte er, wenn er hungrig wurde, oder: »Weißt du, wo sie mein weißes Hemd hingetan hat?«), gab ich meinen Traum von Mode und Glamour auf und suchte mir, um bei Papa zu bleiben, eine Arbeit in Arras, in der Kurzwarenhandlung Pillard.
Ich konnte mich für die Knöpfe dort begeistern wie Brigitte aus unserer Gruppe der Anonymen Gewinner (AG) für Taschen, wenngleich ich nicht gerade knopfomanisch bin, um ihre etwas alberne Bagomanie aufzunehmen. Ich fand die diversen Metallschnallen, die zweilöchrigen Holzknöpfe mit Druckmuster, die gewölbten goldenen Stegknöpfe, die Schnapp- und Druckknöpfe, die verschlungenen Kordelknöpfe einfach toll. Auch jede Art von Stoff entzückte mich. Krepp, Perkal, Popeline, Cretonne. Ich sehnte mich damals nach Prinzessinnenkleidern und natürlich nach einem Prinzen, und am Ende war es Jocelyn,[2] ein sympathischer Kerl ohne weißes Ross, ohne wallendes blondes Haar oder blaue Augen, der mich wach küsste, mit dem ich zwei lebendige Kinder und eine totgeborene kleine Tochter bekam und der meinem Herzen später den Dolchstoß versetzen sollte, indem er mich sitzenließ und sich mit den 18547301 Euro und 28 Cent davonmachte, die ich bei Euro Millions gewonnen hatte, per Zufallsgenerator, und mit einem Einsatz von zwei Euro.
Dieses viele Geld hatte mein Leben ordentlich verwirbelt.
Lange war ich unschlüssig geblieben, ob ich den Scheck überhaupt einlösen sollte, und hatte ihn in einem alten Schuh versteckt. Danièle und Françoise hätten mir natürlich einen Vogel gezeigt – so viel Geld auf einen Schlag, mit dem ich mir ein schönes Leben machen konnte! Aber ich mochte mein Leben, wie es war. Es war redlich und einfach. Es war gut. Mein Mann liebte mich vorbehaltlos. Er machte mich glücklich. Nadine und Romain waren gute Kinder, auch wenn Romain womöglich ein bisschen länger brauchte, um sich zu finden, wie die Psychologen das nennen.
Meine Zwillingsfreundinnen hätten mir keine Ruhe gelassen.
Stell dir nur vor, Jocelyne, stell dir doch nur vor!
Stell dir was vor?
Was du alles tun könntest.
Ich lache. Nun, ich werde deswegen nicht über Nacht zur Miss World und ebenso wenig George Clooney heiraten.
O nein, bloß nicht den, der lebt mit einem Schwein[3] zusammen. Und na gut, vielleicht nicht gerade Miss World, fährt Françoise fort, aber du könntest dich dem ein bisschen annähern. Wie wäre es mit Körbchengröße fünfundneunzig C? Die Männer glauben ja alle, sie hätten so große Hände. Und vielleicht neue Zähne? Einen Personal Coach für deinen Body. Einen anderen für die Ernährung …
O ja, zwei Coachs, hätte Danièle vermutlich mit geschürzten Lippen gesäuselt, muskulöse, hübsche Jungs, die nach Brut von Fabergé duften. Außerdem könntest du dann wenigstens deine Freundinnen ein bisschen verwöhnen.
Als Jocelyn mich bestahl, als er mit dem ganzen Geld verschwand, brach mein Leben zusammen. Und damit alles, woran ich geglaubt hatte. Vor allem an das Gute im Menschen.
Einige Jahre zuvor hatte ich den Kurzwarenladen übernommen, der nun auf meinen Namen lief, außerdem hatte ich begonnen, einen Blog zu schreiben, der Zehngoldfinger hieß. In diesem Blog ging es um das Glück des Strickens, Nähens und Stickens, und ich stellte fest, dass er Frauen half – manche von ihnen hatten den Faden ergriffen, den ich ihnen zuwarf, und waren nicht untergegangen. Im Laufe der Zeit hat sich eine große Community gebildet, eine verschworene Gemeinschaft, in der man sich gegenseitig unterstützt. Und mehrmals durfte ich sogar Artikel für den Observateur de l’Arrageois und La Voix du Nord schreiben.
All das hatte mein Mann durch seinen Verrat ebenfalls beschmutzt.
Was uns die Männer antun, ist wie ein Fleck auf einem Löschpapier, der immer größer wird.
In der Folge hatte ich alle Brücken abgebrochen. Hatte alles hinter mir gelassen. Arras. Den Laden. Den Blog. Meine Zwillingsfreundinnen. Meine Zukunftsvisionen einer glücklichen Ehefrau. Einer zufriedenen Großmutter eines Tages.
Kälte hatte mich erfasst. Ich war nach Nizza geflohen, in die Sonne, wo ich mir die Zeit nahm, um wieder auf die Beine zu kommen. Und Zeit brauchte es.
Dort im Süden lernte ich einen Mann kennen. Doch es war nie wieder so wie früher. Nicht alle Wunden verheilen.
Und so antworte ich jetzt auf die Frage des Gruppenleiters mit belegter Stimme: »Meine Geschichte? Das Geld hat alles, was ich an Liebe in mir hatte, getötet.«
Seit einem halben Jahr bin ich zurück in Arras.
Das Haus in Villefranche-sur-Mer, das ich vor drei Jahren in Südfrankreich gekauft hatte, habe ich wieder verkauft. Ich hatte es erworben, um möglichst fern von allem zu leben, hatte Papa nachkommen lassen und eine Pflegerin für ihn eingestellt. Meine neue Liebesgeschichte – mit jenem Mann, dem ich am Strand von Nizza begegnet war und der so gut aussah wie Vittorio Gassman – war am Ende nicht wirklich eine. Mehr als eine Liebe war es eine Insel, auf die ich mich nach dem Verrat meines Manns geflüchtet hatte. Er hatte kräftige Arme, die mich festhielten, eine beruhigende Stimme. Er liebte mich, mein Vittorio. Er fand mich schön und sagte es mir. Aber er konnte auch schweigen – eine rare Qualität bei Männern – und rührte nicht an meinen Kummer, riss meine Wunden nicht auf. Ich war seine Prinzessin. Mit ihm zusammen empfand ich wieder neue Leichtigkeit. Ich verlor meine Angst. Abends saßen wir gemeinsam auf der Terrasse mit Meerblick und hörten Opernmusik. Er betrachtete den schimmernden Horizont und meinte, unsere Zukunft vor sich zu sehen.
»Das Beste liegt noch immer vor uns, Jocelyne«, flüsterte er, während er uns Wein nachschenkte oder meine Hand streichelte.
Seine Haut war warm und weich, der Druck seiner Finger gerade richtig. Ich hatte ihm so gern glauben wollen, ich hatte es versucht, mit aller Kraft, doch mein Herz war kalt geblieben.
Vittorio bekam meinen Körper, meine Haut, meine Arme, meine Küsse, meinen Atem, und manchmal mein Lachen, wenn Papa sich in der Hängematte verhedderte oder uns fragte, ob wir seine Eltern seien – aber er bekam nicht mein Herz. Wegen Jocelyn war es zu einem Kiesel versteinert. Zu einem kleinen Grabstein.
Also ging Vittorio eines Morgens davon, verschwand lautlos wie ein fallendes Blütenblatt, mit anmutiger Langsamkeit, und ich weiß, er ging nicht, weil ich ihn nicht liebte, sondern weil seine Liebe nicht die Kälte in mir vertreiben konnte und ihn das bekümmerte.
Seit einem halben Jahr bin ich zurück in Arras.
Ich arbeite wieder im Kurzwarenladen, in Teilzeit. Und ich lebe wieder zu zweit mit Papa. Habe eine neue Pflegerin eingestellt, die nur vormittags da ist. Um ihn zu baden, zu massieren, zu versorgen. Nachmittags, nach einem kleinen Mittagsschlaf, gehen Papa und ich ausführlich spazieren, und dann denke ich mir verschiedene Leben für ihn aus, weil er sich an seines nicht mehr erinnern kann und weil er meinen Bericht nach spätestens sechs Minuten wieder vergessen hat. Ich male mir ganze Lebensläufe für ihn aus, erfinde große, schicksalhafte Momente.
Gestern habe ich ihm erzählt, er sei ein berühmter Rennfahrer gewesen, befreundet mit Juan Manuel Fangio, den man El Chueco – den Krummbeinigen – nannte. Ich erzählte ihm von jenem verrückten Rennen beim Großen Preis von Deutschland 1957, als El Chueco in seinem Maserati mit nur halb gefülltem Tank erneut losbrauste, und Papa lachte.
»Ach ja, ich erinnere mich«, sagte er, »sogar sehr gut. Dem kleinen Argentinier hat man damals keine großen Chancen eingeräumt.«
Und für ein paar Minuten war ich wieder ein glückliches kleines Mädchen.
Heute Abend werde ich ihm von den Case Study Houses erzählen, die er in den Sechzigern zusammen mit den Brüdern Eames entworfen hat.
In der langen Zeit, in der ich weg war, hat Mado den Laden weitergeführt. Wir beide hatten uns über meinen Zehngoldfinger-Blog kennengelernt. Mados persönliche Geschichte – der Tod ihrer erwachsenen Tochter Barbara, die heute so alt wäre wie mein Sohn – hatte mich zutiefst berührt. Eine Mutter sollte so etwas nie erleben müssen, und ich weiß, wovon ich spreche. Die Welt gerät aus den Fugen. Mado war am Boden zerstört. Eine zarte Person, ein Vögelchen mit geringer Lebenserwartung. Also hatte ich sie bei mir im Laden eingestellt, auch wenn ich zu dem Zeitpunkt nicht wirklich eine Verkäuferin suchte. Im Laden blieb sie wenigstens nicht allein. Dort war sie zu beschäftigt, um zu grübeln und durchzudrehen.
Mado brauchte eine Weile, bis sie es über sich brachte, die Kundinnen anzusprechen. Bis sie sich zu einem schwachen Lächeln durchrang und Produkte zu empfehlen begann, Schnittmuster vorschlug oder Neuwaren anpries. Nach und nach kam sie mit hübschen Dekorationsideen für das Schaufenster an. Sie lancierte einen Scrapbooking-Wettbewerb mit Stoffresten. Organisierte eine Mützen-, Handschuh- und Schal-Strickaktion mit fröhlichen bunten Wollfarben für die Senioren im Saint-François- und im Saint-Camille-Altenheim. Mado war von einem verletzten Spatz zu einer unternehmungslustigen Taube geworden, und als ich nach Nizza floh, weil Jocelyn mein Herz zerstört hatte, war es für mich eine große Erleichterung, ihr den Kurzwarenladen überlassen zu können.
Als ich nach Nizza floh und einfach nur noch sterben wollte.
Die Nonnen des Centre Sainte-Geneviève retteten mein Leben. Auch Vittorio rettete mein Leben. Auch die Liebe meiner Tochter und die Hoffnungen, die ich für das Leben meines Sohns hegte. Das Lachen der Zwillinge. Die aufmunternden Worte Hunderter, ja Tausender Frauen, die mir auf Zehngoldfinger folgten. Denn am Ende ging ich doch nicht zugrunde am Verrat des Mannes, den ich liebte. Ich starb nicht an seinem Dolchstoß. Starb nicht daran, dass er mich zurückließ wie einen im Sommer ausgesetzten Hund. Starb auch nicht an meinem Unvermögen, ihm zu vergeben, als er wieder zu mir zurückwollte. Ich möchte wieder nach Hause kommen, hatte er mir geschrieben, nachdem er von den rund achtzehn Millionen, die er mir gestohlen hatte, 3361296 Euro und 56 Cent ausgegeben hatte. Ich möchte wieder nach Hause kommen, flehte er, wieder mit dir zusammenleben, du fehlst mir, Jocelyne, Geld ist nicht alles, Geld entfremdet nur.
Ich konnte ihm nicht vergeben.
Ich habe auf seinen verzweifelten Brief nie geantwortet.
Doch diesmal löste ich den Scheck ein, den er beigelegt hatte, den Restbetrag meines Geldes, 15186004 Euro und 72 Cent, die er nicht ausgegeben hatte oder nicht auszugeben geschafft hatte, schließlich kann man nicht gleichzeitig in drei Häusern leben und gleichzeitig fünf Autos fahren. Geld kann uns nicht vervielfältigen, wir bleiben immer ein Einzelwesen. Sicher, man kann damit einen Kühlschrank füllen, ein ganzes Haus einrichten, ein ganzes Leben, bis zum Überdruss, und genau das hatte Jo getan, er hatte sich mit meinem Geld bis zum Überdruss befüllt. Hatte seine Jungenträume wahr gemacht, einen Porsche Cayenne gekauft, eine Seiko Quartz oder eine Patek Philippe, ich weiß es nicht mehr genau, ist mir auch egal, einen großen Flachbildschirm, den kompletten James Bond auf DVD, Brioni-Anzüge, und vermutlich auch leichte Mädchen, junge Frauen mit perfekten Brüsten, glänzenden vollen Lippen, einem bonbonglatten Venushügel, wahre Naschwerke, Objekte männlicher Lust, die Dinge zuließen, die ich ihm verweigert hatte, wenn er seine gelegentlichen Wutanfälle hatte und seine bösartigen Seiten zeigte, wenn das Bier seinen Blick trübte und ich in seinen Augen zu einem bloßen Stück Fleisch wurde.
Trotzdem war ich damals geblieben. Wegen der Kinder und weil es für eine Frau schwierig, wenn nicht gar unmöglich ist, in dieser Schmach zu leben, in der finanziellen Klemme zu stecken, allein mit zwei kleinen Kindern. Weil es sehr schwer ist, eine Wohnung und eine Arbeit zu finden in dieser Männerwelt, in der so viele noch die Vorstellung haben, eine Frau sei selbst schuld, sie hätte ja nur, sie müsste eben, sie brauche sich nicht einzubilden …
Männer halten zusammen wie ein Wolfsrudel, und besäßen wir nicht diesen Lebensinstinkt, diese unglaubliche Fähigkeit zur Liebe, würden wir jedes Mal zerfleischt und gefressen werden. Ich war bei Jo geblieben, weil ich ihn liebte. Aber ich konnte ihm später nicht vergeben. Ließ mich nicht von seinem honigsüßen, wachsweichen Gurren einlullen. Ich überließ ihn sich selbst, seiner eigenen Gesellschaft ausgeliefert, wie man einen Hund im Dreck sitzen lässt. Ja, ich blieb standhaft, trotz all dieser steinzeitlichen weiblichen Schuldgefühle, trotz all der Zärtlichkeit und Demut, die ich von Maman gelernt hatte, meiner Königin, die glaubte, dass überall Schönheit und Güte zu finden seien, man müsse nur richtig hinsehen. Ich sah hier absichtlich nicht hin, verschloss fest die Augen und wartete ab. Ich biss mir auf die Lippen, ballte die Fäuste und wartete ab, dass Gewitter und Erdbeben vorüberzogen, bis ich eines Tages von den Zwillingen erfuhr, dass Jo in seinem großen, menschenleeren Luxusapartment an der Brüsseler Place des Sablons von seinen Nachbarn tot aufgefunden worden war, auf seinem weißen Vollledersofa liegend wie auf einer Leichenbahre.
Später erklärte mir der Arzt, er sei an gebrochenem Herzen gestorben. Ich glaube das nicht. Er starb an dem, was Männer am meisten fürchten.
Selbstverachtung.
Von den 18547301 Euro und 28 Cent, die ich bei Euro Millions gewonnen hatte, blieben mir also noch rund fünfzehn Millionen – die Villa in Villefranche-sur-Mer hatte ich sogar noch mit einem leichten Wertzuwachs verkauft.
In dem Jahr, als ich meine letzte Liste von Wünschen angelegt hatte, hatte ich mir vorgenommen, jemandem aufs Geratewohl eine Million zu schenken, irgendjemandem, den mir der Zufall zuspielte. Doch dieser Zufall war noch nicht eingetreten. Ich war noch immer nicht auf jenes unverhoffte Lächeln gestoßen, auf die kleine Zeitungsmeldung in Vermischtes, auf den entscheidenden traurigen Blick.
Wie vorgenommen, hatte ich meiner Tochter geholfen, ihren ersten großen Film zu realisieren. Vorher hatte Nadine nur Kurzfilme gedreht, und dann gewann sie im folgenden Jahr gleich einen wichtigen Preis in der Sektion Un Certain Regard von Cannes. Es war die Geschichte einer Frau, die ein misshandeltes Kind entführt, um es zu retten, dann aber erleben muss, dass sich das Kind nach seinen Peinigern zurücksehnt.
»Nicht sehr lustig«, meinte ich zu ihr, »aber aufrüttelnd.«
Ich musste an The Kid von Charlie Chaplin denken. Seit diesem Preis war Nadine sehr gefragt. Sie bekam zahlreiche Drehbücher angeboten. Trotzdem stieg ihr die Sache nicht zu Kopf. Sie wusste um die Flüchtigkeit der Dinge. Um die Zerbrechlichkeit des Lebens.
Ich hatte immer versucht, ihr all das zu geben, wozu Maman bei mir nicht mehr die Zeit blieb. Flügel und Wurzeln. Ich war stolz auf meine Tochter. Stolz wie eine Löwin. Eine wilde Raubkatze. Fergus, Nadines irischer Ehemann, war von Aardman Animations weggegangen, wo er als Trickgrafiker gearbeitet hatte, um sich um die Postproduktion (ich glaube, so heißt es) von Nadines Filmen, vor allem aber um ihren gemeinsamen Sohn Oliver zu kümmern.
Oliver. Ich weiß, dass sie diesen Vornamen wegen Oliver Barrett IV. (Ryan O’Neal) gewählt hat, der sich so leidenschaftlich in Jennifer Cavilleri (Ali MacGraw) verliebt. Wegen dieser Liebesgeschichte, die nur von kurzer Dauer, dafür aber von einer unvergesslichen, fast unerträglichen Intensität ist. Wegen der Musik von Francis Lai und wegen unserer sprudelnden Tränen, für die wir drei ganze Kleenexboxen und am nächsten Morgen Augentropfen benötigten. Nadine und ich hatten uns den Film gleich zweimal hintereinander angesehen, in fester Umarmung schluchzend miteinander verschmolzen, nachdem Jo mich im Stich gelassen hatte, nachdem unsere Lebenswege sich für immer getrennt hatten.
Oliver ist drei Jahre alt. Es sind die drei Jahre, die ich in meinem südfranzösischen Exil verbracht habe. Er nennt mich Grammy. Plappert eine ulkige Mischung aus Englisch und Französisch, die für mich, die ich nur Don’t worry, be happy und Play it again, Sam kenne, ungewohnt ist. Ich bin eine liebevolle Großmutter, honigweich, zuckersüß, nutellasüß, pfannkuchensüß … Nadine hat mich angefleht, ich soll aufhören, ihm Kleider zu schicken.
»Allmählich können wir einen ganzen Laden aufmachen«, meint sie, aber ich kann es einfach nicht lassen.
Ich liebe Geschäfte für Kindermode. Sie machen einem Lust, Kinder zu kriegen, sie fest zu umarmen, ans Herz zu drücken, den Duft von Dickmilch und Brioche einzuatmen, von Windelcreme und Babylotion. Sie erinnern mich an mein eigenes Mutterglück, an diese ursprünglichen, fast tierischen Freuden. Sie erinnern mich an Nadège, mein kleines Mädchen, das auf dieser Welt keinen Tag gelebt hat, in meinem Herzen aber unsterblich ist.
Nadine und Fergus wohnen abwechselnd in London und Arras. Ich habe hier in der Rue de la Housse ein großes Haus gemietet, von dessen einer Seite man auf die Kirche Saint-Jean-Baptiste blickt und von der anderen auf den großen Glockenturm des Rathauses, den Belfried von Arras. Es liegt nicht weit entfernt von der Place des Héros und jenem Bar-Tabac, wo ich mit den Zwillingen diesen verfluchten Lottoschein ausfüllte und der Zufallsgenerator mir eine 6, eine 7, eine 24, eine 30, eine 32 und als Sternzahlen die 4 und die 5 ausspuckte. Nadine und Fergus haben im Haus ihre eigenen Schlafzimmer und zwei Badezimmer. Ich mag es, ihre Geräusche zu hören, wenn sie da sind, ihren Lärm und ihr Lachen, und auch die kleinen Spuren des Chaos, die Oliver überall hinterlässt. Es erinnert mich an meine eigene Kindheit, an die Zeit, als Maman sich die Welt ermalte und Papa gut gelaunt pfeifend von der Chemiefabrik in Tilloy-lès-Mofflaines zurückkam, weil er kurz davor war, ein neues Produkt zu entwickeln, etwas Nützliches für die Menschheit, wie er mit einigem Stolz berichtete.
Es war die Blauer-Himmel-Zeit. Die Zeit der Unschuld.
Wenn ich nach meinem Geldgewinn die 18547301 Euro und 28 Cent nicht einlösen wollte, dann, weil ich dunkel ahnte, dass diese Summe unser Leben zerstören würde. Und ich hatte recht behalten.
Das ist nun drei Jahre her.
Ich gehe zwar weiterhin jede Woche zu den Meetings der Anonymen Gewinner, doch ich fühle mich geheilt.
Und ich habe fest vor, all mein Geld loszuwerden.