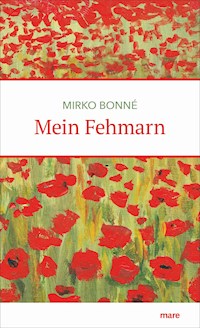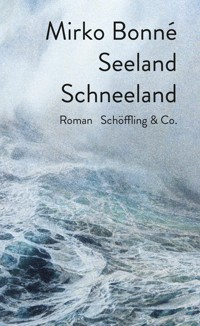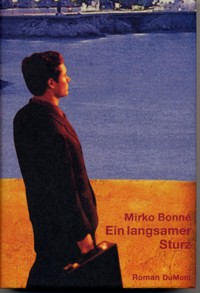19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schöffling & Co.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was fängt man mit dem Leben an, wenn die Tage gezählt sind? Das muss Benno Romik, ehemals Brückenkommissar in Hamburg, sich fragen, als er mit einer tödlichen Diagnose konfrontiert wird. Während er um Fassung ringt und überlegt, was und wer ihm für seine präzise errechnete Restzeit wichtig ist, wird sein Leben gewaltig durcheinandergeworfen, ja geradezu gesprengt. Denn mit einer Detonation aus heftigem Protest tritt Hollie Magenta in seine Welt und findet verletzt bei ihm Zuflucht. Sie und ihre Gruppe infolge des G20-Gipfel radikalisierter »Zertrümmerfrauen« setzen Autos in Brand, haben aber, wie sich herausstellt, auch noch größere Pläne. Und je näher Dr. Romik die 21-Jährige kennenlernt, desto mehr wird er darin verwickelt. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Mit seinem neuen, meisterlichen Roman Alle ungezählten Sterne sprengt und baut Mirko Bonné mit seiner intensiven poetischen Sprache Brücken über heikles Terrain zwischen den Generationen. Voller Witz, mit großer Wucht und Präzision führt er uns die Zerbrechlichkeit unserer Gegenwart vor Augen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 411
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
[Cover]
Titel
Widmung
Motto
1 Die Münze unter der Zunge
2 Rotverschiebung, Todverschiebung
3 Im Meer der Ruhe
4 Das Kommando
5 Tag, Pfauenauge
6 Aus dem Album der Ausflüchte
7 Gypsophila
8 Ein Mumientreffen
9 Die Brücke im Flur
10 Versuch einer Beschreibung
11 Die Kostüme der Müdigkeit
12 Höhere Gewalt
13 Die Lilie
14 Aus den gesammelten Abschweifungen
15 Zertrümmerung
16 Rover und Cessna
17 Botschaften im Regen
18 Am Lagrange-Punkt
19 Fiasko
20 Flucht
21 Grauschleier
22 Fabers Sand
23 Willkommen im Untergrund
24 Die Entzweiung
25 Unter Möwen
26 Instandsetzung eines Lochs
27 Der abgetrennte Arm
28 Todesanzeigen
29 Tyltow
30 Blau wie See und Himmel
31 Sternenkinder
32 Wiedersehen mit einem Unbekannten
33 Im Wald ganz aus Erinnerungen
34 Ein Sternenkind kehrt zurück
35 Hinterm Licht
36 Schuppenstunden
37 Das Silberpapier
38 Zschendlow
39 Das besetzte Schloss
40 Kleine Nachtwanderung mit Bosie
41 Der Anfang der Wahrheit
42 Vergessen
Dank
Quellennachweis
Autor:innenporträt
Kurzbeschreibung
Impressum
Widmung
Für Florentineund für Lucile
Motto
In jedem einzelnen Moment des Lebens ist man zugleich, was man sein wird und was man war.
Oscar Wilde
1 Die Münze unter der Zunge
So endet alles. Mit diesem flüchtigen Gedanken fing es an. Mein Tod wurde mir vorhergesagt, und wie vom Blitz getroffen dachte ich: Zum zweiten Mal sagt mir einer, ich muss sterben.
Der Arzt war fast noch ein junger Mann, halb so alt wie ich, im Alter meiner Tochter also (die Mitte dreißig ist). Er hätte mein Sohn sein können, dieser Dr. Goossens, der Nachfolger meines letzten Winter pensionierten Hausarztes. In dem Besprechungszimmer erkannte ich keinen Gegenstand wieder. Vertieft in den Bildschirm, saß der junge Arzt hinter dem Schreibtisch und bat mich, gleichfalls Platz zu nehmen.
Ich erkannte wieder: die Kastanienreihe vorm Fenster, große, uralte Bäume, die am Wallgraben stehen, auch die Giebel der Häuser gegenüber, die Dammtorstraße in Rufnähe zur Staatsoper. (Dort war ich zuletzt vor Viviens und Dr. Goossens’ Geburt gewesen.)
Wir schwiegen lange.
(Der über den Stephansplatz brandende Verkehr.)
Eine Zeit lang sprachen wir höflich über Brücken, meinen Beruf, meine (früheren) Aufgaben im Amt. Ich kannte also wirklich alle Brücken der Stadt, fragte er, gab es nicht (das hatte er einmal gelesen) ein paar Tausend?
»Ich kenne natürlich sehr viele«, gab ich zurück, »als Brückenkommissar ist das so.«
»Aber niemand kennt sie alle«, sagte er.
Und ich sagte: »Ich kenne niemanden.«
Und wieder er: »Da berühren sich unsere Tätigkeiten, denn ich kenne ja genauso wenig jede Krankheit.«
In seinem Alter kein Wunder.
(Wohin führte dieses Gespräch?)
Endlich meinte er, was er mir mitzuteilen habe, sei zweifellos das Schwierigste, Traurigste. (Er hätte gar nicht weiterreden müssen.) Es gebe da sozusagen keine Brücke. Dennoch. Er betrachte es dennoch als seine mitmenschliche Pflicht, mir nichts vorzumachen, sondern sie auszusprechen.
»Die Wahrheit.«
Ich hörte ihm zu, wie er mir die Wahrheit schilderte (eine halbe, eine ganze Minute lang).
Dann bedankte ich mich, mitten in Ausführungen, die in Details vorzudringen begannen. »Ihr Körper«, hörte ich ihn mehrfach sagen, als würde er meinen Körper besser kennen als ich (oder ich ihn gar nicht kennen, nur er).
Ich stand auf, hielt ihm die Hand hin (meine), die er aber, wie seit der Pandemie üblich, nicht ergriff.
(Er nickte, und ich ging.)
Ein seltsames Gefühl, lebendig zu sein, diese Treppen hinunterzugehen, in das blendende Licht und die auf die Stadt drückende Hitze zu treten. Ich nahm alles wahr, wie man es Insekten nachsagt: Jeden Sekundenbruchteil empfand ich als nie zuvor erlebt und deshalb ganz und gar erstaunlich.
Etwas Unerhörtes war mir zugestoßen.
Ich ging hinüber in den Park, schlenderte parallel zum Gorch-Fock-Wall unter den Bäumen am Wasser entlang. Nur sehr fern noch hörte ich Schiller-Benz’ Nachfolger sagen, nach seiner Überzeugung müsse ich mich mit dem Gedanken anfreunden, dass dies mein letzter Sommer sei. (Womöglich schon den Herbst, bestimmt aber den Winter würde ich wohl nicht mehr erleben.) Er sei kein Hellseher, so wenig wie die von ihm konsultierten Fachärzte. Es hänge davon ab, wie weit fortgeschritten der Defekt sei. Er nannte den Namen des Defekts, der aus einem englisch und einem japanisch klingenden Nachnamen bestand, die ich beide nie gehört hatte und die ebenso die Namen von Hieroglyphenkundlern oder Schachgroßmeistern hätten sein können. Er hatte mir ein Rezept ausgestellt (und bereits unterschrieben), ein Mittel, sagte er, ohne mich anzusehen, das mir die unzweifelhaft schon in Kürze eintretenden Beschwerden zuverlässig und rasch nehmen werde. (Es galt, keine Zeit zu verlieren.) Noch sei nur wenig über den Defekt bekannt. Corona habe den medizinischen Fortschritt auf anderen Gebieten quasi zum Erliegen gebracht. Doch die bekannten Zahlen verhießen (leider, leider) nichts Gutes.
»Wir sprechen von Wochen, nicht Monaten«, sagte Goossens, der ein seltsames Ding im Ohr trug, ein Gerät offenbar (kaum größer als eine Hornisse), das ihm entweder etwas einzuflüstern oder auf mir unersichtliche Weise am Innenleben des jungen Mannes teilzunehmen schien. Ich hörte ihn sagen, es gebe mittlerweile Computerprogramme, die die Lebenserwartung (als würde es jeder so sagen, sagte er »Restlebenszeit«) exakt berechneten. Bis auf Tage, ja Stunden genau. Das dauere allerdings, vielleicht einige Wochen.
(Die mir ja unter Umständen gar nicht blieben.)
Er sah mich an.
Ich sah ihn an. Als hätte ich eine Münze unter der Zunge, war ich unfähig, etwas zu sagen.
Man werde mich auf dem Laufenden halten, sagte Dr. Goossens, und ich dachte dabei, dieser Futur wird mein letzter sein.
Die Lebendigkeit wird Erinnerung.
Es ging also bergab, ins letzte Tal hinunter. (Nie hatte ich mich als alten Mann empfunden.) Ich fragte mich, ob ich die Verurteilung zu meinem baldigen Ableben verdrängte, während ich so durch den sonnigen Nachmittag spazierte, den Finken und Amseln lauschte und, wie stets, wenn ich im Anschluss an einen Termin bei Dr. Schiller-Benz den Wallgraben entlanggelaufen war, nach den angeblich darin lebenden Sumpfschildkröten Ausschau hielt.
(Nie eine gesehen.)
Das Unerhörte bestand nicht darin, was mir vorausgesagt worden war. Vielmehr erinnerte ich mich zum ersten Mal seit über fünfundsechzig Jahren an ein Gespräch mit meinem Vater, das ich komplett vergessen hatte. Der junge, ahnungslose Arzt. Mit seiner Mitteilung musste er die verschüttete Erinnerung freilegt haben: Wie eine Tür, die man zur eigenen Verblüffung hinter einer altbekannten Tapete entdeckt, eröffnete sie mir einen verloren gegangenen Raum.
Alles darin sah ich in vollkommener Deutlichkeit wieder, meinen Vater neben mir auf der roten Sitzbank in der Straßenbahnlinie 2 (Endstation Niendorf), die den Grindelberg und die Hoheluft hinauffährt, meine Hände auf meinen nackten Knien, das hellblaue Tageslicht über Harvestehude. Vier Jahre alt bin ich vielleicht. Die Grindelhochhäuser (fertig ’56). Nur, wie wir auf das Thema gekommen sind, mein Vater und ich, fiel mir nicht wieder ein. Gab es noch Trümmerberge im Grindel-Viertel, hatten wir einen Verkehrsunfall oder eine Leichenbergung beobachtet? Er und ich, mein Vater mit Aktentasche, ich mit meinem Schinken (wie er meinen Ranzen nannte), sprachen sehr ernst und ausführlich über die Vergänglichkeit von allem, das Unausweichliche, den Tod.
Ich fragte meinen Vater Delf, ob auch er sterben werde, und er lächelte und nickte, als wir an der Hoheluftbrücke unter dem Hochbahnviadukt hindurchfuhren (wo ich heute wohne) und irgendwann nahm ich mir ein Herz und wollte von ihm wissen, was dann mit mir sei. Ob denn, da alles sterben müsse, etwa auch ich sterben müsse.
2 Rotverschiebung, Todverschiebung
Niemand gelangt zu einer Übereinkunft mit seinem Ende. Allen Widerständen in mir zum Trotz fängt mein Protokoll dort an, wo ich aufhöre. Ich erstatte Bericht vom Ende eines kommissarischen Lebens.
Es lassen sich Vorbereitungen auf das Ende treffen, das ist alles. (Alle Vorbereitung ist Beschwichtigung.) Man bestellt online ein Klappbett. Man kauft sich bei einem »Outdoor-Ausrüster« einen gefütterten Schlafsack (in der Schaufensterfront, acht Meter hoch, rotieren Kanus und Kajaks elektrisch umeinander herum), man probiert die Ausrüstung im Wohnzimmer aus und wartet dann eine nicht zu kalte, jedoch sternenklare (spektakuläre) Nacht ab.
Sobald sie sich abzeichnet, trinkt man am Abend statt des üblichen Schattens eines Rieslings, der ohnehin nach kaum noch etwas schmeckt, drei (vier) Gläser eines eigens zu diesem Zweck gehorteten Lagrein.
Oben übt wie täglich zwischen 18 und 20 Uhr der Jazztrompeter, der (unglückseligerweise) auch ein Saxofon besitzt, nur dass die altbekannten Tonfolgen mit einem Mal nach einer Totenklage klingen.
Dann der entscheidende Moment. Man gibt sich einen Ruck, setzt den Entschluss in die Tat um, das heißt, legt sich mitten in Hamburg, inmitten fast zwei Millionen fremder Leute unter freiem Himmel schlafen (auf dem Balkon). Denn das hat man nie gemacht, wollte es aber fast sieben Jahrzehnte lang wenigstens ein Mal erleben.
(Das Hier und Jetzt. Frisch, fast kühl.)
Gut zwei Wochen waren vergangen seit meiner tödlichen Konsultation bei Dr. Goossens (dessen Praxis mich seither zu erreichen versuchte). Ich: bestens vorbereitet (weiterhin ohne Schmerzmittel). Angenehm berauscht, sah ich die Sterne aufgehen.
Doch es kam anders. (Selbstverständlich.) Ich schloss in dieser Nacht nicht etwa mit der Gewissheit von meinem bevorstehenden Ende Freundschaft, sondern mit dem exakten Gegenteil.
Ho … Hoffnung.
Lie … Liebe.
Hollie …
Das Gegenteil des Endes ist keineswegs der Anfang, auch wenn es so scheint. (Was hätte je begonnen?) Alles hebt bloß neu an, geschieht zum x-ten Mal.
(Alles ist Fortsetzung.)
Man denke an den Venustransit, das mir liebste Beispiel aus der Astronomie. Der Durchgang der Venus zwischen Sonne und Erde findet in einem Zeitraum von rund zweihundertdreiundvierzig Jahren nur vier Mal statt: erst nach acht, dann nach einhunderteinundzwanzigeinhalb, darauf wieder nach acht und schließlich nach hundertfünfeinhalb Jahren, bevor dieser offenbar unveränderliche Zyklus von Neuem beginnt.
(So denkt man.)
Zum letzten Mal zog die Venus 2012 vor der Sonne vorbei (ich war sechzig, geschieden), davor 2004 (ich war zweiundfünfzig, lebte in Trennung). Rebekka und ich hatten zwei Wohnungen, und 2004 ging unsere Tochter für ein Jahr zu Airbus nach Toulouse, aber nach dem Abbruch ihrer Ausbildung zog Vivien nicht mehr zu Rebekka zurück. (Sie war neunzehn.) Voraussichtlich ereignet sich die nächste Venuspassage am 11. Dezember 2117.
Doch wird dann (so ist anzunehmen) kein halbwegs vernünftiger Mensch auf den Gedanken kommen, der erdgroße Planet, den man da als schwarzes Körnchen über die gleißende Sonnenscheibe huschen sieht, könnte das zum ersten Mal machen.
Von meinem Balkon aus war die Venus nicht zu sehen. Denn sie hatte ihre nächste Jahrhundertreise angetreten, und zumindest vor dem riesenhaften Sonnenrund würde ich sie wohl nie erblicken, denn es war ziemlich ausgeschlossen, dass ich hundertfünfundsiebzig Jahre alt wurde.
Obwohl man das, logisch betrachtet, nicht wissen kann.
(Der Philosoph Wittgenstein behauptet, man könne sich nicht einmal sicher sein, dass morgen die Sonne aufgeht.)
Es gibt Aufzeichnungen von Venusdurchgängen, die in die Tiefen der Zeit zurückreichen und sich im Unnennbaren verlieren. Keplers (noch leicht ungenaue) erste Berechnung des Transits erfolgte 1631. Registriert wurden Venusdurchgänge jedoch schon in der Antike, möglicherweise ebenso in der mitteleuropäischen Bronzezeit. So repräsentieren mehrere Goldpunkte auf der in Sachsen-Anhalt gefundenen, rund viertausend Jahre alten Himmelsscheibe von Nebra (wahrscheinlich) das Bewegungsmuster der Venus. Bereits das alte Ägypten verzeichnet dutzende Venustransitbeobachtungen, die Jahrtausende zurückreichen, Einkerbungen unbekannter Hand, stumme Zeichen versunkener Dynastien und Zivilisationen. Pharaonen sind hier reine Randfiguren (Zählhilfen). Bericht erstatten vielmehr anonyme Einzelne, so wie auch ich einer bin.
Darüber dachte ich in dieser Nacht auf dem Balkon nach.
(Was heißt Ende, was Anfang?)
Ein Anfang wäre vielleicht gemacht, würde 2117 die Venus ausbleiben. Unsere Hochleistungsteleskope, die Augen unseres Wissens vom Makrokosmos, würden sich auf die Sonne und die exakt errechnete Route richten, die der Nachbarplanet mit seinem Kohlenstoffdioxidhimmel nehmen muss (weil das schon immer so war).
Aber sie (die Venus) würde nicht kommen.
Kein Venustransit.
Keine Venus.
Wo blieb sie?
Was dann?
Kein Anfang. (Alles bloß Vorwand.) Jeder Anfang ist ein Neuanfang.
Der Neuanfang wäre das maßlose Erstaunen darüber, dass etwas für unverrückbar Gehaltenes einfach so zu Ende gehen kann.
Aus und vorbei.
Wie mein Leben, bevor ich Hollie traf.
Ma … Maskerade.
Gen … Genusssucht.
Ta … Taktlosigkeit.
Ma – Gen – Ta.
Hollie Magenta!
Ich begegne sternenklaren Nächten durchaus mit Interesse. Alles Unklare ist mir ein Gräuel, und ich glaube sagen zu können, dass ich stets Verfechter klarer Verhältnisse war. Es gibt Argumente für und wider, doch sollen sie bitte (ob in diese oder jene Richtung) für größere Klarheit sorgen.
Allerdings erzeugen Gestirne keine Stimmungen in mir. Am Nachthimmel sehe ich Himmelskörper, unvorstellbar (jedoch messbar) weit entfernte Lichter, ferne Sonnen fernster Galaxien, manche lange erloschen. Ja, in einer gewissen (milden) Verfassung denke ich mir: Die funkelnden Sterne teilen den Menschen etwas mit. Nur sind sie keine Abbilder oder Inbilder meiner wie auch immer gearteten seelischen Verfassung. Auf welche Weise sollte der Mars oder gar der Uranus Einfluss auf mich ausüben? (Bitte!) Astrologie. Unterhaltsamer, bestenfalls erbaulicher Mumpitz.
Nein, Sterne teilen meinem Auge, das sie funkeln sieht, nichts anderes mit als ihr Licht und ihre Entfernung. Mein Schwiegersohn (der sich Astrosoph nennt) würde womöglich behaupten, gerade darin, in Licht und in Entfernung, bestehe ja die Erzählung der Venus. Licht, das (zufällig) die Erde erreiche, erzähle die Geschichte etwa des Riesensterns Beteigeuze im Sternbild Orion oder gar von einem Quasar. »Ja, bester aller Bennos«, würde er sagen (mein Schwiegersohn Timothy), »darin verbindet sich die verkannte, eigentlich verbannte Wissenschaft der Astrologie mit der Philosophie und der Dichtung.«
Dichtung – bei dem Begriff denke ich an die siebenundvierzig Jahre alte Zylinderkopfdichtung im Motorblock meines Rover.
Ich bin (war) Ingenieur. Als Techniker berechne ich. Begutachte. Wäge ab, minimiere Risiken durch sachverständige Kalkulation.
Alles andere ist in meinem Beruf fahrlässig (und war es schon zu Zeiten der alten Ägypter).
Ich dachte in dieser denkwürdigen Nacht auf dem Balkon über Sterne nach, so weit, so gut, vielleicht sogar, um mich abzulenken von Gedanken (Empfindungen womöglich), die mir zu nahe gingen, ich will das gar nicht verhehlen. Ich fragte mich, weshalb man Orion nicht sah, nicht den Schulterstern (Beteigeuze), ja nicht mal die drei Sterne des Gürtels.
Natürlich, ein Quasar ist weder Stern noch Sonne. Quasare sind rotierende Glutkerne weit entfernter Galaxien. Die leuchtkräftigsten unter ihnen (als wären Quasare im Plural überhaupt vorstellbar!) besitzen die Strahlkraft von über einer Billiarde Sonnen.
Ja. Und das heißt?
Vielleicht, dass es Menschen gibt, die wie Quasare sind.
Unfassbar fern (weil gestorben oder noch nicht geboren, oder weil sie sich abgewandt und dich vergessen haben).
»Unfassbar leuchtende Menschen gibt es.«
Würde mein Schwiegersohn Tim der Astrosoph sagen. (Er glaubt, das Wassermannzeitalter steht kurz bevor.)
Und ich ihm erläutern: »Ein Quasar rotiert in Lichtgeschwindigkeit.«
Und er mir: »So wie jeder von uns, liebster Benno.«
(Kokolores.)
Auf der Straße, unter der Brücke, herrschte Stille. Ich sah vom Balkon aus die Sterne über den Dächern blinken, den feinen Nebeldunst und wie sich das Hellblau des Abendhimmels eindunkelte und minütlich satter wurde.
Einige alte Platanen und Ahornbäume stehen in meiner Straße, ihre Kronen nachts dunkle Flecken. Und fast so dunkel wie dieses dichte Gewirr aus Blattwerk und Schatten der Ahornbäume und Platanen in der Isadorastraße war die Dunkelheit unter der Brücke, die auf Höhe meines straßenseitigen Balkons erbaut ist, um in rund sieben Metern Höhe U-Bahnzüge in nordöstlicher Richtung den Vororten und Richtung Süden dem Hafen entgegenzuführen.
Es gab das Sternenlicht, es gab die Entfernung zwischen den Sternen und mir. (Demzufolge gab es auch mich.)
Trotz aller Erklärbarkeit: seltsam, dass auf keinen dieser Sterne je ein Mensch einen Fuß gesetzt hat.
Anders als meine fast zeitgleich mit mir pensionierte Assistentin Fischer lese ich keine Horoskope. (Ich weiß, wer ich bin, und ich weiß, dass in die Zukunft zu sehen unmöglich ist.) Und im Gegensatz zu Fischer lese ich auch keine Gedichte. (Ich weiß, dass ich Poesie vor mir habe, wenn ich nichts verstehe.)
Im Durchschnitt alle siebzehn Minuten fuhr ein Paar auf einem oder zwei E-Scootern vorbei. Ich hörte das je nach Akkustand leisere oder lautere Sirren des Elektromotors, war hundemüde, aber musste hinuntersehen. Ich sah die roten Rücklichter und wie die Roller (es waren tatsächlich zwei) zwischen den unter der Brücke parkenden Wagen verschwanden.
Das rote Licht dehnt sich ins Dunkel, bis es darin erlischt.
In einer Abhandlung über das Hubble-Teleskop las ich einmal, je weiter eine Galaxie entfernt sei, desto stärker sei die Rotverschiebung. Man könne das im Alltag überprüfen am Blaulicht eines vorbeibrausenden Krankenwagens, das umso roter erscheint, je weiter es sich entfernt.
»Rotverschiebung, Todverschiebung«, wird Hollie sagen, wenn ich ihr das irgendwann erzähle, dann wird sie, und auch ich werde lachen.
3 Im Meer der Ruhe
Ich versuchte einzuschlafen, erwog, das freiwillige Balkonasyl abzubrechen, es als Experiment zu betrachten (durchaus lehrreich) und, endlich, in mein wahres Bett zu gehen. Ich sehnte mich danach, die Augen zuzumachen (mindestens bis Mittag), die Ohren verstopft mit diesen Wachsklümpchen, die ich inzwischen in Großpackungen online bestellte, auch weil mir der Firmenslogan gefiel: »Wir sind die Erfinder der Stille.«
Aber (aber, aber) ich hatte mir diese Nacht im Freien vorgenommen, zum einen, weil es womöglich die letzte Gelegenheit war (ich fragte nicht mehr nach Alternativen), zum anderen, weil ich erledige, was ich plane, jawohl. Ich nehme mir nur das vor, was ich erledigen kann.
Der helle Mond (ein Dreiviertelmond) über der Häuserzeile.
U-Bahnen fahren nachts nur am Wochenende, es war jedoch der frühe Morgen eines Werktags: U-Bahnen Fehlanzeige. Die Brücke ist tagsüber dunkelgrau, nachts unter der Woche aber von tiefem Schwarz (als wäre sie zugleich ihr eigener Schatten).
Manchmal rollt nachts ein Gleisbauzug vorbei, flach, fast aufbautenlos rattert er durch das Dunkel wie ein Vehikel, das auf Schienen in die unbekannte Finsternis eines anderen Sterns vordringt, und es wissen nur die in Warnfarben gekleideten Männer im Triebwagen (und der Nachtkoordinator in der Ohlsdorfer Gleisinstandhaltungszentrale), wohin dieser GBZ um 2.29 Uhr in der Frühe unterwegs ist.
Fast jeden der drei in dem erhellten Führerstand der Mittellok kannte ich von Unterredungen über diese oder jene Brücke.
Brücken sind Gleise auf Pfeilern für sie. (Jede Brücke ist zu etwas gut.) Deshalb muss sie instandgehalten werden.
Das Gute an jedem Ende: Alles ist Vergangenheit. Auf mich kommt nichts mehr zu, ich habe die Zukunft hinter mir. Um das unter Beweis zu stellen, nehme ich mir an dieser Stelle meines Protokolls die Freiheit und springe mit meinem Bericht weit vor in der Zeit.
In drei Wochen (an einem Abend im August) wird mich Hollie einmal fragen, ob ich glaube, die Mondlandung der Amerikaner (»der Leute aus Ami-Land«) habe wirklich stattgefunden. Wir werden noch spät am Elbufer sitzen, im von der Sonne des Hochsommertages erwärmten Ufergras der kleinen Insel Fabers Sand. Als blutorangerote Scheibe steht der Mond zwischen den Sternbildern.
»Ich war siebzehn«, erwidere ich (als bewiese das etwas). »Ich glaube es nicht, ich weiß es: Am 20. Juli 1969 betrat Neil Armstrong als erster Mensch den Mond.«
»Warst du dabei?«
»Hast du Che Guevara getroffen?«
(Sie lacht, amüsiert sich prächtig.)
Sie wolle die Mondlandung (die erste) den Amis nicht in Abrede stellen. (Danke.) Aber sie wolle Zweifel äußern dürfen am Faktendenken, das (in ihren Augen) Faktenglaube sei, Faktengläubigkeit.
»Wieso die Wahrheit anzweifeln?«
»Weil es keine Wahrheit gibt, old bro?«
(Würde sie mich fragen, seit wann Freibäder beheizt seien, ich wüsste die Antwort: in Europa seit 1927.)
Für ihr Alter hat sie viel gelesen (das meiste aber verworfen).
Sie zweifelt an fast allem, zieht, abgesehen von ihrem Widerstand dagegen, eigentlich alles in Zweifel. Aber das werde ich erst auf Fabers Sand wissen. In dieser Julinacht auf meinem Balkon (drei Wochen zuvor) konnte ich es gar nicht wissen, ich hatte sie ja noch nicht in meine Wohnung und mein Leben gelassen. Drei Wochen lang stritten wir von da an über alles, was ich für wahr halte oder hielt.
(Durch Hollie sehe ich vieles mit anderen Augen.)
Wahrheit!
Wenn ich von den Himmelskörpern zu erzählen anfing, sagte sie, es sei höchste Zeit, die Sterne neu anzuzünden.
»Sind sie denn erloschen?«, fragte ich.
»Weißt du es?«, fragte sie.
Mir schien, wir redeten von unterschiedlichen Dingen mit demselben Namen (nicht nur Sternen, fast allem), als wären die Namen wichtiger als was sie benannten.
Für Wahrheit hielt ich, was durch Thales von Milet, Isaac Newton und Marie Curie aus dem Nebel der Mutmaßungen ans Licht geholt worden war.
Für Hollie war diese Wahrheit »der selbstherrliche Wahrheitsbegriff des alten Mannes und seiner wahren alten Welt«.
Endlich bin ich eingeschlafen, dachte ich auf meinem Balkonfaltbett, war aber (in Wahrheit) hellwach.
In einiger Entfernung waren beständig lauter werdende Geräusche zu hören. (Das waren sie: Sie kamen.) Während Hollie und ihr Kommando vorrückten, sah ich über dem Hochbahnviadukt den Erdtrabanten leuchten. Ich suchte unterhalb des nördlichen Mondpols nach dem hellen Leuchten der Berge des ewigen Lichtes, aber erkannte nur die größeren geografischen Formen, das Mare Crisium, das Mare Tranquillitatis. Eine Nachtmaschine überquerte zwischen Mond und mir die schlafende Stadt mit unfehlbar regelmäßigem Blinken – und flog weiter Richtung Polen oder Baltikum. Und eine übers Firmament ziehende Lichtlinie war weder ein sich irritierend schnell bewegender Stern noch eine merkwürdig träge Sternschnuppe, nein dieses Leuchten, dieser helle Punkt (der etwas an den Nachthimmel zu schreiben schien) war ein dem Verlöschen entgegeneilender Satellit in seinem Orbit.
4Das Kommando
Natürlich würde Hollie die Geschehnisse dieser Nacht ganz anders schildern. Ihr Blick und mein Blick können unterschiedlicher gar nicht sein. So oft ich sie nach ihren Eindrücken gefragt habe, so wenig hat sie sie mir offengelegt, und es passt zu ihr, zu Hollie Magenta, dass ich dadurch eine seltsame Freiheit erhalte, eine, die ich selbst zu gestalten habe, nur damit sie von ihr beurteilt werden kann.
Ich halte mich an die Begebenheiten. Ich schildere die Ereignisse. Alles andere (Empfindungen, Deutungen) führt mich auf Umwege, für die ich keine Zeit habe.
Die Zeit, die mir blieb, ich kannte sie nicht. (Tage, Wochen, mit Glück Monate?) Ich spürte nur, sie verrinnt mit rasendem Tempo.
So schien es. Wahr ist natürlich, dass jede Sekunde exakt so lange dauert wie alle anderen Sekunden jemals, ob im Jahr 1965 oder 1695. (Fragen, Thesen und Beweise der speziellen Relativitätstheorie seien hier bewusst ausgeklammert, im Gegensatz zu Hollies übersteigt die Quantenphysik mein Vorstellungsvermögen.)
Ich schildere die Ereignisse der Nacht meines Aufeinandertreffens mit Hollie in der Reihenfolge, wie ich sie erlebt habe, und da ich wie üblich (der regelmäßigen Blutzuckermessung wegen) auf dem Nachtbalkon meine Armbanduhr trug, bin ich imstande, die Chronologie des Geschehens denkbar genau wiederzugeben.
Ich besitze die Timex übrigens seit 1968 (ich war sechzehn), als mein Vater meine Mutter und mich verließ und die Uhr entweder mitzunehmen vergaß oder aber sie einfach liegen ließ.
Sie sei aus Amerika, aus New York, sagte er immer. Hamburg während der Studentenunruhen.
(Sobald man zu erzählen beginnt, schweift man ab.)
2:35 Uhr.
Unter den Pfeilerbögen auffällige Geräusche! Am frühen Morgen würde unter der Brücke (die eigentlich ein Viadukt ist, ein Hochbahnviadukt) der Markt aufgebaut werden, wie jeden Dienstag und Freitag – Obst, Gemüse, Feinkost, seit Abflauen der Pandemie verstärkt auch wieder Kleinkunst, saisonale Mode. Ein beliebter Treffpunkt und Touristenmagnet, alles Feilgebotene mindestens ein Drittel teurer (»hochpreisiger«) als in den Supermärkten an der Hoheluftchaussee.
Geräusche von Flüssigkeiten: Zischen, Sprühen, Plätschern (stets in dieser Abfolge). Dazwischen Getrappel, Schritte von schwerem Schuhwerk. Kurze, unverständliche Kommandos, in Halbminutenabständen kamen sie ruckartig näher.
2:42 Uhr.
Hooligans.
(Ein Anschlag!)
Ich stehe auf, trete im Dunkeln ans Geländer.
Nichts zu sehen. Die Schwärze unter der Brücke, wo die Straßenlaternen nicht hinleuchten. Die Bäume. Eine leichte Brise in den Kronen. Unvermittelt das nächste Kommando. Und sofort erneut das Trappeln, zwei, drei Sekunden lang, ehe wieder Stille herrscht. Dann Zischen, Sprühen. Und zum Schluss Geplätscher. Als würde jemand mitten in der Nacht mit einem kaputten Schlauch Blumen gießen, für Andere unsichtbare Blumen.
Da sah ich die sechs. (Ich Balkon, erster Stock, sie unten, unter Brücke.)
2:45 Uhr.
Sechs, so weit ich sehe. Alle in Schwarz, mit Stiefeln, Kapuzen, Halbgesichtsmasken wie wir alle in den letzten Jahren. Drei hatten Sprühflaschen, drei Kanister, Fünfliter-Benzinkanister aus dunklem Plastik. Sie rückten im Pulk vor, eilten geduckt von Auto zu Auto, unterschieden offenbar zwischen den Wagen. Allesamt Nachtparker: Sobald der Markt aufgebaut wird, muss sich jedes Fahrzeug in Luft aufgelöst haben. Ich war froh, die Garage zu haben (auch wenn ich den Rover immer seltener fuhr).
Für je anderthalb Minuten etwa blieben sie stehen, aber nur bei größeren Neuwagen oder Luxus-Oldtimern, die im Sommer hier zuhauf herumgondeln (Snobs überrollen das Viertel): bei dem grünen Carrera (Baujahr ’74), der ein Vergaserproblem hatte (und kein kleines), dem Jaguar eines Nachbarn, mit dem ich mich ab und zu über »die Brücke« (das Viadukt), über Brücken schlechthin, ihre Konstruktionsgeschichte, ihr »Wesen«, austauschen musste. Zu diesem Zweck schien er mich abzupassen. Er sehe, sagte er, dieser Hildesheimer (Herr Dr. Hildesheimer), »einen gewissen benefit« in unseren Unterhaltungen, wisse er doch, Brücken zu begutachten sei mein Beruf gewesen – woher? (Mir schleierhaft.) Und wieso sagte er »benefit« statt »Zugewinn«, versprach er sich etwas davon? Dass ich vor meiner Pensionierung Brückeninspektor war (leitender, sprich Kommissar), »so ein hohes Brückentier«, das hatte dieser mir völlig unbekannte Mensch, der mir jedes Mal etwas zu freundlich, zu beflissen die Hand hinhielt, in Erfahrung gebracht. Herr Dr. Hildesheimer war Turnschuhträger. Er war ein Mann mit einem Auftreten, als würden seine Ahnen aus Hildesheim nicht nur stammen, sondern als habe Hildesheim ihnen (und damit ihm) über Generationen hinweg gehört. Er fuhr einen dunkelgrünen XJ der ersten Baureihe (nur deshalb ließ ich mich auf Unterhaltungen mit ihm ein). Sein Jaguar war eine so betagte Schönheit wie mein Rover und wie die Armbanduhr meines Vaters.
Dann umstellen sie das Auto (den Porsche, den Jaguar), gehen in die Hocke, werden unsichtbar.
Der Vorgang wiederholt sich … sieben Mal.
Bis (2:48 Uhr) der glücklicherweise einzige Wagen in Flammen aufgeht. Ein Rätsel, wieso ich nicht kombiniert habe, es nicht kommen sah.
Hollie behauptete später (noch Isadorastraße), das sei nicht die Absicht gewesen. Geplant war vielmehr, in einer Kettenreaktion (»wie bei einem crazy Domino«) alle präparierten Fahrzeuge anzuzünden, »die acht Bonzenkisten alle zeitgleich zu roasten«.
Sofort flattern überall Vögel auf, Hunderte Tauben.
Und in Dutzenden Fenstern gehen Lichter an.
Und lauter Leute mit einem Mal draußen auf ihren Balkonen.
Woher kam das Feuer? Plötzlich war es da. In einer schmalen Flammenspur hielt es auf einen unter dem Viadukt abgestellten Jeep zu, ließ erst die Reifen auflodern, dann die Radkästen und fraß sich in die Türen. Eine halbe Minute lang stand das Auto in gleißend hellem Licht, ein brennender Luxusgeländewagen, eigentlich aber »eine krasse Muttergotteserscheinung« (Hollie) – die allerdings, wenn überhaupt, eine lärmend hupende Epiphanie war, denn mit Getöse heulte die Alarmanlage in dem in Flammen stehenden Wagen los.
Noch immer 2:48 Uhr.
Zeitgleich bricht unter den sechs Vermummten Tumult aus, Panik (kann es nicht anders nennen), laut Hollie (lächelnd) war alles »dreiundsiebzig Mal durchgespielt«.
2:49 Uhr.
Zum ersten Mal sehe ich Frau Magenta persönlich.
In brückenbaulicher Hinsicht bestand keine Gefahr, selbst falls der Jeep explodiert wäre. Als Ingenieur weiß ich, was eine Brücke aushält (es lässt sich berechnen, ja abschätzen, allerdings nur unter kritischer Einbeziehung aller Unsicherheiten). Das Hochbahnviadukt in der Isadorastraße (Fertigstellung 1912) hat im Zweiten Weltkrieg Bombardierungsdruckwellen während des sogenannten Feuersturms (Juli 1943) nahezu schadlos überstanden.
Meine Mutter war vierzehn. Mit ihrer Mutter und ihrer Schwester war sie auf einem Schleppkahn untergekommen und sah Hamburg vom Wilhelmsburger Hafen aus brennen.
Die junge Frau dort unten hatte davon (so nahm ich zumindest an) keine Vorstellung – und sie war eine junge Frau, wie ich in den Sekunden nach der Detonation mit einiger Verwunderung feststellte.
Der Jeep explodierte nicht ganz, das war ihr Glück. Sein Innenraum brannte lichterloh, somit war der große Knall nur eine Frage der Zeit. Dessen Wucht überraschte mich in seiner Heftigkeit doch. Mit doppelt stumpfem Donnern (wie unterirdisch, untertage) zerfetzt es die Motorhaube. Ich spüre eine Druckwelle anschwellen und heraufdringen wie eine zu Konzessionen nicht bereite Bö. Ich tauche ab (Benno Romik, du gehst besser in Deckung), ducke mich in Erwartung, dass der Tank oder Akku (es war womöglich ein E-Jeep) in die Luft fliegt.
Stattdessen kracht schrill fiepend ein großes Metallteil von unten gegen den Brückenstahl – Funkenflug. Holla!
Dieses Ding (der Kühler, die Brennstoffzelle) kracht gegen die Brücke, stürzt auf den Parkstreifen zurück, ein zunächst in die Höhe, dann zu Boden geschleudertes Etwas (schwarz, schwer), so schnell fast wie ein Geschoss trifft es eine der davonhechtenden Gestalten. Es reißt sie zu Boden (sie verliert einen Schuh), und die Kapuze rutscht ihr vom Kopf und die Maske vom Gesicht.
Dass man bereit sein muss, einen Menschen in jedem Moment herauszulösen aus allen Begriffen, die man sich von ihm macht – daran glaube ich so unverbrüchlich, dass ich ebenso sagen kann: Ich weiß, das stimmt. Für mich eine Frage der Vernunft. Ich sehe mich außerstande zu bestimmen, welcher Mensch für mich weniger oder mehr wert sein sollte als ein anderer. Und ich sehe mich genauso wenig imstande, zu bestimmten Zeiten (etwa nachts auf dem Balkon), Ausnahmen davon zu machen. »Sorry« (Hollie), für mich eine logisch erwiesene Tatsache: Jeder Mensch ist zu jeder Zeit mein Mitmensch.
Dass jeder Mensch der Liebe wert sei, hätte Rebekka gesagt, die meine Ex-Frau war und seit sechs Jahren nicht mehr lebt. Von Liebe würde ich in diesem Zusammenhang nicht reden, Rebekka jedoch hätte es (sehr wahrscheinlich) so gesagt.
Um nicht abzuschweifen: Es war für mich keine Frage von Mitgefühl, Mitleid oder gar Nächstenliebe, einzugreifen, als ich sah, diese junge Verletzte schleppt sich (und kann sich dabei sichtlich nur unter größter Anstrengung auf den Beinen halten) zu meinem Hauseingang. Es wäre schlicht falsch gewesen, nicht einzugreifen, das heißt bloß zuzusehen. Vielleicht versetzte ich mich in ihre Lage, vielleicht bin ich (wie Rebekka des Öfteren sagte) wenigstens dazu noch imstande. Jedenfalls hätte ich in Hollies Lage jede Hilfe genau so angenommen (ob dankbar, ist eine andere Frage), wie sie die meine nach kurzem Zögern akzeptierte.
Die Straße: mittlerweile voller Leute, die aus ihren Häusern gekommen waren, voller Menschen, die ihre Autos gestoppt hatten und auf der Straße standen. Eifrige sprühten mit Feuerlöschern in der Dunkelheit herum, um die Benzin- oder Spirituslunten unschädlich zu machen. (Der Jeep erinnerte an ein verkohltes Brathuhn.) Frauen kreischten, weil auch Kinder unter dem Viadukt auftauchten, kleine Mädchen in Nachthemden, Jungen in Pyjamas. Jugendliche leuchteten mit Taschenlampen, Lichtkegel strichen über die verschont gebliebenen Karossen, die Brückenbögen, den Asphalt, auf dem weiß wie Sprühsahne Schaum glänzte. Kaum war das monotone Lärmen der Alarmanlage verklungen (als wäre ein riesiger Lautsprecher von innen aus der Verankerung gerissen worden), da hörte man erste Martinshörner. Löschzüge, Peterwagen und Krankenwagen jagten durch Eppendorf und die Grindelallee herauf. Noch wagte sich keiner der von dem nächtlichen Abenteuer Euphorisierten näher an das ausgebrannte Wrack, aber alle suchten sie bereits nach den Brandstiftern, Vandalen, Autonomen, Schändern des G20-Gipfels von vor ein paar Jahren. Wichtigtuer überall. Ich sah die verletzte junge Frau viereinhalb Meter unter meinem Balkon in einer Nische kauern (dem gewundenen Niedergang zum Müllraum im Keller). Kein Lichtschein fiel dort hin.
2:54 Uhr.
Blaulichter. Blaue Isadorastraße. Alles plötzlich blau, und am Himmel die (wie üblich) sich unbeteiligt gebenden Sterne. In dem ganzen Radau war es unmöglich, das Mädchen zu rufen. (Ich hätte nur auf sie aufmerksam gemacht.) Wie schwer war sie verletzt?
Entscheidende Augenblicke unterscheidet nichts von gewöhnlichen, es sei denn, man nimmt sie anders wahr (jeder x-beliebige Moment hält Möglichkeiten bereit), ich wusste es wieder bei jedem Schritt, jedem Handgriff, als ich vom Balkon in die dunkle Wohnung, durch die Zimmer, den Flur zur Wohnungstür ging, als ich im Hausflur kein Licht machte, sondern im Dunkeln durchs Treppenhaus bis zur Haustür schlich und dann zurück (draußen war es mittlerweile taghell, taghellblau, wenn es das gibt) zur Kellertür, die Treppe hinunter und weiter, weiter durch den stockfinsteren Keller bis zur Feuerschutztür, hinter der der Müllraum liegt.
(Erst als ich sein Licht sah, fiel mir der Lift wieder ein.)
Ich zögerte keine Sekunde lang. Nicht länger angenehm beduselt, vielmehr bei klarem Verstand (auf alles gefasst, hellwach), öffnete ich die Tür. Sechs Tonnen stehen links und rechts in dem muffigen Gelass, drei mit roten, drei mit gelben Deckeln. Zwischen ihnen ein schmaler Durchgang zur Kellertür (mit Gitterfensterchen, um den Geruch hinauszulassen), die nicht verschlossen wird. Aber das konnte Hollie nicht wissen. Ich sah sie draußen auf der Treppe zur Straße kauern, gepresst an das Backsteinmäuerchen unterhalb des Geländers, und wusste bei jedem Schritt und jeder Bewegung: Ich kann mich umentscheiden, im Gegensatz zu diesem in die Falle gegangenen Menschen hatte ich alle Freiheit, und gerade deshalb hielt ich unbeirrt auf sie zu.
Ich öffnete die Tür (nach draußen).
Schlagartig war ich zurück in einer schon vergangenen Jahreszeit. Es war Herbst geworden nach meiner Unterredung mit dem jungen Arzt, jetzt aber war mit einem Mal wieder Sommer. Dass sich eine Wirklichkeit abrupt von Grund auf ändert, ist das möglich? Meine Verstrickung in die Logik jedenfalls hörte (ohne dass ich es bemerkte) von einer zur anderen Sekunde auf.
Alles kann zu jeder Zeit geschehen, ich bin das beste Beispiel dafür: ein Brückenkonstrukteur, der Brückenkommissar wurde, Witwer einer Frau, mit der ihn keine Liebe verband, verlassener Vater, immer stur Sesshafter, der aufbrechen sollte, um nicht wiederzukommen.
Schicksal war das nicht. Es gibt keine Fügung (wer, bitte, würde sie kommunizieren können, und wie). Hollie hatte sich rein zufällig in meinen Hauseingang gerettet. (»Weil er – mein Pech! – am nächsten lag.«) Sonst wären wir einander nie begegnet.
Und wäre es nach ihr gegangen, hätte ich unverrichteter Dinge auf meinen Sternebalkon zurückkehren müssen.
Ich sah, sie hatte bloß noch einen Schuh – der Fuß, den sie umklammert hielt, steckte in einer schwarzen Socke.
Als sie den Kopf hob und mich vor sich sah, fauchte sie, allerdings sehr schwach: »Hau ab, alter Mann.«
Erst da sagte ich zu ihr: »Kommen Sie lieber rein. Drinnen wird man Sie nicht suchen. Ich sorge dafür.«
5 Tag, Pfauenauge
Logik und Lüge sind ein altes Ehepaar« lautet ein weiterer auf mich und sie gemünzter Ausspruch Rebekkas, der sie überlebt hat, denn bis sich unsere Tochter von mir abwandte, rieb ihn mir Vivien bei jeder Gelegenheit unter die Nase.
Natürlich hatte ihre Mutter auch damit recht. Denn Hollie Magenta in Sicherheit zu bringen, gelang mir lediglich durch eine beherzte Verquickung von logischer Schlussfolgerung und kreativer Tatsachenverdrehung.
»Zwei Minuten, und man wird Sie hier aufstöbern«, sagte ich zu ihr, während sie dort in der Ecke kauerte und ich im Müllraumeingang stand. »Man wird Sie fragen, wieso Sie sich hier verstecken, Sie mitnehmen, im Krankenhaus verhören und Ihnen nicht glauben. Kommen Sie lieber mit mir rein. Ich bin Arzt, also, das dürften Sie wissen, an die Schweigepflicht gebunden.«
Sie ergab sich der Logik. Dass ich möglicherweise log, nahm sie in Kauf. In ihrem Gesicht las ich widerstreitende Empfindungen (ihr ständiger Begleiter Zweifel), doch schließlich gab sie sich einen sichtlichen Ruck. Um keinen Preis wollte sie eingesperrt werden, weder von Polypen noch von Sanis.
Sie schleppte sich bis zum Fahrstuhl, wimmerte nicht, fluchte nicht, war nur unheimlich stumm. (Wir fuhren nach oben.) Sie humpelte. Mit dem schuhlosen Fuß konnte sie kaum auftreten, ich musste sie stützen, sah, ihre Schmerzen waren stärker, als es den Anschein hatte, sah zum ersten Mal ihre Züge, ihre Augen, die schwarz geschminkt waren, mich fortwährend musterten und so einem wie mir nicht trauten.
Zwei Stunden später. (5:03 Uhr.) Unterm Viadukt tritt Ruhe ein. Die Löschzüge schalten das Blaulicht aus, nachdem sie das Jeepwrack in dicken Schaum gehüllt haben. Blaue Morgendämmerung stattdessen. Erste Marktbeschicker fahren vor. Mit einiger Verblüffung sehe ich vom Balkon, dass alles wie gehabt seinen Gang geht, nur dass es einen Anschlag auf die Ordnung gegeben hat, der aber abgewehrt wurde. Eine unterhaltsame Irritation im Woche für Woche sich wiederholenden Gefüge, dieser mitten im Hochsommer wie winterlich eingeschneite Wagen. Mit einem rot-weiß gestreiften Absperrband hat ihn die Polizei vom munter seinen Anfang nehmenden Markttreiben isoliert. Vorüberschlendernde Gemüse-, Blumen-, Käse-, Brot- und Kräuterkäufer werden das Wrack als absurdes Zeugnis einer aus unerfindlichen Gründen zerstörerischen Außenwelt wahrnehmen, als Bestätigung eines Innenbezirks, dem es um Sicherheit zu tun ist und der dafür das ländlich Idyllische als vollendeten Ausdruck gefunden hat. (Im gelb sich ausweitenden Lichtdunst der erwachenden Stadt sind alle Sterne verschwunden.)
Sie schlief noch nicht. Ich hatte ihr im Gästezimmer (Viviens verwaistem) das Bett bezogen, darin lag sie und blickte abwechselnd auf ihr Handy und zur Decke. Über ihr im Regal brannte Vivis Leselampe aus Abizeiten.
Die Zimmertür offen.
Sie fragte nach dem W-LAN-Passwort, und ich schrieb den Code auf einen Zettel und gab ihn ihr.
»Es normalisiert sich draußen, schlafen Sie erst mal«, sagte ich. »Morgen ist ein neuer Tag. Geht es Ihrem Fuß mit den Kühlpacks schon besser?«
Sie sah gar nicht her. Leise, mit ihrer dunklen Stimme, sagte sie nur: »Am Fenster sitzt ein fetter Schmetterling.«
Der Falter, der bewegungslos, schon ganz schwach, nicht außen, sondern tatsächlich innen an der Scheibe saß (ein Tagpfauenauge), musste seit Stunden, wenn nicht Tagen in dem Zimmer gefangen gewesen sein. Ich holte ein Glas und nahm eine der Ansichtskarten (»Great Barrier Reef – It’s great!«), die vor Viviens Büchern lehnten. Dann war der Schmetterling im Glas, ein ziemlich großes Exemplar, mit vier strahlend hellblauen, klar konturierten Augen auf den Flügeln, die Unterseiten anthrazitgrau, fast schwarz und blass getigert.
»Zeig mal«, sagte sie, und ich hielt ihr das Glas vor die Augen.
Sie betrachtete das Tier lange, scheinbar ohne jede Regung.
»Tag, Pfauenauge«, sagte sie freundlich.
Kaum hatte ich den Falter nach draußen entlassen, änderte sich ihr Ton. In ihrem Gesicht stand es schon geschrieben: Sie wurde ernst, und sofort griff sie mich an. Ich stand in Viviens halbdunklem Zimmer, sie lag im Bett, nur ihr Kopf, ihre Schultern und bloßen Arme waren zu sehen, die schwarzen Träger ihres Unterhemds.
(Unser erster echter Clinch.)
»Du bist kein Arzt, auch wenn auf deinem Klingelschild Doktor steht, also was soll der shit? Hab dich gegoogelt, Fossil!«
»Sie wären doch nicht mitgekommen. Wirken die Tabletten?«
»Ihr dreht euch die Welt hin, wie es euch passt. Aber damit ist Schluss. Ich werd mich bei dir nicht bedanken, auch wenn du dreißig Mal versuchst, mir ein ›Thank you so much‹ abzupressen. Hast du – ach forget it.« Sie verzog das Gesicht und stöhnte laut fluchend auf, als sie den Fuß nur leicht zu bewegen versuchte.
Ich hatte sie schon zwei Mal danach gefragt, sie mir ihren Namen aber nicht verraten.
»Hören Sie bitte …«, sagte ich also nur, »Sie sollten bis morgen, bis heute Vormittag versuchen, möglichst ruhig zu liegen.«
»Fuck«, stieß sie hervor, wie so unzählige Male in den kommenden Tagen (ich werde es nur noch in Ausnahmefällen erwähnen), »hast du hartes Zeug da, irgendwas?«
»Hartes Zeug? Was meinen Sie?«
Trotz Schmerzen grinste sie belustigt und wandte mir das Gesicht zu. »Wie alt bist du, dreihundert?«
So entstanden die ersten der zahlreichen Bezeichnungen, die Hollie für mich erfand: »das Fossil« und »Dreihundert«.
Ich bat um Verzeihung (woraufhin sie lachte), nur verstünde ich leider ihre Sprache nicht immer sofort.
Unvermittelt siezte sie mich, es war das erste Mal, dass sie bereit schien, mir einen gewissen Respekt entgegenzubringen.
»Sie tun nur so«, sagte sie. »Nice. Gute Show. Jede Wette, du bist so ein Denkpilot, ein total erfahrener Allesversteher, und kommst dir dadurch so richtig, richtig riesig vor. Korrekt, o großer Meister?«
Ein so böses Funkeln hatte sie im Blick, dass sogar Schmerzen und Erschöpfung in den Hintergrund traten.
Sie verstand ihre Augenbrauen einzusetzen (besser als Vivien es je konnte), das hatte ich gleich bemerkt.
»Ich gehe schlafen«, sagte ich. »Wenn Sie morgen früher wach sind als ich und loswollen, ziehen Sie einfach die Tür ins Schloss. Gute Nacht!«
»Echt rührend. No chance, Dreihundert. Die emotional challenge hab ich für mich verworfen. Hier geht es um Härte, also.«
Ich hatte eine junge Marsianerin zu Gast, nach einer Bruchlandung bei mir untergekrochen. Sobald Gefühle ins Spiel kamen, wurde alles, was sie von sich gab, kryptisch, und ich fragte mich, ob das Absicht war, fragte mich aber zugleich, zu welchem Zweck ich mich überhaupt auf sie einließ. Sie war nicht unhöflich, sondern offen abweisend. (Empfand sie mich wohl als ähnlich feindselig?) Sie war mir ein Rätsel, aber eines, vor dem ich Respekt hatte. Dagegen waren Leute wie ich für sie altbekannt und durch die Bank abzulehnen.
Ich zog mich zurück.
Aber kaum war ich im Flur, rief sie (und konnte nur mich meinen).
»Hartes Zeug, das heißt Hochprozentiges, Wodka, Whiskey, Gin! Haben Sie so was? Damit ich schlafen kann? Sleep! Help!«
Wieder stand ich im Türrahmen und betrachtete die Klamottenfährte, die zu ihrem Bett führte, eine schwarze, verkokelt riechende Spur aus Jeans, Kapuzenpullover (»Hoodie, old Schlurf, Hoodie«) und dem einen übrig gebliebenen (verlassen wirkenden) Schuh.
»Hilfe«, sagte sie noch mal schwach.
Ich hätte, sagte ich, einen trinkbaren Weißwein und einen sehr guten Lagrein. Und einen Marillenschnaps (beide aus Südtirol).
Lagrein kannte sie nicht. Klinge aber nach Greinen.
Marillen kannte sie nicht. Aber Schnaps sei gut.
»Aprikosen?«
»Bitte davon, yes, ein großes Glas!«
Nach einem halben wurde sie ruhig. Ich saß auf Viviens altem Schreibtischstuhl neben dem Bett und trank ein Glas Südtiroler Roten. Sie schien sich zu entspannen. Sie wollte Musik hören, einen Lieblingssong, den ich nicht kannte, obwohl er von »einer alten Band« sei: »The Waterboys« – Fossile (wie ich). Ich hatte von diesen Wasserjungs nie gehört, trotz zahlloser Gespräche und Auseinandersetzungen mit Vivi über Musik. Hollie suchte den Song auf ihrem Handy: »A Girl Called Johnny«. Unvermittelt aber ließ sie die Hand sinken.
Sie war eingeschlafen.
Nach ein paar regungslosen Minuten ging ich vor ihrem Bett in die Hocke, hob die Decke von ihrem Fuß und betrachtete im Lichtkegel der Regalleuchte das böse Gelenk. Inzwischen war es gelb, grün, auch blau angelaufen und faustgroß geschwollen, nirgends aber war eine Wunde oder Spur einer Fraktur zu erkennen. (Ich löschte das Licht.) Ich schlich mich hinaus und lehnte die Tür an.
Dann stand ich im Flur, am Ende einer Nacht, die ganz anders hatte verlaufen sollen. Ich spürte mich (sehr real). Ich fühlte mich zugleich leer und als müsste ich innerlich platzen, um etwas von dem abzusprengen, was sich da in mir zusammenballte. Ich zerfloss. (Ich trieb durch die Zeit.) Die Rolle meines Körpers war mir sehr unklar. Ich war ein Schwarzes Loch mit Beinen, und mein Zorn und Kummer so dicht zusammengebacken, dass ich nicht mehr wusste: War ich wütend auf Vivien, auf mich? War ich enttäuscht von der Welt, ihrer fortwährenden Ungerechtigkeit? Oder war ich einfach nur traurig, weil so wenig gelingt und die Zeit nie ausreicht?
Sechs Uhr morgens. Ich war seit fast vierundzwanzig Stunden wach, hatte zuletzt vor dem ersten abendlichen Glas Wein etwas gegessen (neun Stunden her).
Solche sich überstürzenden Bilder von meinem vermeintlichen Innenleben sind untrügliche Zeichen. In einem rettenden Automatismus fällt mir dann zumeist die Faustregel meiner Diabetologin Frau Dr. Huppertz ein, beim geringsten Anzeichen von Unterzuckerung unverzüglich zum Messgerät zu greifen. In der Küche schob ich einen Teststreifen in den Sensorschlitz (bemerkte erst da mein Zittern), platzierte die Lanzette an der Fingerkuppe (rechter Mittelfinger, rechter Ringfinger, steter Wechsel, auch das Automatismus), hielt die Blutperle an den Streifen und fixierte das Display im Wissen, dass der Wert zwar abschätzbar, immer aber unvorhersehbar war. Seit der ersten Mondlandung, seit der Geburt des Internets, seit ich siebzehn war (1969), besitzt mein Körper (besitze ich) kein Blutzuckersensorium.
(42.)
Ich trank ein randvolles Glas Orangensaft binnen fünfzehn Sekunden und trank ein zweites, für das ich mir eine Minute Zeit ließ.
Ich trank den Saft aus Rebekkas Libellenglas und betrachtete wie immer in solchen Unterzuckerungsmomenten die zwei (von wem oder welcher Maschine – und wie) dem Glasrund aufgesetzten Libellen: mit ihren vier Flügeln, dem langen, filigranen Hinterleib und dem punktartigen (irgendwie befremdlichen) Kopf.
Diese beiden gläsernen Libellen … je mehr mein Interesse an ihnen nachlässt, umso mehr kann ich mir sicher sein, dass ich in die reguläre Wirklichkeit zurückgekehrt bin.
Ich will ruhig bleiben, und ich bleibe ruhig.
Ich rege mich nicht auf. (Nicht mehr.)
Doch ich bin auch mein Körper, nicht bloß mein Verstand, der das Aufbrausen meines Gemütes zu zügeln weiß, und mein Körper hat andere Prämissen, wenn es ums Überleben geht.
(Er gibt keine Ruhe, solange er sich nicht sicher wähnt.)
Zumindest er weigert sich zu sterben.
6 Aus dem Album der Ausflüchte
Seit ich von diesem jungen Arzt in den Kreis der Moribunden gerufen worden war, hatte ich es mir zur Gewohnheit gemacht, hin und wieder über das Viadukt zu fahren. Ich lief dann unter den Pfeilerbögen hindurch bis zum Bahnhof Hoheluftbrücke, stieg oben in die U3 und fuhr (bis Eppendorfer Baum) eine Station Richtung Norden.
So auch am folgenden Morgen. (Keine drei Stunden lang hatte ich schlafen können.)
Aufgekratzt, innerlich zerwühlt vor Nervosität, zog ich mich an, trank ein Glas Saft und horchte an der Tür meines namenlosen Gastes. Alles war ruhig, alles außer mir. Ich nahm mein Telefon mit, um von unterwegs Fischer anzurufen (damit sie Schiller-Benz anrief), ich schloss nicht ab, zog die Tür nur ins Schloss und nahm den Lift. Unterm Viadukt schob sich der Besucherstrom bereits über den Markt, und die Obststände leuchteten.
Am Bahnhofskiosk kaufte ich meine Zeitungen. Die Kriegsmeldungen aus der Ukraine hatten die Pandemie fast vollständig von den Titelseiten verdrängt. Immer seltener waren Menschen mit Masken darauf zu sehen, immer öfter dagegen russische Panzer und Raketenwerfer und von ihnen zerstörte Gebäude, Straßen, Lastwagen oder Kinderspielplätze in Kiew oder Charkiw. Auf der Rolltreppe hinauf separierte ich die verzichtbaren Rubriken (Finanzen, Immobilien, Sport, Unterhaltung, Wirtschaft), und auf dem Bahnsteig warf ich sie in einen Mülleimer.
Die zwei Minuten, bis die Bahn kam, nutzte ich (Routine), um die Inzidenzzahlen zu prüfen und die Todeszahlen abzugleichen. Sie gingen seit Wochen kontinuierlich zurück, ja zum ersten Mal schien es sogar Anlass zur Hoffnung auf ein Ende des Sterbens zu geben. Ich verglich die Zahlen in den Tageszeitungen: Sie wichen nie auch nur minimal voneinander ab, und sie entsprachen stets den offiziellen. Täglich kleiner waren erst Kästen, dann Kästchen geworden, in denen man Zahlen und Kurven aufführte, und immer tiefer waren sie ins Zeitungsinnere und an die Ränder gerückt und schließlich ersetzt worden von Grafiken zu Frontverläufen und Massengrabfunden, von Fotos von Panzern und Armeetransportern, auf denen das Z der von der Richtigkeit ihres Überfalls überzeugten Invasoren prangte.
Meine U3 kam.
(Pünktlich warf ich das ganze Papier weg.)
In den vergangenen zwei troglodytischen Jahren hatte es Wochen und Monate gegeben, in denen waren an einem Tag mehr Leute von dem Virus getötet worden als Platz finden in einer U-Bahn mit acht vollbesetzten Wagen. (Ich blickte den Bahnsteig entlang.) Viele junge Frauen trugen Sommerkleider, fast alle Menschen Sonnenbrillen und kaum jemand eine Jacke. (Alle lebten sie, alle lebten sie ihr Leben.) Vor vier Monaten hatte ich hier an einem der ersten Aprilmorgen fassungslos von den Gräueln gelesen, die russische Soldaten Bewohnern der Kleinstadt Butscha nordwestlich von Kiew zugefügt hatten. Vor noch nicht einmal drei Monaten hatte ich hier gestanden und in den Zeitungen gelesen, seit Beginn des Angriffs seien bereits dreizehntausend von Putin und seinen Schergen an die Front beorderte junge Russen bei Gefechten mit sich widersetzenden Ukrainern getötet worden (»verschrottet«, hieß es). Und keine sechs Wochen später waren es fünfzigtausend gewesen. Aber die Zahlen galten als nicht gesichert, so wenig wie die Anzahl getöteter Zivilisten und Soldaten auf ukrainischer Seite. Von Zahlen und Toten las ich seit Jahren (vorher war das nie so gewesen), von der Zahl der Toten, von zahllosen, ungezählten Toten, und immer öfter büßten die Zahlen für mich nicht ihre Glaubwürdigkeit ein, sondern die Befähigung, irgendetwas über das Leben auszusagen. Dann dachte ich, wie tot sie doch waren. Sie waren allesamt tote Zahlen.
Immer stieg ich in den ersten Wagen. Maskiert postierte ich mich an der Sicherheitsglasscheibe zur Fahrerkabine, um dem Fahrer (oder der Fahrerin) über die Schultern zu sehen, schon begannen die zwei Minuten, derentwegen ich diesen Freigang eigentlich unternahm.
Die Bäume, Fassaden, Fenster, die Balkone flogen vorbei, so schien es mir, denn in Wirklichkeit war der Fliegende ja ich. Die Strecke ist nicht sehr lang, immerhin aber erstreckt sie sich in voller Länge über das Viadukt (1,1 km). Ein berauschendes Gefühl jedes Mal, das nie schaler wurde. Ich fühlte mich losgelöst von allem, was hinter und was vor mir lag, von meinem Leben und meinem Sterben, die zu etwas Ununterscheidbarem zusammenzusacken und zurückzusinken schienen. Wolkenlos, voller Schwalben und Tauben, rauschte über mir der Sommerhimmel genauso hinweg wie unter mir die Gleise, auf denen ich dahinfuhr, weil kein anderer Weg möglich war. Grenzenlose Euphorie erfüllte mich in diesen zwei Minuten.
Ich hätte Stunden, Tage, Wochen lang so weiterfahren mögen zwischen den Platanen, Ahornbäumen und Fenstern hindurch (nur verlor sich nördlich des Eppendorfer Baums alles im Einerlei). Dann wieder wünschte ich mir, Goossens’ Prophezeiung würde auf der Stelle eintreten und ich tot umfallen, kaum dass die Bahn das Isadorastraßenviadukt hinter sich gelassen hatte.
Aber ich starb (leider) nie auf dieser Kurzstrecke, genauso wenig wie anderswo, ja ich machte noch nicht mal Anstalten, überhaupt das Zeitliche segnen zu müssen.
(Nicht das geringste Anzeichen von Schmerzen.)
Einige Male in den vergangenen Wochen ritt mich schon früh am Morgen der Teufel. Dann wartete ich am Eppendorfer Baum die nächste Bahn in entgegengesetzter Richtung ab, fuhr zurück und bestieg an der Hoheluftbrücke noch einmal die U3 Richtung Nordosten (Barmbek). Und fuhr wieder über das Viadukt in das Offene hinein (in umgekehrter Richtung fuhr ich stets nur in die Stadt).
Die Angst wich zurück, hörte beinahe ganz auf.
Es blieb dasselbe, unergründlich beflügelnde Gefühl: Ich flog, wie in eine wirklichere Wirklichkeit, wo ich endlich wieder ich war, Teil von allem, und aller Logik, allen hingefälschten Träumen ledig.
Alles war anders (»totally«), seit Hollie da war und im früheren Zimmer meiner Tochter tief und fest schlief. Während ich dahinflog auf meiner Kurzstrecke und nur abwarten musste, dass sich meine Selbstgenügsamkeit einstellte, stand mir Vivi vor Augen, wie ich meine Tochter nie erlebt habe – die Flugbegleiterin, die Purserin, inzwischen womöglich Chief-Purserin nachts auf dem viertelstündigen Sicherheitsbesuch im Cockpit, der Jet und seine zwei im Wechsel schlafenden Teams bereit zum Anflug auf Panama City, Melbourne oder Shanghai. Das Meer liegt hinter ihr. (Das Meer liegt hinter uns.) Die Leuchtfeuer der Rollbahn. Freier Luftraum. Landeerlaubnis. Kabinen unauffällig. Landeklappen. Sie schnallt sich fest (ich sehe sie), Vivi festgeschnallt auf dem Pursersitz, bereit, in drei Sprachen die Landeanweisungen durchzugeben.
(Touchdown.)