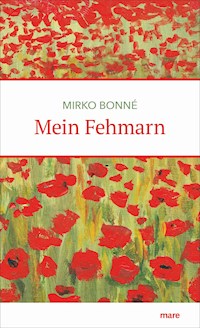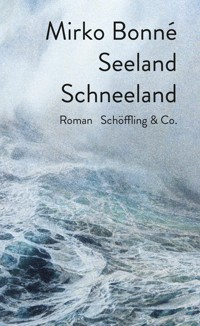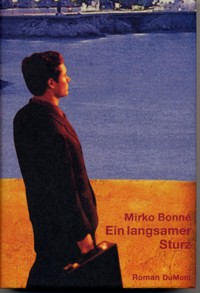9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schöffling
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nominiert für den Deutschen Buchpreis 2013Markus Lee reist in den Herbstferien in die Normandie, um für ein Hamburger Kunstmagazin Brücken zu zeichnen, die bei der Landung der Alliierten im Sommer 1944 eine entscheidende Rolle spielten. Lee nimmt seinen fünfzehnjährigen Neffen Jesse mit, dessen bester Freund mit seiner Familie in Nordfrankreich ein verlassenes Strandhotel hütet. Überschattet wird die Reise von der Trauer um Jesses Mutter Ira, deren Suizid der Bruder und der Sohn jeder für sich verwinden müssen. In der verwunschenen Atmosphäre des Hotels L"Angleterre entwickelt sich der geplante einwöchige Aufenthalt zu einer monatelangen Auszeit, die nicht nur für Markus Lee einen Wendepunkt im Leben markiert."Nie mehr Nacht" erzählt schonungslos und ergreifend von der Befreiung Frankreichs, bei der zahllose junge Männer umkamen, die kaum älter als Jesse waren. Dem Zeichner aber ist es zunehmend unmöglich, die Verheerungen des Krieges künstlerisch darzustellen. Doch beinahe noch schwerer fällt es ihm, den Tod der geliebten Schwester zu vergessen. Denn während ein dramatisches Kapitel europäischer Geschichte auf unheimliche Weise in ihm auflebt, stellt sich Markus Lee einem Trauma der eigenen Jugend und Abgründen seiner Familie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 467
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Inhalt
[Cover]
Titel
Widmung
Zitat
I NACHTFAHRTEN
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
II BRÜCKENTAGE
III EBENBILDER
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
Autorenporträt
Über das Buch
Impressum
Für Nick
Nacht – wird nicht müde –Ist wie der Sand am Meer –Zu unscheinbar die Unterschiede –Bis nie mehr – Nacht sein wird –Emily Dickinson
INACHTFAHRTEN
1
Es gab nichts, was nachts anders war als am Tag. Allem fehlt nur die Farbe, sagten wir uns.
»Das Bett ist das Bett, das Zimmer das Zimmer. Der Flur ist der Flur und die Treppe die weiße Treppe.«
Die Tür war die Tür, und sie war zu.
Draußen der Garten ist der Garten auch in der Nacht, sagten wir uns. Und Ira wusste dabei, und ich wusste es ebenso, jeder für sich musste lernen, allein zu sein, auch nachts. Auf die unzähligen Nächte in unserem gemeinsamen Bett folgten die langen Jahre, als jeder in seinem eigenen Zimmer schlief. Schon lebte jeder in der eigenen Wohnung, hatte eigene Schränke für die eigenen Sachen, machte sich eigene Gedanken und ertrug, so gut es ging, seine Angst allein.
Länger als ich es wahrhaben wollte, hatte ich mich gegen das Alleinsein gesträubt, so schien es mir rückblickend. Seit ich mit neunzehn zu Hause ausgezogen war, hatte ich zusammengenommen kein Vierteljahr lang allein gelebt. Ich war in eine WG gezogen, dann in eine andere, und von dort in eine dritte. Mitbewohner kamen und gingen. Eine Zeit lang hatte ich mit drei Freunden zusammengewohnt, später waren es zwei, dann nur noch einer. Als der letzte zu seiner Freundin zog, sah auch ich mich nach einer Mitbewohnerin um.
Währenddessen war Ira auf Reisen. Über zehn Jahre lang, bis sie dreißig war, reiste meine Schwester durch die Welt, lernte Sprachen und hatte mal hier einen Freund und mal dort. Für eine Weile wohnte sie bei Hector in Rio, dann bei Dave in Brooklyn, bevor sie wie ein großer grauer Zugvogel weiterflog nach St. Petersburg oder Netanja. Sie beschrieb mir einen Liebhaber, wenn ich ihr dafür erzählte, wen ich gerade anhimmelte. Erst waren es Kommilitoninnen, später Kolleginnen – eine Malerin, eine Clipkünstlerin, eine junge Slowenin mit eigenem Blumenladen, der kaum größer war als ein Ballonkorb. Mal wohnte ich bei einer Frau, mal zog eine Freundin zu mir. Gemeinsam umgezogen war ich nie. »Nestbauschaden« nannte das unsere Mutter.
Ira reiste durch Israel, um Hebräisch zu lernen, und wurde schwanger. In Hamburg heiratete ich meine Nachbarin. Ira kam aus Netanja zurück und brachte einen Sohn zur Welt. Ich ließ mich scheiden. Aber meine frühere Frau blieb in der Nähe, Saskia und ich blieben Freunde. Aus Angst umeinander wurden wir wieder zu Nachbarn.
Rückblickend schien mir außerdem, dass im Gegensatz zu mir meine Schwester sehr wohl versucht hatte, sich gegen ihre Angst zu wappnen. Oder waren ihre Reisen eine Flucht gewesen? Wovor? Vor wem? Was uns peinigte, schienen wir entweder in uns zu tragen oder waren es selbst. Beide nahmen wir es überallhin mit, ihm entkommen, das wusste wir, konnten weder sie noch ich.
Irgendwann wohnte sie in einem eigenen Haus. Es war kein schönes Haus, nichts daran war besonders, außer dass es in den letzten Jahren vor ihrem Tod der Mittelpunkt ihrer Welt war. In ihrem Haus, sagte Ira, stehe zu jeder Sekunde alles auf dem Spiel, bei Tag und auch in der Nacht.
Allein mit dem Kind, fühlte sie sich in dem Haus eingemauert. Bei Wind und Wetter – immer! – kamen um kurz nach halb zwei die Nachbarskinder aus der Schule und fuhren mit Fahrrädern durch die Siedlung, so wie sie selber vor zwanzig Jahren keine zehn Kilometer entfernt durch Schnelsen gefahren war.
Moos überwucherte den Garten, und schon im März kamen die Mücken. Ab Mitte Juni bellte der kleine Hund von nebenan gegen die Terrassenmarkise an, sobald sie herausgekurbelt wurde. Im Hochsommer schob sie den Buggy mit dem Jungen auf trostlose Spielplätze. Im Herbst stand sie an der Terrassentür und starrte durch das Gitter des Regens auf eine bemooste Pergola und lauter Thujen. Zwei Fledermäuse gaukelten durch die Dämmerung. Manchmal bekam sie Lust, den Rasen umzugraben, die schwarze Erde ans Licht zu holen, aber tat es nicht. Es wurde kalt, und in seinem Kellertank tropfte das Heizöl, im Kinderzimmer, im Vorgarten, in der Garage, wo immer man stand und horchte, überall war es zu hören.
Einmal hatte sie mich gebeten, ihr Haus zu zeichnen. An einem Wintertag standen wir im Garten, und sie zeigte mir, wie sie sich das Bild vorstellte: Das Haus sollte wegfliegen. Es sollte aus lauter großen grauen Zugvögeln bestehen, die alle wie sie aussahen und davonflatterten.
Ira nannte ihr Haus den Versteinerungszustand.
Das Haus war nicht groß. Aber ihre Angst war es, und anders als meine wurde sie größer. Auf ihren Reisen hatte sich die Beklemmung gelöst, pulverisiert, in alle Richtungen davongeweht war ihr die alte Nachtangst manchmal vorgekommen. In jedem fremden Land hatte die Schwärze versucht, sich im Dunkeln neu zu sammeln und zu bündeln und in sie einzudringen, so wie sie es immer gemacht hatte. Irgendwie aber war es anders gewesen als zu Hause. Die neuen Eindrücke, die fremde Sprache, die Leute hatten sie abgelenkt, und allmählich hatte sie vergessen, dass es etwas gab, was ihr Angst machte. In Rio fürchtete sie sich nicht mehr vor der Dunkelheit. Irgendwann fing sie an, auf Portugiesisch Selbstgespräche zu führen, in Netanja dasselbe, nur auf Hebräisch, und schon träumte sie in der neuen Sprache. Und bald war sie nicht mehr allein. Im Ausland blieb immer einer über Nacht, einer wie Dave oder Hector, der neben ihr lag und im Dunkeln redete oder zuhörte oder schnarchte.
In Wellingsbüttel war es anders. In ihrem Haus war sie allein, auch wenn das Kind da war. Sie dachte an das Öl und dachte über das Öl nach. In ihrer Vorstellung überschwemmte es den Tank, dann den Keller und stieg schließlich durchs Haus. Tintig troff es über die Stufen, schwappte über Böden und Teppiche, manchmal floss es nachts ins Kinderzimmer, und sofort wurden die Wände davon grau. Überall eine graue Tinte, die mich an die Bilder erinnerte, die Degas an seinen grauesten Tagen gemalt hatte. Und so grau war man auch selber – ohne jedes Eigenleben, hatte Degas gesagt.
Ira erzählte mir, sie sehe manchmal abends eine Alte, eine mausgraue Frau, die auf dem Gehsteig vorm Haus hin und her ging. Vielleicht eine Verwirrte, es gab doch in der Nähe, am Alsterlauf, ein großes Altenheim, sagte ich zu ihr. Sie glaubte das nicht.
»Das Eigenleben verliert sich«, sagte sie. »Ich bin die Frau.«
Und ich, ins Telefon: »Einbildung. Soll ich vorbeikommen? Hast du gegessen? Ich bring was mit. Wir können reden, oder einen Film gucken.«
Sie wollte nichts essen, einen Film sehen auch nicht, vielleicht konnten wir Musik hören und uns unterhalten.
»Ich fahre gleich los. Nimm solange ein Bad. Wie geht es Jesse? Schläft er schon?«
Ja, der Kleine lag in ihrem Bett, er schlief.
»Beruhig dich, bitte, versprich es.«
»Ich versuche seit heute Morgen, mir bewusst zu machen, dass die Wände bloß Wände sind«, sagte sie. »Aber je mehr ich das versuche, umso weniger glaub ich meinen Gedanken. Markus, meine Gedanken, das sind doch gar nicht meine.«
Wie den Augenblick, da das Blatt sich wendete, wie den Moment erkennen? War man denn in der Lage, einen Augenblick zu erkennen? Das hieße doch, sich auf den Zeitpunkt gefasst zu machen, da nichts mehr blieb, wie es eben noch war.
Wenn ich an meine Schwester dachte, kamen mir die Fragen in den Sinn, die Ira und ich in den Nächten in ihrem Haus sinnlos hin und her gewälzt hatten. Es gab darauf keine Antworten. Es waren Fragen, die Antworten ausschlossen, und immer öfter beschlich mich das Gefühl, dass Ira sie nur deshalb stellte.
»Wenn du dich in die Enge getrieben siehst, wenn sich alles, aber auch alles gegen dich verschworen zu haben scheint und du meinst, nicht eine Minute länger kannst du es aushalten vor dieser Wand, woher willst du dann die Kraft nehmen, das alles als Trugschluss zu durchschauen?«
Ich wusste nichts zu erwidern. Ich konnte ihr nicht folgen und wollte Ira auch gar nicht folgen bis vor die graue Wand.
»Hör auf, dir das Hirn zu zermartern. Nimm deine Tabletten, nimm sie regelmäßig. Geh zum Arzt. Geh zu der Gruppe, wo du früher warst, das war doch immer gut. Lass dich von dem negativen Kram nicht so anfressen und runterreißen.«
Meistens hatte ich nur Phrasen gedroschen.
»Ich weiß«, lautete für gewöhnlich ihre Antwort, sobald sie sich müde geredet hatte, »ich weiß ja« – was zwar genauso mechanisch klang, dafür aber ehrlich war. Und es folgte ihr Seufzen, bei dem es mir den Magen umdrehte, oder noch schlimmer das traurige Lächeln, mit dem sie in der Terrassentür stand und den Zigarettenrauch in die Nachtluft blies.
»Du musst Lewandowskis anrufen«, sagte sie. »Bitte mach du das. Ruf sie an und frag sie, ob er die nächsten zwei Wochen bei ihnen sein kann.«
Bevor ich nur an Jesse gedacht hatte, redete sie von ihm. Ihren Kummer sah sie mit seinen Augen, aus seinem Blickwinkel. »Wie als Mutter deinem Kind begreiflich machen, dass du in jedem Zimmer, auch in seinem, einen Abgrund siehst?«
Ihre verrätselten Fragen machten sie mir fremd und fremder. Ich hatte schon so lange nichts mehr zu ihr gesagt, das bis zu ihr durchgedrungen wäre.
»Versuchen Sie es, indem Sie geduldig einatmen, Ira, ein und aus, ein und aus, und wieder ein …«, sagte ihr Arzt sehr ruhig, und das stimmte auch sie eine Zeit lang ruhig.
Mir fielen nur Platitüden ein oder, wenn ich Hemingway las, Hemingway-Zitate, und bestenfalls fragte Ira dann, wie alt die Übersetzung war.
Achselzucken. »Älter als wir wahrscheinlich, keine Ahnung. Sicher ist bloß, dass kein Pferd mit Namen ›Trübsal‹ je ein Rennen gewonnen hat.« Das sagte der todkranke Oberst in Über den Fluss und in die Wälder.
Sie lächelte. Im Vorbeigehen strich sie mir über den Arm.
»Bitte ruf Lewandowskis an. Die Nummer ist gespeichert.«
Ich rief an. Jesses Bereitschaftspflegeeltern würden in den nächsten zwei Wochen da sein, der Junge konnte gern zu ihnen kommen. Lewandowskis hatten noch nie nein gesagt.
Wenn Ira von Jesse erzählte, huschte über ihr Gesicht ihr Mädchenlächeln, das sich nie verändert hatte. Ich erkannte es, auch wenn es in dem Haus noch so finster war, und liebte es, gerade weil es so schwierig geworden war, sie zu lieben und nicht bloß Mitleid mit ihr zu haben. Wenn Ira lächelte, schienen mir die vielen gemeinsam verbrachten Jahre nicht verloren zu sein, vielleicht weil wir, wie als Kinder so oft, dasselbe dachten.
Was mir allmählich dämmerte, wusste sie längst: Das Blatt, mit dem sich alles wenden würde, war für sie zu schwer. Jesse würde es anheben müssen, das für seine Mutter zu schwer gewordene Blatt würde er in die Höhe stemmen und die Seite umschlagen. Mit ihrem Sohn begann ein neues Kapitel.
Anfangs war sie sich der Tragweite des Gedankens, der sich da in ihr festsetzte, vielleicht gar nicht bewusst. Mich packte eine rasende Angst um sie, sobald ich begriff, wie weit ihre Bereitschaft, sich aufzugeben, vorangeschritten war.
Für sie hingegen war es schon lange Gewissheit: Indem sie ihrem Sohn die eigene Lebensaufgabe überantwortete, gab es für sie selber nichts mehr, was eine Anstrengung lohnte. Tragweite war da für sie längst kein Kriterium mehr.
Gedanken an Ira hin und her wälzend saß ich vor der Wand, die das Letzte war, was sie gesehen hatte. Es waren Gedanken zum Weinen, düstere Vorstellungen voller Selbstanklagen, die ich zur Genüge kannte, mir aber nicht aus dem Kopf schlagen konnte. Da sitzt du in deinem vollgepackten Wagen und starrst gegen eine Garagenwand. Guck durchs Fenster, dieses Bullauge. Draußen im Oktoberlicht blinken Käfer und Fliegen, während dir hier im Halbdunkel der einzige Mensch durch den Sinn geistert, den du liebgehabt hast. Wie willst du je aus diesem Schlamassel wieder rauskommen.
Nach Iras Tod hatten meine Eltern das Haus in Schnelsen aufgegeben. Um Jesse den Übergang so einfach wie möglich zu machen, zogen sie zu ihm nach Wellingsbüttel und setzten dem Unglück das entgegen, worin sie Fachleute waren, das Meistern des Alltags. Nur die Garage klammerte ihr Pragmatismus aus. Sie war Tatort und Mahnmal, Tor zur Unterwelt und Schandfleck, ein unverständlicher Ort. Deshalb stand sie leer und wurde zu einem nach Benzin stinkenden Mausoleum, in das außer mir keiner einen Fuß setzte.
Wenn ich die drei besuchte, stellte ich den Wagen übers Wochenende in die Garage. Bevor ich ins Haus ging, blieb ich so lange im Auto sitzen, bis der graue Steinquader mit seinem kreisrunden Fensterloch den Gruftcharakter verlor. Nach dem Abendessen ging ich vor die Tür, rauchte eine Zigarette und schloss die Garage noch einmal auf. Ich wuchtete das Tor in die Höhe, setzte mich ans Steuer, drückte im Ascher die Zigarette aus und wartete, dass sie sich einstellten: Meine Gedanken in Iras Garage waren immer dieselben. Manchmal dauerte es keine Minute, schon sah ich sie vor mir, wie sie rauchend in der Terrassentür stand, sah sie lächeln, ihr Mädchengesicht, ihre langen dünnen Beine in der Turnhalle bei einem Sportfest oder wie sie mit einer Freundin auf dem Gepäckträger nach Haus fuhr. Ich hörte ihre Stimme, die dunkel war und so wenig zu dem schmalen Körper passte. Unerklärlich langsam kam mir die Stimme meiner Schwester vor, wenn sie Sätze sagte, die so nur sie sagte.
»Ist überhaupt jemand in der Lage, einen entscheidenden Augenblick zu erkennen?«
Wenn das Wochenende vorbei war, setzte ich mich sonntagabends oder montagmorgens ins Auto und fuhr den Wagen ins Freie. Kaum war das Tor geschlossen, verschwanden Gedanken und Fragen, ganz so, als blieben sie bei meiner toten Schwester in der Garage.
Seit Längerem hatte mein Vater vor, die Garage abreißen zu lassen und eine neue zu bauen. Sie sollte an derselben Stelle stehen und sah auf den Plänen genauso wie die alte aus, war es aber nicht. Sie würde einen Zugang zum Haus haben. Und es würde eine Sicherheitsbelüftung geben. Mein Vater zeichnete detaillierte Pläne, wie früher, und sogar einen Rapido, einen Rapidographen schaffte er sich dafür noch einmal an, weil er sein altes Tuschzeichnerset schon vor Jahren mir vermacht hatte.
Seit März schob er das Vorhaben auf. Auch wenn meine Eltern die Garagenandachten ihres Sohnes makaber fanden, wenn sie lieber, wie es sich gehörte, nach Ohlsdorf zum Friedhof spazierten und meinten, Jesse untersagen zu müssen, die Garage zu betreten oder mit seinem Freund Niels Basketball davor zu spielen, so sahen sie mit der Zeit doch ein, dass mich nichts so tröstete wie vor Iras Wand zu sitzen.
Wenn meine Mutter mich fragte, warum ich nicht endlich damit aufhörte, gab ich zurück, dass ich es bleiben ließe, sobald ich darüber weg sei. Aber das stimmte nicht. Ich glaubte keinen Augenblick lang, je über Iras Tod hinwegkommen zu können, und wollte es auch gar nicht.
2
Im Rückspiegel sah ich unten an der Straße meine Mutter stehen und aufgeregt Zeichen geben. Es war nicht zu erkennen, wem ihr Winken galt, wahrscheinlich aber meinem Vater, der in allem der Besonnenere war. Das Licht blendete. Die Konturen meiner Mutter verschwammen darin. Entfernt erinnerten sie an Iras, sodass ich die Augen verengte und mich für ein paar Momente der Illusion überließ.
Jesse reagierte für gewöhnlich nicht auf Kommandos. Seit er in den pubertären Taumel eingetreten war, brauchte er länger als sein Opa, um den Vorgarten zu durchqueren. Meine Mutter schien den Startschuss zum allgemeinen Verabschieden gegeben zu haben, und so ließ sich zwar einigermaßen vorausberechnen, wann auch ihr Mann an der Straße stehen würde, nicht aber, wann ihr Enkel bereit war, zu seinem Onkel in den Wagen zu steigen. Der Onkel war ich, Onkel Markus. Jesse, an dessen Schule jeder Vorname amerikanisiert wurde, nannte mich manchmal Marky Mark. Meine Mutter signalisierte, dass die Straße frei war. Ein letztes Mal starrte ich auf die Wand und die hellblaue Iris des Bullauges darin, dann ließ ich den Motor an. Während ich den Kombi langsam zurücksetzte, sah ich über der Hecke den weißen Haarschopf meines Vaters, wie er sich hinunter zum Fuß der Auffahrt bewegte. Die Herbstsonne stand tief, und ich überlegte, wo ich meine Sonnenbrille gelassen hatte.
Es war Montagmorgen. Ich würde im Studio nicht vor mich hinstricheln müssen. Ich hatte ausgeschlafen, und die Wetteraussichten für die kommende Woche waren nicht schlecht. Ich würde das Meer sehen, hatte einen Auftrag, für den ich genügend Zeit hatte und der gut bezahlt wurde. Es gab eine ganze Reihe von Gründen, weshalb ich annahm, meine Traurigkeit in Schach halten zu können.
Für die Reise mit Jesse, die unsere erste gemeinsame und die erste für ihn seit dem Tod seiner Mutter war, fühlte ich mich daher gewappnet. Und auch mein Vater schien fest entschlossen, seine gute Laune bis weit in den Tag hinein zu retten. Er lächelte mir über die Hecke hinweg zu, formte aus Daumen und Zeigefingern zwei Ringe und setzte sich das imaginäre Brillengestell auf die Nase. Durch das Schiebedach hörte ich meine Mutter, sie rief ihm zu: »Wird Zeit!«
In den Pappelwipfeln hörte man die zwei Wacholderdrosseln schackern, die seit Sommer im Garten nisteten und denen meine Eltern angeblich Namen gegeben hatten, auch wenn Jesse und ich es für nicht sehr wahrscheinlich hielten, dass sie die beiden Vögel wirklich unterscheiden konnten.
Als ich den Wagen am Straßenrand geparkt hatte, kam meine Mutter ans Seitenfenster. Es fuhr hinunter, und sie steckte den Kopf herein, sodass ich kurz dachte, die herbstkühle Luft, das ist sie. Sie nickte in Richtung Hecke. Dort stand auf dem Gehsteig Jesses neuer Rucksack, schwarz und nicht sehr prall gefüllt.
»Ich hab ihm den Koffer gepackt, aber er wollte ihn nicht. Wahrscheinlich wirst du unterwegs Unterwäsche kaufen müssen. Nur damit du dich nicht wunderst.«
Mit schnellen Blicken suchte sie das Wageninnere ab. Auf der Ladefläche über den umgeklappten Rücksitzen lagen die Zeltplane, der Kocher, der Feldstecher, die russischen Gummistiefel. In meiner Sporttasche stapelten sich Bücher, obenauf Der grüne Heinrich. Den Umschlag zierte eines der beiden Selbstbildnisse von Franz Pforr, die Jacke, die Pforr trug, war grün nachkoloriert.
»Der ganze Krempel«, meinte meine Mutter zerstreut, »den braucht ihr doch gar nicht. Wo, hast du gesagt, übernachtet ihr?«
»In Belgien, in Mons.«
Sie wiederholte es und fragte, wieso ausgerechnet da.
»Einfach nur so, Mama. Es liegt auf dem Weg.«
»Du wirst es wissen. Eh ich’s vergesse … Hier hast du seine Versichertenkarte.«
Ich steckte die Chipkarte ein und sagte, sie solle sich keine Sorgen machen. Auch in der Normandie gebe es Unterwäsche.
Davon sei auszugehen. »Und genauso davon, dass du nur dieses Handwaschzeug dabeihast, von dem man sich einen Pilz holt. – Hier.«
Sie hielt mir ein paar Geldscheine ins Auto, vielleicht vierhundert Euro.
»Nimm es. Wenn der Junge es nicht braucht, gibst du’s mir wieder. Also in acht Tagen seid ihr zurück? Du rufst mich übermorgen an.«
Die Beifahrertür ging auf. Mein Vater stellte Jesses Rucksack in den Fußraum und zwinkerte mir zu. Ich roch sein Aftershave.
»Habt eine schöne Zeit, Markus. Arbeite nicht zu viel. Mach lieber Skizzen. Deine Skizzen waren immer wunderbar. Skizzen, hörst du?«
»Er hat’s gehört«, sagte von links meine Mutter.
Und mein Vater von rechts: »Das Buch hast du?«
Ich nickte. »Ist eingepackt. Ich werd’s mir ansehen, sobald wir da sind. Danke.«
Das Buch war der Bericht eines jungen Lastenseglerfliegers der Royal Air Force, der im Sommer 1944 in der Nacht zum D-Day die Erstürmung der Pegasusbrücke in der Normandie miterlebt hatte. Er hieß McCoy Lee, hatte also denselben Nachnamen wie wir gehabt. Deshalb hatte mein Vater das Buch gelesen und wollte es mir leihen.
»Gut. Aber lies es auch wirklich! Es ist spannend und voller Details. Man erfährt nicht nur viel über ihre fantastischen Gleiter, die ganz aus Holz waren, sondern auch über die Brücke, die sie erstürmen sollten. Ich geh rein und seh nach, wo der Prinzregent bleibt. Also: Bonne chance! Ich lass die Tür auf.«
»Danke, mach’s gut!«, rief ich ihm nach und sah über die Schulter, wie er auf dünnen Beinen in einer vollendet gebügelten cremefarbenen Hose davonging.
»On y va, Monsieur!«, hörte ich seinen Bass hinter den Berberitzen.
Kaum war er weg, langte meine Mutter wieder herein. Ich schrak zurück, zuckte zusammen, als sie mir aufs Herz fasste und die Geldscheine in meine Brusttasche schob, wo schon Jesses Versichertenkarte war. Mit der Faust klopfte sie darauf, aber sofort zog sie die Hand zurück und stemmte sie in die Hüfte. Ich hörte sie, streng und dabei warm: »Nun mal hopp, hopp! Alles wartet auf dich!«
Es war dieselbe Stimme, die Ira und mich aus dem Sumpf der Kindheit in den Morast der Jugend und weiter ins trockengelegte Moor der mittleren Jahre gelotst hatte.
»Hast du die Zahnbürste eingepackt? Jesse, ja oder nein?«
Der Junge ließ sich auf den Beifahrersitz fallen und sank augenblicklich in sich zusammen. Er schwitzte. Er schwitzte wie nach einem Waldlauf durch bergiges Gelände und roch zugleich nach Schlaf. Ein Grollen war zu vernehmen, offenbar die Antwort auf die Zahnbürstenfrage.
Und meine Mutter verstand sie.
»Dann ist gut.«
Ich lächelte ihr zu. Sie strich mir über die Stirn. »Mach’s gut. Pass auf ihn auf, und pass auch auf dich auf – warte!«
Sie lief ums Auto und griff über die Beifahrertür nach Jesses Schläfen. Als sie seinen Kopf zu sich herangezogen hatte, hauchte sie ihm einen Kuss auf den goldenen Scheitel, dann schlug sie die Tür zu.
Damit wir uns aneinander gewöhnten, war ich vor zwei Wochen mit Jesse zu einem HipHop-Konzert und ein paar Tage später zu einem Bundesligaspiel gegangen. Das Gefühl von einem Ausflug zu zweit hatte sich unter all den Leuten jedoch weder bei mir eingestellt, noch dürfte er es gehabt haben, und so war ich erst jetzt tatsächlich zum ersten Mal, seit Ira nicht mehr lebte, mit dem Jungen allein.
3
Nach Iras Auffassung war der Zufall die Sprache der Welt. Jeder Stein und jeder Baum, jedes Tier und alle Menschen sprachen und verstanden sie. Musste nicht alles und jeder zu jedem Augenblick auf alles gefasst sein?
Sie hatte das vor langer Zeit gesagt. Später redete sie von geborgten Lebensgefühlen, allumfassender Täuschung, Sinnleere statt Erfüllung. Immer seltener sagte sie etwas, meine verschwiegene Schwester. Deine schweigsame Schwester! Schweigeminuten, -stunden, -tage. Kein Ende des Schweigens abzusehen, und doch im Kopf, ihrem wie meinem, und auch in den Köpfen unserer Eltern keine andere Vorstellung als die von einem Ende.
Wenn es stimmte, dass die Welt sich durch Zufälle äußerte, konnten meine Eltern und ich wohl behaupten, dass wir der Welt zugehört und ihren Weisungen zu folgen versucht hatten. Denn es war nichts als bloßer Zufall, dass Jesse mit mir in meinem alten Mercedes saß, um für acht Tage in die Normandie zu fahren.
Doch waren wir deshalb nicht auf alles gefasst. Als Überbleibsel einer Familie von Pragmatikern waren wir vielleicht auf alles Mögliche vorbereitet. Für Ira allerdings, die auf gar nichts vorbereitet war und nichts mehr für möglich hielt, hätte das einen elementaren Unterschied bedeutet.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!