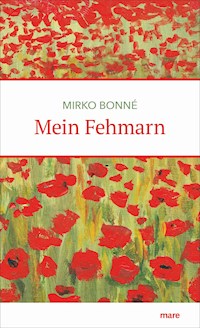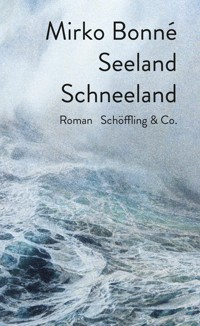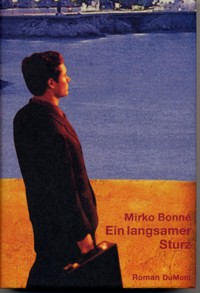9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schöffling
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie wir verschwinden erzählt eine große Geschichte der Erinnerung: Raymond, Witwer mit zwei so lebhaften wie eigensinnigen Töchtern, erhält nach Jahrzehnten des Schweigens einen Brief seines todkranken Jugendfreundes Maurice, der ihn in die gemeinsam erlebte Vergangenheit zurückversetzt: nach Villeblevin, wo 1960 Albert Camus bei einem Autounfall ums Leben kam. Ein französisches Dorf und ein historisches Ereignis werden für zwei Jugendfreunde zum symbolischen Angelpunkt, um die fünfzig zurückliegenden Jahre zu erinnern und ihre Schicksalhaftigkeit anzuerkennen. Erinnerung an die eigene Jugend und das Sterben eines Idols verbinden sich zu einem ergreifenden Roman, der Mirko Bonné als einen der bedeutenden Autoren unserer Zeit zeigt. Wie wir verschwinden ist ein großes Buch der Erinnerung, ein Roman unseres Lebens wie des Sterbens einer Ikone des letzten Jahrhunderts: Albert Camus.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 462
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhalt
[Cover]
Titel
Widmung
Wie wir verschwinden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Dank
Impressum
Kurzbeschreibung
Autorenporträt
[Leseprobe – Lichter als der Tag]
Für meine ElternBruni und Thomas Eggers
Schwarzes Pferd, weißes Pferd, eine einzelne Menschenhand zügelt das Rasen beider. Wie heiter die Fahrt mit halsbrecherischem Tempo. Wahrheit lügt, Offenheit verhehlt. Verbirg dich im Licht. Albert Camus
Wie wir verschwinden
1
Es war Sommer, als ich den ersten Brief von Maurice Ravoux bekam, der Jahrhundertsommer, nachdem Chauvin, Grubbs und Schrock für die Entdeckung des molekularen Partnertauschs den Nobelpreis für Chemie erhielten. Ich dagegen war aus meinem Labor ausgeschieden. Eine Angina, eine instabile, sogenannte Crescendo-Angina, hatte mein Herz eingeschnürt, und so war ich sechs Wochen lang unfreiwillig Dauergast der Clinique de la Porte Verte von Versailles gewesen, während die Hitze die Berberitzen und Forsythien vorm Fenster in blühende Mauern verwandelte. So flach mein Atem war, so wenig ich den Flügeln noch traute, die in meiner Brust schnarrend nach Luft japsten, nie sehnte ich mich mehr nach einer leichten Brise im Freien. Blanker Hohn, dass es pünktlich am Tag meiner Entlassung wie aus Eimern zu schütten begann. Aber ich wusste ja, einem Schleierwolkenhimmel war Moral so fremd wie dem menschlichen Herzmuskel.
Meine Jüngste holte mich ab und fuhr mich die paar Kilometer durch den Regen nach Haus. Mit seinem vielen Grün, alles strotzend vor Lebendigkeit, war es in Le Chesnay um einiges kühler. Pénélope brachte mir die Post ins Schlafzimmer hinauf, die meine Nachbarin für mich gesammelt hatte, und sagte, während sie Jalousien und Fenster schloss, in dem Stapel aus Rechnungen und Wurfsendungen sei auch ein Brief ohne Absender.
Ich bekam nur noch selten persönliche Post. Pénélope wollte wissen, wer mir geschrieben habe.
Sie konnte sich an einen Jugendfreund ihres Vaters mit Namen Maurice nicht erinnern, und was ihre Mutter ihr von ihm erzählt hatte, schien sie wieder vergessen zu haben: 1969, als wir aus Villeblevin wegzogen, war sie noch ein kleines Kind gewesen, keine zwei Jahre alt. Es war 38 Jahre her.
»Ruf mich, wenn du was brauchst«, sagte sie. »Ich bin unten und sehe nach, was ich einkaufen muss. Jeanne kommt aus dem Verlag direkt hierher, dann entscheiden wir, wer über Nacht bleibt.«
Damit ließ sie mich allein, und kurz darauf hörte ich sie unter der Terrassenmarkise mit meiner Nachbarin anreden gegen den strömenden Regen.
Ich hatte mich matt gefühlt, müde, traurig und alt wie der seiner Krone beraubte Ludwig XVI., ich hatte mich in meinem Krankenzimmer als Letztes noch einmal im Spiegel betrachtet, mein fahles eingefallenes Gesicht, die Hakennase und die Bürste aus weißem Haar, und hatte mir vorgestellt, dass so der Bürger Ludwig Capet aussah, als man ihm die Allongeperücke samt Krone vom Kopf riss.
Wie groß warst du, Ludwig?
Ich war knapp 1,90 und wog nun kaum noch 70 Kilo.
Maurice’ Schrift zu lesen und dabei sein Gesicht vor mir zu sehen machte mich nervös. Ich setzte mich im Bett auf und dachte an dieses Gesicht, das es so wenig noch gab wie mein eigenes Jungensgesicht. Und erst als ich mir vergeblich vorzustellen versuchte, wie Maurice Ravoux an diesem verregneten Sommertag wohl aussehen mochte, las ich den Brief.
Es waren wenige Sätze in einer fremden, genau gesetzten Handschrift. Schwarze Tinte. Kein Datum. Dann folgten fünf mit der Maschine geschriebene, eng getippte Seiten.
»Mein lieber Raymond«, mit dieser Frechheit begann der Brief, »Du wirst Dich wundern, von mir zu hören. Ich möchte Dich nicht belästigen, will Dich aber darüber informieren, dass es mir nicht gut geht. Ich dachte lange an unsere gemeinsamen Jahre zurück und frage mich, ob es Dir auch so geht.
Bist Du bei guter Gesundheit? Und die Kinder?
Ich hoffe es von Herzen! Véroniques Tod vor zwei Jahren hat mich sehr erschüttert, auch wenn ich mich nicht gemeldet habe, um Dir mein Beileid auszudrücken. Ich habe viel gedacht an Dich, an Jeanne und Pénélope.
Es gibt Dinge, über die ich gern mit Dir sprechen würde.
Erinnerst Du Dich an unsere Strecke?
Die Gleise, die Züge?
Den negativen Wind?
Weißt Du noch: der alte Schuppen und unsere glorreiche Maschine, mit der wir hofften, für immer zu verschwinden?
Ich habe das alles in den Jahren nie vergessen, besonders nicht den einen Tag, den Unfall auf der Chaussee. Ich habe begonnen, über den Autounfall zu schreiben, frage mich nun aber, weshalb, für wen?
Ich glaube, ich habe die beigefügten Seiten für Dich geschrieben, und deshalb schicke ich sie Dir.
Ich weiß, und ich höre Dich sagen, das Leben geht weiter, vorbei ist vorbei.
Mein Leben geht nicht weiter, Raymond, darum dieser Brief. Ich war ja nie gut im Fach Selbstlosigkeit.
Beste Grüße, Maurice«, hatte er unterschrieben, und unten, sehr klein auf der Seite, stand die Adresse einer Klinik, in einem Ort, den ich nicht kannte.
Ich legte den Brief beiseite, überlegte und döste dann etwas. Ich hatte keine Lust zu lesen, was Maurice Ravoux von einem Unfall schrieb, über den die ganze Welt Bescheid wusste. Ich fragte mich, was ich mit dieser Nachricht anstellen sollte, was sich in Wahrheit dahinter verbarg, und als ich mich schließlich dabei ertappte, dass ich Maurice zumindest in einem Punkt recht gab, darin nämlich, dass Selbstlosigkeit nie seine Stärke gewesen war, schlief ich ein.
2
Jeanne weckte mich am nächsten Morgen. Sie saß auf dem Bettrand, schön wie ihre Mutter, mit einem geblümten Tuch im Haar.
»Wie geht es dir?«, fragte sie und ob ich frühstücken wolle. Sie ging nach unten und bereitete etwas zu. Als ich Tee trank, einen Happen aß und meine Medikamente nahm, fragte sie nach dem Brief, von dem Pen ihr erzählt habe.
Maurice, wer das sei.
»Ein Freund«, sagte ich schwach, »ein alter Freund.«
»Darf ich lesen, Papa?«
Ich gab ihr den Brief. Sie las ihn und sagte dann, es sei seltsam, dass mein Freund und ich gleichzeitig im Krankenhaus gewesen seien.
»Willst du ihm antworten?«
»Meinst du, ich sollte?«
»Er scheint im Sterben zu liegen.«
»Scheint so. Ich habe seit fast 40 Jahren nichts von ihm gehört. Sogar als deine Mutter starb, hat er sich nicht gemeldet. Jetzt, wo es mit ihm selber zu Ende geht, meldet er sich.«
»Kannte er Maman?«
»Wir waren alle auf einer Schule. Du kanntest ihn auch, sogar Pen. Aber ihr wart noch Zwerge. Du warst vier und Pen zwei, als wir nach Versailles zogen. Kein Wunder, dass du … ich erinnere mich selbst kaum an ihn.«
»Und dieser Unfall, von dem er schreibt?«
»Villeblevin«, sagte ich bloß, und die Seiten, die ich noch nicht gelesen hatte, fielen mir wieder ein. Sie lagen auf dem Nachttisch. Ich hatte noch immer keine Lust, sie mir anzusehen.
Jeanne sah zur Zimmerdecke, zog die Mundwinkel nach unten und zuckte mit den Achseln. »Keine Ahnung. Was für ein Unfall war das?«
»Im Januar 1960. Der Autounfall, bei dem Albert Camus starb. Der Wagen fuhr draußen vorm Dorf gegen einen Baum.«
»Das hat Maman uns immer erzählt!«, sagte sie freudig. »Dass ihr in dem Dorf aufgewachsen seid, in dem Albert Camus verunglückt ist. Ich glaube, wir haben Mythos des Sisyphos in der Schule gelesen, und ich weiß noch, dass Camus irgendwo geschrieben haben soll, der absurdeste Tod sei, bei einem Autounfall zu sterben. Na, deinen Freund scheint das immer noch zu beschäftigen.«
»Er ist nicht mehr mein Freund.«
»Aber er war es. Du solltest ihm den Gefallen tun und ihm antworten, egal, was du jetzt von ihm hältst.«
»Ich weiß nicht, was ich von ihm halte. Ich kenne ihn ja nicht. Er ist ein alter Mann, irgendwo in einem Krankenhaus.«
»Gestern warst du selber noch im Krankenhaus, und wir hatten Angst um dich. Du bist selber kein alter Mann, Papa, nur ein älterer Herr, das bist du.«
»Ich könnte zumindest dein Vater sein«, sagte ich. »Moment mal: Bin ich nicht sogar dein Vater?«
Sie lachte. »Sehr komisch. Alzheimer hast du zum Glück nicht. Noch nicht! – Du solltest ihm schreiben. Was verlierst du dabei?«
»Was hätte deine Mutter gesagt, was meinst du?«
»Genau dasselbe. ›Schreib ihm. Sei nicht so stur. Ich mag sture Leute nicht‹, hätte sie gesagt.«
»Gut, damit steht es zwei zu eins. Ich werde Pen fragen.«
»Mach das.« Jeanne stand auf. »Frag sie. Aber du solltest auch das in dir drin fragen, dessentwegen du im Krankenhaus warst.«
»Du willst, dass ich auf mein Herz höre«, sagte ich. »Also gut. Gib mir einen Kuss. Komm her, mein Herz.«
Jeanne ließ mich allein, ich hörte, wie sie sich unten an den Flügel setzte und ein bisschen spielte, es klang nach Rachmaninow, wie der Wind so traurig und zugleich leicht und schwer, und ich sank zurück ins Kissen und starrte zur Decke.
Meine Gedanken verschwammen, so lange, bis ich nur noch den Regen hörte. Ich fragte mich, wie lange es her sein mochte, dass ich im Garten unter den Pappeln gesessen hatte. Ich nahm den Umschlag und sah auf dem gelben Papier nach, von wann der Poststempel war.
Maurice Ravoux’ Brief war schon zwei Wochen alt. Inzwischen bist du vielleicht tot, dachte ich und faltete die getippten Seiten auf.
3
Der dunkelgrüne Wagen flog fast, als er aus dem Wäldchen auftauchte und herauspreschte in Richtung Paris. Es war ein trüber Mittag Anfang Januar mit beständigem Nieseln. Diesiges Licht und in der Ferne Krähen und Elstern, die versprengt über Felder und Äcker längs der Chaussee durch die Lüfte gaukelten. Kein Schnee und keine Sonne. Aber beinahe dottergelb waren die zwei Paar Scheinwerferkegel, die da durchs Unterholz brannten und das Zwielicht zwischen den Bäumen auf einen Schlag zunichtemachten. Es schien, das triste Grau der Birken würde im selben Tempo zerplatzen, mit dem der fremde Wagen näher kam und hineinraste in die winterliche Stille des Tages.
Es war ein Tag, der dem Treiben von allem und jedem so zärtlich und so gleichgültig gegenüberstand wie jeder Tag vor ihm und jeder danach – nur ein gewöhnlicher Montag, wäre er nicht der erste Montag des Jahres gewesen. Am 4. Januar 1960 kam der grüne Wagen durch den Wald. Die Fahrbahn war regennass. Auf dem Asphalt spiegelte sich der Himmel. Und in den Pfützen schwammen Abbilder von Wolken, die seit Tagen von den Britischen Inseln herüberkamen und ihren Regen dem Land spendeten zwischen Seine, Marne und Yonne, rasche, tief dahinziehende Wolken aus Somerset und Cornwall.
Was dort herandonnerte, musste ein tonnenschweres Geschoss auf vier Rädern sein, ein Projektil, das durch den Tag flog und in dessen Innern Leute saßen, denen es offenbar darum ging, Zeit zu gewinnen. Der so dachte, stand in sein Regencape gehüllt, mit nassem Gesicht und beschlagener Brille am Straßenrand auf einem schmalen, schmutzig grünen Streifen zwischen Graben und zwei der uralten Platanen, die die Nationalstraße säumten. Vom Sattel auf die Rahmenstange gesprungen, hatte Paul Cassel, ein Bauer aus der Ortschaft Villeblevin, sein Fahrrad zum Stehen gebracht. Es kam nicht oft vor, dass derartiger Lärm die Mittagsstille durchbrach, Lärm wie von einem herabstoßenden Flugzeug. Paul Cassel hatte in den Ardennen gekämpft. Er war in Sachsen in Gefangenschaft gewesen. Der Lärm, den er aus dem Birkenwäldchen hörte, fuhr ihm durch die Glieder wie das Kreischen der deutschen Stukas. Er rutschte vom Sattel und sank auf die Rahmenstange. Und als das Fahrrad stand, wandte er sich um, gepackt von der alten Panik und zugleich neugierig, zu sehen, welche Höllenmaschine dort in seinem Rücken durch Chévreaux’ Forst brach.
Cassel sah vier gelbe Lichter, die auf ihn zurasten, vier Lichter, zwei links, zwei rechts. Ihm war kein Auto mit solchen Scheinwerfern bekannt. Er war ein aufgeklärter Mann, der viel las. Er hatte eine Melkmaschine entwickelt. Er war bei seinem Bruder im Nachbarort Villeneuve-la-Guyard gewesen und hatte dort den ganzen Morgen lang über Elektrozäune diskutiert.
Neun Meter breit war die Route Nationale 6 bei Villeblevin. Rund 30 Meter freie Fläche, in den warmen Jahreszeiten bewachsen von Gras, Brennnesseln und Huflattich, lagen zwischen je zweien der mehr als 250 Platanen zu beiden Seiten der Fahrbahn. In dem noch kahlen Geäst der über ein Jahrhundert alten Chausseebäume hingen die Mistelbälle des letzten Sommers. Paul Cassel wusste, es gab Pläne, jeden zweiten Baum zu fällen, um seinem Nachbarn Platz zum Atmen und Wachsen zu verschaffen, Pläne, gegen die nicht allein die Erben der Chévreaux Einspruch erhoben, die den Platanensaum zu einer Zeit gepflanzt hatten, als die Nationalstraße zwischen Sens und Fontainebleau noch ein Heerweg gewesen war, ungepflastert, mit Sand und Schottersteinen bestreut, die Mulden und Schwemmlöcher mit Scherben aufgefüllt, Scherben aus Ton oder Glas.
Ohne die Geschichte der Straße zu kennen, setzte Gilberte Darbon den Blinker und stoppte ihren Renault kurz vor der Einmündung in die RN 6. Seit den Weihnachtstagen besuchte die Erzieherin aus Lyon eine Freundin, die in Misy-sur-Yonne lebte, ein paar Minuten nördlich von Villeblevin. Selten zu Fuß, lieber mit dem Wagen, zumal es nicht aufhören wollte zu regnen, erkundete sie die Gegend, Kirchen, Märkte. Mademoiselle Darbon war an diesem Montag unternehmungslustig gestimmt, sie hatte das Autoradio laut gestellt und sang die Chansons mit, deren Text sie kannte.
Die Gestalt mit dem roten Cape, die auf der Hauptstraße unter den Bäumen hindurchradelte, hatte sie schon vor einiger Zeit entdeckt, umsichtig, wie sie fuhr, hatte sie den Fahrradfahrer seither nicht aus den Augen gelassen. Dass er, ein Mann, wie sie annahm, einige hundert Meter östlich von ihr und bevor sie auf die Einmündung traf, sein Fahrrad anhielt, verwunderte sie nicht, es erleicherte Gilberte Darbon, und weil er nicht länger ein Verkehrsrisiko für sie darstellte, vergaß sie Paul Cassel wieder.
Gilberte Darbon aus Lyon und der alte Monsieur Cassel waren nicht die ersten, die an diesem 4. Januar Zeugen wurden, mit welcher Geschwindigkeit das dunkelgrüne Coupé durch den Birkenforst bei Villeblevin fuhr. In dem Wäldchen war ein Holztransporter unterwegs, und darin saßen zwei Männer, zwei Brüder: France IVFM spielte ein Chanson von Yves Montand, Les enfants qui s’aiment. Wie die Kindergärtnerin, die das Lied so laut gestellt hatte, dass sie nichts von einem durch das Wäldchen brechenden Lärm vernahm, hörten Montand in ihrer Fahrerkabine auch die Waldarbeiter Roger und Pierre Patache zu, während sie ihren schweren Lastwagen durch das Waldstück bugsierten. Roger saß am Steuer. Sein jüngerer Bruder Pierre, den man Pipin nannte, überflog auf dem Beifahrersitz eine Zeitung. Der Scheibenwischer quietschte. Ab und zu verzog Roger Patache das Gesicht zu einer Grimasse, denn bei dem Lied aus seinem Transistorradio musste er an Yves Montand in Lohn der Angst denken, und auch wenn er selbst bloß Baumstämme geladen hatte, konnte er sich gut in den Nitroglyzerin-Fahrer aus dem Film einfühlen. Seinem Bruder, der ein schlichtes Gemüt besaß, verriet er von dieser Tagträumerei, die ihn für Sekunden zu einem Kinostar machte, allerdings nichts.
Es war ihr erster Transporttag. Weshalb die Erben der Chévreaux beschlossen hatten, das Birkenwäldchen fällen zu lassen, durch das er schon als Kind gelaufen war, wusste Pipin nicht, das heißt, eigentlich wusste er es schon, denn Roger hatte ihm erklärt, dass im Zuge der Flurbereinigung die Abholzung vonnöten war. Er überlegte deshalb, wieso die Felder und der Wald, die er so gut kannte, überhaupt flurbereinigt werden mussten. Pipin fand jedoch vorläufig keine Antwort. Und er wollte Roger auch nicht auf die Nerven gehen, zumal sie beide ja gutes Geld mit dem Holz verdienten, und Arbeit gab es im Winter nur wenig. Pipin vertiefte sich in die Zeitung, er sah sich Bilder darin an, die seine Aufmerksamkeit erregten.
Roger sah den heraneilenden Wagen zuerst, im Rückspiegel tauchten Lichter auf und wurden rasch größer. Er nahm an, der Wagen würde abbremsen und hinter ihnen bleiben, zumindest bis sie aus dem Wald kamen und die Chaussee erreichten. Doch er irrte sich und sagte im selben Moment, als der Wagen auf die andere Spur wechselte und im toten Winkel verschwand: »Jetzt sieh dir den an: Friedhof, ich komme.«
Einen Sekundenbruchteil später erschien das grüne Coupé seitlich vor der Schnauze des alten Simca-Lasters und scherte auf die Spur zurück, so dass auch Pipin es sah.
»Hallo, hallo!«, lachte er, »wie viel Sachen hat der denn drauf!«
Roger schätzte das Tempo des Wagens, der vor ihm davonschoss und dem Ausgang des Wäldchens zustrebte, auf mehr als 130 Stundenkilometer, behielt die Mutmaßung jedoch für sich. Eine andere Frage beschäftigte ihn. Aber auch Roger war das Fabrikat des Wagens unbekannt, er entschied, dass es sich entweder um ein neues Mercedes-Modell oder um einen amerikanischen Wagen handelte.
In einiger Entfernung verlief längs der Chaussee die alte Bahntrasse nach Paris. Mit seiner Dampflok fuhr dort der Mittagszug aus Sens vorbei, Roger sah die Qualmschleppe, wie sie auf der Brücke über die Yonne heller wurde und dann verschwand.
»Hast du die Karre gesehen?«, rief Pipin. »Weißt du, was das war?«
Roger sagte es ihm: ein Chevrolet.
Pipin prustete. Chevrolet … Von wegen! Ein Facel Vega sei das gewesen, und er gab sich einen Klaps auf die Stirn, bevor er in tiefes Nachdenken versank. Roger sah den Wagen den Waldsaum erreichen, sah die lange schnurgerade Schneise der Chaussee, in die der Amischlitten eindrang.
Im selben Moment, da sich in ihm ein elendes Gefühl für die Schneckenartigkeit seines nicht im mindesten mit Nitroglyzerin beladenen Lasters breitmachte, stieg ein paar hundert Meter entfernt in Paul Cassel die alte Angst vor dem Lärm der Stukas auf, so mächtig, dass er trotz des Regens sein Fahrrad zum Stehen brachte und die Stiefel in den Matsch grub.
Einen Renault, der in östlicher Richtung in die RN 6 einbog, sah Cassel nicht. »Les enfants qui s’aiment ne sont là pour personne«, sang Yves Montand im Radio und mit ihm Gilberte Darbon, als sie vor sich am Ende der Chaussee das Birkenwäldchen liegen sah. In zartes Lila getaucht, oder vielmehr ein zartes Lila von sich gebend, lag der Wald da. Daraus hervor kam ein Wagen, ein Auto mit vier gleich stark blendenden Scheinwerfern kam ihr so schnell entgegen, dass sie erschrak, noch ehe sie den Mann mit dem Fahrrad wieder entdeckte. Das grüne Auto mit dem weißen Dach jagte in einem Tempo an ihm vorüber, dass der Luftzug den Mann fast von den Beinen hob, er schwankte, das Cape blähte sich, und Cassel fluchte, er hob drohend eine Faust. »Merde alors!«, »So eine Scheiße!«, brüllte er durch den Lärm, in dessen Mitte er sich plötzlich versetzt sah, denn zu seiner Verblüffung stammte das Dröhnen und Kreischen, das er hörte, nicht nur von dem Wagen, der an ihm vorbeibrauste, und von dem Mittagszug, der pfiff, bevor er auf die Yonne-Brücke fuhr, es kam gleichzeitig noch immer aus dem Wald. Roger Patache schaltete dort in einen niedrigeren Gang. Das Lkw-Getriebe jaulte auf, fügte sich, der Simca wurde schneller, auch die Brüder Patache erreichten die Chaussee.
Damit waren zwischen Chévreaux alten Platanen alle versammelt, vier Opfer, vier Zeugen und zwei Handvoll Elstern und Krähen. Die Vögel schenkten dem zufälligen Aufeinandertreffen keine Beachtung. Sie gaukelten durch den Nieselregen mit der gleichgültigen Zärtlichkeit jener Kinder, die für niemanden da waren, weil sie sich liebten.
4
Ich fragte mich, ob mit diesen Kindern in Wahrheit wir gemeint waren – Véronique, Delphine, Maurice und ich. Vieles erkannte ich in der Beschreibung wieder, das Wäldchen der Chévreaux, die Chaussee, sogar an den Laster der Patache-Brüder erinnerte ich mich: Er war blau, aber der Lack an vielen Stellen vom Blech geplatzt, und darunter kam ein fast weißes Hellblau zum Vorschein. Ein alter Simca, so verbeult, Maurice sagte einmal, der Laster der Pataches sehe aus, als habe ein Flugzeug ihn abgeworfen.
Ich fragte mich, ob er wohl noch einmal in Villeblevin gewesen war, um mit Roger, Pipin oder dem alten Cassel über den Unfall zu sprechen. Seit dem Tod meines Vaters, als auch meine Mutter nach Versailles zog, war ich selbst nicht mehr dort gewesen. Ich rechnete nach und kam zum Schluss, dass Paul Cassel wahrscheinlich nicht mehr lebte. Er musste schon damals über 60 gewesen sein, so alt wie ich heute war.
Und wir waren auch ganz anders gewesen als die Kinder in dem kitschigen Chanson von Prévert. Wir waren, das stimmte, für niemanden da, nicht für den alten Cassel und nicht für Pipin Patache, der nur vier oder fünf Jahre älter war als wir und so kreuzeinsam wie die Eichhörnchen, die er im Wald einfing und hinterm Haus in winzigen Käfigen sich selbst überließ. Wir waren ja nicht mal füreinander da. Geliebt hatten wir uns? Maurice schien es zu glauben. Ich hatte es auch geglaubt.
Unsere Strecke. Die Gleise.
Was wir wirklich liebten, waren Züge. Der die Eisenbahn erfunden hatte, der hatte sie für uns beide in die Welt gebracht, meinten wir, und die Welt war es, die sie uns bedeutete.
Dabei hielt kein Zug der Welt jemals in Villeblevin, all die Jahre nicht, die Maurice und ich zusammen in dem Nest lebten, bevor es uns auseinandertrieb und wir, jeder mit dem eigenen Wagen, vollbepackt, vollgetankt und ohne dass wir uns voneinander verabschiedet hätten, davonfuhren, Delphine und er und bald darauf auch Véronique und ich.
Sie saß neben mir. Wir waren Anfang 20 und hatten zwei kleine Kinder, Jeanne und Pénélope, sie saßen hinter uns. Ich erinnerte mich deutlich an den Augenblick, als ich den Renault, den wir von Véroniques Mutter übernommen hatten, über die Yonne-Brücke lenkte und uns mitten über dem Wasser der Morgenzug aus Sens entgegenkam. Es war das letzte Mal, dass ich ihn sah. Er hatte noch immer die alten grünen Waggons mit dem goldenen Schriftzug. Eine Diesellok zog sie, so wie das früher Dampflokomotiven getan hatten. Und ich dachte auch da an Maurice: Wo mochte er sein? Ein halbes Jahr, vielleicht etwas länger, war es her, dass er und Delphine aus Villeblevin weggezogen waren. Und Véronique muss in meinen Augen gelesen haben, woran ich dachte, denn kaum war das Geratter vorüber und wir am anderen Ufer, fragte sie mich, ob ich an ihn denke. Wen sie meine, fragte ich. Und sie lächelte lange. Maurice, sagte sie irgendwann, sie rede von Maurice.
Kam ein Zug wie der Mittagszug aus südlicher Richtung über die Yonne, fuhr er gut einen Kilometer lang parallel zur Chaussee, bevor Gleise und Nationalstraße sich trennten. Die Route Nationale 6 machte im Norden einen Bogen um Villeblevin, die Schienen aber führten mitten durchs Dorf, mitten zwischen zwei Sportplätzen hindurch, vorbei an der Kirche, dem Friedhof, dem Freibad, der Schule, vorbei hinterm Haus von Maurice’ Großonkel und weiter zwischen Bauernhöfen, Gärten, Feldern hindurch, bis das Dorf zu Ende war und der Wald von Fontainebleau begann. In seinen ersten Ausläufern lagen umgeben von alten Eichen der Park und das verfallene Gutshaus der Chévreaux. Das war die Strecke, die Maurice in dem Brief erwähnte – die er heraufbeschwor. Denn die Strecke war uns heilig, ja mehr als das. Sie war unser Ausweg, unser Fluchttor aus Villeblevin. Auf ihr übten wir zu verschwinden.
Die Erinnerungen jagten mir seit dem Brief durch den Kopf. Vorbei ist vorbei – ich wusste nicht, wann ich das zu Maurice gesagt haben sollte, aber ich wünschte dennoch, es wäre so: vorbei, vorbei.
In der Woche nach meiner Entlassung aus der Klinik kümmerten sich meine Töchter im Wechsel um mich: Vormittags kam Pen, nachmittags nach dem Büro Jeanne. Hatte Jeanne länger zu tun, besuchte mich mein Schwiegersohn und spielte Schach mit mir. André gewann jede Partie, obwohl, wie mir nicht entging, er mir fast immer ein Sizilianisch vorschlug, in dem ich besser war als er. Ich war erschöpft, doch so erschöpft auch wieder nicht, dass ich ihm den Triumph des absichtlichen Verlierers gegönnt hätte. Ich im Bett sitzend, er im Korbstuhl daneben, so schoben wir stumm und verbissen die Figuren übers Brett. Gute Spieler waren wir nicht. Beide neigten wir zu dramatischen, unüberlegten Offiziersopfern, André sogar zum Selbstmord seiner Dame, was er wohl genial, ich hingegen idiotisch fand, ihm aber nicht sagte. Beide waren wir scharf aufs Gewinnen, und kaum war die Eröffnung abgeschlossen, versuchte er mich zu verwirren, indem er Züge aus seinen Lieblingspartien zitierte, »Fischer gegen Spasski, Reykjavík 1972!«, oder Sätze aus Vladimir Nabokovs Romanen: »Wenn Sie so, dann ich so, und Pferd fliegt.« Von dem Brief schien er nicht zu wissen, deshalb erwähnte ich ihn erst gar nicht. Und Jeanne und Pen schienen Maurice’ Elaborat schon vergessen zu haben, weshalb ich auch ihnen verschwieg, was in mir vorging. Es hörte nicht auf zu regnen. Es regnete fast die ganze Woche. Ich hörte mir Andrés Ausführungen zum »Solus Rex« und anderen grässlich öden Beispielen aus dem weiten Feld des Problemschachs an, während ich so gut wie nie das Bett verließ und doch in Gedanken durch die heißesten Sommertage lief, an die ich mich erinnerte.
Ich entsann mich jeder Einzelheit. War ich endlich allein mit mir, warf ich das Kissen aus dem Bett, mähte damit die für die nächste ruhmlose Partie bereits aufgestellten Figuren nieder und legte mich flach auf den Rücken. Ich schloss die Augen. Ich verschränkte die Hände überm Herzen. So ließ ich es über mich ergehen. Und es dauerte keine Minute, bis sich die Bilder, die Geräusche und alles andere einstellten und sie wieder da waren: Brücke, Gleis, Bahndamm. Das Freibad und der Schulhof. Madame Labeige, Professor Ravoux, die Patache-Brüder. Der Tag des Unfalls. Albert Camus! Der Nobelpreisträger tot in Villeblevin. Und nicht tot, nicht Nobelpreisträger, aber am Leben: ich, ich in Villeblevin. Und Villeblevin in mir. Ich hatte das ganze Nest in meinem Kopf.
Dann rollte er, und der Regen prasselte dazu gegen das Fenster: Der Zug, der Regionalexpress meiner Erinnerungen überquerte die Yonne-Brücke und preschte auf die genau dreieinhalb Kilometer lange Strecke zum Waldrand zu. Dazwischen lag Villeblevin, das keinen Bahnhof hatte. Die Strecke war zweigleisig, und das Nebengleis, als Ausweichgleis gedacht, war in Wirklichkeit ein totes Gleis, kein Zug war je darauf gefahren. Die Holzbohlen verrotteten, die Schienen waren verrostet, ein dicker, klumpiger roter Pelz klebte darauf, Mäusestädte mit Gängen und Tunneln, Magazinen und Friedhöfen lagen unter dem Schotter, und der Schotter war nicht grau, sondern schillerte und leuchtete, grün, blau und im Sommer sogar lila, von Flechten und Moos.
Der tote Bahndamm war das Beste, was es in Villeblevin gab. Während der Sommerferien glich ihm der ganze Ort. Alles war ausgestorben, öde und leer. Beamte und Bauern waren dageblieben, alle anderen aber verreist ans Meer. Es schien nur zwei Kinder in Villeblevin zu geben, Maurice und mich, ausgerechnet. Wir waren auch in der Schulzeit diejenigen, die sich am königlichsten langweilten. Im Sommer langweilten wir uns Löcher ins Gesicht. Es gab Wochen, in denen wir Tag für Tag die einzigen Freibadbesucher waren. Handtücher, Bücher, Süßigkeiten und mein Transistorradio, wir ließen abends alles auf dem Rasen liegen, am Morgen fanden wir es genauso vor wie nach einer Runde zum Abkühlen durch das leere blaue Becken.
Was war gut an Sommerferien? Nur, dass auch das Schulhaus leer stand. Bloß die Fenster der Hausmeisterwohnung im Erdgeschoss waren tagsüber offen, um etwas kühlen Wind hineinzulassen. Lange nach zehn Uhr am Abend, wenn meine Mutter hereinkam und ich so tat, als würde ich schlafen, und sie das Licht ausmachte, leuchtete etwas drüben in der Stube der Hausmeister so hell wie ein Raumschiff kurz vor der Landung. Wenn ich noch mal aufstand und zum Fenster zurückschlich, sah ich die Wohnzimmer des Dorfes flimmern. Das absolut Helle aber, das vor meinen Augen schwebte und sie starr werden ließ, bis ich zu träumen anfing und praktisch schon träumend zurückschlüpfte in mein Bett, war der Kronleuchter der Hausmeister, so groß und strahlend hell, dass er eigentlich in der Schulaula hätte hängen müssen. Bestimmt hatte er das früher, meinte Maurice – und Dinge, die er sich ausmalte, waren für ihn so gut wie wahr. Er war ein Junge, der mit Kopf und Kragen in Wunderdingen steckte. Ich war vorsichtiger, vielleicht weil meine Vorstellungskraft mir eher Angst einjagte. Laut Maurice hielt Monsieur Labeige seine junge Frau als eine Art Hausmeistersklavin, und den Kronleuchter hatten sie unter irgendwelchen frei erfundenen Sicherheitsvorwänden aus dem Schulhaus in ihr Wohnzimmer verbracht, so wie sie einmal die ausgediente Vitrine für Tierpräparate aus dem Biologieraum abtransportierten und durch ihren Vorgarten schleppten, um damit in ihrem Hauseingang zu verschwinden. Ob es stimmte, dass sie den Glasschrank, in dem noch kurz zuvor Fuchsschädel, ausgestopfte Vögel und Fischskelette zu sehen gewesen waren, fortan wirklich als Küchenschrank nutzten, fanden wir nie heraus. Aber wir hielten alles für möglich bei Labeige, und das nicht nur, weil Maurice und ich uns jahrelang in einer Art intergalaktischem Kriegszustand mit ihm befanden.
Ob ich wisse, wer 1957, in seinem Geburtsjahr, Schachweltmeister war, fragte mich André an einem der Nachmittage, als Jeanne im Verlag festgehalten wurde. Ich hatte weder von Botwinnik gehört noch von Smyslow, zwei Russen, die sich, wie André lang und breit erklärte, über ein Jahrzehnt hinweg auf dem Brett bekämpften und beide 1957 Weltmeister waren, bevor endlich mit Tal und Petrosjan die Ära der …
1957, als wir anfingen, die Maschine des großen Verschwindens zu bauen, waren Maurice und ich 13. Wir gingen in die achte Klasse und wohnten in derselben Straße, in der auch das Gymnasium lag. Mein Vater war Binnenschiffer. Schach interessierte ihn so wenig wie die sowjetische Planwirtschaft. Er war nie da, und war er doch da, war es so gut wie unmöglich, mit ihm auszukommen. Wenn sie sich begegneten, redeten meine Mutter und Maurice’ Mutter nur über unsere Väter. Wir, sagten sie, würden werden wie unsere Herren Väter. Wobei ich nicht vorhatte, Binnenschiffer zu werden, und Maurice nicht anstrebte, sich mit Anfang 30 in der Normandie von einem Deutschen abknallen zu lassen. Er und seine Mutter hatten drei Zimmer im ersten Stock eines alten Hauses, das in Villeblevin nur Haus Ravoux genannt wurde, eine kleine, stille Wohnung mit lauter Stuck an den Decken, die auf einen verwilderten Hinterhof und den Bahndamm blickte. Über ihnen wohnte niemand, dort waren der Dachboden und ein großer Raum zum Wäscheaufhängen, an den ich mich gut erinnerte. Maurice und ich wünschten uns, dort hinaufziehen zu können, um die dämmrige Leere dieses Raums ganz aus Holz für uns allein haben zu können. Haus Ravoux hieß so nach seinem Großonkel Benjamin, der allein im Erdgeschoss wohnte und um den seine Mutter sich kümmerte, weil er zuckerkrank war. Maurice’ Mutter war, wenn man sie nach ihrem Beruf fragte, Haushälterin, manchmal sagte sie auch Zugehfrau. Ob Professor Ravoux 1957, als André zur Welt kam, sich für Schach interessierte, für den Schachkrieg zwischen Smyslow und Botwinnik? Ich wusste es nicht.
Gelang mir mal ein Überraschungszug, rief André gleich »Ssobáka!«, was, wie er mir erklärte, auf Russisch »Hündchen« bedeute und durchaus liebevoll gemeint sei. Boris Spasski habe es 1972 am Brett zu Bobby Fischer gesagt. Während André redete, während er Sätze zitierte aus Lushins Verteidigung oder Lolita – »finis, meine Freunde, finis, meine Feinde« – und meine Rochade-Bauern torpedierte, entsann ich mich unvergesslicher Sommernachmittage. Sie waren die heikelste Tageszeit. Nie konnte man wissen, wo sich der Feind aufhielt. Vormittags reinigte Labeige die Korridore und Klassenräume, am Mittag schloss er die Fenster und zog die Vorhänge zu. Dann, hieß es, schlief er für zwei Stunden. Nachmittags aber war man nicht sicher vor ihm. War es nicht zu heiß, um im Freien zu arbeiten, stand Madame Labeige breitbeinig, ihren schönen Po zum Himmel gereckt, im Schulgarten und zupfte Unkraut aus einer sandigen Erde. Denn wo der Schulgarten lag, war früher, bevor man ihn an den Bahndamm verpflanzt hatte, ein Bolzplatz gewesen. Madame Labeige und ihr Hintern beschäftigte unsere Phantasie wie kein anderes weibliches Wesen in Villeblevin: Sie war nicht nur schön und viel jünger als ihr Mann. Sie war wild, war klug, lebendig, stark, ehrlich und rätselhaft. Zauberhaft und wundervoll. Meist trug sie ihre Haare hochgesteckt, und ihr Mann, orakelte Maurice, zwang sie in den Ferien dazu, den gleichen taubengrauen Trainingsanzug anzuziehen wie er selbst, so dass man die beiden von weitem kaum unterscheiden konnte. Allerdings schraubte bloß Labeige am Dach des Fahrradunterstands herum. Wenn er uns entdeckte beim schwersten aller Vergehen, wenn wir, um den Weg zum Bahndamm abzukürzen, über den Schulhof rannten, war es immer Labeige, der brüllte. Seine Frau dagegen, stand sie plötzlich vor uns, sagte: »Raymond und Maurice. Unterwegs? Zehn Sekunden noch halte ich euch für eine Luftspiegelung, dann muss ich leider Monsieur Labeige rufen …« – so als folge sie einer Vorschrift, die zu ändern nicht in ihrer, nur in der Macht des Hausmeisters lag, zufälligerweise ihr Mann. Sie hatte Sommersprossen und grüne Augen. Sie schwitzte stark und roch sehr süß nach Schweiß und noch etwas, was ich nicht kannte, was Maurice aber so wild machte wie mich. Manchmal fragten wir uns, wie sie wohl reagieren würde, käme einer, oder kämen zwei, um sie zu retten.
Ockergelb erstreckte sich das Gebäude fast über die gesamte linke Seite der Straße. Außer dem Gymnasium war die Mairie darin untergebracht. Die Trikolore hing an einem Mast über dem Eingang, einer Tür, die wie ein paar Meter weiter die Einfahrt mit dem Holztor fast immer verschlossen war, es sei denn, der Bürgermeister wollte hinein- oder herausfahren. Am Lenkrad der DS saß Roger Patache, der den Bürgermeister manchmal chauffierte. Roger war ein Freund von Maurice’ Vater gewesen, und seit dessen Tod besuchte er ab und zu Maurice’ Mutter oder fuhr mit ihr ins Kino nach Fontainebleau. Hinten hatte der Citroën getönte Scheiben, so dass man vom Bürgermeister nie mehr zu sehen bekam als vielleicht seine Hand, ein Stück seines Hemdsärmels.
Ab und zu, wenn der Hausmeister den Rasenstreifen vor der Schule mähte oder in den Rabatten frische Blumen pflanzte, parkte Roger die DS in der Einfahrt vor dem geschlossenen Tor, ließ die Fahrertür offen und rauchte eine Zigarette mit dem am Zaun lehnenden hochroten und kahlköpfigen Hässling Labeige. Spähten wir durch die Vorhänge von Maurice’ Kinderzimmerfenster, hatten wir nur für den Wagen Augen. Wir spürten, wir würden Zeugen eines geheimen Vorgangs werden, sobald sich hinten in der schwarzen DS etwas regte. Man musste sich dann nämlich fragen, wieso der Bürgermeister nicht auch ausstieg, wieso er nie selbst mit dem Hausmeister sprach, sondern lieber Roger Patache vorschickte, der, abgesehen von Maurice’ Mutter Cora, zu niemandem freundlich war. Cora nannte er sie, obwohl sie Corinne hieß.
Aber nie regte sich etwas in der DS. Manchmal, wenn er die Zigarette auf die Straße schnippte und sich von Labeige abwandte, sah Roger zu uns herauf, bevor er zu dem Wagen zurückging. Und wir, wir duckten uns, tauchten mit einer Drehung weg unter dem Fenster und wurden unsichtbar wie der Bürgermeister, der Léaud hieß und der die ganze Zeit in der Gangsterlimousine saß und wartete.
»Kannst du«, fragte André, als ich am Zug war und mir ein Blick übers Brett verriet, dass ich auch diesmal keine Chance hatte, »kannst du wohl die Weltmeister seit 1957 in der korrekten Reihenfolge aufsagen?«
»Nein.«
»Ich schon. Warte …« – er rieb sich die Hände und starrte zur Decke – »Botwinnik, Smyslow, Botwinnik, Tal, Botwinnik, Petrosjan, Spasski, Fischer, Karpow, Kasparow und …«
»Botwinnik?«
Er lachte. Und sagte beleidigt: »Kramnik.«
Wir warteten, bis man hörte, wie drüben die DS in den Hof fuhr und das Holztor zukrachte. Dann sprangen wir auf die Beine, rannten nach hinten ans Küchenfenster und rissen es auf. Alles war still im Haus und in dem verwilderten Hinterhof. Vor uns lag der Nachmittag, leer und lang und brütend heiß. Unter uns stand die Gartentür von Maurice’ Großonkel offen. Aber wir hörten auch von dort nichts, kein Schnarchen und kein Sichwälzen in dem Bett, das ein Stockwerk tiefer genau unterm Bett von Maurice stand, nicht das kleinste Geräusch. Professor Ravoux war da, nur hörte man ihn nicht, er war immer da, denn aus dem Haus ging er schon lange nicht mehr, und selbst wenn er es gewollt hätte, er war viel zu dick dafür. Wenn es so still war, saß er in seinem Spezialsessel am Fenster, dem, der unter seinem Gewicht nicht zusammenbrach. Da las er oder schrieb über den Herzog von Montmorency, den er verehrte, oder schaute bloß, was auf der Straße passierte.
Aber da Roger Patache und Bürgermeister Léaud nicht mehr da waren, passierte auf der Straße nichts. Wo es passierte, war hinten, jenseits des verwilderten Gartens in den großen Walnussbäumen, und darauf warteten wir.
Was wir den negativen Wind nannten, kündigte es an.
»Stoppuhr?«, fragte Maurice und fuhr sich durch den Haarschopf, der rötlich blond war und ihm wild mal in die eine, mal in die andere Richtung vom Kopf abstand. Und ich nickte und starrte wie er hinüber zum Bahndamm.
Noch bevor das Pfeifen von der Yonne-Brücke kam, fingen die Walnussbäume an, sich zu bewegen. Von unserer grünen Tribüne aus, dem efeuumrankten Fenster im ersten Stock von Haus Ravoux, sahen wir es: Das Laub rauschte nicht, es wehte kein Lüftchen. Was die Blätter zittern ließ, war der negative Wind – sie bebten und rasselten, und nur dann zeigten sie ihre schillernde Unterseite. Im Sommer wurden die Bäume am Bahndamm silbern, wenn der 13-Uhr-50-Schnellzug nach Paris durch Villeblevin donnerte.
Dann kam das Pfeifen von der Brücke. Es war der schrille, lang anhaltende Pfiff der größten Dampflok, die noch im Einsatz war. Wir liebten sie und nannten sie für uns »die Schöne, die Wunderbare«, und genau das war sie, denn so waren unsere Empfindungen für sie, schön und wunderbar.
»Still jetzt!«, war das Nächste, was Maurice sagte, obwohl er es nicht zu sagen brauchte. Ich wusste, worauf es ankam. Wir hofften, dass uns kein Geräusch störte. Wir lauschten bloß hinaus in den Garten, die Gleise entlang und immer weiter bis zum Fluss. Von dort kam das Rattern. Die Schöne, die Wunderbare kam über die Brücke, und wir wussten, wurde das Rattern etwas leiser, nur einen Hauch, dann war die Lok angelangt diesseits der Brücke und hatte die Weiche passiert, von der das Nebengleis abging, und dann raste sie neben dem toten Gleis her, während die Waggons mit den Menschen, die nach Paris zur Gare de l’Est fuhren, noch über der Yonne schwebten.
»Jetzt!«, rief Maurice, und einen Sekundenbruchteil später: »Hast du?«, und die weit aufgerissenen Augen in seinem Sommersprossengesicht starrten mich an.
Und ich rief zurück: »Ja! Ich hab sie!«, und dann hielt ich, um es zu beweisen, die Stoppuhr hoch, so dass wir beide darauf sehen konnten, wie die Sekunden rannten.
5
Schach!« Andrés Fanfare riss mich aus meinem Dämmern. »Ich fürchte, du hast nicht aufgepasst und bist – schachmatt, Raymond. Smyslow ist am Boden, Botwinnik triumphiert.«
Ich musste ihm recht geben und gestand meine Niederlage ein. Ich gratulierte ihm, und er freute sich und war zugleich betrübt, schon wieder, zum siebten Mal, gewonnen zu haben.
So ging es nicht weiter. Welches Fiasko. Immerhin wurde das Wetter besser. Um die Schmach abzumildern, traute ich mich zum ersten Mal aus dem Schlafzimmer hinaus und begleitete André in Pyjama und Morgenmantel zu seinem Wagen.
Als er gefahren war, setzte ich mich an das Metalltischchen unter den Bäumen. Ich sah mir an, wie alles gewachsen war. Gesund fühlte ich mich noch nicht, aber doch so weit wiederhergestellt, dass von Beschwerden zu sprechen übertrieben gewesen wäre.
Hätte ich Maurice geantwortet, ich hätte keine Beschwerden erwähnt, geschweige denn, dass ich glaubte, überhaupt nur zu genesen, weil ich wusste, ihm ging es schlecht. Aber so war es: Wenn es stimmte, was er geschrieben hatte, lag mein Jugendfreund Maurice im Sterben. Er war so alt wie ich, aber ich war noch einmal davongekommen.
Ich hatte mir eingestehen müssen, dass es mir ziemlich gleichgültig war, ob Maurice lebte oder nicht, und als ich es mir eingestand, nahm ich an, dass es besser war, wenn ich ihm nicht zurückschrieb. So hatten meine Verdrängungsmechanismen immer funktioniert: Ich gestand mir etwas ein, war ganz nah dran an der Wahrheit, war aufrichtig bis zum Umfallen, und dann fiel ich um – wie mein König, Solus Rex, mutterseelenallein auf dem Brett. Wer konnte sagen, dass es besser war, Maurice zu antworten? Jeanne vielleicht konnte es, ich nicht.
Jeanne wusste nicht, was in meinem Kopf vorging, aber sie sah mich vom Auto aus im Garten sitzen und in die Baumkronen starren. Sie parkte den Spider in der Auffahrt und winkte. Als sie die Einkäufe ins Haus gebracht hatte, kam sie zu mir, mit einer leichten Decke, die sie mir um die Schultern legte, als sie mich auf die Wangen küsste.
»Bonsoir, Papa, wie fühlst du dich?«
Ich sagte es ihr: »Gut. Sehr gut.«
»Was machst du hier?«
»Nichts. Die Luft genießen, das Grün, den Duft. Ich denke an nichts. Es gibt nichts, worum ich mir Sorgen mache. Es ist schön.«
»Weißt du, woran ich denke, wenn ich dich hier so sitzen sehe? Wir sollten ein Essen geben. Nichts Großes. Eine kleine Feier zu deiner Genesung. Wenn das Wetter schön ist, könnten wir den Esstisch in den Garten tragen.«
Mir gefiel die Vorstellung, nicht allein unter den Pappeln zu sitzen, sondern mit Jeanne und André und Pen und ihrem neuen Freund Thierry, der in Kanada lebte und sich mit dem Gedanken trug, zu meiner Tochter an die Porte Molitor zu ziehen. Ich stellte mir vor, wie wir tranken, aßen und lachten. Aber wie stets bei auszusprechenden Einladungen nagte da auch Skepsis an mir. Véronique hatte es geliebt, Gäste auszuwählen, die zueinander passten oder sich auf wundersame Weise bei Tisch ergänzten, obwohl sie ganz und gar nicht zueinanderpassten, sie hatte Freude daran gehabt, Einladungskarten auszutüfteln, die ihre kleine Lieblingsdruckerei für sie druckte. Eine Meisterin im Organisieren und Vorbereiten war sie gewesen, und kein Abend hatte einem anderen geglichen.
Mit keinem einzigen unserer Gäste von früher, allesamt Leute, die Véronique als unsere Freunde bezeichnet hatte, stand ich noch in Kontakt. Als wären die Carons und die Le Roys, der blasierte Jules Mugler und die chronisch kinderlose Suzette, die Prochets und die Fourniers mit ihren beiden ein jedes Mal neu den Garten verwüstenden Airedale-Terriern – als wären sie alle auf einen Schlag bei einem Flugzeugabsturz in den Anden ums Leben gekommen.
Irgendwo, wahrscheinlich in ihrem Zimmer, musste Véroniques Zigarrenkasten stehen. Jules Mugler hatte ihr den Humidor geschenkt. Darin hatte sie alphabetisch geordnet, versehen mit Bemerkungen über Geschmacksvorlieben und Geschmacksaversionen, Karten mit Namen und Anschrift eines jeden Menschen aufbewahrt, der einmal bei Véronique und Raymond Mercey zu Gast gewesen war. Ich hatte den Humidor lange nicht gesehen, seine Kartei nie wieder benutzt.
»Wen soll ich einladen? Aus dem Labor will ich keinen hier haben. Dich, André, Pen, ihren Freund. Und sonst?«
Jeanne umarmte mich –
Sie küsste mich auf die Stirn.
»Vergiss dein altes Labor. Zunächst dachte ich an Oma«, sagte sie. »Wir holen sie ab und richten ihr Mamans Zimmer her. Was meinst du?«
»Gut – nur denk an Mamies Bridge-Nachmittage. Und ihre Theaterabende. Madame verlässt das Heim nur mit dem gepanzerten Theaterbus.«
»Ich werde sie überlisten. Und dann dachte ich auch an Madame Sochu. Weil sie immer für dich da ist. Als du im Krankenhaus warst, hat sie …«
Ich war mir bewusst, was ich an meiner Nachbarin hatte. Mich störte, dass sie Witwe war, dass es keinen Monsieur Sochu mehr gab, seit der den plötzlichen Herztod gestorben war.
Aber meinetwegen. Ich war einverstanden.
6
Am Wochenende darauf saß meine Mutter Marguerite neben meiner Nachbarin Robertine unter den Pappeln und plauderte mit meinem Schwiegersohn. André arbeitete für ein Kulturmagazin und hatte Mamie zwei Karten fürs Théâtre Mogador organisiert: für eine ausverkaufte Aufführung von Sartres Fliegen. Das also war Jeannes List gewesen, anerkennend nickte ich ihr dafür zu. Ihre 89-jährige Oma glücklich zu machen war eine hohe Kunst, und ich war froh, die beiden miteinander lachen zu sehen – auch wenn mich betrübte, dass Jeanne ihrer Mutter offenbar immer ähnlicher wurde.
Ihre Schwester war ganz anders. Pénélope war jung geblieben, und darauf war sie stolz wie ein Kind. Sie war ungestüm und vertraute ihrer Phantasie und ihren Empfindungen mehr als der Vernunft, mit der ihre ältere Schwester sie vor den Abgründen des Lebens bewahren wollte. Jeanne war seit 15 Jahren mit André liiert, vor drei Jahren hatten sie geheiratet. Ihre Mutter war schon in der Chemotherapie gewesen und hatte bei der kirchlichen Trauung eine Perücke getragen.
Einen Steinwurf entfernt von Notre-Dame lag in Versailles das Haus der Antikrebsliga. Noch ein halbes Jahr nach Véroniques Tod hatten Jeanne und ich in der Rue Madame mittwochabends die Gruppentherapiestunde besucht und uns Vorträge angehört über den Umgang mit Trauer: Trauer führe zu Veränderungen im Hormonsystem, Immunsystem, autonomen Nervensystem und kardiovaskulären System, referierte ein graues Männlein, das Professor an der Sorbonne war und sich unentwegt die Brille auf- und absetzte. Dass so ein vertrockneter Blindfisch lieber zum Ophthologen gehen solle, zischte mir von links Jeanne ins Ohr. Und mein rechter Stuhlnachbar brach in würgendes Schluchzen aus und sagte, nach dem Tod seiner Frau habe sich die Hälfte seiner Seele verfinstert. Alle diese Systeme, antwortete der Pariser Professor und zeigte mit der Brille wie zum Beweis auf den hemmungslos Weinenden neben mir, fundamental würden sie abhängen von Gehirnfunktionen und Neurotransmittern.
Auch Pen war auf der Sorbonne gewesen. Sie hatte dort Kunstgeschichte studiert. Seit dem Abschluss ihrer Doktorarbeit hatte sie viele Beziehungen gehabt, war aber nie mit einem Freund zusammengezogen. Jeanne machte gern Urlaub, Pen dagegen reiste durch die Welt. Im Herbst hatte sie für jeden Ort, den sie gesehen hatte, eine Sommersprosse im Gesicht. Allein oder mit Freundinnen war sie in den letzten drei Jahren in Schweden, Karelien, Bulgarien, Patagonien und Mexiko gewesen. Sie ging zum Yoga, Jazzdance, Beckenbodentraining und verteidigte ihre Trommelmeditation, obwohl ich nie etwas gegen Schamanismus gesagt hatte. Er war mir bloß fremd. 39 war sie jetzt. Im Winter hatte sie eine alte Schulkameradin in Montreal besucht und sich dort verliebt. Wie sie interessierte sich Thierry besonders für die Kunst der deutschen Romantik, Caspar David Friedrich, Philipp Otto Runge, Maler, deren Namen ich kannte. Thierry war bretonischer Champion im Wellenreiten gewesen. Seine Eltern lebten in der Bretagne, in Pont-Aven. Er fuhr einen alten Saab. Mehr wusste ich nicht von ihm.
Nun saß auch er unter meinen Pappeln. Er rauchte von Andrés Gitanes. Die beiden schienen sich zu mögen. Sie waren sich einig, dass dem Wasserstoffauto die Zukunft gehöre.
»Alten Saabs jedenfalls nicht!«
Der lachende André gab Thierry seine Visitenkarte und sagte, er wisse vielleicht einen Job für ihn: Das Centre Pompidou plane eine neue Zeitschrift, und ein Freund suche noch Mitarbeiter, die etwas von Kunst verstünden.
Thierry hob eine Hand und verdeckte die Augen. Na, ob er da der Richtige sei … Dann aber zog er seinerseits eine Karte aus der Cordjacke, strich sie auf dem Tisch glatt und schob sie zu André hinüber.
Ich merkte, wie meine Mutter den jungen Mann musterte, wenn er von seinem Sport erzählte, von Wellenformen, Spots und Tubes und Webcams am Strand. Ich fand Thierry etwas zu unbedarft. Mamie zwinkerte mir zu.
Kurz gab es am Büfett Streit zwischen Pénélope und Jeanne, die mit irgendeiner Deko nicht einverstanden war. Aber dann aßen wir, und ich hielt eine kleine Rede über uns, die Merceys, unser Herz, dem eine Angina nichts anhaben könne.
Bei Tisch kam das Gespräch plötzlich auf Albert Camus. André fing damit an, und ich mutmaßte sofort Jeanne dahinter. Aber der Name Maurice Ravoux fiel nicht. André psalmodierte vom Theater für den kleinen Mann, pries das Mogador, den Mut dort, Sartres verstaubte Revoluzzerstücke zu aktualisieren. Den Namen des Regisseurs hatte ich noch nie gehört.
Ihr sei Camus stets lieber gewesen als Sartre, sagte meine Mutter, und das nicht nur, beileibe nicht, weil Albert Camus wie Humphrey Bogart ausgesehen habe. Das Mogador, das sei doch so ein Spaßtheater.
»Camus hatte viel kleinere Ohren«, trompetete André und lachte heiser. Er war sichtlich in seiner Eitelkeit getroffen, und Jeanne musste ihm beispringen. Sie könnten die Karten ja umtauschen. Demnächst würde Camus’ Caligula gegeben.
»Alles Käse«, schnaubte Mamie in ihr Taschentuch.
Pen zeigte Thierry nach dem Essen das Gästehaus. Als sie zurückkamen, küsste sie ihn und nahm dabei sein Gesicht in beide Hände. Jeanne sah mich vielsagend an. Und ich sah, dass Madame Sochu ihr Besteck ordnete und Anstalten machte, aufzustehen, als sie merkte, dass der Kuss kein Ende nahm.
»Hilfst du mir abräumen, Schwesterherz?«, fragte Jeanne.
Meine Mutter meinte, es müsse erlaubt sein, Vorlieben zu äußern. Sie kenne wenig von Sartre. Der Ekel sei unvergesslich, Das Spiel ist aus rührend, Die Wörter bloß Geschwätz. Leider seien ihre Augen zu schlecht, um noch viel zu lesen.
»Mit Camus allerdings verbindet mich eine Menge«, sagte sie stolz. »Immerhin waren wir dabei, als er starb.«
»Sie waren dabei, als Albert Camus starb?«, fragte Thierry nahezu entrüstet. »Ist er nicht in Algerien gestorben?«
Jeanne begann abzuräumen, und Robertine Sochu half ihr schließlich, das Geschirr hineinzutragen, als Pénélope sich nicht rührte. Den Teller ihrer Schwester ließ Jeanne stehen.
»Camus war ein Pied-noir, Algerienfranzose, schon richtig«, sagte André. Er rauchte und zwei gelbe Finger hielten die offene Schachtel Thierry hin. »Aber er ist nicht in Algerien gestorben. Er ist tödlich verunglückt in dem Dorf, in dem Raymond und Madame Mercey damals lebten, in …«
»… in Villeblevin«, sagte Mamie unwirsch, »mon dieu, ja, und das kann nicht die ganze Welt wissen. Abgesehen davon, dass auch mein Mann in Villeblevin lebte, nur war er selten zu Haus, denn er verdiente das Geld für unsere Familie, allein, mit harter Arbeit auf einem Binnenkahn, einem Flamländer. Er liebte uns und liebte seinen Beruf. Überlege, André, wie lange das her ist. – Wie alt, wenn ich fragen darf, sind Sie, junger Mann?«
Thierry hob die Hände und öffnete und schloss sie rasch dreimal, bevor er den Kopf schief legte und grinste. Mit seinen langen blonden Locken sah er viel jünger aus als 30. Aber auch so war er neun Jahre jünger als Pénélope.
Auch André machte eine Geste – eine, die ankündigte, dass er gar nichts mehr sagen würde. Und da auch kein anderer etwas sagte, entstand endlich das peinliche Schweigen von der Sorte, wie Véronique es nie zugelassen hätte, selbst bei ihrer wie eine provençalische Distel vertrockneten Freundin Suzette nicht.
»Jules, heute Abend bist du kein guter Tischnachbar«, hätte Véro zu Doktor Mugler gesagt, der Zahnarzt war und kubanische Zigarren rauchte, mit denen er die Luft verpestete. In Ermangelung einer Lebensgefährtin versoff und verrauchte er ein Vermögen, das er den Leuten aus dem Mund bohrte.
»Deine Gattin hat keine hohe Meinung von meinen gegenwärtigen Möglichkeiten«, pflegte Jules in solchen Momenten zu mir zu sagen. An Véronique persönlich richtete er das Wort nur in Notfällen. Sie war seine Patientin, er kannte ihre Zunge, ihre Lippen, und ich war mir immer sicher gewesen, dass sein ertrunkenes Herz sie vergötterte.
»Muntere die liebe Suzette etwas auf, bitte. Suz! Sieh nicht mich an, sondern den Doktor! Jules, erzähl uns eine Geschichte, ja? Auf mein Kommando – eins – zwei – los!«
Dann lauschte Suzette voll Abscheu Jules’ Gefasel. Um seine Art von schmerzhafter Groteske zu würdigen, brauchte es einen robusteren Humor als den ihren. Immerhin aber lachte sie am Schluss, und der Tisch applaudierte hustend weniger Jules’ jüngster geschmackloser Parodontose-Anekdote als vielmehr Suzettes tapferer Heiterkeit. Suz lachte Véronique ins Gesicht, obwohl ihr bestimmt nach Weinen zumute war.
»Calvados?«, fragte Jeanne. »Oder jemand Kaffee?«
Keiner wollte etwas, keiner am Tisch und keines meiner Gespenster, niemand außer Jeanne, die noch nicht bereit war aufzugeben.
»Lasst uns etwas spielen«, sagte sie, »so wie früher! Was haltet ihr von einer Runde Königsscharade?«
Sie stand am Tisch. Mit großen Augen, lächelndem Gesicht, die Hände hinter dem Rücken, blickte sie in die Runde.
Ich sagte, ich sei müde, und stand auf.
»Heute nicht, Schatz. Oder spielt doch ohne mich.«
Aus der Küche drangen die Geräusche von Madame Sochu in den Garten, die den Geschirrspüler einräumte oder ausräumte, um ihn neu einräumen zu können. Aus seinem Bau gekrochen kam mein schlechtes Gewissen. Ich hatte immer ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn Véronique nach einer Party oder einem Essen Jules Muglers Zigarrenasche einsammelte, die sie als Porzellanreiniger hortete. Dann ging sie zu Bett, wortlos. Wie Efeu rankte die Freudlosigkeit an einem empor.
Jeanne pfefferte eine Handvoll Kugelschreiber und einen Stapel Post-it-Zettel auf den Tisch. Sie drehte sich um und stiefelte beleidigt ins Haus.
So war sie mit sechs gewesen, mit 16, 26 und 36. Und so würde sie noch mit 86 sein, wenn ich schon seit Jahrzehnten Beute eines mitleidlosen Gewürms war.
Pen kam um den Tisch, auf dem noch Kerzen brannten, und schmiegte sich an mich.
»Ich liebe dich, Papa«, sagte sie leise.
Thierry nahm sich eine Gitane, und André fragte: »Spielst du eigentlich Schach?«
Als sich Robertine Sochu verabschiedet hatte und der Saab davongefahren war, gingen Jeanne und André ins Gästehaus, während ich wartete, bis meine Mutter aus dem Bad kam. Wir tauschten Gutenachtgrüße, dann verschwand Mamie oben auf der Galerie in Véroniques Zimmer.
Im Garten war der Tisch der einzige helle Fleck. Darauf sah ich ein schwarzweißes Muster – Andrés Schachbrett, das er bei mir eingeschleust hatte, um mir Woche für Woche Niederlagen beizubringen. Ich setzte mich, zündete eine Kerze an und besah mir auf dem Brett, wie Thierry sein Königsgambit so rasch hatte entwickeln können, dass Andrés Stellung binnen weniger Züge zusammengebrochen war. »Ach, was soll’s, bin zu blau«, hatte mein Schwiegersohn noch genuschelt und beleidigt, mit mahlenden Kiefermuskeln, den weißen König gekippt. Lauschend in die Geräusche der Nacht, die aus den Büschen kamen, räumte ich die Figuren ab und legte sie in den Kasten. Flieder und Rhododendren waren verblüht. Und auch der Goldregen hatte aufgegeben und seine gelben Trauben auf den Rasen geworfen wie ein Boxtrainer in den Ring das Handtuch seines chancenlosen Schützlings. Es tat gut, die Anspannung des Abends von mir abfallen zu spüren, aber ich war auch wieder müde wie in den Wochen der Angina. Quecksilbrig, hartnäckig und giftig war mir im Krankenhaus meine Deprimiertheit vorgekommen. Etwas gelöst hatte sie sich erst, als der Brief von Maurice kam.
Aber sie war nicht vergangen. Sie saß in mir fest und wartete. Ich hatte es nicht erst an diesem Abend gemerkt. Das Essen nicht zu geben, wäre für alle Beteiligten besser gewesen. Véronique hätte nicht gezögert, einen Abend abzusagen, bevor meine Launen ihn verkorksten.
Im Gästehaus ging das Licht an. Ich sah es Jeanne sofort an, dass sie aufgebracht war. Sie fuchtelte herum und lief auf und ab. Wie nicht anders zu erwarten, stritt sie mit André. Ihn sah ich erst, als er ins Zimmer kam, mit nacktem Oberkörper, ein Handtuch um die Hüften, und sich auf das Sofa fallen ließ. Jeanne redete auf ihn ein, unablässig, beharrlich, der Argumentehagel ihrer Mutter. André schwieg. Er mochte klug sein, aber er war feige. Auch ich hatte nie ein Widerwort gesagt, zwecklos. Ich konnte André nicht leiden, aber ich hatte mich an seine geschmäcklerisch gespitzten Lippen, die Raucherfinger und die Großspurigkeit, mit der er nicht nur beim Schach seine Selbstzweifel kaschierte, gewöhnt. In gewisser Hinsicht waren wir uns ähnlich, und er war gut für Jeanne. Ihre Stimmungsschwankungen, die es für sie gar nicht gab, nahm er hin als naturgegeben, er sah sie bloß an, verstummte und wartete, bis sie sich beruhigte. Im Garten hörte man von ihrem Streit keinen Ton. Es war so still wie im antarktischen Weddellmeer, so still wie in meinem Labor, wenn ich nachts über Daten der letzten Strukturübertragung gesessen und Hunderte fotolithographischer Tabellen ausgewertet hatte.
Nach meiner kleinen Rede hatte ich bei Tisch so gut wie nichts mehr gesagt. Es war mir nie gelungen, dieses Bindeglied zu sein, das Véronique gewesen war. Sie kannte viele, alle, ich nur einen Weg, wie man Streit vermied. Und darum schrieb ich Maurice Ravoux nicht zurück: Man ging Konflikten aus dem Weg, sehr einfach. Es war nie leicht gewesen, Vater, Laborchef und Patriarch zu sein, wenn man Konflikte scheute. Das war der schwerste Konflikt von allen, die größte Herausforderung der reifen Jahre, viel entscheidender als die Lösung des Paradoxons, wie es gelang, die Integrationsdichte eines Planarhalbleiters durch zunehmende Verkleinerung zu steigern.