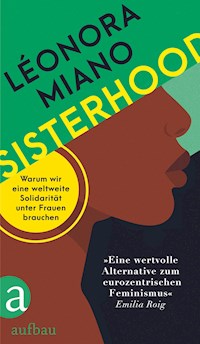Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlagshaus Jacoby & Stuart
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Herrschaft der Länder des Westens über andere Völker hat sich stets auf einen Rassismus gestützt, der die Menschen nach Hautfarben sortiert. Die Bewohner Europas und die aus Europa stammenden Menschen Amerikas haben vor zwei oder drei Jahrhunderten damit begonnen, sich als »weiß« und die Bewohner des südlicheren Afrika oder die von dort stammenden Menschen als »schwarz« zu bezeichnen und die »Weißen« als den »Schwarzen« überlegen zu deklarieren. Die Vorurteile gegen Schwarze Menschen haben Herrschaft ermöglicht und sich durch diese Herrschaft weiter verstärkt. Das Weißsein wurde im Rahmen der Plantagenwirtschaft entwickelt, hat sich dann im kolonialen Raum auf allen Kontinenten ausgebreitet und sich in den multiethnischen Gesellschaften des heutigen Euramerika verfestigt. Wer sich aus reiner Konvention als Weißer bezeichnet, ohne ein Bewusstsein der Geschichte, die die Kategorie geschaffen hat, versteht nicht, dass die damit bezeichnete Beziehung zwischen Menschen auf historischen Verbrechen beruht. Léonora Miano analysiert das »weiße Problem« in den Vereinigten Staaten seit der Zeit der Sklaverei und das der Europäer seit den kolonialen Eroberungen auf eine ebenso feinsinnige wie schonungslose Weise. Ohne ein Bewusstsein dafür, was »weiß« zu sein bedeutet, wird es nicht einfach sein, ein Erbe abzuschütteln, das von Generation zu Generation, vielleicht als Familiengeheimnis, weitergegeben wird, das zwar etwas peinlich ist, aber immer noch für den symbolischen politischen und wirtschaftlichen Status von Menschen von hoher Bedeutung ist. Es wird einige Zeit vergehen, um die Vorstellung von »Rasse« ihrer Bedeutung zu berauben. Das bedeutet nicht, dass man die Hände in den Schoß legen sollte. Wenn man sich der Größe der Aufgabe bewusst ist, kann man sie auch angehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 173
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LÉONORA MIANO
Alles andere als strahlend weiß
Gedanken zum weißen Problem
Ein verlagsneues Buch kostet in ganz Deutschland und Österreich jeweils dasselbe. Das liegt an der gesetzlichen Buchpreisbindung, die dafür sorgt, dass die kulturelle Vielfalt erhalten und für die Leser:innen bezahlbar bleibt. Also: Egal ob im Internet, in der Großbuchhandlung, beim lokalen Buchhandel, im Dorf oder in der Stadt – überall bekommen Sie Ihre verlagsneuen Bücher zum selben Preis.
Das Buch ist zuerst auf Französisch unter dem Titel L’opposé de la blancheur. Réflexions sur le problème blanc erschienen.
© 2023 Éditions du Seuil, Paris
Für die deutsche Ausgabe:
© 2024 Verlagshaus Jacoby & Stuart, Berlin
© für das Foto der Autorin: JF Paga
Aus dem Französischen von Edmund Jacoby
Alle Rechte vorbehalten
Printed in Slovakia
ISBN 978-3-96428-228-6
eISBN 978-3-96428-239-2
www.jacobystuart.de
Dieses Buch ist auf Papier gedruckt, für das nur Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft verwendet wurde.
All unsere mit finanziellem Klimabeitrag gedruckten Novitäten und Nachdrucke finden Sie auf climatepartner.com unter Angabe der ID 13916-1911-1001. Hier erhalten Sie auch Einblick in die Windenergie- und sozialen Projekte, die wir mit Ihrer Hilfe unterstützen.
Der Ausgangspunkt dieses Essays war ein Vortrag mit dem Titel De la blanchité déconstruite (Die Dekonstruktion des Weißseins), den ich am 22. November 2022 im Theater von Lüttich gehalten habe. Ich danke dieser Institution und dem anwesenden Publikum für ihr Interesse an meinen Überlegungen. Wie ich damals angekündigt habe, werden sie auf den folgenden Seiten weiterverfolgt.
Léonora Miano
»Die Überlegenheit der Weißen ist nichts anderes als das politische System, das, ohne jemals als solches benannt zu werden, die moderne Welt, wie sie heute existiert, geschaffen hat.«
CHARLES MILLS
Inhalt
Weiß ist keine strahlend weiße Farbe
Weißsein wäscht weißer
Kürzlich ist in der Debatte über das Verhältnis der Geschlechter zueinander der Begriff des »dekonstruierten Mannes« aufgetaucht und hat unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Was man auch von dem Ausdruck halten mag, er legt jedenfalls nahe, dass es eine Männlichkeit geben könnte, die nicht allein unaggressiv, sondern auch bemüht ist, den Schaden wiedergutzumachen, den die Vorherrschaft der Männer angerichtet hat. Könnte nicht ähnlich auch mit dem Weißsein verfahren werden, also der Selbstdefinition, die die Westeuropäer sich ausgedacht haben, als sie mit vielen anderen Völkerschaften in Kontakt traten? Kann man sich noch einfach aufgrund einer Konvention »weiß« nennen, ohne damit auch auf die Geschichte Bezug zu nehmen, in der diese Kategorie entstanden ist? Kann man trotz dieser Geschichte einfach aufhören, weiß zu sein, und für sich in jeder Lage in Anspruch nehmen, ein einzigartiges Individuum zu sein (was anderen oft verwehrt wird)? Vor allem diese Fragen werde ich zum Abschluss meines Essays beantworten, nachdem ich untersucht habe, was »weiß« zu sein bedeutet und wie und was es bewirkt.
Was ich hier vorbringe, ist keine akademische Arbeit. Studien zum Weißsein, auch als »weiße Identität« bezeichnet, sind zuerst vor einigen Jahrzehnten in der anglophonen westlichen Welt entstanden.
Wenn derartige Untersuchungen in den französischsprachigen westlichen Ländern auch mit einer gewissen Vorsicht betrachtet worden sind, werden sie jedoch auch hier betrieben. Ich werde empirisch vorgehen. Auch wenn der Bezug auf verschiedene Lektüren naheliegt, werde ich lieber amerikanische oder französische Filme anführen, die für das Kino, öfter aber für das Fernsehen entstanden sind. Diese populären Fiktionen sind ohne größere Kosten zugänglich, denn die meisten Haushalte verfügen über einen Fernseher. Die Dinge ändern sich derzeit, doch lange Zeit hatte das Fernsehen großen Einfluss auf die Vorstellungswelt der Menschen. Ich kann mich daran erinnern, in meinen jungen Jahren eine ungewöhnliche Zahl an Fernsehfilmen oder Features gesehen zu haben, die sich mit der Geschichte der Vereinigten Staaten befassten. Ohne dass ich vorher daran gedacht hätte, werden Szenen aus diesen Produktionen meinen Text illustrieren. Aber ich fand es wichtig, auch französische Filme hinzuzuziehen, um meine Argumentation weniger einseitig zu machen. Man muss sie übrigens gar nicht alle gesehen haben; sie steuern nur den ethnographischen Stoff bei. Diese fiktiven Erzählungen erweisen sich als eine reiche Quelle von Informationen, die jemand Einzelnes nicht ohne Weiteres preisgegeben hätte. Im Übrigen zeigen diese Produktionen, die von unterschiedlichen Epochen erzählen, auch – ohne dass dies unbedingt ihr Ziel gewesen wäre –, wie das Konzept des Weißseins funktioniert.
Mein Interesse an dem weißen Problem stammt nicht erst von heute.1 Es ist die Folge dessen, dass mir die politische Dimension des Rassenproblems bewusst geworden ist, aus einer Fragestellung heraus, die unvermeidlich ist, wenn man zu der am meisten durch eine Rassenzuschreibung benachteiligten Menschengruppe gehört. Wenn man schwarz ist, wird, gleich auf welche Weise einem das bewusst gemacht wird, Rasse sehr schnell zum Thema. Nicht so sehr wegen einer Hautfarbe, der man selbst keinerlei Bedeutung zumessen würde, sondern weil man von der Geschichte überwältigt wird. Schon bald drängen sich Begriffe wie »Negersklaven« oder »Sklavenhandel mit Schwarzen« auf, gefolgt von anderen wie dem »Code Noir«, in dem Ludwig XIV. regelte, wie mit schwarzen Sklaven umzugehen war, oder der südafrikanischen Apartheid – alles Vokabeln, die verständlich machen, was es seit dem Anfang der Neuzeit bedeutet, Schwarz zu sein. Bis zu dieser Epoche, als die Europäer in Amerika eindrangen und Subsahara-Bewohner über den Atlantik verfrachteten, kann man die Rede von einer »schwarzen Rasse«, so wie sie heute verstanden wird, zurückverfolgen. In dieser Geschichte dient die Hautfarbe nur als Hilfsmittel. Sie ist bloß der Sockel, auf dem ein kompliziertes Gedankengebäude ruht, das erdacht wurde, um eine ontologische, politische und schließlich soziale Hierarchie zu errichten. Biologie und Kultur wurden dabei gleichermaßen bemüht, um Theorien jeder Art hervorzubringen, die diese Hierarchien rechtfertigten. Im Laufe der Zeit wurde die Farbe derer, die zu Schwarzen gemacht wurden, zum Symbol nicht so sehr einer ethnischen Herkunft als solcher, sondern eines besonderen Status – dessen der Personen, von denen oft in Zweifel gezogen wurde, dass sie überhaupt Menschen seien.
Für diejenigen, denen dieser Status zugeschrieben wurde, die mit ihm leben mussten, weil die Hautfarbe nicht verschwindet, erzählt eben diese Hautfarbe sowohl die Geschichte des Ausgestoßenseins aus der Menschheit als auch die einer dauernden Zurückweisung dieser Entmenschlichung. Auch wenn man Rassismus bekämpft und die rassistische Kategorie »schwarz« als Produkt eines Willens zur Ausgrenzung begreift, kann man sich nicht so leicht aus ihr befreien. »Schwarz« ist ebenso das Wort, dessentwegen man aus dem Licht, dem Hellen, verjagt wurde, als auch das für den Kampf um die eigene Würde, für die Gleichheit der Menschen. In den durch eine starke Präsenz von Menschen afrikanischer Herkunft geprägten Weltgegenden ist »schwarz« zu einem Wort für die Spiritualität, die Lebensart oder die Ästhetik geworden, die von der Gegnerschaft zum rassistischen Unsinn zeugen. Das Problem, das diese Bezeichnung schafft – und das nicht mehr das eines äußeren Aussehens, sondern des aus ihm resultierenden Erlebens ist –, besteht darin, dass sie das Ergebnis eines abschätzigen Blicks von außen ist. Daher ist es nicht leicht, angesichts einer von anderen formulierten abschätzigen Definition seine eigene Identität herauszubilden. Folglich ist, sich als schwarz zu erfahren und als schwarze Person in der Welt zu bestehen, noch nicht in seiner ganzen Tragweite verstanden worden. Der intellektuelle Einfluss der von diesem Erleben geprägten Gruppen ist schwach, fast unmerklich. Und im Übrigen ist es schwierig, wenn nicht unmöglich, den Sinn eines Wortes zu ändern, das für die Kulturen der Welt stets mit etwas gänzlich Negativem verbunden war, überall und seit je. Wir könnten jetzt noch tiefer auf die Bedeutungen dessen eingehen, was keine Farbe ist, doch das, was uns beschäftigen sollte, liegt anderswo.
Die Erfahrung der Subsahara-Bewohner und ihrer Nachkommen anderenorts, als minderwertig angesehen zu werden, seit sie als Schwarze definiert wurden, wird uns zu einer anderen Erfahrung führen, die exakt am anderen Ende der Achse aller Verhältnisse zwischen Menschengruppen angesiedelt ist. Damit – grob gerechnet – mehr als anderthalb Milliarden Menschen sich noch heute in einer symbolpolitischen Lage gefangen sehen, die auf die negative Rassialisierung zurückgeht, die ihre Vorfahren schon vor Jahrhunderten betroffen hat, muss ein ganz besonderes System installiert worden sein.
Menschen müssen mehr oder weniger bewusst darauf achten, dass dieses System aufrechterhalten wird. Die Frage, die sich daher stellt, betrifft nicht die zu ihrem Nachteil einer Rasse zugeordneten Menschen, deren Leid und deren Proteste bekannt sind. Wenn wir das Problem »Rasse« verstehen und nach Möglichkeit lösen möchten, sollten wir uns mit der zu ihrem Vorteil rassialisierten Kategorie befassen.
Doch sobald man die Sache auf diese Weise angeht und auf verständliche Weise die »weiße Frage« formuliert, werden die Visiere heruntergelassen. Diejenigen, die einen jahrhundertealten rassischen Vorteil genießen, versuchen zu verhindern, dass das Thema untersucht wird, und erklären sich zu Opfern eines umgekehrten Rassismus. Auch wenn ihre eigenen Vorfahren es waren, die darauf verfielen, die Menschheit nach »Rasse«-kriterien einzuteilen, wollen die Bürger des Westens, die rein europäischer Herkunft sind, sich nicht länger als Weiße bezeichnen lassen. Während sie es als selbstverständlich erachten, wie ihre Vorfahren die Welt eingeteilt haben – die Länder, die Völker und sogar die Botanik –, ertragen sie es nicht, selbst definiert zu werden und einen präzisen Ort in der Geschichte der zwischenmenschlichen Beziehungen zugewiesen zu bekommen. Diese Zuweisung ist der Ausdruck konkreter Handlungen, deren Folgen den Alltag sehr vieler Menschen überall auf der Welt bestimmen. Sie wissen nämlich, dass definiert zu werden einem die Möglichkeit nimmt, etwas Universelles zu verkörpern beziehungsweise ein einzigartiges Individuum zu sein. Sie wissen, dass sie dadurch Attribute zugewiesen bekommen, die sie nicht selbst gewählt haben und die oft eine bedrückende Bedeutung haben. Was sie ebenfalls wissen – die meisten freilich nur nebelhaft –, ist, dass es eigentlich nicht um die Hautfarbe geht, die dafür instrumentalisiert worden ist, »Rassen« zu erfinden. Sondern um eine symbolpolitische Asymmetrie, die regelmäßig die egalitären Projekte sich als progressiv verstehender Gesellschaften scheitern lässt und ihren Anspruch auf etwas Universelles infrage stellt, dessen beste Vertreter und berufene Garanten sie selbst sein wollen. Und diese Asymmetrie geht auf das Weißsein zurück – auf etwas, das für mich nichts anderes als »Westlichkeit« bedeutet.
1Vgl. insbesondere Léonora Miano, »La question blanche«, in: Ce qu’il faut dire, Éd. L’Arche 2019.
Weiß ist keine strahlend weiße Farbe
Judith Ezekiel, eine Spezialistin für Studien über Geschlecht und Rasse, hat den Begriff »blanchité« (Weißsein) vorgeschlagen, der sich zunehmend verbreitet, ohne dass seine Nutzer seinen Ursprung und die Gründe für seine Formulierung kennen. Es ging darum, das Wort »blanchitude« zu ersetzen, das damals in den Sozialwissenschaften gebräuchlich war. Als Pendant zu »négritude« – der Kultur der Schwarzen – konstruiert, litt der Begriff unter dem Mangel, keine Herrschaftsbeziehung zu bezeichnen. Ich hatte nie die Absicht, auf »blanchitude« zurückzugreifen, sondern habe mich aus guten Gründen für »blanchité« entschieden. Auf Englisch wäre das mit whiteness zu übersetzen – was ärgerlicherweise das Äquivalent zu blackness2 zu sein scheint, also mit demselben Problem wie das Paar blanchitude/négritude behaftet ist, doch auf Französisch hat das Wort den großen Vorteil, dass es sich deutlich von »blancheur« als der strahlend hellen Farbe Weiß unterscheidet, und das war für mich von Interesse. Blanchité – Weißsein – ist nicht mit blancheur – dem strahlenden Weiß – zu verwechseln, einem Wort, dessen Äquivalente in vielen Kulturen voller positiver Bedeutungen sind. Weiß ist, was fleckenlos, was rein ist. Es ist eine der Eigenschaften des Lichts, wenn es am hellsten strahlt. Weiß bezeichnet auch etwas spirituell Erhabenes. Weiß ist die Farbe der Unschuld. Deshalb ist es angemessener, von einem »Weißsein«, von blanchité, zu sprechen, wenn es sich um ein beklagenswertes Projekt handelt, eines, das, wie man zu sagen nicht zögern sollte, von Kriminellen verfolgt worden ist.
In der Tat unterscheidet sich Weißsein (blanchité) grundsätzlich vom strahlenden Weiß. Rassendiskriminierung ist in den amerikanischen Sklavereigesellschaften als Mittel entstanden, den einen wie den anderen ihren Platz in der Gesellschaft zuzuweisen. Ich verweise auf das bedeutende Werk Un monde en nègre et blanc3 der Historikerin Aurélia Michel, das hilft, uns die Etappen der Einführung dieses Systems und seiner Konsolidierung als Reaktion auf die revolutionäre Proklamation demokratischer Gleichheit vor Augen zu führen.4 Für mich besonders interessant ist hier, dass die Rasseneinteilung das klare und gut dokumentierte Ziel hatte, dafür zu sorgen, dass in Gesellschaften, für die die Gleichheit zu einem Wert wurde, diese nur bestimmten Gruppen zugute kam. Anders gesagt ging es darum, die Gleichheit zu kolonisieren, sodass nur eine Kategorie von Menschen, und zwar aufgrund ihrer angeblichen Rasse, in ihren Genuss kamen. Kolonisieren heißt hier nichts anderes als konfiszieren, sich aneignen. Und dazu kam es, um die Hegemonie einer Gruppe auf Dauer zu festigen, und zwar mithilfe eines ganzen Arsenals von Gesetzen, die allein zu diesem Zweck eingeführt wurden. Aurélia Michel erklärt dazu:
Für die Französische wie die Amerikanische Revolution galt, dass alle Menschen Verwandte werden konnten, dass alle Menschen von Natur aus Verwandte waren. An dieser Stelle wird die atlantische Erfahrung wichtig, dass die Eliten, schockiert von der Vorstellung, die Schwarzen könnten ihre Brüder werden, das Weißsein als ein Merkmal hervorhoben, das heißt, ein Attribut, das man nur auf eine Weise erwerben kann, nämlich durch biologische Vererbung, durch »natürliche« Reproduktion. […] Die Fiktion von Weißsein beruht daher auf der Phantasie einer Allmacht, die über jedwede Autorität und jedwedes Recht erhaben ist, außer über das Recht der Natur, das stets dazu tendiert, das des Stärkeren zu sein.5
Die populäre Kultur hat natürlich das Bewusstsein davon weitergetragen, und zwar zuweilen auf recht rohe Art. Ich schlage vor, dies zunächst anhand einiger US-amerikanischer Filme zu betrachten. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist die populäre Kultur überall auch von amerikanischen Musik- oder Filmproduktionen geprägt. Es sind die Vereinigten Staaten, einst das Enfant terrible der europäischen Eroberer, die heute die Codes der Moderne diktieren. Davon abgesehen sind sie der Anführer der westlichen Nationen, in dessen Schatten sich die anderen flüchten. Und hier ist es auch, wo die Europäer und ihre Abkömmlinge sich selbst übertroffen haben beim Schreiben der berühmtesten Seiten der Geschichte des Weißseins. Die Anfänge davon gehen auf die Zeit ihres Eindringens in diese Weltgegend zurück. Aus unterschiedlichen Ländern kommend verständigten sie sich auf das, was sie gegenüber anderen gemein hatten. Sie verstanden es auch immer wieder, eine Einwanderungspolitik zu verfolgen, die ihnen für lange Zeit ihre demographische Überlegenheit garantierte. Dies, neben noch weiteren Dingen, rechtfertigt das Interesse an amerikanischen Erzählungen und dafür, was diese über das Weißsein zu sagen haben, sowohl auf kollektiver als auch auf individueller Ebene. Ich werde dabei oft den Begriff »afrikanischstämmig« verwenden, um die Schwarzen zu bezeichnen, und zwar aus zwei Gründen. Auch wenn das subsaharische Afrika nicht alleine die Heimat der Vorfahren der betreffenden Menschen ist, so hat es doch ihr Erscheinungsbild geprägt, das sie der rassistischen Stigmatisierung aussetzt. Es ist die körperliche Prägung durch ein fern gewordenes und in vielen Fällen unbekanntes subsaharisches Afrika, die diese Menschen in eine ungünstige Situation versetzt. Im Folgenden wird es darum gehen, so weit wie möglich die Rassenkategorisierung auf diejenigen anzuwenden, die diese für die Menschheit zerstörerische Sichtweise etabliert haben und davon bis heute profitieren – auch wenn das nicht meinem Verhalten im Alltag entspricht. Wie sagte doch James Baldwin: »What white people have to do ist to try to find out in their own hearts why it was necessary to have a nigger in the first place. Because I’m not a nigger.«6
Amerikanische Bilder von Weißsein
Nehmen wir zum Beispiel den Film The Long Walk Home von 19907, dessen Handlung während des bus boycott von 1955 in Alabama spielt. Dieser Film lässt die Zuschauer ganz und gar in das Innenleben der weißen Bourgeoisie eintreten, die schwarze Bedienstete beschäftigt, deren Arbeit gelobt wird und denen man für ihre würzige Küche dankt. Nichtsdestoweniger hat sie keine Hemmungen, in ihrer Gegenwart die Gründe festzuhalten, wegen derer es ausgeschlossen ist, ihnen Gleichberechtigung zuzuerkennen. Manches von dem, was vorgebracht wird, macht einen sprachlos, und man fragt sich, wie die Arbeitgeber die Speisen der afrikanischstämmigen Frauen genießen und ihnen ihre Kinder anvertrauen können. Eines sollten wir den Amerikanern lassen: dass sie es schaffen, dem Hässlichen bei ihnen selbst ins Gesicht zu sehen und trotzdem das Selbstbewusstsein haben, es vor der Welt bloßzulegen. Stets kommt die harscheste Kritik an den Schwächen und Verbrechen der Vereinigten Staaten aus der amerikanischen Gesellschaft selbst.
Natürlich begnügt sich The Long Walk Home nicht damit, den Rassismus zu verurteilen, der anscheinend einem Teil des weißen Amerika im Blut liegt. Im Film tritt auch eine privilegierte weiße Frau auf, die sich für die Sache der Afrikanischstämmigen engagiert, obwohl sie damit ihre Ehe aufs Spiel setzt und riskiert, aus der besseren Gesellschaft ausgeschlossen zu werden, aus der sie kommt. Doch der white saviourism8 des Films ist durchaus ambivalent: Die moralische Kraft der Afrikanischstämmigen ist so groß, dass deutlich wird: es ist nicht die weiße Frau, die ihnen zu Hilfe kommt, sondern umgekehrt. Es sind die Afrikanischstämmigen, die die Würde dieser Frau bewahren und sie als Teil der menschlichen Familie akzeptieren, indem sie ihre ausgestreckte Hand annehmen. Sie könnten sie ebenso gut in ihrem Unglück belassen, mit ihren Schuldgefühlen als unfreiwillig Privilegierter. Tatsächlich spielen sie eine wichtige Rolle, denn die Welt, die diese Frau erstickt, ist die, die ihre Vorfahren eingerichtet haben und zu der sie weiter gehören muss, um ihnen helfen zu können. Ihre Geste, nämlich ihren Wagen, den sie selbst steuern will, den Protestmarschierern zur Verfügung zu stellen, ist keine Ablehnung des rassischen und sozialen Privilegs, das sie genießt. Sie kann es nicht loswerden, denn dann hätte sie nichts anzubieten. In einer rassialisierten Gesellschaft kann diese Frau sich nicht mit den Afrikanischstämmigen gleichsetzen und die politische Bedeutung einer Hautfarbe, die sie nicht gewollt hat, zurückweisen. Das steht auch ganz außer Frage.
Dieses Weißsein, aus dem man nicht entkommen kann, auch wenn man es als Schande begreift, erscheint daher als eine unvermeidliche Strafe. Positive Rassialisierung ist stets die Kehrseite einer negativen Rassenzuschreibung und hat den Zweck, eine dauerhafte Überlegenheit schaffen. Die strukturell rassistische Gesellschaft Amerikas gründet auf der Enteignung und beinahe der Ausrottung der autochthonen Bevölkerung sowie auf der Sklavenarbeit von gewaltsam aus Afrika gebrachten Menschen, und eine weiße Person, die in dieser Gesellschaft lediglich sie selbst sein möchte, findet sich bald in einer Sackgasse wieder. Solange es diese Asymmetrie gibt, ist Brüderlichkeit über die Rassengrenzen hinweg, wenn es denn gelingt, solche Verbindungen zu knüpfen, nicht nur stets bedroht, sondern auch wenig befriedigend. Die Ungleichheit macht aus ihr etwas Auswegloses, eine Anomalie. Wenn »Schwarz und Weiß sich gleichen wie zwei Tropfen Wasser«9 dann bedeutet das nicht, dass sie wie das Blut oder die Knochen dieselbe Farbe haben. Denn die Rassialisierung, die beide Farben an die entgegengesetzten Enden der Werteskala platziert, lässt sie in zwei unterschiedliche Zellen desselben Kerkers tropfen. Für einen Menschen, der seine Scheuklappen verloren hat, ist das Weißsein ein vergiftetes Privileg, eine Belastung, obwohl es die ja eigentlich nicht darstellen sollte.
In The Long Walk Home vermag der individuelle Wille einer bürgerlichen Weißen die Gesellschaft nicht zu verändern. Die Geschichte lehrt uns bekanntlich, dass es vielmehr die Beharrlichkeit der Afrikanischstämmigen war, die das erreicht hat: Der Busboykott in Alabama dauerte fast ein Jahr, von Dezember 1955 bis November 1956, und führte zu einem Urteil des Obersten Gerichts, das die Verfassungswidrigkeit der Segregation in den öffentlichen Bussen feststellte. Die höchste Instanz der Rechtsprechung musste urteilen, damit die weiße Gesellschaft von Alabama akzeptierte, dass die Afrikanischstämmigen, die keine Gratistransporte annahmen, wie gewöhnliche Bürger behandelt wurden. Dieser Sieg bezeichnete nicht etwa das Ende, sondern den Beginn der Bürgerrechtsbewegung in den USA. The Long Walk Home gehört zu einer Gruppe von Filmen für ein breites Publikum, die Anfang der 1990er Jahre gedreht wurden und zwei gegensätzliche, aber untrennbare Erfahrungen thematisierten: Afrikanischstämmigkeit und Weißsein. Malcolm X von Spike Lee warb 1992 um die Kinogänger; ein Jahr zuvor war ein Film mit dem Titel She Stood Alone10 erschienen, in dem es um Prudence Crandall (1803–1990) ging, eine weiße Lehrerin, die 1833 in Connecticut eine der ersten Schulen für afroamerikanische Mädchen eröffnet hatte.
She Stood Alone zeigt den Kampf dieser Frau – die auch eine Frauenrechtlerin war – für Gleichheit in einer christlichen Gesellschaft, die diese nicht wollte. Der Film setzt auch eine noch berühmtere Persönlichkeit in Szene, nämlich den abolitionistischen Verleger William Lloyd Garrison, einen Star seiner Zeit. Eine seiner Reden, wie sie für den Film rekonstruiert worden ist, verdient unser besonderes Interesse. Um vor einem zweifarbigen Publikum gegen Sklaverei und Rassismus zu wettern, sagt der William Lloyd Garrison des Films nicht, was geändert werden muss, sondern entschließt sich zu einer Litanei von Fragen, die sämtlich dieselbe Antwort nach sich ziehen:
And why are the slaves not created in the image of God? Because they’re black. Why would the slaves, if emancipated, cut the throat of their masters? Because they’re black. Why are the slaves not fit for freedom? Because they’re black. Why don’t they want to be free? Because they’re black. And why are they not our brethren and our countrymen? Because they’re black.