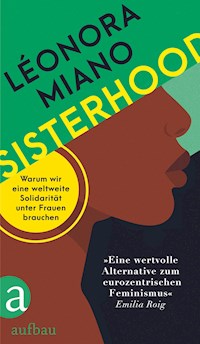
16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie kann eine weltweite Solidarität unter Frauen aussehen? Und was lehrt uns die Geschichte der Frauen aus der Subsahara? Léonora Miano zeigt anhand der Mythen und sozialen Praktiken, wie die Subsahara-Frauen über patriarchalische Gesellschaften herrschten, sexuelle Lust zu einem Recht machten und sich in antikolonialen Kämpfen engagierten. Der reiche, vielfältige Erfahrungsschatz der Afrikanerinnen bleibt in der globalen Feminismus-Geschichte jedoch marginalisiert. Würden sich die Frauen Europas und Afrikas zu einer neuen Solidarität vereinen und voneinander lernen, statt immer nur die männliche Dominanz zu beklagen, wäre der Feminismus einen entscheidenden Schritt weiter. Mianos Buch ist ein leidenschaftliches Plädoyer für eine neue weltweite Schwesternschaft und eine faszinierende Reise zu den Ursprüngen eines anderen Feminismus.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über das Buch
„Für die Frauen der Subsahara, für alle Frauen. ist es wichtig, sich außerhalb des Vergleichs mit den Vertretern des männlichen Geschlechts zu erkennen und zu denken. Das tut der Feminismus, wie wir ihn kennen, aber nicht. Er ist besessen vom Bild des Mannes. Nötig wäre hingegen, dass die Frauen das weibliche Prinzip leben, stärken und lieben, ihm seine Souveränität garantieren. (…) Vor uns liegt also die Aufgabe, uns selbst wiederzuerobern.
Zunächst müssten wir über eine wirkliche zivilisatorische Solidarität nachdenken, die es uns ermöglicht, uns gegenseitig zu inspirieren, über Beziehungen der Frauen der Welt untereinander nachzudenken, ohne zu behaupten, es reiche aus, mit weiblichem Geschlecht geboren zu sein, um einander näherzukommen.“ Léonora Miano
Über Léonora Miano
Geboren in Kamerun, lebt und schreibt Léonora Miano zwischen den Kontinenten: in ihrem Herkunftsland Frankreich und in Togo. Ihre Romane, Theaterstücke und Essays wurden weltweit mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Léonora Miano gehört neben Bernardine Evaristo, Chimamanda Ngozi Adichie u. a. zu den wichtigsten feministischen Denkerinnen unserer Zeit.
Claudia Steinitz studierte Romanistik und übersetzt seit 30 Jahren französischsprachige Literatur u. a. von Virginie Despentes und Véronique Olmi.
Uta Rüenauver hat Germanistik, Romanistik und Philosophie in Berlin und Dijon studiert. Sie arbeitet als Lektorin, als Feature- und Essay-Autorin.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Léonora Miano
Sisterhood
Für einen anderen Dialog zwischen den Frauen der Welt
Aus dem Französischen von Claudia Steinitz und Uta Rüenauver
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Motto
Einleitung — Zwischen den Frauen der Welt
Machthaberinnen
Schöpferische Lust
Verstoßene Rebellin
Ruhmreiche Kindsmorde
Der Sitzplatz der Königin
Abgeschlagene Köpfe
Kastrierende Furie
Prinzessinnenromanze
Schwarze Pantherin
Pax africana
Weibliche Kollektive
Sitting on a man
Die berüchtigten Nana Benz
Klitoriskult
Schlussbemerkung — In Afrika und jenseits der Meere
Literatur
Erläuterungen
Impressum
»Die Frau ist das starke Geschlecht. Die Frau ist die Krone der Schöpfung.«
Chantal Kingué Tanga (meine Mutter)
»I found god in myself, and I loved her. I loved her fiercely.«
Ntozake Shange
Einleitung
Zwischen den Frauen der Welt
Die Frauen des afrikanischen Kontinents haben eine lange Geschichte. Sie sind die Urahninnen, der Ursprung der Menschheit. Sind sie dafür auch in die Geschichte eingegangen, haben sie einen Ehrenplatz im menschlichen Bewusstsein, in der Vorstellungswelt der Völker erhalten? Zweifel daran sind erlaubt, denn die Identifikation mit den Frauen der Subsahara, die uns hier interessieren werden, liegt bei null. Wir sprechen nicht von Frisuren oder Gewändern, die man ihnen abschaut, von punktueller und geringfügiger Aufmerksamkeit. Es geht auch nicht um das Interesse, das man an ihrer Musik finden kann, oder um das Vergnügen, die als exotisch wahrgenommenen literarischen Welten zu durchschreiten. Identifikation ist keine flüchtige, oberflächliche Angelegenheit. Sie ist vielmehr die Anerkennung eines Teils von sich selbst im Anderen, die Legitimation seiner Erfahrung als Quelle von Lehren, eine zumindest partielle Aneignung seiner Geschichte, weil ihr das Heimatrecht in einer universellen Erzählung zusteht. Und natürlich geht es um echte Empathie, nicht um jene Herablassung, mit der man die Frauen der Subsahara als gefährdete Menschen betrachtet, die zu retten man sich zur Pflicht macht, noch bevor sie um Hilfe gerufen haben. Natürlich rettet man sie vor nichts, das ist nicht das Ziel. Wie könnte man auch, da man in ihnen nicht das eigene Abbild sieht? Da die verschiedenen Rettungsunternehmungen – und die von Männern entschieden schlimmer als die anderen – meist darauf abzielen, sie von rückständigen Kulturen zu befreien, stutzt man ihnen nur die Flügel. Diese Frauen, denen ein wenig beneidenswerter Platz zugewiesen wird, die von drängenden Anweisungen bestürmt, von entwertenden Repräsentationen niedergedrückt werden, müssen sich fest in dem verankern, was sie ausmacht, um sich zu erheben und zu leuchten. Das ist nicht einfach, weil das Geschrei von außen die inneren Stimmen übertönt, weil die Bilder von außen den Blick auf sich selbst verstellen.
Der symbolische und epistemische Einfluss des Westens bleibt derart prägend, dass wir uns anscheinend nur durch Mimikry angemessen in unsere und mehr noch in die kommenden Zeiten einschreiben können. Oft erhalten wir jedoch nur der Form nach Zugang, das macht die Nachahmung unvollständig und ungeeignet, um die Vorbilder zu reproduzieren, denen wir entsprechen sollen. Das Entscheidende entgeht uns, aber nicht wegen einer absoluten Unmöglichkeit, es zu erfassen. Um es wirklich zu verstehen, müssten wir andere sein als wir sind. Es ist denkbar, dass wir diese Wahl bewusst treffen und beschließen, es sei die beste Lösung, eine andere zu werden. Darauf kommt es an, man muss sich ohne jede Art von Zwang dazu entschließen, muss das Für und Wider abwägen und dann vielleicht zu dem Schluss kommen, dass für sich zu sterben eine der radikalsten Arten des Überlebens sein könnte, wenn das das einzige Ziel wäre. Das Anderssein würde bleiben, die Verbreiter des hegemonialen Denkens wären nicht zufrieden mit ihrem Sieg und würden versuchen, ihn zu vervollkommnen.
Vorerst haben die Frauen der Subsahara, wie auch ihre männlichen Artgenossen, noch nicht die Werkzeuge geschmiedet, die diese willentliche, weil selbstbestimmte Metamorphose erlauben. Die neokolonialen Gesellschaften, hervorgegangen aus der bekannten Parade von Tragödien und Gleichgültigkeit, haben nicht den Versuch unternommen, neue Kulturen zu erfinden. Sie haben keine Systeme geschaffen, die die Konfrontation zwischen europäischen Einflüssen und altem Vermächtnis befrieden könnten. Der Begriff Hybridisierung bezeichnet nur ungenau das ungedachte, schlecht verkörperte Nebeneinander der einen und der anderen. Es gibt nur Wenige, die beide Kulturen, die europäische und die subsaharische, perfekt beherrschen. Grundsätzlich bestehen sie nicht gleichberechtigt nebeneinander und können sich deshalb nur schwer gegenseitig befruchten. Die vertrautere Kultur, die man am meisten bewohnt, vereinnahmt die andere, die ursprüngliche, die dann nur als Zierrat existiert. Diese andere kann die Erscheinung schmücken, die man sich gibt, den Gerichten, die man isst, Würze verleihen, aber es entsteht nichts aus ihr. Sie kann nichts begreifen, entwerfen, festschreiben. In den neokolonialen Gesellschaften besitzt der Erwerb von europäischen Techniken und europäischem Wissen den höchsten Wert, weil er gesellschaftliche Integration und Aufstieg erlaubt. Deshalb genießen diejenigen, die erfolgreich ein Studium absolviert haben, einen höheren Status. Weil ihre subsaharische Kultur im Beruf, der einen großen Teil ihrer Zeit einnimmt, keinen Platz findet, wird sie als überholt wahrgenommen. Sie formt nicht die Welt, bestimmt nicht mal die kleinsten Dinge des Alltags, am wenigsten in den städtischen Ballungsgebieten.
Das Problem liegt darin, dass das herrschende Gesellschaftsmodell woanders herkommt und fremd ist. Die Mehrheit der Bevölkerung kann es nur in der Weise begreifen, wie es den Raum strukturiert und den Menschen Verpflichtungen auferlegt, denen sie sich unterwerfen, um Sanktionen zu vermeiden. Das bedeutet nicht, dass die Menschen dieses Modell verstehen würden, es also bewusst annehmen oder ablehnen. Das bedeutet erst recht nicht, dass sie imstande wären, ihm ihren Stempel aufzudrücken, es zu verändern, daraus ein anderes entstehen zu lassen, weil sie es von Grund auf begriffen haben. So gibt es, um ein Beispiel zu nennen, in der aktuellen Verwaltung der meisten subsaharischen Städte nichts, was von der Organisation vorkolonialer Gesellschaften zeugt. Alles, was diese Metropolen sagen, ist, dass eines Tages andere gekommen sind und beschlossen haben, zu bleiben. Es gibt zwar nicht unbedingt einen inneren Konflikt, weil man sich an eine verderbliche Ordnung der Dinge gewöhnt hat, aber die Möglichkeit, eine neue Welt Wirklichkeit werden zu lassen, deren Schlüssel man selbst in der Hand hielte, wird dadurch sehr behindert. Da sich die Menschen der Subsahara auf das Überleben beschränkt haben, haben sie sich mit der Niederlage abgefunden, ohne sie hinreichend zu verarbeiten. Das importierte Modell wird identisch reproduziert. Alles, was ihm vorausging und was dem Verschwinden geweiht ist, wird auf seine folkloristische Dimension reduziert.
Die gegenwärtige Afrikanität erscheint so als endloser Epistemizid, als Auslöschung von Wissen, was gewiss eine Folge des kolonialen Einflusses ist, aber auch im Fehlen von Visionen und politischem Willen der subsaharischen Länder begründet liegt. Da sich die aus der Kolonialität1 hervorgegangene Afrikanität an der Spitze der Staaten, an den Orten der Macht festgesetzt hat, ist es nicht erstaunlich, dass sie den Horizont verstellt. Wer sich etwas anderes vorstellen will als eine unter den Ruinen des Selbst verbrachte Existenz, muss trainiert und angeleitet werden. Beides geschieht nicht, und das ist nicht einzig und allein den transozeanischen Deportationen oder den zahlreichen Morden an subsaharischen Freiheitskämpfern zuzuschreiben, so traumatisierend diese auch gewesen sein mögen. Subsahara-Afrika besitzt einzigartige Vorkommen an Rohstoffen – mindestens zwei Drittel der für das Überleben der Industriestaaten notwendigen Ressourcen befinden sich allein auf diesem Kontinent – und stellt einen bedeutenden Markt dar. Deshalb kam es nie infrage, den Ländern freie Hand zu lassen, um ihre Wunden zu verarzten und sich in aller Souveränität neu zu definieren. Sie konnten sich dieses Recht auch nicht erkämpfen, und das hält sie in dem Zustand, in dem sie seit einem halben Jahrtausend verharren.
Abgesehen von den eben genannten Rohstoffen bietet Subsahara-Afrika den Mächtigen auch die wunderbare Illusion ihrer Überlegenheit. Das wird nicht hinreichend wahrgenommen. In einer sich wandelnden Welt mildert es den Schmerz der Deklassierung, sich zu sagen, dass es immer irgendwo jemanden gibt, der kleiner ist als man selbst. Die Frauen der Subsahara verkörpern die Erde, die sie bewohnen. Ihr Status verschmilzt mit dem dieser Erde. Sie werden als Elende wahrgenommen, als die Unterdrückten schlechthin, die Opfer einer Geschichte, die ohne sie stattgefunden hat. Dabei ist es nicht ihr Land, das den Frauen gerade erst erlaubt hat, selbst Auto zu fahren, wurden nicht bei ihnen bis vor kurzem Mädchen systematisch getötet. Ironischerweise werden diese Frauen, mit denen sich niemand identifiziert, oft als Zukunft ihres Kontinents präsentiert. Natürlich nur dann, wenn sie sich so verhalten, wie es sich gehört, und die Vorschriften respektieren. Diese sind an ihre Repräsentationen gekoppelt, die außerhalb des Kontinents geschaffen werden, sich auf die gewünschte Nutzung dieses Kontinents und seiner Bewohner beziehen und sich je nach den Bedürfnissen derer ändern, die diese Vorschriften erlassen. In der allochthonen [gebietsfremden] Vorstellungswelt wandelten sich die Frauen der Subsahara von Wilden, die als solche unfähig waren, gute Mütter zu sein, in unvergleichliche, fast von Natur aus mütterliche Ammen.1 Zwischen alternativer Geschichte und Utopie haben die Bilder, die man sich von den Frauen der Subsahara macht, immer das Ziel, die Ordnung der Gesellschaft, die solche Vorurteile hervorbringt, zu stabilisieren oder anzufechten. In jedem Fall können sich mit diesen Konstruktionen andere Frauen auf die Schultern derjenigen stellen, die sie herabwürdigen, und sich so erhöhen. Dies sei, so wird uns gesagt, die Zeit der Schwesternschaft. Kaum vorstellbar, was – vor allem auf politischer Ebene – die Fundamente dieser Schwesternschaft sein sollten, wenn die einen sich weiterhin selbst verstümmeln, um den anderen zu gleichen, die das keineswegs stört. Bleichen der Haut, Glätten der Haare, Straffen der Augenlider oder Verlängern der Beine: Das alles hat durchaus eine Geschichte. Es erzählt sie unablässig und erinnert daran, dass der Kolonialismus hier geherrscht hat und dass Frauen davon profitierten, dass sie zu seiner Umsetzung beitrugen, dass sie die Menschenzoos besuchten, in denen andere Frauen ausgestellt waren, dass es ihnen nie in den Sinn gekommen wäre, diese Frauen zu umarmen, deren Behandlung als Tiere nicht nur ihre eigene Weiblichkeit, sondern vor allem ihre Menschlichkeit stärkte.
Seit Jahrzehnten versuchen die Frauen der Subsahara nach Kräften, die Bestimmungen aus dem Ausland zurückzuweisen und sich von den Programmen zu befreien, die andere für sie entwickelt haben. Sie rebellierten schon einige Jahre vor der Ersten Weltfrauenkonferenz, die 1975 in Mexiko stattfand, und der von 1976 im Wellesley College in Boston2, zwei wichtigen Ereignissen, bei denen die Frauen der Subsahara auf ihre Differenz hinwiesen. Diese ist in den Protokollen eines Kolloquiums festgehalten, das 1972 die Société Africaine de Culture (Afrikanische Gesellschaft für Kultur) organisierte: »Die Zivilisation der Frau in der afrikanischen Tradition«. Man muss nur die Einleitung lesen, um zu erkennen, dass die aktuellen Diskussionen schon vor fünfzig Jahren geführt wurden:
Die feministischen Bewegungen wollen der Frau dieselben Rechte gewähren wie dem Mann. Das ist in Europa tatsächlich die beste Formel, die man gefunden hat, um die Frau von einer Reihe von Knechtschaften zu befreien, die aus dem Egoismus des Mannes und der kontinuierlichen Entwicklung seiner Zivilisation herrühren. An dem Tag, da die Frau die gleichen Freiheiten und die Vorteile genießt, die diese Freiheiten gewähren, wird es wohl in Europa keine gravierenden Probleme für die Frau mehr geben.
Aber ist es in Schwarzafrika ebenso?
(…) Man kann den Automatismus bedauern, mit dem die aus der Geschichte des Westens geborenen Probleme, Lösungen und Institutionen schlicht und einfach nach Afrika übertragen werden.2
Auf diesem Kolloquium, bei dem sich vor allem frankophone und anglophone Frauen der Subsahara trafen, wollte niemand die Probleme leugnen. Die Teilnehmerinnen bemühten sich vielmehr um eine eigene Lesart, wollten den Beitrag der Frauen bei der Errichtung der Gesellschaft hervorheben, daran erinnern, dass sie nicht darauf gewartet hatten, bis ihnen der Feminismus verpasst wurde, um in vielen Bereichen ihre Talente zu entfalten und auf diese Weise zu Wohlstand und Macht, auch politischer Macht, zu gelangen. Die Frauen der Subsahara, die in der Wahrnehmung der Welt immer noch nicht vorkommen, hatten seit der Antike alle denkbaren Funktionen ausgeübt. Und im Gegensatz zu anderen gingen sie nicht nur in die Geschichte ein, weil sie Stimmen hörten oder die Favoritin eines Königs waren. Bei der Wanderung durch ihre Geschichte begegnen wir den außergewöhnlichen Persönlichkeiten, zu denen sie wurden, den Initiationsgesellschaften oder den Frauenbewegungen, die sie gründeten. Dabei lässt sich mühelos ein weibliches Erbe [matrimoine] erkennen, das genug Selbstvertrauen schenkt, um sich der Welt zu stellen. Zu diesem Spaziergang laden die folgenden Seiten ein. Sie wollen durch die Analyse ganz unterschiedlicher Lebenswege eine andere Sprache der Frauen offenbaren. Aus den Worten dieser Sprache spricht eine aktive Stimme, die Stimme von Frauen, die sich nicht durch negatives Einwirken anderer auf sie definieren und nicht auf Vorbilder warten, um ihr Leben zu erfinden.
Diese andere Sprache der Frauen entspringt einem Selbstbewusstsein, das sich durchsetzen kann, ohne dass die Männer erst mal die Güte besitzen müssen, sich zu reformieren. Viele Frauen der Subsahara haben über Jahrhunderte hinweg diese Sprache gesprochen. Nicht alle können in diesem Buch genannt werden, das nicht die Arbeit einer Historikerin präsentiert. Es wurde auf der Grundlage eines zwar dokumentierten, aber unvollständigen Wissens geschrieben, denn die mündliche Überlieferung bewahrt die Erinnerung an einige der vorgestellten Persönlichkeiten nur in Legenden. Diese Ahninnen, die ein Geschenk Afrikas an alle Frauen sind, ignorierten keineswegs die kulturellen Zwänge, behaupteten aber dennoch ihre Einzigartigkeit und bestanden Prüfungen, ohne deshalb gleich Theorien zu entwickeln. Sie verpassten der Geschichte ihren Stempel, indem sie sich erlaubten zu sein, indem sie ihr Schicksal in ihre Hände nahmen, aber auch, indem sie den Preis für die individuelle Freiheit zahlten, die oft durch die Gruppe und ihre Bräuche bedroht war. Von allen werden wir etwas lernen, auch wenn wir uns ihre Schwächen ansehen oder zwischen den Zeilen der Legenden lesen, in denen der Glanz zuweilen die eigentliche Botschaft überstrahlt. Dieser Essay untersucht nicht den Diskurs der Frauen der Vergangenheit, der nicht immer hinreichend bekannt ist. Ausgehend von Persönlichkeiten, die der Welt noch vorzustellen sind, wollen wir über das Leben der Frauen der Subsahara nachdenken.
Bevor wir in das Universum und die Erinnerung dieser Frauen eintauchen, sei klargestellt, dass die Kritik an der Kennzeichnung einiger Frauen als Feministinnen nicht darauf abzielt, diese abzuwerten. Wir wollen ihnen vielmehr ihre Wahrheit zurückgeben, indem wir sowohl den Anachronismus als auch die intellektuelle Unterwerfung zurückweisen. Warum sollten weibliche Erfahrungen nur dann wichtig werden, wenn sie in einem Haus, das von den Frauen einer Weltregion nach ihren Bedürfnissen errichtet wurde, das Dienstmädchenzimmer bewohnen. Nur wenn man ihre besonderen Lebenswege anerkennt und respektiert, können die Frauen der ganzen Welt in einen fruchtbaren Austausch treten. Nach fünfzig Jahren Streit muss es möglich sein, das zu verstehen. Für die Hoffnung, dass eine Art Fraueninternationale entsteht, wäre es nur angemessen, wenn Schwesternschaft nicht nur auf den Stigmata der Unterdrückung – eheliche Gewalt, sexuelle Aggression, Diskriminierung usw. – beruhen, sondern die Beteiligung der einen und der anderen an der Weltgeschichte der Frauen hervorheben würde. Es bleibt noch viel zu tun, um Gleichheit auf diesem Gebiet zu erreichen.
Viele Frauen beklagen sich über die Hegemonie der Männer, aber die Kritik sollte sich auch gegen die Asymmetrie in den Beziehungen zwischen menschlichen Räumen richten, die manchen Frauen eine Macht verleiht, mit der sie skrupellos den anderen ihr Modell aufzwingen. Natürlich ist das in der Beziehung der Frauen der Subsahara mit den Frauen aus dem Westen der Fall, aber auch mit denen, die islamischen Gesellschaften angehören. Frauen aus dem Westen und dem Osten erfreuen sich eines kolonialen Vorteils, den sie nicht infrage stellen. Sie sind nicht nur die Hehlerinnen der Früchte kolonialer Plünderung, ob materiell oder symbolisch, sondern verlangen, dass sich alle an ihnen orientieren, niemals andersherum. Die Kabelfernsehsender überfluten die Subsahara aus der Ferne mit den Bildern dieser Frauen, verbreiten ihre Ästhetik, ihre Weltsicht. In diesen ungleichen Beziehungen zwischen Frauen haben die aus dem Westen die Macht der Kolonialität, während die aus den islamischen Ländern den auch politischen Vorteil genießen, den die göttliche Offenbarung verschafft. Gott offenbarte sich den Menschen in ihrer Sprache, und er hat inzwischen keine andere gelernt.
Die Sprache Gottes zu sprechen ist kein schlechter Trumpf, da sind wir uns einig, vor allem in einem Rahmen, der den Glauben nicht zu einem, sondern zu dem Gesetz erhebt. Hinzu kommen seitens Marokkos oder der Monarchien am Persischen Golf, um nur diese zu nennen, finanzielle Macht, skandalöser Reichtum und ihre Ambitionen in Subsahara-Afrika. In der kolonialistischen Vorstellungswelt der Orientalen bleibt die Subsahara von der Sklaverei geprägt, und die systematische Afrophobie, die in diesen Staaten grassiert, wird bisher kaum bekämpft. In Europa engagieren sich Künstler wie der Afro-Iraner Saeid Shanbehzadeh für eine missachtete Kultur, die in ihren Heimatländern vom Verschwinden bedroht ist. Die Palästinenser subsaharischer Herkunft, weniger bekannt als ihre israelischen Nachbarn, werden trotz ihrer vollkommenen Identifikation mit Palästina diskriminiert. Das sind nur Beispiele, denn die orientalischen Gesellschaften sind alle von diesem Rassismus betroffen.
Die Frauen der Subsahara werden also genötigt, sich zwischen Okzident und Orient3 zu entscheiden, da ihr eigenes Erbe von den ausländischen Eroberungen entwertet wurde. Angesichts dieser Situation muss man sich die Worte von Kwame Nkrumah, dem ersten Präsidenten Ghanas, ins Gedächtnis rufen: »We face neither East nor West, we face forward.« Dieser zu Zeiten des Kalten Kriegs ausgesprochene Satz verwies auf die beiden Blöcke, die sich damals gegenüberstanden und die ganze Erde zum Schauplatz ihres Konflikts machten. Die Afrikaner sollten sich auf die eigene Zukunft konzentrieren, auf das, was vor ihnen [forward] lag, anstatt ein Lager zu wählen. Heute besitzt der Satz in seiner Aussage, dass das Vorbild weder im Osten [East] noch im Westen [West] zu suchen ist, nach wie vor Gültigkeit. Das wäre nur vernünftig. Es ist kaum vorstellbar, Systeme zu übernehmen, die sich so sehr mit Zerstörung hervorgetan und sich Mühe gegeben haben, die subsaharischen Kulturen zu verachten. Das Eindringen des Orients in Subsahara-Afrika, in Gestalt von Anhängern der Sklaverei und Eroberern auf dem Gebiet der Religion, dauerte viele Jahrhunderte und schwächte die subsaharischen Gesellschaften, denen die westlichen Invasoren nur noch den Rest geben mussten.
Während die orientalische Vorherrschaft vor allem von religiösem Fanatismus angetrieben wurde – es ging mehr um die Besetzung der Köpfe als des Bodens –, wurde Europa, das seinen Glauben für imperialistische Zwecke instrumentalisierte, von Käuflichkeit gelenkt. Diese verhängnisvollen Mächte folgten aufeinander und zerstörten die Strukturen der subsaharischen Welt. Natürlich sind die Beziehungen dieser beiden Räume zum Afrika südlich der Sahara nach wie vor durch die Geschichte beeinflusst, aber auch dadurch, ob und wie sich jene zu dieser Geschichte bekennen. Dabei ist die westliche Ambivalenz hervorzuheben, das ständige Hand‑in-Hand von Verachtung und Begehren, ja sogar eine – allerdings vergiftete – Form von Zuneigung. Diese unangenehme Umgebung hat immerhin eine Stimme hörbar gemacht, die im Orient unterdrückt wird. Davon zeugen zwei 2019 und 2020 verabschiedete Resolutionen des Europaparlaments.3 Die Okzidentalität, das dunkle Gesicht von Euroamerika, wird von Anbeginn durch Kräfte in den Ländern bekämpft, denen sie entstammt. Obwohl diese Kräfte in der Minderheit sind und im Lauf der Geschichte oft besiegt wurden, unterscheiden sie den Okzident vom Orient, wo bis heute nichts dergleichen zu bemerken ist. Die schon lange währenden Beziehungen zwischen den Weltregionen wie auch die Identitätsveränderungen verbieten den Gedanken an eine Rückkehr zu unbekannten Zeitaltern und Lebensweisen. Die Aufgabe für Subsahara-Afrika besteht darin, ein gesellschaftliches, politisches und spirituelles Modell zu erarbeiten, das seine Bestrebungen, seine besondere Sprache zu transportieren vermag. Nur so wird es mit den anderen menschlichen Räumen in einen angemessenen Dialog treten und dem Gesicht der Welt auch seine kulturellen Züge verleihen können. Wir sprechen hier von Denkweisen, sozialen Praktiken, historischen Persönlichkeiten und Spiritualität, von Elementen, mit denen Subsahara-Afrika nicht nur in den Körper der Völker eindringen würde, unter denen es in Jahrhunderten gewaltsamer Unterwerfung lebte, sondern auch in ihren Geist. Elementen, die wir oftmals in den individuellen oder kollektiven Lebensgeschichten der Frauen wiederfinden werden, die wir hier untersuchen wollen.
Der Westen, Herr aller Dinge, hat in der ganzen Welt die Vorherrschaft des Habens über das Sein verbreitet. Was jedoch die Völker, welche auch immer, an Wesentlichem zu bieten haben, passt nicht in dieses Schema. Es gibt also keinen Grund, sich beeindrucken zu lassen. Unser Spaziergang in die Geschichte und die Erinnerung an Frauen der Subsahara will nicht die Vorstellung bestärken, die Zukunft des Kontinents liege einzig in seiner Vergangenheit. Was hier gezeigt werden soll, sind weibliche Lebenswege, die ihren Platz im Bewusstsein der Welt finden müssen, Mythen, die das universelle Denken befruchten und das künstlerische Schaffen bereichern, sowie natürlich die Gründe, warum sich die Frauen der Subsahara nicht dem Befehl zum Feminismus4 unterwerfen müssen. Es geht nicht darum, den Wert dieser Position zurückzuweisen, sondern darum, sie einzuordnen und daran zu erinnern, dass das Universelle nicht jenes Besondere ist, das sich durch die koloniale Brutalität verbreitet hat. Das Universelle ist das, was die Menschen durch ihr Menschsein in sich tragen. Alles andere ist das Besondere.
Der Feminismus als Forderung nach Gleichheit mit den Männern in einer bestimmten Gesellschaft ist nicht universell und soll es nicht sein. Er ist die Antwort der Frauen eines bestimmten Ortes auf die Fragen, die sich ihnen stellten. Der Frauen, die sich vor allem als Opfer männlicher Dominanz wahrnahmen und eine weibliche Opferontologie schufen. Das war ihre Entscheidung, und es gibt keinen guten Grund, weshalb jede mutige oder ehrgeizige Frau mit dem feministischen Etikett ausstaffiert werden muss. Es kommt durchaus vor, dass eine solche Frau kein Interesse am Schicksal ihrer Geschlechtsgenossinnen zeigt. Schlimmer noch, dass sie frauenfeindlich ist. Das wird aber selten erwähnt. In ihrem Kampf für die Emanzipation vom Patriarchat fordern die Frauen der Subsahara keineswegs das Recht, zum Beispiel mehrere Männer zu heiraten. Einige Frauen genossen früher dieses Privileg. In Gesellschaften, die noch die Polygynie kennen, gehört diese Art von Gleichheit mit den Männern jedoch nicht zu ihren Erwartungen. Dabei ist es ein Recht, das den Männern per Gesetz zuerkannt wird, jenseits jedes religiösen Rahmens, auch wenn es manchmal möglich ist, sich für ein monogames matriarchalisches System zu entscheiden.5 Die Frauen der Subsahara, die in Ländern leben, deren Gesetzgebung dem Mann das Recht auf Züchtigung von Frau und Kindern gibt, würden dieses Recht lieber abschaffen, als selbst in seinen Genuss zu kommen. Gleichheit im engen Sinne ist also nicht emanzipatorisch.
Wenn man sich für die Entfaltung der Frauen ausspricht, muss man es sich selbstverständlich zur Pflicht machen, ihre Stimmen zu hören und dafür zu sorgen, dass sie wahrgenommen werden. Ebenso selbstverständlich muss man ihre individuellen Entscheidungen respektieren. Zum Beispiel die, sich nicht mit anderen als Opfer zu identifizieren und ständig gegen diese Rolle anzukämpfen. Die Forderung nach Autonomie und Perspektiven zur Selbstverwirklichung schließt auch nicht ein, absolut alles zu tun, was die Männer tun. Sie sind kein anzustrebendes Ideal, und die Frauen einer bestimmten Gesellschaft könnten nach ihren Vorstellungen auch Rechte fordern, die sich von denen der Männer unterscheiden. Die Macht der Frauen in früheren subsaharischen Gesellschaften beruhte oft darauf, dass ihnen besondere Vorrechte gewährt wurden. Der unverletzliche weibliche Raum bildete ein wesentliches Fundament der Gemeinschaft. Der Feminismus definiert sich sehr klar. Will man ihm jede weibliche Forderung aufladen, wird er seines Sinns beraubt, verliert er seine Schlagkraft und werden einzigartige Stimmen zum Schweigen gebracht.
Für die Frauen der Subsahara, für alle Frauen ist es wichtig, sich außerhalb des Vergleichs mit den Vertretern des männlichen Geschlechts zu erkennen und zu denken. Das tut der Feminismus, wie wir ihn kennen, aber nicht. Er ist besessen vom Bild des Mannes. Nötig wäre hingegen, dass die Frauen das weibliche Prinzip, das sie verkörpern, leben, stärken und lieben, ihm seine Souveränität garantieren, bevor sie sich für ihre möglichen Beziehungen zu der anderen Polarität interessieren, die sich außerhalb von ihnen manifestiert.6 Abgesehen von der Frage der Rechte, die jedem Menschen zustehen, sollte Gleichheit mit den Männern kein Thema für die Frauen sein. Oft sind sie ihnen überlegen, auf allen denkbaren Gebieten, was jedes Mal anzuerkennen ist, wenn es vorkommt. Subsahara-Afrika hat dies getan. Wenn die Menschheit seit Jahrhunderten die Verheerungen einer schlecht kontrollierten männlichen Macht beklagt, werden wir das Problem nicht lösen, indem wir eine Gleichheit der Prinzipien postulieren. Wir müssen nicht nur die Notwendigkeit anerkennen, die als weiblich wahrgenommenen Werte zu rehabilitieren, sondern auch, so lange es nötig ist, ihre Vorherrschaft. Das ist etwas anderes, als das, was die Feministinnen sagen, aber da sie die Gunst der heutigen Zeit genießen, täten sie gut daran, andere Diskurse zu unterstützen und zu erhalten, wenn diese den Willen von Frauen manifestieren und ihrer Erhebung, wie sie sie verstehen, dienen.
Wir werden alle in eine Welt hineingeboren, die durch die Kolonialgeschichte, durch die Unterwerfung der einen durch die anderen geformt ist. Nichts zwingt uns, sie als solche hinzunehmen, an Positionen festzuhalten, die uns durch die Abwege des Männlichen auferlegt wurden. Doch genau das tun wir, wenn wir die Notwendigkeit verkennen, dass jede Frau die Welt ausgehend von ihrem Ort und in ihren eigenen Begriffen ausdrückt. Diese Feststellung gilt für die Frauen, deren Stimme sich durchsetzt, ebenso wie für diejenigen, die es akzeptieren, nicht so deutlich gehört zu werden. Wir würden gern glauben, dass alle sofort dieselbe Sprache sprechen müssen, um sich zu verstehen. So ist es nicht. Es kommt darauf an, die Sprache der anderen zu hören und zu erlernen. Sie zu kennen, um die Ähnlichkeiten und die Unterschiede herauszuhören. Ebenso kommt es darauf an, dass wir uns die Akzente der eigenen Sprache vergegenwärtigen, um zu vermeiden, dass wir sie verlernen und uns nur noch erbärmlich in der der anderen ausdrücken können. Seit mehreren Jahrzehnten ist den Frauen der Subsahara ihre Einzigartigkeit bewusst. Manchmal hat ihnen der Mut gefehlt, ihren eigenen Diskurs zu aktualisieren, haben sie sich darauf beschränkt, den der anderen grenzüberschreitend zu übernehmen oder ihm zu widersprechen. Die Gedanken, die sich als Alternative zum Feminismus präsentierten7, haben sich in dieser Selbstbehauptung gegen eine sich für universell haltende Rhetorik selbst entwertet.
Ohne diese ganz und gar westliche Anmaßung an den Tag zu legen, hätte es ausgereicht, wenn die Frauen ihre eigene Wahrheit ausgesprochen und sie in ihrer Heimatregion verbreitet hätten, dort, wo die andere Sprache der Frauen leiser geworden war. Das ist nicht geschehen. Ihre Theorien – vor allem aus der Feder von Anglophonen – wurden den Universitätskreisen überlassen, wo sie mehr in US‑amerikanischen Seminaren für African oder Gender Studies gelesen wurden als im frankophonen Teil der Subsahara. Vor uns liegt die Aufgabe, uns selbst wiederzuerobern. Diese Rückeroberung hat bereits begonnen. Davon zeugen zahlreiche Publikationen über die Frauen in der Geschichte des afrikanischen Kontinents. Meistens handelt es sich um eine notwendige Selbstfeier, aber auch um eine Instrumentalisierung von Figuren der Vergangenheit, mit der man den eigenen Platz innerhalb des feministischen Hauses rechtfertigt. Wir wollen durch die Geschichte jener Frauen der Subsahara streifen, die häufig als Feministinnen avant la lettre angeführt werden, um zu zeigen, warum diese Sicht meistens falsch ist.
Die Frauen der Subsahara, die Mütter der Menschheit, haben es überhaupt nicht nötig, um ein Zimmer für sich in dem großen Haus zu betteln, das andere errichtet haben. Sie müssen sich nur ihre Geschichte zurückholen und ausgehend von ihrem weiblichen Erbe die Werkzeuge ihrer Selbstbestimmung schmieden. Wenn sie diese Selbstkenntnis zurückerobert und aktualisiert haben, werden sie sich des Reichtums bewusst werden, den sie mit allen Frauen teilen sollten. Diese Feier ist bereits im Gange, und wir werden uns erlauben, gegenüber unseren Ahninnen eine respektvolle Unehrerbietigkeit an den Tag zu legen. Da es sich besonders um Frauen mit Macht handelt, werden wir ihr Handeln auch kritisch betrachten, ihre Geltung als Vorbilder für die jüngeren Generationen hinterfragen. Wie wir sehen werden, sind auch die Beeindruckendsten, die Einzigartigsten nicht vor Kritik gefeit. Sie zu respektieren, sie sogar zu lieben heißt auch, in der Lage zu sein, sich mit den dunklen Seiten zu konfrontieren, die sie antrieben. Die Macht offenbart auch ihre Schatten: Da sie den Glanz des Lichtes kennt, kann sie auch mit jenen umgehen. Die Scham, die in einer bestimmten subsaharischen Wahrnehmung der Dinge nur allzu präsent ist, hat bei der Betrachtung der Geschichte nichts zu suchen und behindert die Fähigkeit, Lehren aus ihr zu ziehen. Die Frauen der Subsahara müssen weder den Blick noch das Urteil Dritter fürchten, es sei denn, man wollte nicht nur deren Herablassung, sondern auch ihre Neigung rechtfertigen, ungebetene Ratschläge zu erteilen und zwar auf allen Gebieten. Sich zum eigenen Anteil an der Finsternis, dem eigenen Anteil am universellen Verbrechen zu bekennen heißt, zur eigenen Menschlichkeit zu stehen. Wer sich selbst mustergültige Vorfahren erfindet, bekundet seine Unreife, seine Unfähigkeit, Teil der Welt von morgen zu sein, und bekräftigt den Verzicht auf Gerechtigkeit zugunsten des Erhalts eines künstlichen Bilds.
Die Frauen, über die wir sprechen werden, gehören zu verschiedenen Regionen des subsaharischen Raums und vertreten besondere Kulturen in einem bestimmten Moment ihrer Entwicklung. Wir haben uns bewusst entschieden, sie auf diesen Seiten zusammenzubringen. Ihre Lebenswege bilden ein Netz von Geschichten starker Frauen, die das weibliche Erbe des Kontinents prägen und im Erbe der Welt einen sichtbaren Platz finden sollten. Die Auswahl drückt auch den Wunsch aus, dass die subsaharischen Völker ihr Erbe bald mischen, sich gegenseitig befruchten mögen. Um ihre Situation zu verbessern, könnten die Frauen zunächst auf dem eigenen Kontinent Ressourcen auftun, und erst, wenn sie dort nichts gefunden haben, auf anderen Erdteilen suchen. Aber das geschieht selten. Subsahara-Afrika ist vielfältig, das gilt auch für die Erfahrungen der Frauen. Sie sahen und sehen sich jedoch mit regionalen Ausprägungen männlicher Hegemonie konfrontiert, die es überall gibt, wo Menschen leben. Dieses Phänomen ist universell, obwohl es sich je nach kulturellem Kontext unterschiedlich darstellt und nicht erfasst werden kann, ohne die (geo‑)politischen Bedingungen der Betroffenen zu berücksichtigen. Die sehr seltenen matriarchalischen Gesellschaften, die es gab, haben den Lauf der Welt nicht beeinflusst. Das konnten sie aufgrund ihrer Struktur auch nicht.
Die Macht der Frauen im Matriarchat ist von ganz anderer Art als die spätere Macht der Männer: Sie wird in einer egalitären Gesellschaft ausgeübt, die keine staatliche Institution kennt. Die Macht ist nicht in den Händen einer begrenzten Gruppe konzentriert und Privateigentum ist unbekannt (…). Nur die Blutsbande oder solche, die man dafür hält, bestimmen die sozialen Beziehungen: Aus diesem Grund haben die Frauen durch ihre Fähigkeit zur Fortpflanzung Anerkennung erlangt. (…) Die Frauen haben die Menschheit geboren, aber sie haben sich dennoch nicht von der Natur gelöst. Das Matriarchat ist ebenso wie die Mutterschaft ein Naturzustand, der überwunden werden musste, um der Kultur Platz zu machen.4
Das Matriarchat, das oft mit der in Subsahara-Afrika häufigen Matrilinearität verwechselt wird, gehört also zu einer Ordnung, die man als primitiv bezeichnen kann, und es konnte nur in akephalen, also führerlosen Gesellschaften auftreten. Sobald sich ein Volk politisch zur Bildung einer Nation hin ausgerichtet hat, wie es in der Vergangenheit in Subsahara-Afrika geschah, gibt es keinen Platz mehr für das Matriarchat. Und wenn manche Anhängerinnen der girl power vom Matriarchat träumen, dann verkennen sie sein Wesen, die Tatsache, dass es mehr mit der Mutterschaft zusammenhängt als mit der politischen Macht der Frauen, die ihm nachgesagt wird, die es aber nicht beinhaltet. Die Lebenswege der Frauen an der Macht, die in diesem Buch vorgestellt werden, haben nichts mit dem Matriarchat zu tun. Es hat keinen Sinn, anhand ihrer Geschichten auf die Existenz dieser Organisationsform in Subsahara-Afrika zu schließen. Das lässt sich auch heute feststellen: Wenn Frauen in Staatsangelegenheiten mitreden oder sogar regieren heißt das nicht, dass wir uns in einer matriarchalischen Situation befinden. Im Matriarchat ist die Frau mit der Natur verbunden, wird von ihr gelenkt und definiert. So wird man es zumindest ausdrücken, wenn man die Geschichte durch ein westliches Prisma liest.
In Subsahara-Afrika wird die Verbindung der Frauen mit der Natur als Zusammenwirken mit der göttlichen Kraft, der Schöpferin jedes Seins, gesehen. Sie ist also ein unvergleichliches Privileg. Dem Mann obliegt es, Nationen zu errichten, Zivilisationen in ihrer materiellen Form zu gründen. Denn er kann im Gegensatz zur Frau, die das Geheimnis des Lebens in sich trägt, seinen Beitrag zum Werk der Schöpfung leisten, indem er außerhalb des Hauses tätig wird. Und wer das Leben der Frauen in einer solchen Umgebung als Eingesperrtsein wahrnimmt, dem die Männer entkommen, dem fehlt es an Urteilskraft. Die Beschränkung gilt für die einen wie die anderen, nur die Räume – also die Zuständigkeitsbereiche – unterscheiden sich. Jeder und jede ist auf sich selbst begrenzt, auf seine und ihre Rolle, seine und ihre symbolische Bedeutung in der Ordnung der Dinge. Zu bedauern, dass die Frauen vor allem im privaten Bereich leben, entwertet die Aufgaben, die sie dort erfüllen, und verleiht den sogenannten männlichen Tätigkeiten größeres Ansehen.
Die Frauen in Subsahara-Afrika waren außerdem nie auf Hausarbeiten beschränkt, sie bestellten die Felder, betrieben Medizin, Handel und Kunsthandwerk, kümmerten sich um spirituelle Angelegenheiten oder beteiligten sich am politischen Leben. Die ganze Menschheit hat immer Frauen erlebt, die sich auf vielfältigen Gebieten auszeichneten, was schon bei einer oberflächlichen Betrachtung von Frauenleben überall in der Welt deutlich wird. Im Frankreich des Grand Siècle zum Beispiel, dem 17. Jahrhundert, in dem das Leben der Frauen aus unzähligen Zwängen bestand, trotzten einige von ihnen dennoch den Ozeanen und reisten zu den Inseln, um ihren Horizont zu erweitern. Man brauchte Frauen in den Kolonien und ermunterte sie, sich dort niederzulassen. Man suchte wohlhabende Witwen, die ihr Vermögen in das koloniale Unternehmen stecken konnten. Aber »man stellte [auch] Frauen ein, damit sie bestimmte speziell weibliche Berufe ausübten«.5 Diese gab es also, und es waren oft handwerkliche Tätigkeiten. Die Hausarbeiten erledigten die Sklaven. Es wäre abwegig, das Matriarchat, um darauf zurückzukommen, mit der Vorstellung einer Hierarchie zu verbinden. Matriarchalische Gesellschaften waren insofern egalitär, als in ihnen die Autorität jedes Geschlechts anerkannt war und nicht das eine Macht über das andere ausübte. Da sich jedoch die Autorität der Frauen aus ihrem Status als (potenzielle) Mütter ergab, versteht sich von selbst, dass wir es nicht mit Gleichheit zu tun hatten, wie sie heutzutage gefordert wird. Das Matriarchat war antifeministisch und bedeutete auch nicht die Übermacht der Frauen. Genau betrachtet, vor allem, wenn man sich für seine metaphysische Dimension interessiert, hatte das Matriarchat nichts mit der Gynaikokratie [Frauenherrschaft nicht nur in der Familie, sondern auch im Staat] zu tun, die manche darin vermuten.





























