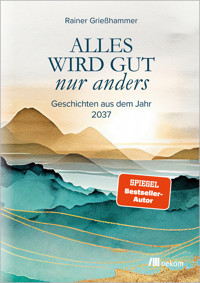Rainer Grießhammer
Alles wird gut –nur anders
Geschichtenaus dem Jahr 2037
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
© 2024 oekom verlag, Münchenoekom – Gesellschaft für ökologische Kommunikation mbHGoethestraße 28, 80336 München
Lektorat: Katharina SpanglerKorrektur: Lena DenuUmschlaggestaltung: Sarah Schneider, oekom verlagUmschlagabbildung: © Adobe Stock/Piyapong
E-Book: SEUME Publishing Services GmbH, Erfurt
Alle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-98726-393-4
https://doi.org/10.14512/9783987263262
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Coffee to sit
Klimatribunal – Wer wird angeklagt?
Das Avatario: Szenen einer Ehe
Malaria in Deutschland
Die Wunschkindpille für den Mann
Noch hinter dem Mond
taz-Le Monde
Das Telefon in der Westentasche
Das E-Bike 1988 – zwanzig Jahre zu früh
Kein Trinkgeld für den Servierroboter
Das inhärente Desaster
Lebenslanges Lernen
Die Bremsspur des Hyperkonsums
Leben wie die Könige?
Verhalten oder Verhältnisse ändern?
Hot Power Challenge
Neues Knie oder SUV?
Die Wiederauferstehung der Innenstadt
Im Transformationsmuseum
Die Energiewende
Die Energiewendekomitees und die Partei Die Zukunft
Freiburg high & matt
Der Sturm Großmann
Fake News für Profis
Atommüll-Endlager mit Oktoberfest
Von Telegramm zu Telegram
Machu Picchu im Metaverse
Kaninchen statt Bambi
Die Alpenalben
Aus eins mach zwei
Hier wohnte ein Auto
Voll autonom
Tempolimit bei Innovationen?
Der Robo-Messner auf dem Mount Everest
Festvortrag: 200 Jahre Eisenbahn
Das fast autonome Interview
Drohnenrettung im Meerchen
Das Medizinkiosk in der Dorfkirche
Das ganze Homeoffice in einer Brille
Patent gegen Motorradlärm
Von der Lohntüte zum digitalen Bankraub
Das Linsengericht
Die Hacker
Weißkragen, Wischiwaschi und Cleverle
Chemiecocktail in der Muttermilch
Der Mann mit dem Koffer
Das Programm »Generation Zukunft«
Paul im Fadenkreuz
Umweltschutz im Cyberspace
Wie blöd ist die künstliche Intelligenz?
Wen macht die Banane krumm?
Der automatische Foulscreener
Von der Schallplatte bis zum MiniHelper: Satisfaction
Der Veggieday der katholischen Kirche
Generation Transformation
Die Maschinensteuer – ein wunder Punkt
Die Wahlprüfsteine
Das Projekt Erdlandung
Das Klimatribunal
Brasilien im Nordschwarzwald
Der Brief
Verwendete Literatur
Danksagung
Über den Autor
Vorwort
Bewegte Zeiten. Multiple Krisen. Schnelle technologische Änderungen. Politischer Stillstand.
Wie wird es weitergehen? Wie soll es weitergehen? Wie wird der Alltag im Jahr 2037 aussehen? Wie die Politik der nächsten zehn, zwölf Jahre? Was wird aus der Klimaerhitzung, der Bildung, den Arbeitsplätzen, einem Grundeinkommen, den Renten?
Was würde ich – in diese andere Zeit hineingeboren – als junger Mensch fühlen, denken, machen? Was als alter Mensch – wenn ich das noch erlebe? Was würden wir gegenseitig wertschätzen, was kritisieren? Welche Generationenkonflikte würden wir ausfechten?
Kann ich aus meiner langen Erfahrung mit vielen technologischen und gesellschaftlichen Entwicklungen plausibel abschätzen, wie es weitergeht? Mit Klimaerhitzung und Klimaschutz? Mit den zwei großen Transformationen – der Energiewende und der Digitalisierung?
Kann ich annehmen, dass alles gut oder wenigstens besser wird? Nur, wenn Sie sich auch dafür engagieren!
In dem Buch habe ich mich in die Zukunft hineingedacht. Ich lade Sie ein. Kommen Sie mit! Machen Sie mit!
Coffee to sit
Bei uns in Freiburg schenkte ich den Kaffee ein, in Berlin verteilte Paul, unser Ersatzenkel, zuerst die schwedische Mandeltorte und tat es mir dann nach. Den gemeinsamen digitalen Kaffeetisch hatten mir Jan und Anna, seine Eltern, zum Geburtstag geschenkt. Wir saßen in Berlin und Freiburg jeweils vor einem großen Bildschirm und sahen uns gegenseitig. Um die Illusion perfekt zu machen, passten in beiden Wohnungen die Tischdecken und selbst das Kaffeegeschirr zusammen. Die lange Reise nach Berlin wollten Clara und ich nicht mehr auf uns nehmen. Außerdem waren solche virtuellen Treffen ökologischer und billiger. Und Jan und Anna waren sowieso immer viel zu beschäftigt, um uns zu besuchen.
Die sonst so quirlige Anna sah heute müde aus, Jan kippelte unruhig auf seinem Stuhl und veränderte mehrfach die Videoeinstellungen. Auch Paul hielt es kaum auf seinem Platz. Er trommelte mit den Fingerspitzen seiner linken Hand auf den Tisch und fuhr sich mit der Zunge immer wieder über seine Unterlippe. Noch bevor wir uns richtig begrüßt hatten, platzte es aus ihm heraus: »Ich habe die Stelle als Assistent beim Klimatribunal bekommen. Und stellt euch vor: Es wird in Freiburg stattfinden!«
»Braucht es dieses Tribunal denn überhaupt noch?«, fragte Jan. »Immerhin sind die CO2-Emissionen unter Grün-Orange-Rot doch massiv reduziert worden.« Paul funkelte ihn böse an.
»Das Ende der fossilen Energien ist doch sowieso in Sicht. Jetzt haben sie sogar das Projekt Erdlandung finanziert. Euer komisches Tribunal reißt nur alte Gräben wieder auf.« Jan hielt nicht hinter dem Berg damit, was er von der Idee seines Sohnes hielt.
»Kann schon sein. Aber die Folgen der Klimaerhitzung sind damit ja nicht begraben. Die Dämme müssen erhöht werden. Die Wasserversorgung in den Dürregebieten muss neu organisiert werden. Der Waldumbau kostet Milliarden. Und die dafür verantwortlichen Konzerne fahren Milliardengewinne ein. Es ist noch so viel zu tun!« Paul war von seinem Stuhl aufgesprungen. Wenn es um sein Thema ging, war er nicht mehr zu halten.
»Du hast recht«, bestätigte Anna. »Dein Vater sucht immer sofort nach Kompromissen. Leider nur in der Politik. Aber ich habe ganz andere Bedenken. Für so ein großes Klimatribunal, bist du dafür nicht zu …«
Paul fiel Anna gleich ins Wort: »Nein, ich bin nicht zu jung. Solomon Yeo hat 2023 im gleichen Alter auf der UN-Vollversammlung die Resolution zum Internationalen Gerichtshof durchgebracht. Und die Klimaschützer*innen, die den US-Staat Montana wegen der Klimafolgen verklagt haben, waren sogar noch jünger als ich.«
Anscheinend hatte er sich auf diesen Vorwurf vorbereitet. Das würde er auch müssen. Seine Mutter war sicher nicht die Einzige, die sein junges Alter ins Feld führen würde. Aber sich gleich mit Solomon Yeo vergleichen? Durch seinen Einsatz dürfen Inselstaaten mittlerweile die Hauptemittenten von CO2 auf Schadensersatz verklagen.
»Aber die hatten auch Unterstützung«, wandte Jan ein.
»Klar, aber unsere Initiative auch. Gleich durch mehrere Klimawissenschaftler*innen und Jurist*innen. Ulrich wird uns sicher auch helfen, oder?«
»Natürlich mache ich das«, sagte ich. »Das Klimatribunal ist wichtig. Aber du weißt, dass du unter Beschuss stehst. Das ist nicht einfach. Ich vermute, dass du bei der Initiative der Einzige warst, der so einen Fulltime-Job ehrenamtlich machen konnte und wollte. Viel Geld habt ihr ja nicht.«
»Wirklich nicht«, murmelte Paul. »Aber ich bekomme wenigstens die Miete bezahlt. Da fällt mir ein …«, er holte kurz Luft. »Kann ich die ersten Monate bei euch wohnen, bis ich was gefunden habe?«
»Klar kannst du bei uns wohnen, zumindest in der ersten Zeit.« Wieder sah Clara mich an und drückte kurz meine Hand. »Aber bei uns gibt es auch eine große Veränderung. Wir wollen so bald wie möglich in ein Mehrgenerationenprojekt ziehen.«
Die drei Berliner*innen schauten uns verblüfft an.
»Wer hat das entschieden?«, fragte Jan mit einem merkwürdigen Unterton in seiner Stimme.
Auf Claras Antwort »Natürlich wir zusammen!« drehte sich Jan zu Anna und murmelte: »Siehst du, die entscheiden zusammen.«
»Du bist so ein Idiot!«, erwiderte Anna scharf. »Wer hat denn gestern wieder ohne Rücksprache das geplante gemeinsame Wochenende gecancelt? Wegen des Wasserstoff-Forums. Deine Arbeit ist eben immer wichtiger als ich.«
Bevor der Streit eskalieren konnte, schrie Paul auf. »Na super. Immer geht es nur um euch. Euren blöden Ehestreit.« Dann sprang er auf und verließ fluchtartig das Zimmer. Dabei stieß er an den Tisch, die Kaffeekanne kippte um und floss auf meine Hose zu. Blitzschnell legte ich die Serviette dazwischen, aber wie von Geisterhand hatte die Flüssigkeit schon an der digitalen Trennlinie unserer beiden Tische Halt gemacht.
Eine halbe Stunde später, wir diskutierten immer noch, ob wir uns bei Anna und Jan einmischen sollten, hörten wir: »Hallo, hier ist Paul.«
»Hallo, Paul!«, sagte Clara in den Raum hinein und nahm den Anruf an.
»Ich will so schnell wie möglich zu euch«, sagte Paul. »Ich halte das hier nicht mehr aus! Ich helfe euch auch gerne beim Aussortieren und Umziehen!«
Clara schaute kurz zu mir, wartete kaum mein Nicken ab und sagte zu. Nachdem Paul aufgelegt hatte, war ihr die Freude anzusehen: »Schön, dass wir Paul dann wieder öfter sehen.«
Auch ich fand Gefallen an dieser Lösung. Die ersten drei Jahre seines Lebens hatten wir Paul sehr oft gesehen. Jan und Anna hatten damals mit ihm gleich ums Eck gewohnt, seine Großeltern weit weg in Norddeutschland. So waren wir seine Ersatzgroßeltern geworden. Noch immer diskutierten wir gern, wer eigentlich wen zuerst gefragt hatte. Anna und Jan uns oder umgekehrt?
Als die drei nach Berlin gezogen sind, hat das eine große Lücke hinterlassen. Aber immerhin war er in den meisten Schulferien bei uns.
»Zum Glück ist er aus der Pubertät raus«, stellte ich fest und nahm meine Frau in den Arm. »Dafür fühle ich mich nämlich langsam zu alt.«
Klimatribunal – Wer wird angeklagt?
Paul und ich hatten uns zu einem Videocall zum geplanten Klimatribunal verabredet. Weil ich lange im Öko-Institut gearbeitet hatte, hatten wir oft über Umwelt- und Klimathemen diskutiert. Zur Vorbereitung hatte ich in alten Unterlagen geblättert und zeigte ihm jetzt einen Artikel zur Klimaerhitzung, den ich 2024 geschrieben hatte. Damals glaubten eine Menge Leute tatsächlich noch, dass wir das 1,5-Grad-Limit der Pariser Klimakonferenz einhalten würden. Aber vielen, mir inklusive, war klar, dass das nicht mehr realistisch war. Jetzt, dreizehn Jahre später, war klar, dass die 1,5 Grad deutlich überschritten werden würden. Leider hatte ich recht behalten.
»Zum Glück tut sich jetzt endlich was«, sagte Paul, der aus einer Generation kam, die überhaupt nicht mehr verstehen konnte, warum wir jahrzehntelang so untätig gewesen waren.
Er hatte recht. Durch mittlerweile strenge Klimaschutzgesetze waren die jährlichen CO2-Emissionen zuletzt zwar stark reduziert worden, und es bestand erstmals seit Jahrzehnten die realistische Hoffnung, dass die weitere Erhitzung knapp unter 2 Grad blieb. Aber diese Temperaturerhöhung würde schon zu massiven Klimaschäden führen.
»Warum hast du denn gerade 2024 den Artikel geschrieben?«, wollte Paul wissen.
»2023 war das Wendejahr in der öffentlichen Wahrnehmung der Klimaerhitzung. Und da wollte die Frankfurter Rundschau einen Übersichtsartikel zu ›25 Jahre Klimawandel und Klimaschutz‹. In Deutschland hatten viele lokale ›Jahrhundertüberschwemmungen‹ und Tornados die letzten Zweifel beseitigt. Auf der Ferieninsel Rhodos hatte es im Sommer wochenlang gebrannt, viele Touristen mussten evakuiert werden. In Griechenland …«
»Moment«, sagte Paul, »InforMe soll die Bilder reinholen.« Der Chatbot InforMe war Pauls digitaler Assistent, der in Sekundenschnelle für ihn recherchierte. Auf dem Laptop erschienen Bilder von dem brennenden Rhodos, Videos von den riesigen Flutkatastrophen in Griechenland und in Libyen und – nach meiner Aufforderung – auch von der Zerstörung Acapulcos durch einen heftigen Hurrikan. Auch jetzt noch, vierzehn Jahre später, deprimierten mich die Bilder.
»Du hast recht«, sagte ich. »Bilder und Videos sagen oft mehr als Worte. Wobei man denen ja heute auch nicht mehr trauen kann. Aber lass mich weitermachen: 2023 war das heißeste Jahr, seit es Temperaturaufzeichnungen gab. Im Sommer lag die Durchschnittstemperatur mit fast 17 Grad weit über dem langjährigen Durchschnitt.«
»17 Grad«, wandte Paul verblüfft ein. »Während der letzten drei Jahre lag das doch immer bei 18 Grad – dabei war 2037 noch ein kühles Jahr. InforMe hat zu den Kipppunkten des Klimasystems recherchiert. Der Golfstrom hat sich schon gefährlich verlangsamt. Und beim Grönland-Eisschild ist das komplette Abschmelzen nicht mehr zu stoppen. Zum Glück für uns wird das mehrere Jahrhunderte dauern. Aber damit wird der globale Meeresspiegel langfristig um mehr als sieben Meter steigen. Pech für die Generationen nach uns.«
»Unvorstellbar«, sagte ich und zuckte mit den Schultern. »Wie oft haben wir davor gewarnt. Und wie wenig wurde auf uns gehört. Man hätte das noch verhindern können, wenn die großen Industriestaaten wenigstens ab dem Zeitpunkt CO2-Emissionen drastisch reduziert hätten, als wir wussten, worauf es hinausläuft.«
»Hätte, hätte, Fahrradkette«, grummelte Paul. »Aber jetzt zu unserem eigentlichen Thema. Fürs Klimatribunal arbeiten inzwischen schon um die dreißig Leute. Wir haben auch eine kleine Finanzierung von einer Stiftung. Aber dafür mussten wir jetzt doch einen Verein gründen: Klimatribunal e.V. Die meisten organisatorischen Sachen haben wir schon geklärt. Jetzt diskutieren wir gerade, wen wir alles vor dem Klimatribunal anklagen müssen. Was meinst du? Die großen Industrieländer? Die Erdöl-, Gas- und Kohlekonzerne? Die Automobilindustrie? Die von der Industrie finanzierten Klimaleugner*innen? Die Politiker*innen – aber wen? Die Boykotteur*innen von wichtigen Klimaschutzmaßnahmen wie die Anti-Windkraft-Organisation Vernunftkraft? Die Konsument*innen? Oder alle zusammen?«
Spontan drängte es mich zu sagen: »Alle!« Aber natürlich musste das gut überlegt sein. In der Diskussion merkten Paul und ich schnell, dass wir für die Beantwortung dieser zentralen Frage viel mehr Zeit und Diskussion brauchten. Als Erstes wollten wir klären, wer ab wann genug gewusst hatte, um Klimaschutzmaßnahmen ergreifen zu müssen.
»Gar nicht so leicht«, meinte ich. »Dass eine steigende Konzentration von CO2 zu einer Erderwärmung führt, wusste man eigentlich schon seit Ende des 18. Jahrhunderts. Und seit 1958 zeigen die damals begonnenen Messungen auf Hawaii, dass die CO2-Konzentration von Jahr zu Jahr zunimmt.«
»Haben denn die großen Wissenschaftsorganisationen vor einem Klimawandel gewarnt?«
»Die World Meteorological Organization hat das schon 1979 gemacht, aber noch relativ zurückhaltend. Viel deutlicher und unmissverständlich war dann die Deutsche Physikalische Gesellschaft im Jahr 1985. Mir selbst ist das auch erst in diesen Jahren klar geworden. 1982 habe ich als Assistent im Deutschen Bundestag gearbeitet. Da hat uns Wilfried Bach sein Buch zugeschickt: Gefahr für unser Klima. Wege aus der CO2-Bedrohung durch sinnvollen Energieeinsatz. Die breite Öffentlichkeit hat den Klimawandel wahrscheinlich erstmals 1986 mitbekommen. Damals hat Der Spiegel den Kölner Dom aufs Titelbild gepackt: abgesoffen.«
»Aber die Forschungsabteilungen der Erdölkonzerne haben den Klimawandel schon viel früher erkannt und intern kommuniziert«, warf Paul ein. »Im Jahr 2023 hat Kalifornien deswegen doch die fünf weltgrößten Ölkonzerne verklagt, weil sie ihre frühen Ergebnisse verschleiert haben und danach sogar Antiinformationskampagnen zur Vermeidung von gesetzlichen Auflagen finanziert haben.«
»Da hast du recht. Also die müssen vors Klimatribunal.«
»Okay, dann haben wir wenigstens schon mal eine Gruppe von verantwortlichen Klimaverbrecher*innen.«
»Vorsicht. Juristisch formuliert habt ihr dann eine Gruppe oder einzelne ehemalige Vorstände, die ihr wegen gezielter Verschleppung von Klimaschutzmaßnahmen anklagen könnt. Die Anklage müsst ihr gut begründen und formulieren und den Angeklagten zustellen. Die können sich dann dazu äußern, sich Anwält*innen nehmen und eventuell Gutachten einfordern. Unabhängig davon dürft ihr vor einer möglichen Verurteilung nicht von Verbrecher*innen sprechen, sonst kann man euch Voreingenommenheit vorwerfen. Das ist sowieso die Hauptkritik bei gesellschaftlich getragenen Tribunalen.«
Paul verdrehte die Augen. »Ich weiß, ich weiß. Das ist harte Arbeit. Wir haben die früheren Tribunale wie etwa das Vietnam-Tribunal detailliert ausgewertet. Das war übrigens eine Analyse, bei der InforMe nicht gut recherchiert hat.«
»Kein Problem. Auf unserem Speicher habe ich noch Material von damals, mindestens drei Kilo.«
»So schwer? Ich wusste, dass ich das Tribunal nicht auf die leichte Schulter nehmen darf.«
Das Avatario: Szenen einer Ehe
Am nächsten Abend läutete es zweimal kurz, zweimal lang – das alte Erkennungssignal von Paul. Clara öffnete die Tür und umarmte Paul herzlich, aber der zuckte etwas zurück.
»Pass auf, ich habe mir vorgestern den MiniHelper implantieren lassen. Der Schnitt ist noch nicht ausgeheilt.«
Das war ja nur eine Frage der Zeit gewesen – alle seine Freunde hatten schon so ein Ding, zwischen dem linken Ohr und der Kinnlade. Das war zugegebenermaßen in mehrfacher Hinsicht praktischer als ein Smartphone. Die gesprochenen Befehle oder Texte wurden vom MiniHelper direkt verarbeitet. Mitteilungen oder Musik konnte man so gut hören wie früher beim Smartphone. Allerdings hatte der MiniHelper kein Display. Viele Eltern ließen ihn schon früh ihren Kindern implantieren, weil sie dann immer wussten, wo die Kinder waren. Mir war der MiniHelper immer noch ein bisschen suspekt.
»Das kleine Zimmer?«, fragte Paul und legte dort seinen wie immer spartanisch gepackten Rucksack ab. Als er wieder zu uns ins Wohnzimmer kam, schossen mir Bilder durch den Kopf. Paul als Baby, Paul auf dem Weg in den Waldkindergarten. Immer abgelenkt durch Vogelgezwitscher oder irgendeinen Ast, den er hinter sich her schleifen musste. Paul mit dreizehn, als er zum ersten Mal beim Skilanglauf deutlich schneller war als ich. Und jetzt Paul direkt vor mir – wilde Lockenhaare, groß, durchtrainiert, meist lächelnd und blaue Augen, die einen festhielten wie der Blick auf das azurblaue Meer am ersten Ferientag.
Kein Wunder, dass die Frauen für ihn schwärmten. In Berlin hatte er gleich zwei Freundinnen. Sie waren wie Paul und seine ganze Clique polyamor. Auch mit einem Freund hatte Paul, wie er sich ausdrückte, schon mal herumgemacht, fand aber, dass das nicht so sein Ding sei. Pauls Mutter hatte Clara anvertraut, dass sie und Jan nach wie vor irritiert vom Lebenskonzept ihres Sohnes waren. Clara und ich waren dagegen amüsiert. Als wir so alt waren wie Paul, hatten auch wir das Ideal der »freien Liebe« verfochten – so hieß das damals. Aber wir hatten damals schnell festgestellt, dass das ganz schön anstrengend werden konnte. Als Clara und ich uns später, Mitte der 1980er-Jahre, kennenlernten, war von der Freie-Liebe-Bewegung nur noch die Idee übrig geblieben, dass man bloß nicht heiraten solle, sondern als »Lebensabschnittspartner*in« zusammenbleiben sollte. Über den Begriff konnte sich Paul totlachen. Eine Zeit lang hatte er uns ironisch »Lebensabschnittsgroßeltern« genannt.
»Warum lächelst du?« Paul holte mich ins Hier und Jetzt zurück.
»Ich habe gerade etwas geträumt. Aber eigentlich bin ich gar nicht in Stimmung, zu lächeln. Jetzt wo du hier bist und uns beim Aussortieren helfen willst, rückt ein Umzug in ein Mehrgenerationenprojekt ganz nahe. Und dabei haben wir noch nicht mal ein Projekt gefunden, bei dem wir aufgenommen werden. Und ehrlich gesagt, haben wir auch noch gar nicht richtig gesucht.«
»Ist das dein Ernst? Das klang alles schon so fix. Das kann in Freiburg doch noch ewig dauern, bis ihr was findet. Da kommt ja das Klimatribunal noch vorher.«
»Gut möglich. Aber jetzt lass uns einen Tee machen.«
»Während Paul Wasser aufstellte, suchte ich nach dem von ihm heiß geliebten Ingwertee. »Oje, sieht so aus, als ob der ausgegangen ist.«
»Mit wem?«, fragte Paul.
Ich liebte seine Witze.
»Hier ist doch noch ein Ingwerbeutel für dich. Ich nehm dann das Zitronengras. Auch für Clara. Mach ein bisschen mehr Wasser.«
»Meerwasser?«
»Genau. Clara hat es gerne salzig. Aber jetzt mal im Ernst: Wolltest du nicht anfangen zu studieren? Jura und Politik und Artificial Intelligence?«
»Schon, aber ich habe es mir anders überlegt. Das klassische Studium ist doch witzlos. Was du da lernst, ist in fünf Jahren Schnee von gestern.«
Paul hatte ein Faible für alte Ausdrücke, wie zum Beispiel »Schnee von gestern«. Das mochte ich sehr an ihm. So völlig aus der Zeit gefallen. Dieser Ausdruck war wirklich anachronistisch, denn im Flachland hatte es seit sieben Jahren nicht mehr geschneit. Im Schwarzwald blieb nur noch gelegentlich Schnee liegen, auf Höhen über 1.200 Metern. Mein Lieblingshobby Skilanglaufen drohte im wahrsten Sinn des Worts dahinzuschmelzen.
»Hallo«, wedelte Paul mit seiner Hand vor meinen Augen, »du hörst mir ja gar nicht mehr zu. Wo bist du denn mit deinen Gedanken?«
»Schwarzwald«, bekannte ich, »Skilanglaufen.«
»Ja, siehst du. Das war einmal. So ist es auch mit dem meisten Kram, den du in der Ausbildung lernst. Wer fit ist, macht einfach Projekte und holt sich dazu, was er oder sie braucht. Oder geht zu Leuten, von denen er oder sie lernen kann. Zum Beispiel von dir. Mein Projekt ist jetzt das Klimatribunal. Dazu kann ich an der Uni einzelne Kurse zu Jura und zu Politik belegen. Zur künstlichen Intelligenz kann ich später was machen. Jetzt beim Klimatribunal reicht mir eine menschliche Intelligenz.«
Paul war nicht zu stoppen. Hinter seiner Begeisterung und dem Überschwang blitzte manchmal etwas Selbstgerechtigkeit oder Arroganz auf; aber das würde er weit von sich weisen.
Clara hatte telefoniert und kam zu uns in die Küche und hatte die letzten Sätze mitgehört. »Das ist ja eine Überraschung. Was sagen deine Eltern dazu?«
»Eigentlich sind sie dagegen. Aber ich verdiene meinen Lebensunterhalt selbst. Ich kann wieder im Philosophischen Café arbeiten, wie in meinen letzten Ferien und wie Mama früher. Außerdem sind die zwei so verstritten und in ihren Problemen versumpft, dass sie kaum Zeit für mich haben. Es war sowieso Zeit, die Düse zu machen.«
Clara hakte nach: »Ist es denn wirklich so schlimm mit den beiden? Wenn wir uns virtuell treffen, merken wir davon nichts. Außer vielleicht beim letzten Mal.«
»Kein Wunder«, sagte Paul, »die verdrängen das so perfekt, dass sie es fast selbst nicht mehr merken. Zehn Minuten Streit mit gemeinen Anschuldigungen, und dann wird wieder ein paar Tage heile Welt gespielt. Aber vor einem Monat habe ich ein Avamovie gedreht, und als sie das gesehen haben, ging der Streit durch die Decke.«
»Du hast ein Avamovie zum Ehestreit deiner Eltern gemacht?«, fragte ich fassungslos. »Die beiden als computergenerierte Avatare? Aber das ist doch verboten, spätestens seit …«
»Überhaupt nicht«, entgegnete Paul ernst, »nur wenn man das Video nicht als Avamovie kennzeichnet und es ohne Zustimmung der Betroffenen veröffentlicht. Im Darknet findest du allerdings einen Haufen genau davon. Die automatische Markierung der Software kann jedes Kind mit ein paar Tricks löschen. Auf Avatario könnt ihr Tausende Avamovies anschauen – die sind alle klar gekennzeichnet – sonst würden sie auch sofort gelöscht.«
»So ein Avamovie wie damals von ABBA, in den 2020er-Jahren?«, wollte Clara wissen. Sie war offenbar nicht so geschockt wie ich und summte Dancing Queen, den Uralthit von ABBA.
»So ähnlich, formal war das ein Hologramm.«
»Und so was kannst du auch machen?
»Das kann doch heute jeder.« Paul winkte ab. »Die Software kannst du auf der Webseite von Avatario herunterladen. Du brauchst nur ein paar Filmaufnahmen von den Hauptfiguren, möglichst mit den typischen Bewegungsmustern und Gesichtsregungen und guten Aufnahmen von den Stimmen. Na ja, zwei, drei Tage Arbeit macht das schon. Wollt ihr jetzt das Avamovie von Anna und Jan sehen? Es hat den Titel Szenen einer Ehe. Die beiden haben doch immer von dem alten Bergman-Film geschwärmt.«
»Nee«, wehrte Clara ab, »das ist mir zu intim.«
»Ach was«, ärgerte sich Paul. »Du wolltest doch wissen, wie es bei den beiden läuft. Wenn ich dir das erzähle, ist es nicht intim, oder was? Ihr seid so was von vorgestern!«
»Ist ja gut«, lenkte ich ein. »Aber weißt du, wie der Film von Bergman ausgeht? Die beiden lassen sich scheiden und heiraten jeweils andere Partner*innen. Jahre später treffen sie sich überraschend, schlafen miteinander und treffen sich ab da dann immer wieder heimlich.«
»Tja«, sagte Paul mit einem sarkastischen Unterton, »bis das bei den Eltern passiert, werde ich so alt sein wie ihr. Aber du lenkst schon wieder ab, wie immer, wenn es unangenehm wird.«
»Eigentlich«, sagte Clara nachdenklich, »ist das Avamovie ja nicht heimlich. Deine Eltern haben es ja gesehen. Es ist eher wie eine Verfilmung.«
»Sag ich doch!« Paul schien überrascht, dass Clara ihm nun doch zustimmte.
»Das ist ja eine sehr trickreiche Interpretation«, sagte ich. »Aber gut. Dann mal los.«
Paul loggte sich auf meinem Laptop in sein Avatario in der Cloud ein. »Die typischen Bewegungsmuster der Eltern, wie sie Hand in Hand gehen, küssen, streiten, Hände über dem Kopf zusammenschlagen, habe ich bei Avatario heruntergeladen und die Gesichter von Jan und Anna einmontiert.«
Manche Bewegungen waren noch etwas ruckelig, aber sonst war der Film perfekt, auch die Sprachsequenzen. Clara und mir lief es kalt über den Rücken. Einerseits war das Avatario so lebensecht, dass wir fast das Gefühl hatten, direkt neben den Streitenden zu stehen. Andererseits wussten wir ja, dass es ein von Paul gedrehter Avamovie war. Das schaffte wiederum eine kalte Distanz, durch die wir den inhaltlichen Streit noch deutlicher wahrnehmen konnten, als wenn wir real dabei gewesen wären.
Eine Szene beeindruckte uns besonders, in der Anna Jan hart anging: »Seit Jahren arbeitest du zu viel zu viel. Während deiner Bundestagszeit und als Staatssekretär hast du mich total vernachlässigt. Und Paul auch. Schon als wir uns kennengelernt haben, hast du selbst gesagt, dass du zu viel arbeitest und dass du dir vorgenommen hast, das zu ändern. Aber nichts ist passiert. Und ich war so blöd, dir zu glauben und habe mein geliebtes Philosophisches Café aufgegeben und bin mit dir nach Berlin.«
Jan hielt dagegen: »Ich habe doch extra wegen deiner Unzufriedenheit den Posten als Staatssekretär abgegeben und den weniger zeitaufwendigen Job als Geschäftsführer des Wasserstoff-Forums angenommen. Wir wussten, dass ich da oft im Ausland sein muss. Aber wenn ich daheim bin, gehst du zu deinen Freundinnen oder rennst von einer Kulturveranstaltung zur nächsten. Irgendwie fühle ich mich abserviert.«
»Mir geht das erst recht so«, seufzte Paul. »Irgendwie weiß ich gar nicht, warum die überhaupt mich beziehungsweise ein Kind wollten. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich mit euch mehr Zeit verbracht habe als mit meinen Eltern.«
Malaria in Deutschland
Es war wieder ein heißer, schwüler Tag, mit 39 Grad, und das Anfang Mai. Clara und Paul wollten an einen Baggersee radeln und schwimmen. Ich wäre lieber mit dem Zug hoch in den kühleren Hochschwarzwald gefahren, aber ich gab nach. Wir nahmen die E-Bikes, Paul lieh sich ein normales Fahrrad.
Natürlich kamen wir völlig verschwitzt an. Die Stechfliegen warteten schon in Zehnerreihen auf uns. Sie hatten es besonders auf Paul abgesehen, der nur noch wild um sich schlug und sich vorerst ins Wasser rettete. Clara und ich setzten uns in eines der großen Schattenzelte mit Moskitonetzen, die von April bis Oktober aufgestellt wurden. Während es in weiten Teilen Deutschlands nur noch wenig Insekten gab, wimmelte es hier in der schwülheißen Rheinebene nur so von Stechmücken.
Wie üblich waren viele Leute am See. Nachdem die 25-Stunden-Woche eingeführt worden war, wurde meist in zwei Schichten gearbeitet, und an diesem Nachmittag waren viele Familien mit Kindern am See.
Über ihm kreiste die Bademeisterdrohne, die Naturseen sicherer machen sollte. Sobald jemand mehr als eine Minute unter Wasser war oder verzweifelt um sich schlug, sandte sie einen grässlichen Dauerton aus, flog direkt zu der Stelle, wo die Person kämpfte, und ließ einen Rettungsring fallen. Die jungen Leute machten sich gelegentlich den Spaß, länger als eine Minute zu tauchen und den Warnton auszulösen. Aber das gab heftigen Ärger mit den anderen Badegästen, weil sich der Warnton erst nach fünf Minuten ausschaltete.
»Den Stechfliegen geht es wie uns, sie mögen dich«, scherzte Clara, als Paul vom Schwimmen kam und sich abtrocknete. »Erinnerst du dich eigentlich noch, dass du als kleines Kind Malaria hattest und fast gestorben wärst? Damals warst du mit Jan in den Ferien hier am Baggersee und nach dem Baden von Kopf bis Fuß voller Stiche.«
Paul schaute uns entgeistert an: »Das war hier? Die Eltern haben mir das nie richtig erzählt. Nur dass ich sehr krank war. Ansonsten haben sie bei dem Thema sofort angefangen zu streiten.«
»Kein Wunder«, hakte ich ein. »Deine Mama wollte dich eigentlich nicht mehr an den See mitnehmen, weil es damals immer mehr Berichte über Malariainfektionen gab, vor allem am Rhein und den nahegelegenen Baggerseen. Aber Jan hat nur gelacht und Anna als Klima-Angsthase verspottet.«
Clara seufzte. »Aber sie hat recht behalten.«
»Ich frage gerade mal InforMe, ab wann man das hat wissen können. Ich lese euch die Antwort vor.
Paul: Ab wann gab es in Europa wieder tropische Krankheiten und Malariafälle?
InforMe: Mitte der 2020er-Jahre wurden gefährliche Stechfliegen und Zecken aus Afrika und Asien in Europa heimisch. Inklusive der ganzen Palette von Parasiten, Bakterien oder Viren und zunehmend mit Tropenerkrankungen wie zum Beispiel Denguefieber, Enzephalitis oder eben Malaria. Angefangen hat es mit der Asiatischen Tigermücke. Die hat sich schon seit 2021 am Oberrhein und in Freiburg verbreitet.
»Aber dein Glück im Unglück war«, fuhr Clara fort, »dass gerade im Vorjahr ein neues Chemotherapeutikum gegen Malaria entwickelt worden war, Globofantrin. Ein paar Tage hast du wirklich um dein Leben gekämpft. Es war furchtbar. Du hast abwechselnd vor Kälte geschlottert, dann wieder hohes Fieber bekommen, Durchfall und Krämpfe gehabt. Die ersten Gegenmittel haben versagt, viele Erreger waren dagegen schon resistent. Erst das neu entwickelte Globofantrin hat geholfen.«
Paul war sichtlich blass geworden, räusperte sich und fragte. »Irgendwo habe ich gelesen, dass es schon in den 2020er-Jahren eine große globale Initiative gegen Tropenkrankheiten gegeben hat. War das wegen der Malaria?«
»Nicht nur. Es hat schon vorher einen Globalen Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria gegeben, aber der war finanziell nicht besonders gut ausgestattet. Aber als die Tropenkrankheiten sich auch in Europa und den USA gehäuft haben, wurde mehr Geld investiert und neue, kostengünstige Impfstoffe und neue Chemotherapeutika entwickelt, auch gegen Malaria.«
Ich ergänzte: »Das meiste Geld ging aber in die Entwicklung von neuen Antibiotika.«
»Warum denn das?«, fragte Paul. »Antibiotika gibt es doch schon ewig.«
»Eben. Aber damit steigt auch die Gefahr von Resistenzen. In der zweiten Hälfte der 2020er-Jahre ist es zu einer globalen Antibiotikakrise gekommen. Da hat es immer mehr Erreger gegeben, die gegen alle Antibiotika resistent geworden waren.«
»Aber warum hat man nicht einfach neue Antibiotika entwickelt?«
»Gute Frage«, sagte Clara. »Die Pharmaindustrie hat wenig Interesse an neuen Antibiotika. Die Entwicklung dauert lang und ist sehr teuer. Aber die Verkaufsmengen sind nicht groß, weil man Antibiotika ja nur ein paar Tage lang einnehmen muss. Da sind Blutdruckmittel oder Magensäureblocker viel lukrativer – die muss man jeden Tag nehmen.«
»Verstehe. Aber warum gab es gleich eine globale Antibiotikakrise?«
»In vielen Ländern, auch in Deutschland, sind Antibiotika schon bei kleinsten Atemwegsinfektionen verschrieben worden. Vor allem gab es aber einen hemmungslosen Einsatz von Antibiotika in der Massentierhaltung. Wurde nur ein Tier in der Massentierhaltung krank, so bekamen gleich alle Tiere Antibiotika. Da wurden mehr und mehr Bakterien resistent. Ganz blöd, weil die meisten dieser Bakterien auch beim Menschen vorkommen.«
Clara ergänzte: »Die Antibiotikakrise war der wesentliche Grund, warum die Vereinten Nationen sich in der Forschung zu multiresistenten Bakterien engagiert haben. Mehrere afrikanische Staaten und Indien haben dabei noch durchgesetzt, dass auch neue und nicht so teure Mittel gegen Tuberkulose entwickelt werden. Daran sind bis dahin jährlich viele Millionen Menschen erkrankt.«
»Auch noch an Tuberkulose?«, fragte Paul. »Ich dachte, das sei im letzten Jahrhundert ausgestorben.«
»Schön wär’s«, meinte ich. »Noch im Jahr 2020 sind mehrere Millionen Menschen daran gestorben.«
»Übrigens hatte mein Vater auch Tuberkulose. Das erste Mal 1935, als er vierundzwanzig Jahre alt war. Damals gab es noch gar keine Antibiotika. Die einzige Behandlungsform waren Ruhe und gute Ernährung. Mein Vater musste dann ein halbes Jahr in ein Sanatorium. Das muss furchtbar gewesen sein. Keinerlei Außenkontakte. Man konnte nur Briefe schreiben.«
»Ich habe noch nie einen Brief oder eine SMS geschrieben«, sagte Paul. »Ich mach nur Sprachnachrichten.«
»Die sind vielleicht ökologischer als Briefe. Aber meistens herzloser. Stell dir vor, mein Vater hätte im Sanatorium nur eine kurze Sprachnachricht bekommen. So etwa wie: ›Habe gehört, du hast Tb. Sackblöd. Gute Besserung.‹«
»Na ja. Heute könnten wir mit ihm im Metaverse spazieren gehen. Da würde er sich fast wie daheim fühlen.«
»Von so einer Möglichkeit hat man damals nicht einmal geträumt. Aus lauter Verzweiflung hat mein Vater dann angefangen, Gedichte zu schreiben, vor allem Liebesgedichte. Damit hat er später seine Frau gefunden – meine Mutter. Im Zweiten Weltkrieg gab es eine Kampagne: Die deutschen Mädels schreiben den Jungs an der Front. Und so haben sich meine Eltern kennengelernt: nur über Briefe, Liebesgedichte und zwei kurze Treffen. Dann haben sie geheiratet. Also nix mit Tinder, Parship oder ElitePartner. Damals …«
»Clara stöhnte: »Jetzt ist aber genug. Du kommst wieder vom Hundertsten ins Tausendste. Der arme Paul ist schon völlig fertig. Ab ins Wasser mit dir«.
»Okay, okay. Ich gehe ja schon. Aber Paul will sicher noch wissen, ob meine Eltern eine glückliche Ehe hatten? Auf die Schnelle kann ich nur sagen: Sie sind damit nicht baden gegangen.«
Die Wunschkindpille für den Mann
Dass Paul nicht zum Frühstück kam, wunderte uns nicht. Er war am Vorabend erst spät zum Tanzen gegangen: »Mal schauen, ob in den Freiburger Klubs auch was läuft.«
Später schlich er in die Küche, mit gesenktem Kopf. »Was ist denn los?«, fragte Clara, aber Paul schwieg und kaute niedergeschlagen an einem Brötchen. Doch plötzlich brach es aus ihm heraus: »Ich habe gestern eine tolle Frau getroffen. Lena. Sie kann irre gut tanzen. Und ist superschlau. Am Schluss haben wir geknutscht. Aber dann kam bei uns beiden im MiniHelper der Warnhinweis vom DNA-Checker: ›Not compatible‹. Das ist so gemein!«
Clara und ich schwiegen betroffen, weil wir wussten, was der Warnhinweis bedeutet. Seit einigen Jahren kostete die komplette DNA-Analytik zur Bestimmung des persönlichen Risikos für schwere Krankheiten und Gendefekte nur noch fünfzig Euro. Die Ergebnisse konnte man auf eine App aufspielen und – wenn man jung war und später vielleicht Kinder wollte – mit denen einer Bekanntschaft vergleichen.
Nach einer gefühlten Ewigkeit nahm ich das Gespräch wieder auf: »Nicht kompatibel, weil …«
»Weil wir kein Kind haben sollten. Die Gefahr, dass es blind wird, ist zu hoch. Maron-Syndrom oder so ähnlich.«
»Hm, ganz schön blöd«, sagte ich, »aber jetzt mal halblang. Wenn ihr wirklich miteinander schlafen wollt, kannst du doch die Pille nehmen. Und in deiner polyamoren Clique hast du doch noch andere Möglichkeiten …« Ich konnte mich gerade noch ducken und dem Marmeladenbrötchen ausweichen, das mir Paul drohte ins Gesicht zu werfen. Clara bedeutete mir mit einem vorwurfsvollen Blick, dass ich mich jetzt besser zurückziehen solle.
Das tat ich auch schulterzuckend und schaute mir dieses Maron-Syndrom genauer an. Tatsächlich ist das ein schwerer Gendefekt, der schon früh zur Erblindung führt. Aber seit Ende der 2020er-Jahren wurde eine In-vivo-Gentherapie erforscht und an einzelnen Kindern erprobt. Seit 2031 war die Behandlung generell zugelassen. Sie war sehr teuer, hatte aber eine hohe Erfolgsquote und keine gravierenden Nebenwirkungen. Mit dieser erfreulichen Nachricht traute ich mich wieder in die Küche, wo die beiden sich mittlerweile über Empfängnisverhütung unterhielten.
»Nimmst du eigentlich die Pille?«, wollte Clara von Paul wissen.
»Nee, nehme ich nicht. Die meisten Frauen haben heute ja einen Temperatur- und Hormontracker. Damit kann man die potenziell fruchtbaren Zeiten ziemlich genau bestimmen. Das ist viel sicherer als diese Uraltmethode Knaus …, Knaus Dingens.« Er schaute überrascht. »Ups. InforMe flüstert mir gerade, seit wann es die Pille gibt.«
»Wie, du hast doch gar nicht gefragt?«
»Das nicht. Ich habe es versehentlich noch laufen lassen. Dann wertet InforMe das Gespräch laufend aus, und wenn ein Fremdwort oder Stichwort kommt, dass ich noch nie gelesen oder ausgesprochen habe, fragt InforMe mich, ob ich Info dazu brauche.«
»Das ist ja ein bisschen unheimlich. Irgendwie bist du von dem Tool schon richtig abhängig. Hoffentlich machst du dir auch noch deine eigenen Gedanken. Und was hat dein kluger Assistent jetzt zur Pille recherchiert?«
InforMe: Die Pille für Frauen gibt es schon seit 1957, zuerst aber nur in den USA. Offiziell war sie als Mittel gegen Menstruationsbeschwerden zugelassen, das als Nebenwirkung »leider« eine empfängnisverhütende Wirkung hatte. Aber natürlich wussten alle, was gemeint war. In Westdeutschland wurde die Pille 1965 unter dem Namen Anti-Baby-Pille eingeführt, in der damaligen DDR mit schönerem Namen als Wunschkindpille.«
»Und wann kam die Pille für den Mann?«
Clara lächelte: »Das war 2027. Ich weiß es noch genau, weil dein Vater als einer der Ersten die Pille genommen hat. Anna wollte kein weiteres Kind, weil Jan viel zu viel arbeitete und sich schon um dich viel zu wenig gekümmert hat. Jan nahm die Pille nicht gerade mit Begeisterung, weil die ja auch bei Männern in den Hormonkreislauf eingreift und Nebenwirkungen hat. Aber deine Mutter fand, dass sie die Pille jetzt lang genug genommen hätte und nun dein Vater dran sei. Da könntest du deinem Vater ausnahmsweise mal nacheifern.«
»Mal schau’n«, sagte Paul, der sich mittlerweile zu einem freistehenden Handstand aufgeschwungen hatte, »bisher haben wir ja nur geknutscht!«
Noch hinter dem Mond
»Sollen wir Schach spielen?«, fragte Paul, wartete aber gar nicht erst auf meine Antwort und baute die Figuren auf dem Schachbrett auf. »Das ist ja voll retro.«
Vor wenigen Tagen hatte er auf dem Speicher mein altes Schachspiel gefunden. Nachdenklich drehte ich den König in der Hand. Seit vielen Jahren spielte ich nur noch in einer Schach-App, mit einer von mir eingestellten Spielstärke gegen den Computer. Die App hatte nur fünf Euro gekostet.
1977 hätte ich mir fast den ersten kommerziellen Schachcomputer gekauft, den Fidelity Chess Challenger 1. Aber der war mit ein paar Hundert Mark noch viel zu teuer und nicht sehr leistungsfähig. Zwanzig Jahre später staunte die Welt dann über den Computer Deep Blue, der das Spiel gegen die Schachlegende Garry Kasparow gewann. Das hatten alle für undenkbar gehalten. Aber Deep Blue konnte pro Sekunde 200 Millionen Stellungen bewerten, Kasparow nur einige wenige.
Paul unterbrach mich in meinen Gedanken: »Hast du auch dauernd Games gespielt, als du jung warst?«
Ich grinste. »Nicht wirklich, das mit den guten Videospielen ging erst in den 1990er-Jahren richtig los. Aber in meinem ersten Semester – 1972 – habe ich im Chemielabor aus Langeweile immer Mondlandung gespielt, weil die chemischen Versuche sich oft stundenlang hinzogen. Ein Freund hatte den Taschenrechner HP-35 für den damals astronomisch hohen Preis von etwa zweitausend Mark gekauft. Das war der erste Taschenrechner mit logarithmischen Funktionen. Bis dahin musste man dafür einen Rechenschieber benutzen.«
Paul runzelte die Stirn, und seine Augen gingen kurz ins Leere. Das war, wie ich gelernt hatte, ein untrügliches Zeichen dafür, dass er von InforMe wieder eine Hintergrundinformation über einen für ihn vermutlich unbekannten Begriff bekommen hatte.
»Und?«, fragte ich spöttisch. »Was sagt InforMe, was ein Rechenschieber war?«